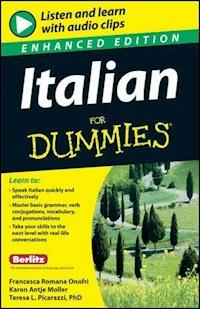Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in eine Reise zur Neugestaltung von Schule und Bildung. Joachim Wolff nimmt uns mit in das unentdeckte Land der Inklusion. Er eröffnet in seinem Buch eine faszinierende Perspektive auf die Entwicklung einer Schule, die Verschiedenheit als selbstverständlich begreift. Mit langjähriger Erfahrung und fiktiven Szenen zeigt er, wie Schulen zu Orten werden können, die die Einzigartigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns stellen. Dieses Buch beleuchtet die Herausforderungen und Chancen einer inklusiven Schulentwicklung. Es bietet tiefgehende Einblicke in pädagogische Ansätze, politische Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung in einer Schule, die Mauern abbaut und Brücken schlägt. Wolff fordert dazu auf, über Grenzen hinwegzudenken und eine neue Lernkultur zu gestalten, dialogisch, mutig und voller Fantasie. Ein ermutigendes Werk für Pädagoginnen und Pädagogen, Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker und für alle, die sich für eine Schule ohne Barrieren einsetzen möchten. Lassen Sie sich inspirieren, die Mauern des traditionellen Schulwesens einzureißen und an einer neuen Ära des Lernens mitzuarbeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
1 Über 28 Millionen Ergebnisse
2 Hinter verschlossenen Türen
2.1 Inklusion in Schule
2.2 Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend
2.3 Sapere aude
3 Du sollst dir kein Bildnis machen
3.1 Das geheimnisvolle Sein des Regelschülers
3.2 Der unheimliche Fremdling
3.3 Über die Grenzen im Kopf
3.4 Das defekte Kind
3.5 Oskar weiß Merkwürdiges
3.6 Der Struwwelpeter
3.7 Worüber noch zu sprechen ist
4 Keine Kleinigkeiten
4.1 Begründete Werturteile statt Haltung
4.1.1 Inklusion ist eine politische Position
4.1.2 Inklusion fordert Mündigkeit
4.1.3 Inklusion braucht pädagogischen Takt
4.1.4 Inklusion ist dialogisch
4.2 Nähe und Macht
4.3 Kleine Schritte, große Wirkung
4.3.1 Individualisierendes Lernen
4.3.2 Kinder- und Jugendbeteiligung
4.3.3 Pädagogische Architektur
5 Ein vorläufiges Ende
1 ÜBER 28 MILLIONEN ERGEBNISSE
Die Vereinten Nationen begannen 2002, also vor mehr als 20 Jahren, mit der Arbeit an der Behindertenrechtskonvention. Im Dezember 2008 legte der Ausschuss für Arbeit und Soziales dem Deutschen Bundestag die Empfehlung vor, das „Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (…)“ zu unterzeichnen. Gleichzeitig wurde die Forderung abgelehnt, die mit Fehlern behaftete deutsche Übersetzung des Übereinkommens sowie die dazugehörige Denkschrift der Bundesregierung zu überarbeiten1. Im abgelehnten Antrag wurde der Vorwurf erhoben, dass beide Papiere „(…) die große Chance auf eine Fortentwicklung der Rechte für Menschen mit Behinderungen (verkleinern)“2. Nach Abschluss der erforderlichen Verfahren wurde die Konvention ab 26. März 2009 für Deutschland verbindlich3. Auf dieser Rechtsgrundlage entwickelte die Forderung nach inklusiven Schulen trotz der genannten Kritik eine völlig neue Durchschlagskraft. Als ich im März 2024 die Stichworte „Inklusion“ und „Schule“ in die Suchmaschine Google eingab, erhielt ich 28.400.000 Ergebnisse in 0,31 Sekunden.
Die Befürworter eines gemeinsamen Unterrichts für alle Kinder und Jugendlichen sahen sich durch die Ratifizierung gestärkt. Sie hofften auf eine vielfältigere und begabungsgerechtere Lernkultur. Sie erwarteten, dass die Schulen endlich kinderreif würden, statt dass Kinder weiterhin ihre Schulreife unter Beweis stellen müssten. Für sie ging es darum, die Schulen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Gegner einer gemeinsamen Schule warnten dagegen vor einer zukünftig schlechteren Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und dem Verlust des für diese Schülerinnen und Schüler notwendigen Schonraums. In der zukünftig bevorstehenden Einheitsschule würden alle langsamer und weniger lernen. Eine Zuspitzung fand dieser Konflikt im Jahr 2018, als die Schulleiterin eines Bremer Gymnasiums gegen die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung an ihrem Schulstandort klagte4.
Ende 2023 wurden die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 veröffentlicht. Wieder gab es heftige und frustrierte bildungspolitische Aufschreie. Ist es berechtigt, überrascht zu sein, dass weder in der Zusammenfassung der deutschen PISA-Ergebnisse5 noch in den Beschlüssen der KMK zu PISA vom Dezember 20236 das Wort „Inklusion“ vorkommt? Die enttäuschenden deutschen PISA-Ergebnisse im Jahr 2000 waren mit der Erkenntnis verbunden, dass erfolgreichere Länder die Kinder und Jugendlichen erst deutlich später auf unterschiedliche Schulformen verteilen. Diese Feststellung war neben der Behindertenrechtskonvention einer der Motoren, die zur Veränderung des bisherigen Schullalltags drängten.
Ist also bezüglich schulischer Inklusion alles gesagt und der Auftrag erledigt? Zahlen sprechen dagegen. Das deutsche Schulwesen ist traditionell exklusiv. Nimmt man den vom Bildungsforscher Klaus Klemm festgestellten Rückgang des Exklusionsquotienten von 2008/09 bis 2020/21 um nur 0,52 Prozent zur Kenntnis7, so hat sich das deutsche Bildungswesen noch nicht sehr weit von seiner Tradition entfernt. Trotz der riesigen Trefferquote bei Google scheint es daher berechtigt zu sein, auch heute noch bezüglich inklusiver Schulen von einem „unentdeckten Land“ zu sprechen.
Dem „unentdeckten Land der Inklusion“ liegt die Idee zugrunde, dass Inklusion nicht ein neues pädagogisches Konzept ist, für das man nur die nötigen Maßnahmen ergreifen müsse, um es umzusetzen. Inklusion wird im Kontext dieses Buchs vielmehr verstanden als eine neue schulische Welt, ein Ort für eine veränderte Art gemeinschaftlicher Lebens- und Lerngestaltung, der entdeckt werden muss. Entdecken kann man allerdings nur, was grundsätzlich schon vorhanden ist. Die Besiedlung des unentdeckten Landes setzt daher nicht voraus, dass erst einmal aus der Ödnis und Leere Himmel und Erde geschaffen werden müssen. Anders als in Shakespeares Hamlet ist mit dem unentdeckten Land auch nicht das Totenreich gemeint, „(…) von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt“. Hier wird es, wie im gleichnamigen Film der Star-Trek-Reihe, als Metapher für die Zukunft genutzt. Unter dem Eindruck der historischen Ereignisse, die der Fall der Berliner Mauer bedeutete, entwickelte der Darsteller der Figur Spock, Leonard Nimoy, die Idee, dass auch im Weltraum diese Mauer fallen könnte8. Und genau darum geht es: eine schulische Zukunft zu entdecken, in der die Mauern des „Vier-Klassen-Schulwesens“ (Sonderschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium) fallen. Ähnlich wie beim tatsächlichen Mauerfall gibt es auch hier Gründe, die den schulischen Mauerfall notwendig machen.
Fünfzehn Jahre nach der Ratifizierung, so erweckt es den Eindruck, hat der Streit um die richtige Position bezüglich des Inklusionsversprechens nicht an Heftigkeit verloren. Die Diskussion wird allerdings überlagert von der Digitalisierung und den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Manche Lehrkraft scheint zu hoffen, dass mit diesen Mitteln auch die Herausforderungen der Inklusion grundsätzlich zu bewältigen sind. Mit iPad und KI könnten die Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler genauer erfasst und mit Hilfe von ChatGPT entsprechend angepasste Arbeitsmaterialien erstellt werden. „(…) Die meisten Kollegen und Kolleginnen haben erkannt, wie sehr ihnen KI die Arbeit erleichtern kann. Sie können sich etwa einen Text auf verschiedenen Niveaus erstellen lassen: eine anspruchsvolle Fassung für Muttersprachler, eine einfachere Version für einen ukrainischen Schüler, der noch wenig Deutsch spricht. (…)“9 So lobt der Lehrer Hendrik Haverkamp die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in einem Interview mit dem ZEIT-Magazin. Vermutlich ist es in der Zukunft kein Problem, zusätzlich Schülerinnen und Schülern bestimmten Leistungsmerkmalen zuzuordnen und ihnen auf dieser Grundlage per Gesichtserkennung die vermeintlich angemessenen Lernmaterialien zuzuweisen. Mit gutem Grund spricht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Entwurf der „Schulpolitischen Positionen“ für den Gewerkschaftstag im Mai 2025 vom „Primat der Pädagogik vor der Technologie“ und fordert, dass „(…) Entscheidungen über Menschen (…) nur von Menschen getroffen werden (dürfen)“10
Ist Inklusion nur eine Frage der physischen Zugänglichkeit von Schulgebäuden, angemessener Arbeitsblätter und weiterer Unterrichtsgegenstände auf unterschiedlichen Lernniveaus sowie der Möglichkeiten ihrer Bereitstellung? So einfach scheint es nicht zu sein: Trotz vielfältiger, umfassender und tiefgehender Unterrichtsentwicklung ist nicht selten eine eher tradierte Unterrichtspraxis zu beobachten. Der inklusive Unterricht unterscheidet sich dann lediglich dadurch, dass es unterschiedliche Arbeitsblätter gibt, die „Geparden-Arbeitsblätter“ für die schneller lernenden Kinder, die „Löwen-Blätter“ für die Regelschülerinnen und -schüler sowie die „Tiger-Blätter“ für Kinder mit einem Förderbedarf im Bereich Lernen. In der Sekundarstufe I ersetzen später häufig abstraktere Symbole die Unterscheidung. Selbstverständlich kann KI hier die Arbeit erheblich erleichtern. Diese Schilderung entspricht zwar den Vorstellungen einer Reihe von Eltern, lokalpolitisch Verantwortlicher und auch einiger Lehrkräfte über das, was inklusiven Unterricht auszeichnet. Aber entsteht aus so einem Unterricht tatsächlich der inklusive Kern einer zeitgemäßen Schule?
Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen zur grundsätzlich positiven Wirkung von Heterogenität. Deshalb mangelt es auch nicht an Erfolgsstorys aus anderen Ländern und an Berichten über „Leuchtturmschulen“. Es fehlt nicht an zugänglichen Sachinformationen. Gleichwohl: Nicht selten äußern Menschen, denen ich meine Erfahrungen mit inklusiver Schulentwicklung schildere, dass sie sich nicht vorstellen können, was ich meine. Es fehlt, so mein Eindruck, an bildhaften und nachvollziehbaren Darstellungen, die helfen, eine Zukunft zu erdenken, die durch die Kraft der Fantasie zwischen einer abstrakten Ideenwelt und der praktisch erlebten Schulwirklichkeit aufkeimt.
Die Ausgangslage ist nicht für alle Schulstufen und Schularten gleich. Das unentdeckte Land der Inklusion stellt sich für eine wohnortnahe Grundschule völlig anders dar11 als für ein Gymnasium oder eine Berufsschule. Selbst im Bereich der Sekundarstufe I sind die Ausgangsvoraussetzungen noch einmal deutlich unterschiedlich, je nachdem, ob es um Haupt- oder Realschulen geht, um kooperative oder integrierte Gesamtschulen oder um Gemeinschaftsschulen. Für alle aber geht es um das konkrete Auffinden von Dingen, die grundsätzlich bekannt sind, und möglicherweise um die Entdeckung überraschender Kombinationen solcher Dinge. Die Sekundarstufe I verbindet, dass hier durch den Erwerb von Schulabschlüssen mit je verschiedenen Zukunftsperspektiven bedeutende Weichenstellungen für die Lebenswege der Jugendlichen erfolgen. Diese der Sekundarstufe I immanente Aufgabe der Auslese ist eine besondere Herausforderung für den Aufbau inklusiver Schulen. Diese Schulstufe steht daher im Mittelpunkt dieses Buchs.
Ziele müssen für die Beteiligten erreichbar sein. Es gibt kaum eine Fortbildungsveranstaltung, in der das nicht vermittelt wird. Gleichzeitig wird dort auch gern erzählt, dass man das Rad nicht noch einmal neu erfinden müsse. Das stimmt, einerseits. Andererseits muss aber immer wieder jedes Kind neu lernen, auf einem Rad zu fahren, muss dessen Möglichkeiten und Grenzen erproben. Vermutlich erinnern sich alle mehr oder minder gut an die eigenen ersten Erfahrungen mit dem Fahrrad. Eine gute Idee anderer kennenzulernen ist etwas anderes, als eine solche gute Idee in der eigenen Schule unter den jeweils ganz eigenen konkreten Bedingungen einzuführen. In der Praxis funktioniert die Orientierung an den vermeintlichen „Best-Practice“-Schulen der Inklusion fast nie.
Welche Schule könnte sich ermutigt fühlen, wenn die Wahrnehmung vom eigenen Tun meilenweit vom gezeigten Ideal entfernt ist? Die übliche Reaktion besteht in solchen Momenten nicht im Hochkrempeln der Ärmel, sondern in dem frustrierenden Gedanken, dass man selbst nie so weit kommen wird. Später wird dieses Gefühl rationalisiert. Die eigene Schülerschaft ist völlig anders, die sozialen Verhältnisse sind viel schwieriger, die Eltern sind Neuerungen gegenüber weniger offen, der Personalschlüssel an der „Best-Practice“-Schule war viel besser; alles Beispiele für argumentative Konstruktionen, die ausbleibendes eigenes Handeln begründen. Überdies empfinden oft selbst diejenigen, die an den sogenannten „Leuchtturmschulen“ arbeiten, solche erhebenden Bewertungen als wenig hilfreich. Auch dort versuchen die Menschen ihre Arbeit zu bewältigen und das, was sie tun, ist ihr normaler Arbeitsalltag. Ein Leuchtturm wird gebaut, um Schiffen den Weg zu weisen. Er erfüllt seine Funktion für andere, für sich selbst hat er keine Bedeutung. Was sollte daran motivierend sein, an einer „Leuchtturmschule“ zu arbeiten, wo man doch selbst so viele Fragen hat? Ohne zu wollen, werden die dort Beschäftigen zu vermeintlichen Besserwissern, obwohl sie selbst ihre Kenntnisse und Kompetenzen jeden Tag aufs Neue als nur höchst fragmentarisch erleben.
Im Februar 2002 fand an der Universität Bremen die „16. Jahrestagung der IntegrationsforscherInnen“ statt. Ines Boban und Andreas Hinz hatten zu der Zeit mit der Übersetzung und Adaption des in Großbritannien entwickelten „Index for Inclusion“ begonnen. Bei dem 2003 erstmals auf Deutsch erschienenen Index handelt es sich um einen Leitfaden zur Unterstützung inklusiver Schulentwicklungsvorhaben. In ihrem damaligen Vortrag beklagten sie, dass die Frage nach der Schulqualität im Bereich der Integrationspädagogik und Integrationsschulen bisher kaum eine Rolle spiele. Sie erklärten dies u.a. damit, dass Schulentwicklung durch die jeweils an den Schulen Tätigen erfolge. Die Schulentwicklungsforschung habe die Frage nach der Entwicklung von „Schulen für alle“ eben deshalb nicht im Blick, weil sie sich bei der überwältigenden Zahl der traditionellen Schulen gar nicht stelle. Gleichzeitig setzten sie die Qualitätsfrage sowohl für die Integrationspädagogik als auch für Integrationsschulen als dringlich auf die Agenda. Um trotz großer Belastungen, geringer Ausstattung und „(…) angesichts der verbreiteten und zunehmenden bildungspolitischen Defensive (…)“ schnell zu Ergebnissen zu kommen, erhofften sie sich von „(…) nutz- und adaptierbare(n) Materialien zur Schulentwicklung unter integrativen Gesichtspunkten eine große Hilfe“12. Inzwischen hat die Behindertenrechtskonvention zu Veränderungen geführt, die damals nicht absehbar waren.
Schulen gehören zu den letzten Zwangsinstitutionen. Man muss sie besuchen, ähnlich wie man in die Justizvollzugsanstalt muss, wenn man verurteilt wurde. Zur Schule verurteilt einen das Alter, sie nicht zu besuchen ist strafbewehrt. Wir können uns über eine solche Regelung glücklich schätzen, da sie den Zugang aller Kinder und Jugendlicher zu kostenloser Bildung nicht nur garantiert, sondern sie sogar erzwingt. Gleichzeitig haben alle Menschen insbesondere deswegen eine hochemotionale Beziehung zu dieser Institution. Das gilt sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ich kenne alte Männer, die mit Tränen in den Augen von ihrer schönen Schulzeit berichten, von ihren Ausflügen und dem Lehrer, der sich stets um sie kümmerte. Sei es mit dem Rohrstock oder mit freundlichen Worten. Ich sehe aber auch einen gepflegten Herren Mitte 50 vor mir, bei dem man spät eine Autismus-Spektrum-Störung feststellte. Ich saß als Gast in seiner Selbsthilfegruppe, in der an diesem Abend das Thema „Schule“ besprochen wurde. „Das man an Selbstmord denkt, ist doch ganz normal“, kommentierte er ohne besondere Emotionalität den Bericht eines Mitglieds der Gruppe.
Was brauchen traditionelle und mit vielfältigen Emotionen behaftete Regelschulen, um im unentdeckten Land der Inklusion gut gangbare Wege entstehen zu lassen und sich langfristig anzusiedeln? Natürlich werden Kundschafter benötigt, Lehrkräfte also, die mutig den bevorstehenden Streckenabschnitt erkunden. Kartenmaterial, wie der Index für Inklusion, ist hilfreich, aber das reicht bei weitem nicht aus. Was man sich nicht vorstellen kann, wird auch keinen Weg in die Wirklichkeit finden. Generell sind die Menschen damit vertraut, wie man Behausungen herstellt, wie man Nahrungsmittel anbaut, wie man Kenntnisse vermittelt oder wie man lösungsorientiert zusammenarbeitet. Im unentdeckten Land werden alle diese Kenntnisse gebraucht, um auf neue Art und Weise Möglichkeiten der Begegnung und des gemeinsamen Lernens zu gestalten. Das unentdeckte Land ist ein zukünftiger Raum, der Begegnungen möglich macht, die wirkliches Leben bedeuten. In diesen Raum ziehen auch die Kinder und Jugendlichen ein, nicht nur die mit dem Schulbetrieb beauftragten Erwachsenen. Auch aus der Entdeckung neuer Formen der Begegnung entsteht die neue Realität in diesem Zukunftsland.
Die Auseinandersetzung mit erforderlichen Schulentwicklungsprozessen wird zeigen, dass es ohne ein inklusives Schulwesen auch zukünftig keine deutlich besseren Schulen und Schulleistungen geben wird. Die Aufgaben der Entdeckung, der Kartografie und letztlich der Urbanisierung sind alternativlos. Mein Anliegen ist es, Mut zu machen, sich den Herausforderungen zu stellen, die sich beim Aufbau inklusiver Schulen ergeben. Die Bereitschaft und der Mut, sich auf den Weg zu machen, entstehen, wenn man sich mit den erforderlichen Handlungen und einzelnen Handelnden identifizieren kann. Wenn man praktikable Lösungen entdeckt. Wenn man erkennt, dass die ersten kleinen Schritte notwendige und hilfreiche Schritte sind, die man auch selbst gehen kann. Damit beginnt der Aufbruch.
Der Aufbau inklusiver Schulen ist ein historischer Paradigmenwechsel von ungeahntem Ausmaß. Die allumfassende Radikalität, mit der die Aufgabe gelöst werden muss, war nach meinem Eindruck selbst denjenigen nicht klar, die in den Jahren zuvor schon intensiv am Thema Integration gearbeitet hatten13. Eine inklusive Schule stellt sicher, dass „(…) Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht (…) haben; (…)“14. Wie kann so eine Gleichberechtigung und Gemeinschaft entstehen? Pfade in der Wildnis entstehen, wenn man immer gleiche Wege geht. Ermattung und Ruhephasen führen jedoch dazu, dass diese Pfade wieder überwuchern. Der Aufbau einer neuen Art von Schule und Unterricht, der im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention angestrebt wird, lässt sich nicht in Wellen von Anstrengung und Ruhephasen bewältigen. Insbesondere Lehrkräfte müssen sich darüber bewusst werden, dass eine kontinuierliche Lösungssuche grundlegender Teil ihres beruflichen Alltags ist. Dabei ist es egal, worum es geht, ob um die konkreten Auswirkungen politischer Entscheidungen vor Ort, um Fragen der Architektur oder um ein konkretes Lernhemmnis eines konkreten Schülers. Dazu hat es im letzten Jahrzehnt nicht an guten Ratschlägen gemangelt, an Appellen und „Man-müsste-mal“.
Wenn unterschiedliche Dinge betrachtet werden, findet man unterschiedliche Wege und andersartige Lösungen. Leserinnen und Leser können daher das hier geschilderte Abenteuer von der Suche nach dem unentdeckten Land nur dann wirklich begleiten, wenn unter dem Begriff „Inklusion“ mehr oder minder Gleiches verstanden wird. So herzzerreißend es tatsächlich ist, man muss heute über den Stand der Inklusion Ähnliches sagen, wie Boban und Hinz 2002 über die Integration: „Die Integrationspraxis ist in die Jahre gekommen, der Reformschwung der Pioniere ist erlahmt, zunehmende Verbreitung hat – wie bei vielen Reformprojekten – zunehmende Verflachung mit sich gebracht, zudem sind die Arbeitsbedingungen teilweise massiv verschlechtert worden (…)“15.
Die oben erwähnte Klage der Bremer Gymnasialschulleiterin zeigt auf tragische Weise Missverständnisse im Umgang mit dem, was Inklusion bedeutet. Ein Gymnasium zeichnet sich traditionell dadurch aus, dass es Schülerinnen und Schüler versammelt, die zu vermeintlich höheren intellektuellen Leistungen in der Lage sind. Zur Definition einer geistigen Behinderung gehört dagegen ein erheblich unterdurchschnittlicher Intelligenzquotient und eine erheblich unterdurchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit. Im Falle dieser behördlichen Anordnung zur Zusammenarbeit geht es daher deutlich erkennbar nicht um den Aufbau einer Schule, in der gemeinsam gleichberechtigt gelernt wird. Dass dies die Vertreterin einer Schulform zum Widerspruch führt, die wie keine andere in Deutschland für Ausgrenzung steht, ist leicht nachvollziehbar. Was aber hat die Behörde bewegt? Vermuten kann man, dass einzelne dort verantwortlich Handelnde es für eine gute Idee hielten, den Gymnasiasten durch Möglichkeiten der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung die Chance zu verschaffen, das eigene Sozialverhalten zu trainieren und zu verbessern. Auf Basis einer solchen Vermutung könnte man behaupten, dass an dieser Stelle Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung zu Objekten der Bildung anderer gemacht würden. Das wäre das Gegenteil des mit der Behindertenrechtskonvention versprochenen gleichberechtigten Zugangs zu Bildung.
Mir wurde bewusst, dass die Erwartungen an das Land, dessen Besiedelung ich schildern wollte, nicht für alle auf Schule bezogen Handelnden ähnlich sind. Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen erschien mir eine Berichterstattung über die ersten vorsichtigen Schritte bei der Ankunft erforderlich zu sein. Ich stellte mir vor, dass der Start an einer sonnigen Küste mit Sandstrand beginnt. An diese Küste gelangen ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei einer Reihe von Lehrkräften muss man davon ausgehen, dass ihre Schiffe sie durch Beschluss der Reederei überraschend dorthin verbrachten. Welche Studienrätin hätte sich vorgestellt, mal Unterricht mit Schülerinnen und Schülern durchzuführen, bei denen eine Lernbehinderung diagnostiziert wurde? Welcher Sonderschullehrer für Wahrnehmung und Entwicklungsförderung erwartete, eines Tages vor gymnasial orientierten Kindern und Jugendlichen im Unterricht zu stehen. Einige Lehrkräfte sind vermutlich aufgrund des Verlusts ihres Schiffs an der Küste gestrandet.
Die schulisch organisierte Bildung der konkreten Kinder und Jugendlichen entwickelt sich aus den einzelnen Schulen heraus. Diese müssen somit bei der Erforschung des unentdeckten Landes als Ausgangspunkt betrachtet werden. Innerhalb der Schulen wirken verschiedene Beschäftigtengruppen aufeinander ein, Gewerkschaften tragen externe Impulse in die Schulhäuser. Die Kinder, die die Schule besuchen, kommen aus Familiensystemen, die zunehmend heterogener werden, und in ihrer Heterogenität wiederum auf die Schulen einwirken. Eine gute Schule braucht eine funktionierende Schulgemeinschaft, deren Kern Eltern, Kinder und Jugendliche sowie das schulische Personal bilden. Beim Personal geht es ausdrücklich nicht nur um Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere pädagogische Arbeitskräfte. Man darf die Bedeutung des Sekretariats, der Hausmeisterdienste, der Reinigungskräfte und der vielen weiteren nicht unterrichtlich in Schule Tätigen keinesfalls geringschätzen.
In und um eine Schule bewegen sich zusätzlich viele miteinander in Beziehung stehende Menschen. So gehören zum Umfeld einer Schule auch die Mitarbeitenden in den zuständigen Schulbehörden, die Kooperationspartnerinnen und -partner oder örtlich politisch aktive Bürgerinnen und Bürger. Außerdem darf man die meinungsbildende Macht der medial arbeitenden Menschen nicht unterschätzen. Versuche, die Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Kräften beim Aufbau inklusiver Schulen systematisch und nachvollziehbar zu beschreiben, erscheinen aufgrund der Vielzahl möglicher Stellschrauben, die Einfluss auf das Geschehen nehmen, fast unmöglich. Unbestritten ist aber, dass die ersten, die sich mit den verschiedenen Aspekten des Aufbaus inklusiver Schulen befassen müssen, diejenigen sind, die ihren Arbeitsplatz im pädagogischen Bereich der jeweiligen Schule haben. Aus diesem Grund stehen die Lehrkräfte im Mittelpunkt der nachfolgenden Kapitel.
Wenn Geschichten oder Anekdoten erzählt, Szenen beschrieben werden, öffnen wir uns für innere Bilder. Wir haben Personen, Landschaften oder Räume vor uns, Gerüche und Geräusche, Dinge, die unsere Fantasie inspirieren. Geschichten sind nicht dokumentarisch, sie müssen nichts belegen.Unsere Leben verlaufen in einem linearen Zeitkonzept. Wir können nicht zurück und eine Situation verändern, egal wie sehr wir uns dies wünschten. Das geht tatsächlich nur in der Welt der Geschichten. Geschichten kann man anhalten, einzelne Elemente verändern, sie einen anderen Verlauf nehmen lassen. Geschichten rufen die Lesenden dazu auf, danach zu fragen: Was wäre, wenn …? Sie sollen helfen, Verständnis für die jeweilige Situation zu entwickeln, und die Möglichkeit bieten, Ideen für ein Repertoire an potenziellen Verhaltensvarianten für den zukünftigen Alltag zusammenzutragen.
Geschichtenerzähler suchen sich ihren Standpunkt, schildern uns die von ihnen ausgewählten Aspekte aus ihrer Sicht auf die Welt. Die Erzählung eröffnet damit allen einen anderen Zugang zur uns umgebenden Wirklichkeit, zu anderen Möglichkeiten der Weltwahrnehmung. Aus diesem Grund handelt es sich bei diesem Buch nicht um den Versuch, durch einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft theoretische Kenntnisse über die pädagogische Arbeit vor Ort zu vervollkommnen. Dies ist keine sozialwissenschaftliche Studie16. Die erzählten Geschichten sind keine Fallstudien, nicht aus Videoaufzeichnungen transkribierte Aktivitäten, sie sind nicht aus gezielter teilnehmender Beobachtung entstanden. Die Erstellung dieses Buchs unterlag keiner analytisch konsistenten Methode. Es entstand zum einen aus einem assoziativ einfühlenden Wechselspiel zwischen einzelnen erzählten Begebenheiten und erläuternden Reflexionen. Zum anderen wurde die Auseinandersetzung mit einzelnen konzeptionellen Erfordernissen einer inklusiven Schulentwicklung in die Erzählung möglicher Ereignisse übertragen. Die Geschichten werden entlang der jeweiligen inhaltlichen Erfordernisse erzählt, sie sind daher nicht chronologisch.
Ich hatte beim Schreiben dieses Buchs die Idee, dass es in gewisser Weise dreidimensional sein müsste: Man kann ein Argument interpersonell nur überprüfen, wenn man den Standpunkt des Autors kennt. Dann ist es möglich herauszufinden, ob aus der offenkundig gemachten Sicht die genannten Argumente konsistent sind. Oder aber man kann den Ausgangspunkt des Autors kritisieren. Die erste Dimension besteht daher in dem Versuch, meine persönliche Sicht erkennbar zu machen. Für viele Dinge, die an Schulen gemacht werden oder in ihrem Umfeld geschehen, gibt es von anderen Autoren und Autorinnen gut begründete Argumente. Da, wo es angemessen erscheint, soll auf pädagogische Debatten zurückgegriffen werden. An anderen Stellen ist es erforderlich, Positionen kritisch zu hinterfragen. Dies ist die zweite Dimension, die den Blick auf eine inklusive Schulentwicklung schärfen soll. Man braucht für einen wirklichen Aufbruch aber auch Emotionen, die einem nur handelnde Menschen vermitteln können. Daher stellen die einzelnen Geschichten das zentrale Element dieses Buchs dar. Schulentwicklungsprozesse werden, und dies ist als dritte Dimension gedacht, durch die handelnden Menschen mitfühlbar. Diese dritte Dimension enthält noch ein zusätzliches Element: Wie in Brechts epischem Theater durch den Chor, erfolgen von Zeit zu Zeit schlaglichthafte Kommentierungen in Form von Berichten aus dem unentdeckten Land der Inklusion.
Vor dem Hintergrund der Kulturhoheit der Länder kann man keine Geschichten aus und über Schulen schreiben, ohne die jeweiligen Gegebenheiten in den unterschiedlichen Bundesländern zu beachten. Meine Geschichten beziehen sich auf eine gedachte Schule im Bundesland Bremen, weil ich die Situation in diesem Land am besten kenne. Über zwanzig Jahre habe ich die Verwandlung einer integrierten Gesamtschule in eine Oberschule Bremer Prägung begleitet. 1994 entstand im Bundesland Bremen im Rahmen der Arbeit des nichtständigen Ausschusses „Novellierung des Bremischen Schul- und Schulverwaltungsgesetzes“ ein umfassend überarbeitetes Gesetzespaket17 , für das das von Dalin und Rolff entwickelte „institutionelle Schulentwicklungsprogramm“ prägend war. Die Einzelschule als Ausgangspunkt von Schulentwicklung zu sehen gelangte so ins Bremer Schulgesetz. Auch heute noch heißt es im Absatz 1 des § 9 „Eigenständigkeit der Schule“: „Jede Schule ist eine eigenständige pädagogische Einheit und verwaltet sich selbst nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes.“18 Hintergrund dieser Entwicklung, die viele Gestaltungsfreiräume für Schulen und ihre Schulleitungen brachte, war die Feststellung eines Steuerungsverlusts durch die zentralen Institutionen. So eine Rechtsgrundlage bringt andere Handlungsoptionen mit sich, als es sie möglicherweise in restriktiver gestalteten Schulwesen anderer Bundesländer gibt.
Inklusive Schulen entstehen nicht als etwas fertig Vorgedachtes, das dann mit einem grandiosen Neubau am perfekten Standort durch virtuose Lehrkräfte realisiert wird. In der Regel handelt es sich um seit Jahren arbeitende Institutionen mit eigenen Traditionen. Der verlangte Transformationsprozess erfolgt durch die schon vorhandenen Lehrkräfte, die dazu ihre bisherigen Gewissheiten in Frage stellen müssen. Erfolg wird sich nur einstellen, wenn es ihnen gelingt, sich für neue Vorstellungen zu öffnen, und sie sich darum bemühen, diese im vorhandenen Schulgebäude umzusetzen. Will man Geschichten über solche Veränderungen in traditionellen Schulen als Entdeckungsreise schildern, braucht es Bilder, die die Erfolge, Herausforderungen und Probleme sichtbar machen. Es braucht eine Leinwand, auf die sie gemalt werden können. Diese Leinwand entstand auf Basis meiner eigenen Bildungsgeschichte und beruflichen Tätigkeiten.
Wer die Schule kennt, an der ich tätig war, wird viele Dinge wiederentdecken, für die ich mich dort mit meinen Kolleginnen und Kollegen engagiert habe. Es gibt verschiedene Formen, wie eine Individualisierung im Unterricht erreicht werden kann, sei es Wochenplanarbeit, Werkstattunterricht oder Projektarbeit. Ich bin aus verschiedenen Gründen überzeugt von der Arbeit mit Kompetenzrastern. Da ich die damit in Verbindung stehenden Probleme aus meiner Praxis am besten kenne, findet sich dieses Vorgehen in den Geschichten wieder. Es ist unerheblich, an welchen Beispielen man die Bedeutung von Schülerbeteiligung und Verantwortungsübernahme durch Kinder und Jugendliche darstellt. Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Da ich beispielsweise „Tourguides“ besser kenne als Schülerlotsen, sind auch die mir bekannteren Partizipationsvorhaben Teil meiner Leinwand. Alle Schulen müssen sich mit architektonischen Fragen beschäftigen, aber auch hier greife ich auf Probleme zurück, die ich kenne. Trotzdem ist keine Geschichte so passiert. Ich bin zur Schule gegangen, habe Zivildienst an einer „Schule für geistig Behinderte“ geleistet, studierte ein Lehramt, arbeitete einige Zeit als arbeitslose Lehrkraft in einem pädagogischen Projekt, war weit über 30 Jahre als Lehrkraft in verschiedenen Rollen tätig und hatte als Vater mit Schule zu tun. Die Geschichten in diesem Buch und die in ihnen zum Leben erweckten Personen sind Verschriftlichungen akkumulierter Lebenserfahrung. Beim Schreiben erkannte ich allerdings, dass ich nicht einfach einzelne, nebeneinanderstehende Begebenheiten schildern kann. Eine Schule erhält die Kraft zur Entwicklung aus den gelebten Widersprüchlichkeiten zwischen den einzelnen Akteuren. Da also die Schilderung eines Schulentwicklungsprozesses ein Kollegium braucht, das die Entwicklungen trägt, sind auch die handelnden Personen dieser Geschichten in einem Kollegium verbunden.
Die Geschichten starten um das Jahr 2003 herum. Zu dieser Zeit wurden auch im Land Bremen, als Reaktion auf den ersten „PISA-Schock“, erhebliche Anstrengungen unternommen, unter anderem durch die Gründung von Ganztagsschulen. 2009 wurde im überarbeiteten Bremischen Schulgesetz festgelegt, dass mit Ausnahme der Gymnasien alle Schulen der Sekundastufe I die Umwandlung in inklusive Oberschulen spätestens im Schuljahr 2011/12 begonnen haben mussten. Die dann ab 2020 einsetzende Corona-Pandemie ist jedoch nur mit einem starken Hurrikan zu vergleichen, der über das zu entdeckende Land hinweg zog. Die Beschreibung von Entwicklungsprozessen endet daher vor den weitreichenden Störeffekten, die durch Corona in mannigfacher Form auf Schulen einwirkten. Wie auch bei jedem echten Sturm ging vieles zu Bruch. In dieser Zeit entstanden neben erheblichen neuen Problemen auch vielfältige Nischen für Rückfälle in alte Gewohnheiten. Solche Rückfälle führen spätestens nach der Pandemie zu erneuten Diskussionen und belasten den weiteren Entwicklungsprozess merklich. Die Herausforderungen erscheinen mir aber im Vergleich zum ursprünglichen Start nicht entscheidend andere zu sein. Der Bau eines Hauses nach einem verheerenden Sturm ist letztlich auch nur der Bau eines Hauses. Aber ein Neustart aus einem Rückfall heraus erfordert deutlich mehr Mut und Zuversicht, um das Vertrauen in die Veränderbarkeit des schulischen Alltags zu bewahren.
Man muss konstatieren, dass es „die inklusive Schule“ nicht gibt. Mit gutem Grund haben Dalin und Rolff schon 1990 darauf hingewiesen, „(…) daß Schulen besondere Institutionen sind, die einer eigenen Entwicklungsdynamik folgen: (…) Die Schulkultur ist ein dominierender Faktor im Erneuerungsprozeß. (…)“19. Sie gelangen vor diesem Hintergrund zu der Erkenntnis, dass Schulentwicklung von der Einzelschule aus zu denken ist. Die nachfolgenden Kapitel richten daher den Blick auf verschiedene Aspekte, die eine einzelne Schule betreffen, wenn sie sich ins unentdeckte Land aufmacht. Es ist meine Absicht, Herausforderungen und, wo es geht, auch Lösungen zu beschreiben, die Entdeckung, Kartografie und Urbanisierung befördern. Auch wenn heute vielleicht noch nicht für jede Schwierigkeit eine Möglichkeit zu ihrer Bewältigung bekannt sein mag, so ist doch auch ein erkanntes Problem für das Finden der richtigen Pfade hilfreich. Man kann nicht sehen, was man nicht sehen kann. Popper vertrat die Auffassung, dass alles wissenschaftliche Denken mit einem Problem anfängt, das man entdeckt20. Das, was jemand als Problem entdeckt, ist jedoch nicht unabhängig von der eigenen Sozialisation und den eigenen Kenntnissen zu finden. Nicht alle entdecken Gleiches als Problem21.
Wie also stoßen die Regelschullehrkräfte in den Regelschulen auf die Probleme der Inklusion? Was hängt damit zusammen und welche Schlussfolgerungen ziehen sie? Was sind die Aufgaben der Sonderschullehrkräfte in diesen Prozessen? Für Außenstehende ist oft nicht transparent, was auf der Seite der Lehrkräfte passiert, deren Aktivitäten ja für die Entdeckung des unbekannten Landes der Inklusion von besonderer Bedeutung sind. Das zweite Kapitel trägt daher den Titel „Hinter verschlossenen Türen“. In diesem Kapitel geht es darum, wie sich in einem Kollegium und einer Schulleitung eine Idee davon ausbreitet, worum es bei der Entwicklung schulischer Inklusion gehen könnte. Was ist die Bedeutung des im § 3 Absatz 4 Satz 1 des Bremischen Schulgesetzes ausgesprochenen Entwicklungsauftrags22? Womit muss man sich auseinandersetzen, wenn man zukünftig eine inklusive Schule aufbauen soll und will?
Mit den „verschlossenen Türen“ wird auf den berühmten Raum verwiesen, in den sich die Lehrkräfte in den Pausen begeben und der für andere häufig unter einem Tabu steht: das „Lehrerzimmer“. Obwohl der Frauenanteil in den Kollegien stetig steigt, Frauen oft die Mehrzahl stellen, wird immer noch vom „Lehrerzimmer“ gesprochen. Auch vor dem Hintergrund der vielfältiger werdenden Berufsgruppen, die an Schulen tätig werden, wäre es sinnvoll, eine andere Raumbezeichnung zu finden. Wörter beschreiben nicht nur die Welt, sie erschaffen auch selbst die Welt, die wir wahrnehmen. Tatsächlich bildet sich die wünschenswerte personelle Vielfalt in diesem Zimmer nicht ab. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen und wenig kompatiblen Arbeitszeitregelungen. Es gibt wohl keinen anderen schulischen Ort, der mehr mit einer Status-Problematik aufgeladen ist, als dieser Pausenraum. Daher bleibe ich bei dem altmodischen und überholten Begriff, er ist Teil schulischer Wirklichkeit. Gleichzeitig ist dies ein Hinweis darauf, dass Entwicklungsprozesse mit Ungleichzeitigkeiten behaftet sind. Sie müssten an vielen Punkten gleichzeitig einsetzen, aber Menschen können nicht alles zur selben Zeit in Angriff nehmen, sie sind gezwungen, mit den vorhandenen Unzulänglichkeiten umzugehen und sich zu behelfen. Das Bild vom Lehrerzimmer steht allerdings nur als Symbol für die schulinternen Prozesse innerhalb der Gruppe der Lehrkräfte, die in Wahrheit vielfältig verteilt über die gesamte Schule hinweg stattfinden. Im Büro der Schulleitung, in den Sitzungen der schulischen Gremien, speziell der Lenkungsgruppe, aber eben auch im Lehrerzimmer entstehen zwischen den Lehrkräften ebenso Konsense wie Konflikte auf dem inklusiven Entwicklungspfad.
Schülerinnen und Schüler verbringen den größten Teil ihres Erwachsenwerdens in der Sekundarstufe I. Sechs Schuljahre sind für Elfjährige eine unfassbar lange Zeit. Sie möchten Freunde gewinnen, Erfolge feiern, das Gefühl haben, dass sie etwas Sinnvolles in der Schule tun. Inklusive Schulen sollten Lernorte für genau die Schülerinnen und Schüler sein, die die jeweilige Schule besuchen. Kenntnisse über ihre Sozialisation sind für die Gestaltung erfolgreicher Lernprozesse unerlässlich. Sozialisation beschreibt Wolfgang Jantzen mit wenigen Worten als „(…) ständig sich erneuernden Widerspruch zwischen biologischer Ausstattung und gesellschaftlichen Verhältnissen (…)“23. Diese Sichtweise, die prägend für die in den 1970er Jahren entstehende kritisch-materialistische Behindertenpädagogik ist, gibt für den heutigen Aufbau inklusiver Schulen einen wichtigen Hinweis. Um eine mit Blick auf die Sozialisation der Schülerinnen und Schüler erfolgreiche inklusive Schule zu gestalten, reicht die Betrachtung der jeweils unterschiedlichen biologischen Ausstattung nicht aus. Der Aufbau inklusiver Schulen wird nur gelingen, wenn deren Lehrkräfte zugleich über gute Kenntnisse bezüglich der Lebenslagen ihrer Kinder und Jugendlichen verfügen, über die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie aufwachsen. Mit dieser Problematik beschäftigt sich der zweite Abschnitt dieses Kapitels. Aber hier muss man sich, wie an vielen anderen Stellen auch, ehrlicherweise damit auseinandersetzen, ob es sich um eine spezifische Aufgabe handelt, die sich nur an inklusiven Schulen stellt.
Den Schulen bieten sich häufig mehr Handlungsoptionen, als auf den ersten Blick möglich scheinen. Veränderungen brauchen speziell den Mut von Schulleitungen, sich auseinanderzusetzen, Veränderungen zuzulassen, Freiräume auszuschöpfen und Konflikte zu führen. Sie sind Vorbilder und Türöffner für ihr Kollegium. Reinhard Stähling und Barbara Wenders haben mit dem von ihnen verantworteten Berichten über den „Ungehorsam im Schuldienst“ ein wichtiges Zeugnis für diese Notwendigkeit geliefert, mutig Verantwortung zu übernehmen24. Der dritte Abschnitt behandelt daher in Anlehnung an Kants berühmten Leitspruch der Aufklärung „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ die Frage des Muts zur Veränderung.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich danach mit einem zentralen Widerspruch beim Aufbau inklusiver Schulen und ihrer Klassenverbände. Mit Bedacht wird in der Überschrift auf das Gebot hingewiesen, sich kein Bildnis zu machen. Der innere Kern inklusiver Schulen besteht im Blick auf die jeweils einzelnen ganz besonderen Kinder und Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler werden jedoch in Lerngruppen unterrichtet, die nach Kriterien gebildet werden müssen. Hinz beschrieb solche inklusiven Klassen als Orte eines Miteinanders unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten25. Wie gelangt man zu solcherart gemischten und damit möglichst heterogenen Lerngruppen? Eine Sortierung nach dem Alphabet führt zu einer anderen Mischung als eine nach Wohnorten oder Herkunftsschulen. Um eine inklusive Schulklasse zu bilden, in der alle gleichberechtigt miteinander Zugang zu hochwertiger Bildung haben, ist ein gesteuerter Umgang mit der vorhandenen Heterogenität erforderlich. Soll dieser gelingen, sind erneut Gruppierungsprozesse vermeintlich ähnlicher Kinder und Jugendlicher notwendig, die es dann aufzuteilen gilt. In dieser Notwendigkeit liegt gleichzeitig eine große Verführung zum Rückfall in alte Denkmuster. Deshalb ist es erforderlich, sich intensiv mit dem Prozess der Klassenbildung zu beschäftigen, die darin enthaltenen Widersprüche und Gefahren zu entdecken sowie Ideen zu entwickeln, wie ihnen entgegengewirkt werden könnte.
Auch wenn es sich bei manchen Dingen um vermeintliche Kleinigkeiten handelt, ist die Umsetzung, das Tun, die Praxis, keine Kleinigkeit. Vermutlich ist es nicht zufällig, dass sich dabei Berührungspunkte zwischen den geschilderten Prozessen und den drei Dimensionen des Index für Inklusion (Kultur, Strukturen, Praktiken) finden lassen. Auch eine Ökologie der Schulentwicklung muss man sich als Wirkung von ineinander geschachtelten und in vielfältiger Weise zusammenhängenden Systemen vorstellen, die untrennbar von einem ebenso vielfältig zusammenwirkenden Makrosystem umspannt werden26.
Beim Aufbau inklusiver Schulen wird immer wieder das Thema der von den beteiligten Lehrkräften zu fordernden Haltung erörtert. Diese Auffassung problematisiert der erste Teil des vierten Kapitels, der seinen Blick so auf Teilaspekte einer inklusiven Kultur richtet. Anhand von vier elementaren Standpunkten wird dargestellt, dass Inklusion nicht monokausal entsteht, wenn Lehrkräfte nur die vermeintlich richtige Haltung haben.
Psychische Erkrankungen sind für einen relevanten Teil der Schülerschaft ein Problem. Lehrkräfte beklagen vermeintlich fehlende Umgangsformen, immer wieder wird über Machtkämpfe im Unterricht berichtet. Wie gestalten sich in Zeiten, in denen die Erwachsenen keinen unaufholbaren Wissensvorsprung mehr vor den Kindern haben, die Rollen zwischen ihnen in den Schulen? Darüber hinaus ist zu beobachten, dass sich auch die Erziehungsprozesse in den Familien schwieriger gestalten. Allein schon aus diesen Gründen ist es an jeder Schule erforderlich, sich Gedanken über die Problematik von Nähe und Distanz, von Macht und Unterordnung im Bildungsprozess zu machen. Das erfordert insbesondere ein Nachdenken über die Frage, wie sich Autorität speziell in einer inklusiven Schule angemessen gestaltet. Mit Überlegungen zum Selbstverständnis einer inklusiven Schule, auch bezogen auf die Abgrenzung zwischen dem, wofür die Schule zuständig zu sein hat und wofür nicht, beschäftigt sich daher der zweite Abschnitt des Kapitels.
Der Weg in eine inklusive Schulwirklichkeit ist ein langwieriges Vorhaben. Oft ist man im Gespräch darüber mit einer vielgestaltigen Vokabelwolke konfrontiert, in der alle Begriffe auftauchen, die in diesem Kontext als gut und wertvoll gelten. Tatsächlich kommt es aber nicht darauf an, besonders bedeutsame Formulierungen für seine Ziele zu finden, vielmehr geht es um eine gelebte Praxis. Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich eine Lehrkraft darüber klagen, dass die Kinder von heute immer weniger dem Frontalunterricht folgen könnten. Ist ein Unterricht, in dem die Lehrkraft den Kindern und Jugendlichen erklärt, wie die Welt funktioniert, deren Teil sie sind, das, was an inklusiven Schulen gebraucht wird? Würde eine solche Frage an „nicht inklusiven“ Schulen anders beantwortet? Spätestens mit der wachsenden Bedeutung von Computertechnik und den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zeigt sich: Lehrkräfte, die sich ausschließlich als Vermittler von Sachverhalten verstehen, werden gnadenlos scheitern. Schulen müssen von den Kindern und Jugendlichen, für die sie gestaltet werden, als bedeutungsvoll und lernhaltig empfunden werden. Gleichzeitig müssen sie das Gefühl haben, dass die an sie gestellten Anforderungen grundsätzlich von ihnen erfolgreich bewältigt werden können. Im dritten Abschnitt soll daher aufgezeigt werden, wie wichtig die Umsetzung von vermeintlich kleinen Schritten in Unterricht und Schule ist. Sie ermöglichen ungeahnte Dominoeffekte, die zu einer nachhaltigen Veränderung der traditionellen Schulwirklichkeit führen können.
Dieses Buch steht ausdrücklich im Bekenntnis zur 11. These von Marx über Feuerbach: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern.“27 Schulentwicklung und erst recht inklusive Schulentwicklung verläuft in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, manchmal sprunghaft, nicht immer synchron und systematisch aufeinander aufbauend ab. Lehrkräfte machen sich auf den Weg, ihre Schule zu verändern, gleichzeitig wirkt jede dieser Veränderungen auf sie und ihre Wahrnehmung von Schule zurück. Die Arbeitsplatzbeschreibung für den Beruf einer Lehrkraft ist vielfältig und an den meisten Stellen unbestimmt. Diese Unbestimmtheit erfordert, dass Lehrkräfte einen inneren Prozess der Redefinition ihres Arbeitsauftrags nach Maßgabe der eigenen Leistungsvoraussetzungen durchlaufen28. Lehrkräfte müssen in Fachkonferenzen, Jahrgangsteams oder in anderer Weise miteinander arbeiten. Ihre persönliche Redefinition steht daher in Wechselwirkung mit den anderen Mitgliedern ihres Kollegiums. Das ist kein konfliktfreier, sich aus logischen Schlüssen ergebender linearer Vorgang. Unvermeidlich entstehen so in der pädagogischen Entwicklung Dynamiken, die einer langfristigen verbindlichen Planung Grenzen aufzeigen. Mit diesem Verständnis fasst das Schlusskapitel die Ausführungen zu einem eben nur vorläufigen Ende zusammen.
1 Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode 03.12.2008, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss), Drucksache 16/11234 (neu). Siehe: https://dserver.bundestag.de/btd/16/112/1611234.pdf (Letzte Abfrage: 26.06.2024)
2 Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode 12.11.2008, Drucksache 16/10841 vom 12.11.2008: Historische Chance des VN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen nutzen (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen). Siehe: https://dserver.bundes-tag.de/btd/16/108/1610841.pdf (Letzte Abfrage: 26.06.2024)
3 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt auf seiner Webseite die Unterzeichnungsgeschichte kurzgefasst dar. https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklu-sion/Politik-fuer-Menschen-mit-Behinderungen/Behindertenrechtskonvention-der-Vereinten-Nationen/behindertenrechtskonvention-der-vereinten-nationen.html (Letzte Abfrage: 26.06.2024)
4 Urteil vom 27.06.2018, Az.: 1 K 762/18. Das Urteil sowie die Leitsätze des Urteils siehe: https://www.verwaltungsgericht.bremen.de/gerichtsentscheidung-en/klage-gegen-inklusive-beschulung-am-gymnasium-18026?asl=bremen73.c.13039.de (Letzte Abfrage: 26.06.2024)
5 Doris Lewalter, Jennifer Diedrich, Frank Goldhammer, Olaf Köller, Kristina Reiss (Hrsg.): „PISA 2022. Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Zusammenfassung.“ Ohne Datum, siehe: https://www.pisa.tum.de/fileadmin/w00bgi/www/Berichtsbaende_und_Zusammen-fassungungen/PISA-2022-zusammenfassung.pdf (Letzte Abfrage 24.01.2024)
6 Mitteilung der KMK vom 08.12.2023: Kultusministerkonferenz fasst Beschluss zu PISA 2022. Siehe: https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/kultusministerkonferenz-fasst-beschluss-zu-pisa-2022.html (Letzte Abfrage: 24.01.2024)
7 Mit diesem Quotienten beschreibt Klemm, den Anteil der Kinder und Jugendlichen, die durch den Besuch einer Förderschule immer noch nicht inklusiv lernen, gemessen an der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich im entsprechenden Alter befinden. Siehe: Klaus Klemm (Juni 2022): „Inklusion in Deutschlands Schulen: Eine bildungsstatistische Momentaufnahme 2020/21“. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, S. 8.
8 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Star_Trek_VI:_Das_unentdeckte_Land (Letzte Abfrage: 26.11.2024)
9 Zeit-Magazin, Ausgabe 4-2024: „KI in der Schule: ‚Fehler korrigiert jetzt die KI‘".
10 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2024): „Schulpolitische Positionen der GEW. Antragsentwurf“. Stand: 15.10.2024
11 Beispielsweise stand der Bundesgrundschulkongress des Grundschulverbandes am 1. – 2. Oktober 1999 in Frankfurt am Main schon unter dem Motto: „Grundschule – Schule der Vielfalt und Gemeinsamkeit“.
12 Ines Boban, Andreas Hinz (2003): „Der Index für Inklusion – eine Möglichkeit zur Selbstevaluation von ‚Schulen für alle‘“. In: Behindertenpädagogik und Integration (Hrsg. Georg Feuser), Band 1: „Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis“. Frankfurt am Main: Peter Lang, Verlag der Wissenschaften, 2003, S. 40.
13 2018 sagte Hans Wocken, ehemaliger Professor für Lernbehindertenpädagogik an der Universität Hamburg und danach in die deutsche UNESCO-Kommission „Inklusion“ berufen: „(…) Die Inklusion ist die größte Reform in der Geschichte der Pädagogik. Der Wechsel zur Inklusion ist ein noch größeres Vorhaben als die Deutsche Einheit oder die Energiewende. Dieser Paradigmenwechsel benötigt mehr Zeit, als wir vermutet haben (…)“. Zitiert nach: https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/hans-wocken-das-eigentliche-ziel-der-inklusion-ist-verfehlt/ (letzte Abfrage: 16.12.2023)
14 UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 24, Bildung, Absatz 2b.
15 Boban und Hinz, a.a.O., S. 40.
16 Siehe Jo Reichertz (2020): „Qualitative und interpretative Sozialforschung – Ein nicht neutraler Überblick“. In: Jasmin Donlic, Irene Strasser (Hrsg.): „Gegenstand und Methoden qualitativer Sozialforschung. Einblicke in die Forschungspraxis“. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH, 2020. S. 15 - 36
17 Senator für Bildung und Wissenschaft, Bremen (1995): "Schule gemeinsam. Bremer Schulgesetze. Die neuen Gremien."
18 Freie Hansestadt Bremen: Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. 2005, S. 260, 388, 398), zuletzt Inhaltsverzeichnis geändert, § 72a neu gefasst durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (Brem.GBl. S. 913, 917).
19 Per Dalin und Hans-Günter Rolff (unter Mitarbeit von Herbert Buchen): „Institutionelles Schulentwicklungsprogramm. Eine neue Perspektive für Schulleiter, Kollegium und Schulaufsicht.“ Soest: Soester Verlagskontor, 1990, S. 21.
20 „(…) Kein Problem ohne Wissen – kein Problem ohne Nichtwissen. Denn jedes Problem entsteht durch die Entdeckung, daß etwas in unserem vermeintlichen Wissen nicht in Ordnung ist; (…)“. Karl R. Popper (1969): „Die Logik der Sozialwissenschaften“. S.104. In: Adorno u.a.: Der Positivismusstreit der deutschen Soziologie. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1993 (ursprünglich Hamburg 1969), S. 103 – 123.
21 Adorno u.a.: „Der Positivismusstreit der deutschen Soziologie“. A.a.O.
22 „Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. (…)“
23 Wolfgang Jantzen (1974): „Sozialisation und Behinderung. Studien zu sozialwissenschaftlichen Grundlagen der Behindertenpädagogik.“ Gießen: Focus-Verlag, 1974, S. 11.
24 Reinhard Stähling, Barbara Wenders (2013): „Ungehorsam im Schuldienst. Der praktische Weg zu einer Schule für alle.“ Grundlagen der Schulpädagogik, Band 66 (Herausgegeben von Astrid Kaiser und Rainer Winkel), Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
25 Andreas Hinz, a.a.O.
26 Siehe Urie Bronfenbrenner (1993): „Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente“. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, S. 24.
27 Karl Marx (1983): „Thesen über Feuerbach“. In: Marx-Engels Werke, Band 3 Berlin: Dietz Verlag, S. 7.
28 Siehe Joachim Wolff (2003): „Pädagogisches Ethos und ökonomische Rationalität“. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, S. 153 ff.
2 HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
Das Lehrerzimmer ist ein Ort der Hoffnung auf einen Augenblick Ruhe zwischen den Unterrichtsstunden. In Wahrheit versammeln sich in der Pause vor der Tür Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Anliegen. Es wird geklopft und die Lehrkraft, die zu spät kommt oder die das Zimmer verlassen muss, hat Pech gehabt. Plötzlich koordiniert sie die verschiedenen Anfragen, ruft nach Kolleginnen und Kollegen, vertröstet, verweist ans Sekretariat oder die Hausmeisterei, bevor sie ihr ursprüngliches Vorhaben weiterverfolgen kann. Oft verlaufen die Pausen mit deutlich weniger Erholung als erhofft. Tiefergehende Gespräche sind in dieser Umgebung nur schwer möglich. Natürlich reden die Lehrkräfte über die Kinder und Jugendlichen, das zu tun ist Teil ihrer Profession. Aber sich angemessen mit innerschulischen Problemen auseinanderzusetzen, mit den Lernprozessen einzelner Kinder oder Jugendlicher, den Schwierigkeiten mit manchen Eltern oder den vielen weiteren Dingen, die die schulische Arbeit betreffen, fällt schwer. Dafür braucht es gemeinsame Zeit und eine ruhige Umgebung. Beides lässt sich im Lauf des Vormittags für die meisten Lehrkräfte kaum finden. Die Fokussierung der Lehrkräftearbeit auf die Unterrichtsstunde und die daraus resultierende Arbeitszeitregelung erschwert das Finden gemeinsamer Zeiten zusätzlich.
Dabei wären intensive gemeinsame Diskussionen dringend erforderlich gewesen, nicht nur über einzelne Schülerinnen und Schüler, sondern insbesondere auch über die zukünftige Entwicklung der eigenen Schule. Anfang der 2000er Jahre waren die Hauptschulen faktisch von den Eltern bundesweit abgewählt. Im März 2004 änderte daher auch die Bremische Bürgerschaft Schul- und Schulverwaltungsgesetz, um die Überführung der Hauptschule in eine neue Schulart zu ermöglichen. Dies war zugleich eine Folge der PISA-Studie, wurde doch mit dieser Änderung auch ein längeres gemeinsames Lernen angestrebt29. Beginnend mit dem Schuljahr 2004/05 starteten Bremer Lehrkräfte daher damit, den Beschluss umzusetzen, die Haupt- und Realschulen durch Sekundarschulen zu ersetzen. In einem Sachstandsbericht an die Deputation für Bildung hieß es im März 2005: „(…) Es bestehen insbesondere erhebliche Unterschiede in den kognitiven Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, in ihren allgemeinen sprachlichen Kompetenzen, in den sozialen Kompetenzen, in den Interessen und Neigungen, in der Leistungsmotivation und in den physischen und gesundheitlichen Voraussetzungen. Diese sehr unterschiedliche Zusammensetzung der Schülerschaft stellt eine große Herausforderung für die Sekundarschule dar, auf die sie mit einem besonderen Konzept reagieren muss, (…).“30
In der Praxis bestand dieses besondere Konzept weitgehend aus einer Übertragung strukturgebender Elemente aus den integrierten Gesamtschulen auf die Sekundarschulen. Nun ging es auch dort um die Einrichtung von Grundund Erweiterungskursen, um die Einstufung der Schülerinnen und Schüler sowie der Klärung von Kriterien für die Vergabe des Haupt- oder Realschulabschlusses. Letztlich wurden mit den Sekundarschulen integrierte Gesamtschulen zweiter Klasse gegründet, da sie, anders als die Vorbilder, nicht auch als Lernort für die leistungsstärkere, auf das Abitur orientierte Schülerschaft gedacht waren. Die formal erforderlichen Bildungspläne für die Sekundarschulen wurden in den Jahren 2006 und 2007 veröffentlicht.
Die Sekundarschulen waren 2008 mit ihren Klassenverbänden gerade bis zum 9. Schuljahr hochgewachsen, als im Land Bremen die Gesetzeslage erneut geändert wurde. Diejenigen, die sich in den fünf vorausgegangenen Jahren engagiert am Aufbau einer neuen Schulform beteiligt hatten, erfuhren plötzlich, dass man sie nur vorübergehend als Pioniere auf einer größeren und dem unentdeckten Land vorgelagerten Insel eingesetzt hatte. Verdutzt stellten sie fest, dass eine erneute Umsiedlung von ihnen verlangt wird. Das Land, das zukünftig erschlossen werden soll, war nun beginnend mit der den Inseln nachgelagerten Küste identifiziert worden.
Mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention bekamen alle Bremer Schulen durch die ab 01.08.2009 gültig werdende neue Rechtslage den Auftrag, „sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln“31. Gleichzeitig wurde beschlossen, der Vielgliedrigkeit des Bremer Schulwesens mit der zukünftigen Aufteilung in Gymnasien und Oberschulen Bremer Prägung ein Ende zu setzen32. „Die Oberschule“, so heißt es heute auf der Homepage der Senatorin für Bildung, „ist eine leistungsorientierte Schule für alle nach skandinavischem Vorbild.“33 Obwohl der Begriff Oberschule beispielsweise auch in Niedersachsen Verwendung findet, gibt es bedeutende Unterschiede. Eine Oberschule Bremer Prägung ist grundsätzlich die einzige Alternative zum Gymnasium. An ihr werden Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen anerkannten Förderbedarfen unterrichtet, gleichzeitig können alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse, eben auch das Abitur, erworben werden. Da sich in Bremerhaven, aufbauend auf dem 1983 verabschiedeten Schulgesetz, die darin geforderte horizontale Gliederung des Schulwesens durchgesetzt hatte, wird das Abitur in der Regel dort nicht an den Oberschulen selbst erworben, sondern an einem der drei damals entstandenen Oberstufenzentren. In Bremen gibt es dagegen eine Reihe von Oberschulen mit eigener Oberstufe.
Kaum drei Jahre, nachdem eine Verbindung aus Haupt- und Realschulen noch als große Herausforderung beschrieben wurde, erwartete die Bildungspolitik jetzt die Umsetzung einer erheblich umfassenderen Veränderung von der Lehrerschaft. Gemeinsamer Unterricht von allen Schülerinnen und Schülern, mit und ohne Behinderung, war bis 2008 kein Thema, von dem man üblicherweise in den Lehrerzimmern der traditionellen Regelschulen sprach. Kooperative, integrative oder inklusive Schulen waren nur von marginaler Bedeutung. Was von den meisten Lehrkräften bisher als Spezialthema von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sowie einzelnen reformorientierten Schulen angesehen wurde, entwickelte sich plötzlich zu ihrem eigenen Arbeitsauftrag. Vereinzelt kannte man Kolleginnen und Kollegen aus Schulen, die mit Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung kooperierten. Natürlich hatten viele auch schon irgendwann mal von „Integration“ gehört. Das Wort „Inklusion“ war dagegen für viele neu. Wie sollte ein angemessener Unterricht für eine Klasse möglich werden, die sich zukünftig noch viel heterogener zusammensetzen würde als fast alle bisher bekannten Konstellationen? Plötzlich entstand in allen Lehrerzimmern aller Schulen ein erheblicher Gesprächsbedarf.
2.1 Inklusion in Schule
Mein Duden-Herkunftswörterbuch von 1997 kennt das Wort „Inklusion“ ebenso wenig wie mein Bedeutungswörterbuch aus dem Jahr 2002 oder mein Synonymwörterbuch aus dem Jahr 2004. In allen drei Büchern findet sich nur das Wort „inklusive“, was mit „einschließlich, inbegriffen“ erklärt wird. Viele der in den Schulen beschäftigten Menschen glauben, dass sie Außenstehenden den Inklusionsauftrag gut erklären und in seiner vielschichtigen Problematik darstellen können. Insbesondere Lehrkräfte nutzen solche Gespräche gerne, um die komplizierten Herausforderungen darzustellen, denen sie sich in ihrem Beruf ausgesetzt sehen. Immer noch wirkt die 1995 geäußerte Bemerkung Gerhard Schröders nach, dass Lehrkräfte „faule Säcke“ seien, auch wenn er sie 2020 relativierte. Der Inklusionsauftrag gibt die Chance, dieses Bild zurechtzurücken. Kaum ein Thema ist in den Unterhaltungen über Schule mit mehr Emotionalität besetzt.
Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention geht es insbesondere um Fragen der Bildung. Die unterzeichnenden Vertragsstaaten sichern beispielsweise zu, dass sie zukünftig das Ziel verfolgen, „Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“. Menschen mit Behinderung sollen gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, in der sie leben, an einem inklusiven Unterricht teilnehmen können. Damit das gelingt, werden sie zukünftig nicht „aufgrund von Behinderungen vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen“. Und dazu soll innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die erforderliche Unterstützung gewährleistet werden.
Die eingangs aufgestellte Behauptung, dass die Schulpflicht den Zugang zu Bildung für jedes Kind erzwingt, war nicht ganz präzise. Unterricht für Menschen mit Behinderung ist keine mit Einführung der Schulpflicht erzwungene Selbstverständlichkeit. 1961 schrieb der Begründer der Sonderschulen für Kinder mit geistiger Behinderung in Bremerhaven, Georg Ennen, in einer von der Lebenshilfe veröffentlichten Denkschrift zur Situation von Menschen mit geistiger Behinderung in Bremerhaven: „Als Kind sind ihm Kindergarten und Schule verschlossen. Er wird ‚von der Schulpflicht befreit‘, was bedeutet, daß sich in Wirklichkeit die Schule von ihm befreit. (…)“34. Viele Jahre lang bemühte man sich in Deutschland unter verschiedenen Überschriften, ein hochspezialisiertes Fördersystem aufzubauen – als Hilfsschule, Sonderschule, Förderschule oder Förderzentrum. In den Empfehlungen zur Ordnung des Sonderschulwesens der Kultusministerkonferenz von 1972 wurden zehn unterschiedliche Sonderschulen beschrieben35. Eine spätere Erklärung der Kultusminister von 1994 gibt Hinweise darauf, dass hinter den Kulissen große Differenzen darüber bestanden, was eine gute sonderpädagogische Förderung in der Schule ist und wie diese gestaltet werden könnte36. Mit der Ratifizierung der Konvention wiederholt sich die Kritik Georg Ennens auf anderem Niveau. Die Gründung von Spezialschulen für spezielle Kinder bedeutete wiederum nur eine Befreiung der Regelschulen von der Schulpflicht für alle. „Wirkliche Teilhabe an einer freien Gesellschaft“ ist jedoch nichts, was durch Beschluss alltägliche Praxis wird. Ein auf dem Papier gewährtes Recht ist noch lange keine gelebte Wirklichkeit. Für das deutsche Schulwesen stand mit Blick auf die nun verbindlichen Beschlusslagen ab 2009 ein drastischer Paradigmenwechsel bevor.
Heute wird zunehmend deutlich, dass beim Aufbau inklusiver Schulen ein zwingend erforderlicher Aspekt der Aufmerksamkeit entgangen ist: Die Behindertenrechtskonvention verbessert den rechtlichen Status von Menschen mit Behinderungen. Der mit ihrem Inkrafttreten versprochene gleichberechtigte Zugang zu schulischer Bildung kann jedoch nicht allein und unabhängig von allen anderen Schülerinnen und Schülern für diese relativ kleine Gruppe realisiert werden. Eine Umsetzung wird erst möglich, wenn das Gesamtsystem Schule sich verändert. Die multiprofessionellen Teams, die den Aufbau solcher Schulen tragen müssten, bilden sich erst langsam und schrittweise im Verlauf einer schon eingeleiteten Schulentwicklung heraus. Die sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräfte gelangen erst Jahrgang für Jahrgang neu und zusätzlich in die Regelschulen. Der gesetzlich verlangte Aufbruch für alle Regelschulen in das unentdeckte Land der Inklusion führte dazu, dass die hinzukommenden Sonderschullehrkräfte auf Beschlusslagen und Schulentwicklungsprozesse treffen, an deren Entwicklung sie in der Regel nicht oder nur geringfügig beteiligt waren. Regelschullehrkräfte, so muss es ihnen unter solchen Bedingungen erscheinen, schreiben ihnen ihre neuen Rollen in den inklusiven Schulen zu.
Im Schuljahr 2008/09 wurde an vielen unterschiedlichen Orten in der Schule darüber diskutiert, was wohl auf sie zukommen wird. Bisher arbeiteten sie als Lehrkräfte an einer integrierten Gesamtschule, demnächst aber sollte sich ihre Schule in eine inklusive Oberschule umwandeln. Zufällig trafen sich Karin Köhler, Klassenlehrerin der neu gebildeten 5b, und Nico Stein, Klassenlehrer der 6a, in einer Freistunde im Lehrerzimmer. Schnell waren sie miteinander über die anstehenden Veränderungen ins Gespräch gekommen. „Manche Sachen sind ja unstrittig und eigentlich völlig überflüssig“, meinte Karin Köhler. „Dass man Schülerinnen und Schüler nicht diskriminiert, weil sie aus einem anderen Land stammen, eine andere Hautfarbe oder Religion haben, ist doch für uns alle selbstverständlich. Der Umgang mit behinderten und beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern ist dagegen etwas ganz anderes!“ „Ich weiß gar nicht, wie die Leute in der Behörde sich das vorstellen! Was soll denn Inklusion sein? Da brauche ich doch in jeder Unterrichtsstunde einen Sonderschullehrer an meiner Seite, damit der sich um die Behinderten kümmert“, äußerte sich Nico Stein. „Damit kennt sich doch gar keiner von uns aus! Ich bin Studienrat, kein Sonderschullehrer.“ Immer öfter tauchte das Wort „Inklusion“ mit mehr oder minder großer Besorgnis in den schulischen Gesprächen auf.
In meiner Jugend Anfang der 1970er Jahre gab es an meiner Realschule einen älteren Jungen, der auf den Rollstuhl angewiesen war, aber trotzdem dieselbe Schule besuchte wie ich. „Regelschulfähigkeit“ und lernzielgleicher Unterricht gehörten zu den Voraussetzungen für solch eine Form der Integration37. Der Begriff „Inklusion“ und die damit verbundenen Fragen nach lernzieldifferentem Unterricht erreichte die meisten sogenannten Regelschullehrkräfte erst im Umfeld der Debatten zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention ab 2008. Dabei ist er deutlich älter und wurde vielfach synonym zu dem noch älteren Begriff der Integration genutzt. Andreas Hinz erklärt, dass Integration die pädagogische Idee von der „(…) Einbeziehung einer Gruppe von Menschen mit Schädigungen in eine Gruppe Nichtgeschädigter (…)“ beschreibe. Demgegenüber handele es sich bei schulischer Inklusion um ein pädagogisches Konzept, das sich ein „(…) Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten – darunter auch die Minderheit der Menschen mit Behinderungen (…)“38 zum Ziel setze.
Schon Ende der 1970er Jahre wies Wolfgang Jantzen darauf hin, dass es nur ein menschliches Wesen und folglich auch nur eine menschliche Pädagogik geben könne39. Trotzdem ist die Klärung von Verschiedenheit und Gleichheit40 für die konzeptionelle Entwicklung inklusiver Schulen von elementarer Bedeutung. Krassimir Stojanov spricht davon, dass Gleichheit eine „(…) über die Gewährung von Grundrechten hinausgehende institutionalisierte Anerkennung der grundsätzlich uneingeschränkten Bildungs- und Autonomieentwicklungsfähigkeit bei jedem Menschen (erfordert)“41. Unbestreitbar muss man darin eine Voraussetzung für ein Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten sehen. Zur Anerkennung der allen Menschen innewohnenden Bildungs- und Autonomieentwicklungsfähigkeiten gehört jedoch auch die Anerkennung, dass alle menschlichen Leben einzigartig sind. Wygotskis Konzept der Entwicklungszonen besagt, dass nur derjenige „(…) Unterricht gut ist, der der Entwicklung vorauseilt“42. Der Ort, an dem der Unterricht der persönlichen Entwicklung vorauseilt, kann aber aufgrund der Verschiedenartigkeit der Menschen immer nur ein individuell unterschiedlicher sein. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Verständnis von Inklusion als allgemeiner Pädagogik, „(…) die es mit einer einzigen, untrennbar heterogenen Gruppe zu tun hat (…)“ 43.
In den Schulen des Landes Bremen und insbesondere den Schulen der zum Land gehörigen Stadt Bremerhaven gab es schon seit längerer Zeit auf Seiten der Lehrkräfte eine gewisse Durchmischung in den Regelschulen. Hauptund Realschullehrkräfte arbeiteten ebenso wie Gymnasiallehrkräfte oder Lehrkräfte mit anderen Ausbildungen an den verschiedenen Schularten der Sekundarstufe I, insbesondere an den integrierten Gesamtschulen. Obwohl von Gesamtschulen gesprochen wurde, waren auch sie mit wenigen Ausnahmen Schulen unter Ausschluss von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarfen, „(…) geprägt von der das deutsche Schulwesen bestimmenden Selektivität. (…)“44