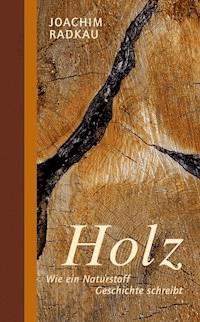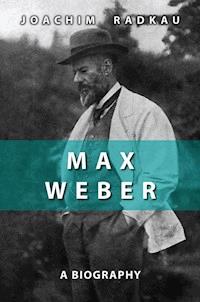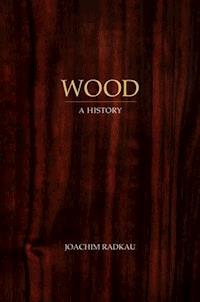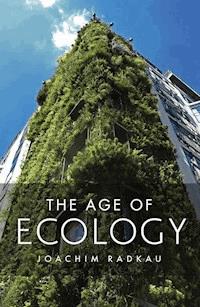Joachim RadkauLothar Hahn
Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2013 oekomGesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Gestaltung und Satz: Reihs Satzstudio, LohmarUmschlagabbildung: © Caspar Benson/fstop/Corbis Umschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.deLektorat: Reimar Paul & Uta Ruge
eBook: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-86581-390-9
Vorwort von Joachim RadkauWie die Atomkraft von der Zukunft zur Geschichte wurde
Vorwort von Lothar HahnBeobachtungen eines Zeitzeugen
KAPITEL IVom Atomprojekt des Zweiten Weltkriegs zum »friedlichen Atom«
Hiroshima und Haigerloch – historische Last und Gruppendynamik der nuklearen Community
Atompolitik zwischen Adenauer, Erhard und Heisenberg
Ökonomische Rahmenbedingungen der Kernenergie in der Bundesrepublik
KAPITEL IIDas »friedliche Atom« als Vision: die Phase derSpekulationen
Kerntechnische Entscheidungsfelder und ihr politischer Symbolwert: britischer oder amerikanischer Weg?
Der Mythos vom »Atomzeitalter«: das »friedliche Atom« als Integrationsideologie der 1950er-Jahre
Kernenergie als Bestandteil ökonomischer Strategien
Furcht vor der »Energielücke«: Gab es sie wirklich?
Atomplanung zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft
Nuklear-Nationalismus und Euratom-Politik
KAPITEL IIIVollendete Fakten: der ungeplante Siegeszug des Leichtwasserreaktors
Das verstärkte Staatsengagement für die Kernkraft und das Umschwenken der Energiewirtschaft
Eigendynamik der Großforschung – Verselbstständigung der Zukunftsreaktoren
Auseinanderentwicklung durch planlose Verflechtung: Zentrifugalkräfte im Dreieck Staat-Wissenschaft-Wirtschaft
Die Kontroverse um die Brütertypen
Die Kontroverse um den »Atomsperrvertrag«
KAPITEL IVDas intern verdrängte Risiko elektrisiert die Öffentlichkeit
Reaktorsicherheit als separater Bereich der kerntechnischen Entwicklung
Die Entstehung der Anti-Atomkraft-Bewegung
Exkurs: Zur Geschichte der Kernenergie in der DDR
Höhepunkt oder nukleare Scheinblüte?
KAPITEL VVom schleichenden zum offenen Niedergang
Rückschläge, Störfälle und ein Super-GAU
Exkurs: Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986
Atomenergiepolitik von Willy Brandt bis Helmut Kohl
Das Hin und Her um den Ausstieg
Exkurs: Die Atomkatastrophe von Fukushima 2011
Fehlentwicklungen und Größenwahn
»Der Weg zur Energie der Zukunft«
Bilanz und Ausblickoder: von der Notwendigkeit neuer Strukturen und neuer Managertypen in der Energiewirtschaft
ANHANG
»Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:›Lieber Freund, das mache ich schon seit zwanzig Jahren so!‹ – Man kann eine Sache auch zwanzig Jahre lang falsch machen.«
Kurt Tucholsky (1932)
Vorwort von Joachim RadkauWie die Atomkraft von der Zukunft zur Geschichte wurde
Als ich mich um 1973/74 neugierig in die Kerntechnik hineinzutasten begann – eine für mich fremde und aufregende Welt –, fragte mich ein Manager der Branche stirnrunzelnd, was ich in seinem Revier zu suchen habe: Das Geschäft des Historikers sei die Vergangenheit, die Kernenergie dagegen sei die Zukunft. Heute, fast vierzig Jahre danach, ist die Kernkraft zumindest in Deutschland ein Stück Geschichte geworden – für mich auch ein nicht geringer Teil meiner eigenen Lebensgeschichte. Glaubte ich vor dreißig Jahren, als ich meine Geschichte der deutschen Atomwirtschaft erstmals veröffentlichte, den Sinn eines historischen Zugangs noch begründen zu müssen, ist diese Begründung heute selber von historischem Interesse. Hatte ich meine damalige Habilitationsschrift noch vorsichtig betitelt: »Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft« – in den frühen 1980er-Jahren war es nach der ersten heißen Phase des Atomkonflikts um die Kernkraft wieder relativ ruhig geworden –, bietet sich heute eine klare Titelkurve »Aufstieg und Fall« an, die bei meiner Historikergeneration die Erinnerung an den Nachkriegs-Bestseller von William Shirer »The Rise and Fall of the Third Reich« wachruft.
Kein Zweifel: Das Auf und Ab der Atomkraft ist eines der aufregendsten Dramen der bundesdeutschen Geschichte – vielleicht sogar dasjenige Drama, das am allermeisten zu denken gibt. Man kann es als Tragödie, Komödie oder Kriminalgeschichte schildern. Umso mehr muss man sich wundern, dass die Historiker der Bundesrepublik um diese Geschichte fast durchweg einen Bogen gemacht haben und meine Arbeit von 1983 nicht längst überholt ist. Das Thema scheint zu volltönenden Werturteilen herauszufordern, die der Historiker nicht mag; und sobald sich der Laie in die technischen Details begibt, gerät er in einen Dschungel. Obendrein sind viele einschlägige Materialien bis heute nicht frei zugänglich. Daher wurde ich schon seit vielen Jahren immer wieder gefragt, wann endlich mit einer Fortschreibung meines Textes zu rechnen sei. Wer die fast 600 Seiten umfassende Taschenbuchausgabe der Habilitationsschrift eifrig benutzt hatte, dem ist sie zerfleddert; im Buchhandel ist sie längst vergriffen, auch antiquarisch nur noch hier und da zu bekommen und in manchen Bibliotheken, auf welche Weise auch immer, verschwunden.
Aber eine Neufassung hätte zugleich eine Aktualisierung erfordert; wie sollte ich das machen? In den 1980er-Jahren hatte ich auf den Heidelberger Gesprächsabenden der FEST (Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft) zum nuklearen Proliferationsrisiko Lothar Hahn kennengelernt, zu jener Zeit Reaktorexperte am Öko-Institut Darmstadt. Er schlug mir damals vor, gemeinsam eine Fortsetzung zu schreiben. Aber in der Folge wurden wir beide über Jahrzehnte von anderen Projekten absorbiert – Lothar stieg unter der rot-grünen Bundesregierung sogar zum Vorsitzenden der Reaktorsicherheitskommission auf.
Jetzt, wo wir beide im Ruhestand sind und nach Fukushima der deutsche Ausstieg aus der Kernkraft auch von bisherigen Befürwortern besiegelt wurde, ist der Augenblick gekommen, unseren alten Plan wieder aufzunehmen: zwar keinen Fortsetzungsband zu schreiben, aber eine überarbeitete, teilweise neu geschriebene und bis in die Gegenwart fortgeführte Fassung jener Untersuchung vorzulegen.
Aus Faszination wird Skepsis
Einen kompetenteren und kongenialeren Partner als Lothar könnte ich mir dabei nicht vorstellen: Genau seit den 1980er-Jahren, als meine Kontakte zur Atom-Szene immer sporadischer wurden, wurde er – um im heutigen Jargon zu reden – »voll vernetzt« und stieg sogar in Positionen auf, die ihm Insidereinblicke boten, von denen ich nur träumen konnte. Er ist von Hause aus Physiker; mit ihm gelange ich endlich zu jener interdisziplinären Zusammenarbeit, die bei einem solchen Thema ideal ist. Mit seinem Physikerblick machte er mir das Kürzen und Überarbeiten leichter, wenn auch der Historiker bei der Feststellung, dass bestimmte Passagen »nur noch von historischem Interesse« sind, das »nur« weglassen würde. Manches, was zeitweise »nur« von historischem Interesse war, wird unversehens wieder aktuell. Das Fiasko der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), die sinnlos Fördermittel vergeudete und unnötige Spannungen schuf, deutet auf die Schädlichkeit einer überspannten europäischen Einigung voraus; das militärische Potenzial der Kerntechnik gewinnt unversehens eine immer neue Aktualität, ob im Nahen oder Fernen Osten; wie einst in der Atomeuphorie der 1950er-Jahre ertönen im Zeichen des Mythos »Neue Technologien« »Deutschland-erwache!«-Alarmrufe, als seien die Deutschen wieder einmal dabei, irgendein angebliches Hightech-Wettrennen zu verschlafen. Und die Erinnerung an die massive staatliche Förderung der Kerntechnik ist nützlich bei aktuellen Kampagnen gegen die Förderung erneuerbarer Energien. Überhaupt ist die Geschichte der Kernenergie unendlich lehrreich für Fragen der Technologiepolitik, wo der Fadenriss in der Erinnerung zu immer neuer frisch-fröhlicher Naivität verführt.
Lothar Hahn und ich haben beide – sachlich wie menschlich – einen ähnlichen inneren Balanceakt hinter uns: Beide haben wir uns mit der Abkehr von der Atomkraft nicht leicht getan. Bis in die 1990er-Jahre war das Potenzial der erneuerbaren Energien schwer zu übersehen; die reale Alternative zur Kernenergie war die Kohle und diese war durch die Warnungen vor einem Klimawandel gleichfalls ins Zwielicht geraten. Wir hatten beide gute Beziehungen zu manchen Angehörigen der nuklearen »Community«, die wir intellektuell und als Menschen respektierten und verstanden und deren Forscherbegeisterung mir sogar sympathischer war als die Wut ihrer Gegner. Aber gerade Spitzenleute boten das beste Beispiel für das Wort Max Webers, dass der leidenschaftliche Forscher die Fähigkeit besitze, sich »Scheuklappen anzuziehen«. Wer gutgläubig meint, die Verantwortung für die Risiken der Kerntechnik sei am besten bei den großen Namen der Atomforschung aufgehoben, kennt die Besessenheit des passionierten Forschers schlecht.
Tragödie ohne Dämon
Gewiss hat die Geschichte der Kernenergie ihre Skandale: Immer wieder wurden Informationen über Risiken und Störfälle unterschlagen und wurde die Öffentlichkeit, ja wurden selbst zuständige Regierungsstellen unzulänglich oder falsch informiert. Insofern lässt sich ein Teil des nuklearen Dramas durchaus als Kriminalgeschichte schreiben. Aber nicht das ist der springende Punkt, dass im innersten Kern der atomaren Community Bösewichte die Strippen gezogen hätten. Es gibt auch andere Geschichten, die Züge einer großen Tragödie haben – oder auch einer Komödie. Schon 1983 war es mein Ziel, und das gleiche Ziel haben Lothar und ich auch jetzt: eine Geschichte der Atomwirtschaft vorzulegen, die auch für bisherige Anhänger der Kerntechnik und für die vielen, die in ihrer Position oft schwankten, lesbar ist und als objektiv und fair erkannt wird. Wenn ein kritischer Grundton vorherrscht, so doch über weite Strecken eine Kritik von innen, nicht von außen: eine Kritik nach dem Maßstab, wie eine verantwortbare Entwicklung der Kerntechnik hätte aussehen können. Kontakte zu Wolfgang D. Müller (1919–2006), dem jahrzehntelangen Chefredakteur der Branchenzeitschrift atomwirtschaft, bestärkten mich in der Zuversicht, dass so etwas wie Objektivität selbst bei dem Thema Kerntechnik möglich ist. Seine große Geschichte der Kerntechnik hatte nach dem Wunsch der Atomlobby eigentlich ein Gegenbuch gegen das meinige werden sollen; aber er versicherte mir, er habe in meinem Buch keine groben Fehler entdecken können.
Anti-Atomkraft-Pamphlete, die zur Selbstbestätigung der Protestbewegung dienen, gibt es seit vierzig Jahren in Hülle und Fülle. Aber eine nur moralisierende Sicht, die in der Atomkraft die Macht des Bösen erblickt – ob des Großkapitals, des wissenschaftlichen Größenwahns oder der mit der Bombe liebäugelnden Machtpolitik – versperrt das Verständnis der bundesdeutschen Kernenergie-Geschichte. Auf diese Weise lernt man nicht aus ihr. Und ohne eine derartige nüchtern-sachliche Analyse läuft auch die neue Energiepolitik Gefahr, in ähnliche Fallen zu laufen: Sie ergeben sich aus der Unübersichtlichkeit des Terrains, der Zeitgebundenheit der Perspektiven, der Schwierigkeit der Bewertung von Informationen und dem Unvermögen, mit Unsicherheiten und einer Mehrzahl von Optionen umzugehen, auch wenn jene tückischen Risiken der Kernkraft, die aus Kettenreaktion, Radioaktivität und Nähe zur Bombe resultieren, bei den »Erneuerbaren« fehlen.
Für mich wurde die Erforschung der Atomgeschichte zu einem geistig-menschlichen Abenteuer. Mit mehr Glück als Verstand gelang es mir, Zugang zu den Aktenmassen des Bundesatomministeriums, der Atomkommission und der Reaktorsicherheitskommission zu erlangen, die noch ungereinigt in Baracken im Bundesgrenzschutzgelände von Hangelar bei Bonn zwischenlagerten. Durch eine persönliche Beziehung zur Familie Heisenberg wurde mir Einblick in die Heisenberg-Korrespondenzen gewährt, in denen ich lebendig vor Augen hatte, wie im Heisenberg-Netzwerk während der frühen Jahre der bundesdeutschen Atompolitik die Fäden zusammenliefen und eine Kontinuität zum »Uranverein« des Zweiten Weltkriegs bestand. Hans-Ulrich Wehler, bei dem ich mein Opus 1980 als Habilitationsschrift einreichte, bemerkte später, »jeder Neuzeithistoriker« würde Habilitanden von einem solchen Thema »mit allem Nachdruck vor allem deshalb abgeraten« haben, »weil die Quellenfrage unlösbar aussah«. »Zur Verblüffung des Lesers« habe ich es »jedoch verstanden, (m)einer Untersuchung eine ebenso solide empirische Basis zu verschaffen, wie sie andere Wissenschaftler etwa für ein Thema aus der Weimarer Republik oder des Kaiserreichs gewinnen können«. (Hans-Ulrich Wehler: »Aus der Geschichte lernen?« München 1988, Seite 92)
Die Macht der Bombe
Es war immer ein Erlebnis, mit »alten Hasen« der Atomszene zu reden. Zu Siegfried Balke (1902–1984), dem früheren Atomminister, gewann ich ein fast vertrauliches Verhältnis und durfte nach Herzenslust in der Fülle seiner privaten Papiere stöbern. Mit Vergnügen erinnere ich mich an die oft mit Cognac animierten Plaudereien mit ihm (1978). Er, der nach den Nürnberger Gesetzen Halbjude war und in der NS-Zeit manches durchgemacht hatte, sah nicht ohne Groll, wie sich in jenen Kreisen der Großindustrie, die in den Gründerjahren der Atomkraft die Regie führten, frühere Manager der Kriegswirtschaft in einem Club »Mars und Merkur« trafen. Anders als diese und im Widerspruch zu seinem einstigen Chef Adenauer, der ihn mit Nichtachtung strafte, zeigte er offen Sympathie mit den Unterzeichnern des Göttinger Manifests gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr.
Balke brachte mir bei, zum Verständnis der frühen Bonner Atompolitik müsse ich mir zu allererst klarmachen, dass diese mit Energiepolitik nichts zu tun gehabt habe. Zu einer Zeit, als die Anti-AKW-Bewegung das Thema »Atombombe« noch als Ablenkung empfand, bestärkte mich der einstige Atomminister in dem Verdacht, dass die Anfänge der Bonner Atompolitik keineswegs so unschuldig waren wie behauptet, sondern militärische Ambitionen dort wie fast überall mitspielten, wo man die Kernenergie-Entwicklung politisch forcierte. Er zeigte mir Notizen von Telefonaten mit Franz Josef Strauß, in denen dessen Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck kam, dass der Atomminister mit ihm so wenig Kontakt hielt. Als er mir von einem Besuch beim Schah von Persien erzählte und ich mit gespielter Naivität fragte, wieso sich der Herrscher eines Öllandes für die Kernenergie interessiert habe, erwiderte Balke mit nachsichtigem Lächeln, dem sei es lediglich um die Bombenoption gegangen. Als ich weiterfragte, ob es denn schwer sei, eine Atombombe zu bauen, wenn man die zivile Kerntechnik habe, lächelte er wieder: Oh nein, das sei nicht schwer.
Das Gespräch ist mir noch nach über dreißig Jahren in Erinnerung; Damals kam es mir indiskret vor, es zu publizieren. Noch heute erinnere ich mich auch an lange abendliche Gespräche mit Elisabeth Heisenberg (1914–1998), der Witwe des Nobelpreisträgers, dessen Korrespondenzen ich den Tag über hatte studieren dürfen. Sie war die Schwester von Fritz Schumacher (1911–1976), der 1936 nach England emigrierte und mit seinem Kultbuch »Small is Beautiful« (1973) zu einem Guru des angloamerikanischen environmentalism wurde, und bedauerte, dass ihr Ehegatte mit ihrem Bruder über Fragen der Technik nicht diskutieren wollte. Die Legitimität der Kerntechnik stand ihm grundsätzlich nicht zur Disposition. Und doch – so versicherte sie mir – sei Heisenbergs Hauptsorge im »Göttinger Manifest« nur nebenbei angeklungen: dass die Atomforschung auch in der Bundesrepublik mit militärischen Hintergedanken betrieben werde. Diese Sorge habe auch in der Zeit danach unvermindert fortbestanden.
Was ich auf der mir damals zugänglichen Aktenbasis nur vorsichtig kombinieren konnte, wurde mittlerweile durch die große Adenauer-Biografie von Hans-Peter Schwarz in verblüffendem Maße bestätigt: dass dieser Bundeskanzler seit dem Herbst 1956 »über EURATOM auf schnellstem Weg die Möglichkeit erhalten« wollte, »selbst nukleare Waffen herzustellen«, da er dem »amerikanischen Atomschirm« nicht mehr traute, und dass er dabei »ganz offensichtlich« »an eine deutsche Option und nicht an europäische Kernwaffen« dachte. Aber bei Schwarz ist auch zu lesen, dass Adenauer später fluchte, man habe sich durch »die ganze verdammte Atomgeschichte« »den Kopf vernebeln« lassen. An dieses Adenauer-Wort sollte man sich heute erinnern!
Entwicklung ohne Steuerung
Aus dem Rückblick nach dreißig, vierzig Jahren grübele ich manchmal darüber: Habe ich damals, im Ozean der Quellen schwimmend und planschend und zugleich von den Turbulenzen des Atomkonflikts umgetrieben, vielleicht manchmal den Wald vor Bäumen nicht gesehen, und enthalten die von mir erschlossenen Materialmassen Einsichten, die mir selber verborgen blieben, während andere aus der Distanz klarer sahen? Ist und bleibt eben doch die Bombe der Schlüssel zum Verständnis der weltweiten Konjunktur der Kernenergie? War es vor allem die Bombe, die diese Technik auf der ganzen Welt mit einer Aura der Macht umgab und überall Eliten hervorbrachte, die sich gegen die Öffentlichkeit abschotteten und zugleich immer wieder gewaltige Fördermittel zu mobilisieren verstanden?
Und wenn immer wieder gefragt wurde, warum die Anti-Atomkraft-Bewegung gerade in Deutschland am stärksten und nachhaltigsten wurde: Lag der entscheidende Grund ganz einfach darin, dass die Bundesrepublik keine Atommacht war, die Adenauerschen Bombenpläne Episode blieben und vor der Öffentlichkeit streng geheim gehalten werden mussten? Dass die Deutschen unter Einschluss ihrer führenden Atomphysiker von nationaler Megalomanie nach 1945 gründlich die Nase voll hatten? Man könnte das Beispiel Japan dagegenhalten, ebenfalls Kriegsverlierer, das keine Atommacht, vielmehr das bislang einzige Opfer der Atomwaffen ist und dennoch keine starke Opposition gegen die Kernkraft hervorbrachte. Aber für japanische Eliten scheint die Offenhaltung der nuklearen Waffenoption eine ungleich größere Bedeutung zu besitzen als für deutsche, da Japan in Ostasien isolierter ist als die Bundesrepublik in Europa.
Wehler verstand mein Buch von 1983 als Paradigma für eine neue Art von Politikgeschichte: Es sei »von paradigmatischem Wert für das Verständnis von Politik in einer Welt, in der klar identifizierbare Subjekte, wie etwa individuelle Politiker, nicht mehr als die Bewegungszentren schlechthin verstanden werden können«, mit dem Effekt, dass am Ende etwas herauskommt, das »so nicht geplant und so von vielen nicht gewollt« sei. Ganz im gleichen Sinne tat Rudolf Schulten, der Erfinder des nach ihm benannten Hochtemperaturreaktors und innernukleare Dissident, als Koreferent eines von mir vorgetragenen Überblicks über die Kernenergiegeschichte den öffentlichen Stoßseufzer, man könne diese ganze Geschichte nur dann begreifen, wenn man sich klar mache, dass »alles gekommen sei gegen den Willen aller«.
Ist diese Geschichte, aus der Distanz besehen, das beste Beispiel für die von Jürgen Habermas bemerkte »neue Unübersichtlichkeit«, und ist mir diese Pointe damals in meiner Faszination durch die nukleare Dschungellandschaft entgangen? Ein Leitmotiv des Buchs von 1983 war die Kritik daran, dass es unter der Vielzahl möglicher Reaktorkonzepte nie einen rationalen, auf Experimente gestützten Ausleseprozess gegeben habe. Einst bei den Dampfkesseln hatte es einen derartigen Prozess gegeben, aber war die Kerntechnik dazu viel zu kompliziert und zu riskant und waren alle Beteiligten – ob in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik – mit einer solchen Aufgabe schlichtweg überfordert? Ist es das, was mein Material beweist, ich jedoch damals nicht auf den Punkt zu bringen vermochte?
Die alte Frage, ob eine sichere Kerntechnik prinzipiell möglich ist, erscheint mir heute naiv. Stattdessen ist zu fragen, auf welche Weise man sich hier auf einen bestimmten Begriff von Sicherheit einigen kann und welche Institutionen auf welche Weise in der Lage wären, unter den Reaktorkonzepten eine entsprechende Auslese zu treffen. Da hat mir Klaus Traube aus seiner Erfahrung als technischer Leiter des Brüterbaus mehr als einmal kräftig den Kopf gewaschen. Im Spiegel (4/1984, Seiten 71–76) hat er mein Buch sehr anerkennend und kennerisch besprochen und doch am Ende – er, der tief ernüchterte einstige Brüter-Enthusiast! – mich, den Historiker, angepflaumt, »die Faszination der Kerntechnik« scheine mit mir manchmal »durchzugehen«, wenn ich mir einbildete, die Entwicklung inhärent sicherer Reaktoralternativen sei möglich gewesen, ohne die Unmöglichkeit einer rationalen Steuerung derart komplexer aufgeladener Megaprojekte zu begreifen.
Auch nach Gesprächen mit Lothar Hahn denke ich: Vielleicht ist das der Punkt und vielleicht besteht das wahre Geheimnis der Kernenergiegeschichte nicht darin, dass es im innersten Kern der nuklearen Community eine allmächtige Direktion gab, sondern dass nirgends eine umfassende Steuerung und Verantwortung existierte. Anfangs liefen alle Fäden bei Heisenberg zusammen; aber nicht ganz zu Unrecht spottete Franz Josef Strauß später in seinen Memoiren: Hätte man die Regie der Atompolitik Heisenberg überlassen, »wäre das Ergebnis ein perfektes Chaos gewesen«. Später hielten viele die Deutsche Atomkommission für die große Strippenzieherin; ich entdeckte jedoch verblüfft in den Akten, dass dieses prominent besetzte Gremium ganz und gar nicht so, wie es aus der Ferne erschien, als Superhirn fungierte, das die Entwicklung der Kerntechnik zu steuern vermocht hätte. Lag die Steuerungszentrale in Wahrheit in den Chefetagen der Energiewirtschaft? Aber als ich viel später Zugang zu Akten des RWE bekam, überraschte mich am allermeisten die Entdeckung, dass es selbst bei diesem Energiegiganten über Jahre keine regulären Vorstandssitzungen gab. Wozu große Strategieberatungen, wenn das Geschäft auch ohne diese lief?
Einsichten für die Energiewende
Umso schärfer müssen wir darauf schauen, dass sich die Entwicklung erneuerbarer Energien nicht ähnlich planlos verheddert. Seit 25 Jahren nehme ich an den Gesprächsabenden von Reinhard Ueberhorst teil, die aus der von ihm geleiteten BundestagsEnquetekommission »Zukünftige Kernenergiepolitik« (1979/80) hervorgingen: Da ist die Frage, wie die Politik mit einer Pluralität der Zukunftsentwürfe umzugehen hat, zum Gegenstand einer unendlichen Diskussion geworden, die über den alten Schlagabtausch pro und kontra Kernenergie weit hinausgelangt ist. Schon bei der Abfassung des alten Buches widmete ich den Zeitspielen besondere Aufmerksamkeit: wie sich im Zuge der Kernenergieentwicklung immer wieder kurzfristige in langfristige Pläne verwandeln, andererseits langfristige Perspektiven von kurzfristigenkurz fristigen Interessen unterlaufen werden und in der öffentlichen Wahrnehmung alles durcheinander geht. Heute im Zeichen des Zauberwortes »Nachhaltigkeit« können wir derart verwirrende Zeitspiele erst recht erleben!
Im Blick auf mögliche Energiezukünfte und von Lothar beraten, habe ich den ursprünglichen Text auf etwa die Hälfte gekürzt und den voluminösen, auf die Habilitation berechneten Anmerkungsapparat fortgelassen: Da dieser sich überwiegend auf Archivalien bezieht, die teilweise bis heute nicht frei zugänglich sind, sofern sie überhaupt noch existieren, wäre er für die meisten Leser wertlos. Die wenigen, die auf diesem Gebiet wissenschaftlich arbeiten, werden die entsprechende Anmerkung in der Erstausgabe von 1983 unschwer finden. Dieses und jenes Bonbon aus den damaligen Anmerkungen habe ich jetzt jedoch in den Text eingefügt. Vor dreißig Jahren hatte ich manches Brisante diskret in den knibbelig gedruckten Anmerkungen versteckt; wie ich später erfuhr, hatte ich ohnehin großes Glück gehabt, wegen meines Buches nicht juristisch belangt worden zu sein. Da kann ich heute Klartext reden. Dazu habe ich Stücke aus einer Reihe späterer Essays, die neuere Erfahrungen verarbeitet haben – allem voran Tschernobyl und Fukushima –, in überarbeiteter Form verwendet und Erkenntnisse daraus in den Text integriert, um die Darstellung an die Gegenwart anzunähern.
Vor allem jedoch hat Lothar Hahn die Brücke zur Gegenwart geschlagen, in manchen Punkten in Kritik zu meiner Sicht vor dreißig Jahren. Dass die letzten dreißig Jahre sehr viel kürzer weggekommen sind als die Phase von den 1950er bis zu den 70erJahren, war nicht zu vermeiden; denn hier sind die Akten noch nicht zugänglich. Zudem sieht es ganz so aus, als besitze die Nuklearhistorie vor allem in jenen ersten drei Jahrzehnten ein großes Format, als dort noch Spitzenleute der Wissenschaft und Wirtschaft zusammenströmten und sich dann in den 70erJahren viele Vorkämpfer der grünen Bewegung zuerst im Kampf gegen die Atomkraft profilierten. Aber das soll künftige Historiker nicht abschrecken: Auch Prozesse des Niedergangs besitzen ihren eigenen Reiz; nicht umsonst steht Edward Gibbons sechsbändige »History of the decline and fall of the Roman empire« (1776–1788) am Beginn der neueren Erforschung der altrömischen Geschichte. Wer weiß, vielleicht findet auch das zunächst klammheimliche, nach und nach immer offenere Zerbröckeln der einst so furiosen nuklearen Community künftig seinen Gibbon. Bei der Aufklärung der Nukleargeschichte gibt es noch viel zu tun! Und es ist eine Geschichte, die immer neuen Stoff zum Nachdenken gibt und gerade für neue Generationen neue Einsichten enthält.
Vorwort von Lothar HahnBeobachtungen eines Zeitzeugen
Als Zeitzeuge einer dreißig Jahre dauernden spannenden Geschichte möchte ich Beobachtungen wiedergeben und interpretieren sowie Zusammenhänge aufzeigen, die sich einer späteren geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung möglicherweise verschließen. Aus der Erinnerung an das Selbsterlebte heraus entwickeln sich womöglich andere Gewichtungen und Wertungen von Fakten als bei jemandem, der die Geschichte später anhand des Studiums von Quellen aufarbeiten will. Bei vielen Entwicklungen bin ich »dabei gewesen«, teilweise physisch, teilweise nur durch Beobachtung, dies aber aus größerer Nähe als der Laie. Viele handelnde Personen kenne oder kannte ich persönlich. Meine berufliche Tätigkeit gestattete mir Einblick in viele Interna aller Konfliktparteien.
Dabei konnte ich Verständnis für alle Rollen, Zwänge und Nöte der an der Kontroverse um die Kernenergie Beteiligten entwickeln. Einiges habe ich mitgestalten dürfen, insbesondere in meinen elf letzten Berufsjahren, zunächst von 1999 bis 2002 als Vorsitzender der Reaktorsicherheitskommission und dann von 2002 bis 2010 als Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). Zuvor hatte ich von 1980 bis 2001 ein halbes Berufsleben lang beim Öko-Institut die verschiedenen Phasen der Kernenergienutzung in Deutschland aus nächster Nähe erlebt. Aber auch die Entwicklung in anderen Ländern und in internationalen Organisationen blieb mir aufgrund zahlreicher Kontakte und einiger Funktionen nicht verborgen.
Das erste Motiv für die Beteiligung an diesem Buchprojekt war mein Wunsch, der Öffentlichkeit zu vermitteln, wie ich die kerntechnische Entwicklung in diesen dreißig Jahren wahrgenommen habe. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Ausgewogenheit. Mein Beitrag folgt auch nicht den Regeln, die ein Experte bei der Erstellung von Gutachten oder bei der Abfassung von technisch-wissenschaftlichen Texten zu beachten hat. Mir kam es vielmehr darauf an, meine Wahrnehmung der Geschichte der Kerntechnik und meine Interpretation von Ereignissen und Zusammenhängen zu schildern – bewertend und ohne eine Art Beweislast übernehmen zu müssen.
Der zweite Anstoß für meine Beteiligung an dem Buchprojekt war der Reiz, mich mit einem Historiker an die Aufarbeitung der kerntechnischen Entwicklung zu wagen. Dass mein Koautor dazu noch der renommierte Historiker und Kenner der Technikgeschichte Joachim Radkau ist, beflügelte meine Bereitschaft in besonderem Maße. Seine 1983 veröffentlichte Habilitationsschrift »Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft« hat mich seinerzeit fasziniert und stellt für mich auch heute noch eine einzigartige Fundgrube dar.
Es ist sicherlich ein interessantes, wenn nicht sogar gewagtes Experiment, einen Historiker und einen Physiker ein Thema gemeinsam bearbeiten zu lassen, nicht nur für die Autoren, sondern auch für den Verlag. Arbeitsstil und Herangehensweise können unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite ein Historiker, der in seiner Habilitation und dem daraus erschienenen Buch eine ungeheure Quellengrundlage erarbeitet und ausgewertet hat, auf der anderen Seite ein Physiker, der weitgehend ohne Quellenangaben seine Interpretation der Geschichte liefert und lediglich zu seiner Absicherung Jahreszahlen und technische Daten wie Kraftwerksleistungen recherchiert. Der Historiker mit dem Schwerpunkt auf Quellengrundlagen und politischen Zusammenhängen, der Physiker mit dem Fokus auf technologischen und naturwissenschaftlichen Wechselwirkungen. Dies führte zwangsläufig auch zu unterschiedlichen Textumfängen.
Für das Experiment sprach nicht nur die Tatsache, dass sich beide Autoren seit vielen Jahren kennen und schätzen. Wichtig war auch der Umstand, dass Joachim Radkaus Standardwerk bis in die Zeit reicht, in der 1980 meine berufliche Laufbahn in der Kerntechnik begann. Dadurch waren wir in der Lage, die gesamte Entwicklung der Atomwirtschaft von ihren frühen Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg bis Fukushima – ziemlich genau ein Jahr nach meiner Pensionierung – ohne zeitliche Lücke zu überblicken. Bei der Frage, wie es nun mit der Energiewende weitergeht, sind der Historiker und der Physiker überfragt. Um dennoch auf der Basis bisheriger Erfahrungen einige Aussagen zu den energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Herausforderungen dieser »Herkulesaufgabe« treffen zu können, haben wir uns mit erfahrenen und prominenten Kennern der Materie beraten: mit Volker Hauff, Michael Müller und Klaus Töpfer aus der Politik, Hans-Jochen Luhmann vom Wuppertal-Institut, Gerhard Mener, dem Historiker der Solartechnik, von dem Mainova-Energieversorgungsunternehmen, und Hendrik Ehrhardt, der die Geschichte der Energiebedarfsprognosen analysiert hat. Es versteht sich, dass wir unsere Schlussfolgerungen selber verantworten.
Jeder Beschäftigung mit einer komplexen Materie wie der Geschichte der Atomwirtschaft wohnt ein gewisses Maß an Subjektivität inne. Das gilt für den Historiker genauso wie für den Physiker. Allein schon die Auswahl der Quellen oder Untersuchungsgegenstände unterliegt bekanntermaßen subjektiven Einflüssen. Eine hundertprozentige Objektivität ist eine Illusion. Was aber angestrebt werden kann und was auch von diesem Buch erwartet werden darf, ist der Versuch von Fairness: Fairness gegenüber Personen, aber auch gegenüber Fakten. Voraussetzung dafür ist meines Erachtens, dass zwischen dem Betrachter und seinem Betrachtungsgegenstand keine Ressentiments bestehen, seien es nicht beglichene Rechnungen zwischen Personen, Streit, Verletzungen oder Ähnliches. Ich glaube, dass diese Voraussetzungen bei uns Autoren erfüllt sind.
Ich für meinen Teil kann feststellen, dass ich in meiner dreißigjährigen Tätigkeit in der Kerntechnik zwar unzählige kontroverse Diskussionen geführt habe und auch vielfach angefeindet wurde. Mal habe ich Recht gehabt, mal andere. Ich darf aber auch feststellen, dass meine Karriere in der Kerntechnik spannend und abwechslungsreich war, in einer äußerst interessanten Zeit stattfand und sachlich wie menschlich am Ende harmonisch verlief. Ich konnte viele meiner Ideen in weitgehender Unabhängigkeit verwirklichen und blicke mit Zufriedenheit auf mein Berufsleben zurück. Folglich habe ich auch keinerlei Grund, verbittert zu sein, Frust abzulassen, mit irgendjemandem oder irgendetwas abzurechnen. Ich möchte niemanden verletzen oder beleidigen, ich möchte niemals persönliche Belange antasten. Auch bin ich bemüht, mich an gewisse Spielregeln zu halten, zum Beispiel werde ich keine Fakten nennen, zu deren vertraulicher Behandlung ich mich in meinen Ämtern und Funktionen verpflichtet habe. Ich will auch kein Besserwisser sein, der im Lichte der Kehrtwende in der Atompolitik nach Fukushima doch Recht behält.
Stattdessen bemühe ich mich, die mir bekannten und nicht vertraulichen Fakten nach bestem Wissen und Gewissen und frei von irgendwelchen Zwängen wissenschaftlicher, politischer oder persönlicher Art nur entsprechend meiner eigenen Wahrnehmung wiederzugeben. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe ich ebenso wenig wie ich wissenschaftliche Belege für meine Einschätzungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen zu liefern beabsichtige. Eine geschichtswissenschaftliche Analyse mit einer Auswertung der relevanten Quellen aus der Zeit von 1980 bis heute würde meine Fähigkeiten überfordern. Dies hat mein Koautor für die Zeit vor 1980 in hervorragender Weise geleistet. Ich hoffe, der Versuch einer Kombination aus den Erkenntnissen eines Historikers und den Beobachtungen eines Physikers über den Aufstieg und den Niedergang der deutschen Atomwirtschaft ist gelungen.
KAPITEL IVom Atomprojekt des Zweiten Weltkriegs zum »friedlichen Atom«
Hiroshima und Haigerloch – historische Last und Gruppendynamik der nuklearen Community
Die überraschende Nachricht vom Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 rief bei den damals im britischen »Farm Hall« internierten deutschen Atomphysikern zwiespältige Empfindungen hervor: Manche äußerten Erleichterung darüber, dass man nicht selber diese furchtbare Waffe entwickelt hatte, aber stärker war doch die Betroffenheit über die überwältigende Überlegenheit der amerikanischen Forschung und auch die Sorge, dass man selbst nunmehr in aller Augen als Versager dastünde.
Robert Jungk hat zu einer Zeit, als er in den Pionieren der Atomforschung noch Zukunftsmenschen zu erkennen glaubte, in seinem Buch über das »Schicksal der Atomforscher« (1956), einem Bestseller der 1950er-Jahre, den Nichtbau der Atombombe als einen Akt passiven Widerstands der deutschen Atomforscher dargestellt: eine These, die in der deutschen Öffentlichkeit mit Begeisterung aufgenommen wurde, zumal sie in der Zeit des »Göttinger Manifestes« ganz plausibel wirkte.
In den USA löste sie jedoch sogleich eine »bittere Kontroverse« aus; denn damit drohte die übliche Rechtfertigung des Bombenbaus durch die amerikanischen Atomphysiker hinfällig zu werden: Jetzt auf einmal erschienen ihnen gegenüber die deutschen Forscher als Gegenbild verantwortungsbewusster Wissenschaft. Jungk musste freilich zugeben, dass sich seine wohlwollende Interpretation nicht einmal auf Selbstzeugnisse der deutschen Atomforscher stützen konnte: Die hätten sich damit begnügt, »als Erklärung für das Nichtvorhandensein einer deutschen Atombombe bei Kriegsende das mangelnde Interesse der politischen Führung und die technischen Schwierigkeiten in den Vordergrund zu schieben«. Wenn sie jedoch tatsächlich passiven Widerstand praktiziert hätten: Hätten sie sich dann nach Kriegsende mit Stolz dazu bekannt?
Die Spontanreaktionen der durch die Nachricht von Hiroshima in Verwirrung gestürzten deutschen Forscher sind durch ein versteckt installiertes Mikrofon auf Tonband aufgenommen worden; es gibt über den Inhalt dieser nie freigegebenen Bänder allerdings lediglich Berichte aus zweiter Hand. Hiernach bemerkte Carl Friedrich von Weizsäcker, nachdem sich die erste Bestürzung gelegt und man sich überzeugt hatte, dass die Nachricht tatsächlich zutraf, er »glaube, es ist uns nicht gelungen, weil alle Physiker aus Prinzip gar nicht wollten, dass es gelang«; Erich Bagge dagegen erwiderte schroff: »Ich meine, es ist absurd von Weizsäcker, so etwas zu sagen. Das mag für ihn zutreffen, aber nicht für uns alle«. Der Tenor von Bagges eigenen Aufzeichnungen passt durchaus zu diesem Wortwechsel und spricht für die Echtheit des Berichtes. Auch aus Weizsäckers Worten geht hervor, dass man sich selbst im engsten Kreis der Atomforscher bis dahin nicht klar darüber verständigt hatte, ob man etwa den Bau der Bombe bewusst vermeiden wolle.
Verräterisch ist die dort abgehörte Bemerkung Heisenbergs, »moralischer Mut« wäre notwendig gewesen – nicht etwa, um den Bau der Bombe zielstrebig zu verhindern, sondern um der NS-Regierung zu empfehlen, »120000 Mann einzustellen, nur um die Sache aufzubauen«! So selbstverständlich lebte er noch nach Kriegsende in der Vorstellung, selbst »moralisch« gesehen sei der deutsche Sieg das höchste Ziel. Otto Haxel behauptete im Gespräch mit dem Verfasser, Heisenberg – ganz in seine eigene Welt eingesponnen – habe bis Kriegsende nicht glauben wollen, dass das NS-Regime Juden ermordet habe!
1947 erschien ein erstes Enthüllungsbuch über die deutsche Atomphysik im Zweiten Weltkrieg; sein Verfasser, Samuel A. Goudsmit, war Mitglied des US-Kommandos »Alsos« gewesen, das sich nach dem alliierten Einmarsch auf die Spuren der deutschen Atomforschung begeben hatte. Goudsmit vertrat die Behauptung, der deutsche »Uranverein« habe sehr wohl den Willen zum Bombenbau besessen, aber in Unkenntnis selbst der elementarsten Voraussetzungen einen ganz ungeeigneten Weg dazu eingeschlagen. Das ging den Atomphysikern an die Berufsehre. Heisenberg, der in dem Buch als die führende Gestalt des »Uranvereins« persönlich angegriffen wurde, verteidigte sich in langen Briefen an den einst befreundeten Goudsmit. Sehr ausführlich verwahrte er sich darin gegen den Vorwurf elementarer Unkenntnis der Prinzipien der Bombenkonstruktion, besonders heftig gegen Goudsmits Unterstellung, die deutschen Atomforscher seien so ignorant gewesen, zu glauben, die Amerikaner hätten auf Hiroshima einen ganzen Reaktor abgeworfen; aber über den entscheidenden Punkt, warum die Bombe dennoch nicht gebaut wurde, ließ er sich nicht detaillierter aus. Er bemerkte, über die »politischen Motive« solle man besser mündlich sprechen; er »glaube nicht, dass durch eine Behandlung dieser Fragen in der breiten Öffentlichkeit etwas gewonnen werden kann.«
Aus alledem lässt sich die vermutliche historische Wahrheit einigermaßen rekonstruieren. Heisenberg war wohl im Recht mit seiner Beteuerung, dass man über die Prinzipien der Bombenkonstruktion im Großen und Ganzen Bescheid gewusst habe. Der von den deutschen Forschern während des Krieges projektierte Schwerwasserreaktor war zwar keine der damals in den USA bevorzugten Methoden zur Spaltstoffgewinnung für Bomben, war aber dennoch – wenn auch angeblich auf Grund einer falschen Berechnung gewählt – ein optimaler Weg zum Bombenbau, wenn man den ungeheuer aufwendigen Weg der Uran-Isotopentrennung vermeiden und dafür die Möglichkeiten der hoch entwickelten deutschen chemischen Industrie nutzen wollte. Der Schwerwasserreaktor besaß gegenüber dem damals in den USA zur Plutoniumgewinnung gebauten Graphitreaktor überdies den Vorteil, dass er bereits bei erheblich kleineren Dimensionen funktionsfähig war.
Warum wurde die Bombe dennoch nicht gebaut? Von einem bewussten Widerstand der Atomforscher war offenbar keine Rede. Und doch erscheint die Behauptung glaubhaft, dass man vor die Entscheidung für oder gegen den Bombenbau gar nicht gestellt wurde: zum einen deshalb, weil der Schwerwasserreaktor zugleich auch ein geeigneter Weg zur friedlichen Energieerzeugung war, und zum anderen auch aus dem Grund, weil das für den Bombenbau erforderliche Maß an Kooperation – Kooperation sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch zwischen Forschern und Ingenieuren sowie zwischen Forschung und Industrie – durch Strukturen der deutschen Wissenschaft wie auch des NS-Regimes verhindert wurde.
Der deutsche Wissenschaftsbetrieb war aus eigener Kraft unfähig zu jener praktisch ausgerichteten Kooperation großen Stils, wie sie in den amerikanischen »Atomstädten« Oak Ridge und Los Alamos realisiert wurde, und das NS-Regime, dessen Beziehung zur Wissenschaft ungleich distanzierter war als die der intellektuellenfreundlichen Regierung Roosevelt, war nicht fähig, seine Wissenschaftler zu solchen Formen der Zusammenarbeit zu bewegen. Diese hatten ihrerseits keinen Anlass, von sich aus die NS-Regierung dazu anzutreiben, die Freiheit der Forschung in einem Maße zu beschneiden, wie dies für den Bombenbau erforderlich gewesen wäre. Insofern ist richtig, dass sich aus den Strukturen der deutschen Wissenschaft tatsächlich eine Hemmung gegen einen zielstrebigen Bau der Atombombe ergab; aber Heisenberg hatte Grund, Goudsmit gegenüber zu bemerken, dass eine öffentliche Diskussion der Motive der deutschen Atomforscher unergiebig sein werde.
Goudsmit ging es zu jener Zeit, wie er Heisenberg schrieb, nicht zuletzt darum, der amerikanischen Atomwissenschaft Argumente bei ihrer Abwehr gegen eine fortdauernde staatliche und militärische Reglementierung zu liefern; er wollte daher den Misserfolg der NS-deutschen Atomphysik als warnendes Beispiel für die Ineffizienz »totalitärer Einmischung« in die Wissenschaft gesehen wissen und ärgerte sich, dass Heisenberg keine Neigung zeigte, ihn auf dieser Argumentationslinie zu unterstützen: »Why is it so hard for you or Hahn to give us a vivid description of the decay of science under totalitarian interference?« In Wahrheit war jedoch die deutsche Kernforschung Anfang 1942 – genau zu der Zeit, als sie in den USA der Armee unterstellt wurde – der Zuständigkeit des Heereswaffenamtes entzogen und dem Reichsforschungsrat übertragen, das heißt praktisch sich selbst überlassen worden: Dies und nicht etwa ein diktatorisches Reglement von oben war die Ursache für den schleppenden Fortgang des Bombenprojekts!
Mehrere Forschergruppen arbeiteten während des Krieges – eifersüchtig voneinander getrennt – an der Konstruktion eines mit Schwerwasser moderierten Reaktors; aber infolge mangelnder Einschaltung der Industrie blieb das schwere Wasser sehr knapp und reichte bis kurz vor Kriegsende nicht einmal zum Betrieb eines einzigen Versuchsreaktors aus. Erst im Frühjahr 1945, unmittelbar vor dem Einmarsch der Alliierten, schien die unter der Leitung Heisenbergs arbeitende Gruppe vom Berliner Institut für Physik der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (der späteren Max-Planck-Gesellschaft), die im schwäbischen Haigerloch in einem ehemaligen Weinkeller einen Schwerwasserreaktor errichtete, so weit zu sein, den Reaktor in Betrieb zu setzen – aber da scheiterte die Probe aufs Exempel an dem Fehlen einer restlichen Menge schweren Wassers, die die konkurrierende Gruppe um Kurt Diebner nicht herauszugeben bereit war!
Diese Erfahrung bekam vor allem im Lichte der dann folgenden Ereignisse etwas Beschämendes: Hiroshima zeigte, dass im Gegensatz zur Überzeugung der deutschen Forscher die Entwicklung einer Kernspaltbombe binnen weniger Jahre doch möglich war, und noch dazu in den USA, die bis dahin in wissenschaftlicher Hinsicht den Deutschen als weit unterlegen galten. Auch kam heraus, dass die Bombe, wenn auch auf japanische Städte abgeworfen, doch nur aus Angst vor einer NS-deutschen Atombombe entwickelt worden war und dass die deutschen Atomforscher nichts Wirksames unternommen hatten, um diese Angst rechtzeitig zu beschwichtigen. Selbst in demjenigen Sektor der Kernforschung, wo sich die Wege zur Bombe und zum Kernkraftwerk noch nicht getrennt hatten, war den deutschen Forschern kein klarer Beweis ihres Könnens geglückt, bevor ihre Versuchsanlagen von den Alliierten demontiert wurden.
Auf internationalem Parkett bekamen die führenden deutschen Atomphysiker noch lange Zeit den Groll zu spüren, dass eigentlich sie den Sündenfall der amerikanischen Atomforschung verschuldet hätten; zugleich aber war – ärger noch – ihre fachliche Kompetenz in Zweifel geraten. Aus dieser Situation heraus ergaben sich bei Heisenberg und anderen Fachkollegen starke persönliche Motive, im Zuge des westdeutschen Wiederaufstiegs die Fähigkeiten der deutschen Wissenschaft auf dem Gebiet der friedlichen Kerntechnik möglichst rasch unter Beweis zu stellen und dabei die Fehler der Kriegszeit – die Zersplitterung der Kräfte und die unzulängliche Zusammenarbeit mit Staat und Industrie – dieses Mal zu vermeiden. Mehr noch: Es galt nun, nachträglich zu beweisen, dass man tatsächlich während des Krieges etwas für die friedliche Kerntechnik geleistet hatte. In den Jahren vor 1955, als Reaktorbau und Uranverarbeitung den Deutschen offiziell noch durch ein Gesetz des alliierten Kontrollrats untersagt waren, trat vor allem Heisenberg als treibende Kraft der bundesdeutschen Atompolitik in Erscheinung. Er zeigte dabei eine wachsende Ungeduld, die in Anbetracht der damals noch begrenzten politischen und ökonomischen Möglichkeiten der Bundesrepublik überrascht.
Die Gruppe um Heisenberg am Max-Planck-Institut für Physik, das nach dem Krieg zuerst in Göttingen, später in München aufgebaut wurde, war in der Frühzeit bundesdeutscher Atompolitik, als der Kreis der Sachverständigen noch eng begrenzt war, ein Kommunikationszentrum, in dem viele Fäden zusammenliefen. Heisenbergs jahrzehntelanger Freund war Carl Friedrich von Weizsäcker, der von der Atomphysik zur Philosophie überwechselte und einiges dazu beitrug, dass die Atomkraft damals Brennpunkt eines weit über physikalisches Fachsimpeln hinausgehenden Gedankenaustausches wurde. Der Dritte im Bunde war Karl Wirtz, die führende Gestalt in den Anfängen des Kernforschungszentrums Karlsruhe, der seinerseits eine enge Beziehung zu Karl Winnacker herstellte, dem Chef der Farbwerke Hoechst und mächtigsten industriellen Protagonisten der Kerntechnik zu jener Zeit. Aus der Reaktorgruppe des Göttinger Max-Planck-Instituts kam Wolf Häfele, der künftige Leiter des Karlsruher Schnellbrüter-Projekts, aber auch sein prominentester Konkurrent auf dem Feld der Zukunftsreaktoren: Rudolf Schulten, der Konstrukteur des gern nach ihm benannten Kugelhaufen-Hochtemperaturreaktors. Ein angeheirateter Onkel Heisenbergs war Wolfgang Finkelnburg, in der Atomwirtschaft »die überragende Persönlichkeit der ersten Stunde« (Robert Gerwin), der die Reaktorforschungsabteilung der Firma Siemens aufbaute und dort das später aufgegebene Schwerwasserkonzept durchsetzte. An Heisenberg wandte sich 1955 das RWE, als es darum ging, ein Firmenmitglied »in die Grundlagen der Kernspaltung einzuführen«. Und auch der Bundeskanzler pflegte sich bis zu jener Zeit in Nuklearfragen an Heisenberg zu wenden.
Otto Hahn dagegen, der als Entdecker der Kernspaltung weit mehr als Heisenberg der Öffentlichkeit als der große Pionier des »Atomzeitalters« geläufig war und nach außen hin nicht selten die Rolle einer Galionsfigur der deutschen Atomwissenschaft spielte, hatte schon während des Krieges kaum mehr Anteil an der Reaktorentwicklung genommen, war in die Geheimnisse der Atombombenentwicklung nicht eingeweiht und stand auch nach 1945, obwohl Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, abseits des Heisenberg-Kreises, dessen hochfliegenden philosophischen und politischen Ambitionen er nicht folgen konnte und mochte. Er glaubte, mit der ökonomischen Nutzung der Kernspaltung habe es keine Eile: Nicht in nächster Zukunft, sondern erst »später« würden »Atommaschinen« Verwendung finden und wohl auch vornehmlich nur in »Polarländer(n), Wüsten usw.«, »wo Kohle und Öl nicht oder nur schwer zur Verfügung stehen«. Industriell ausgerichtete Projektforschung war und blieb ihm zuwider und er meinte 1952 in einem Vortrag über die »Bedeutung der Grundlagenforschung für die Wirtschaft«, dass die Wissenschaft sogar für die Wirtschaft dann am meisten erbringe, wenn sie sich selber überlassen bleibe und jeder eben das erforsche, was ihm »Spaß mache«. Das erklärte er vor der nordrhein-westfälischen Arbeitsgemeinschaft für Forschung, und solche Worte waren in jenem Kreis durchaus nicht in den Wind gesprochen: Die dort vorgeplante Kernforschungsanlage Jülich suchte in ihren Strukturen jene Freiheit der Wissenschaft zu bewahren.
Für die Bemühungen der Heisenberg-Gruppe, die Reaktorentwicklung innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft zu halten, brachte Hahn kein Verständnis auf; vielmehr sah er die durch das Machtwort des Bundeskanzlers erzwungene Übersiedlung der Reaktorexperten nach Karlsruhe nicht ungern und suchte sie sogar »in nicht ganz verbindlicher Form« zu beschleunigen. Hahn verkörperte mit dieser Einstellung Traditionen des deutschen Wissenschaftsbetriebs; der Individualismus der Grundlagenforschung leistete direkt oder indirekt der Ausgliederung der Projektforschung Vorschub.
Ein Gegenpol zur Heisenberg-Gruppe, aber mit ungleich geringerer Anziehungskraft, war die Hamburger Gruppe um Bagge und Diebner, den Initiatoren des Atomforschungszentrums in Geesthacht, das sich auf die Entwicklung von Schiffsreaktoren spezialisierte. Obwohl auch Bagge bei Heisenberg promoviert hatte, entstand schon während des Krieges ein Konkurrenzverhältnis, das in den 1950er-Jahren wieder auflebte; Diebners Habilitation war am Widerstand Heisenbergs gescheitert. Während die 1956 gegründete Zeitschrift atomwirtschaft mehr unter dem Einfluss des Heisenberg-Kreises stand, war die im selben Jahr gegründete Zeitschrift Atomkernenergie das Organ der Bagge/Diebner-Gruppe.
Das alte, laut Heisenberg »wohl noch aus der Kriegszeit stammende Ressentiment der Experimentalphysiker« gegen praktische Ambitionen der Theoretiker machte sich erneut bemerkbar, wobei Bagge und Diebner sich als die Vertreter der Praxis gaben. Diebner bemerkte 1955 in seiner Initiative zur Gründung der Hamburger Studiengesellschaft für Schiffsreaktoren, dass die »an sich erfreuliche Initiative« zum Reaktorbau in Karlsruhe und München »mehr oder weniger von Vertretern der reinen Grundlagenforschung auszugehen« scheine, während er selbst »mit aller Deutlichkeit betonen« möchte, dass er »die Entwicklung von Atomenergieprojekten in Deutschland im jetzigen Stadium nicht so sehr für eine wissenschaftliche Angelegenheit halte als vielmehr im wesentlichen für eine Aufgabe von Wirtschaftlern, Ingenieuren und Technologen«. Die Kritik, dass die Anfänge der kerntechnischen Entwicklung in der Bundesrepublik zu praxisfern gewesen seien, wurde später von verschiedener Seite geteilt. Für Experimentalphysiker und schon gar für Ingenieure hatte die führende Stellung theoretischer Physiker in der Kernenergieentwicklung in der Tat etwas Widersinniges und »Physikerreaktor« wurde zum Schimpfwort.
Mehr der experimentellen als der theoretischen Physik zuzuordnen war auch der zeitweise einflussreichste Gegenpol zur Heisenberg-Gruppe, der an der Münchener Technischen Hochschule wirkende Physiker Heinz Maier-Leibnitz. Durch seine Initiative wurde der erste bundesdeutsche Reaktor, das sogenannte »Atomei« in Garching bei München, errichtet: Indem er einen kompletten Reaktor aus den USA bezog, kam er Wirtz und dem Karlsruher Zentrum zuvor, die auf einer deutschen Eigenentwicklung gemäß dem alten Schwerwasser-Konzept insistierten. Der Geschäftsführer der Atomkommission wusste (1961) Maier-Leibnitz als einzige »unparteiische Autorität« in dem Arbeitskreis Kernreaktoren und als »Gegengewicht zu der führenden Rolle« von Wirtz zu schätzen. Der Maier-Leibnitz nahestehende Experimentalphysiker Haxel wurde in Karlsruhe zu Wirtz’ erfolgreichem Gegenspieler.
Dieses gesamte Beziehungsgeflecht – die vielfach schon in die Zeit vor 1945 zurückreichenden Gruppenbindungen und Rivalitäten – muss zum Verständnis der nuklearen Frühgeschichte in der Bundesrepublik im Auge behalten werden: Zu einer Zeit, als im kerntechnischen Bereich die Institutionen und ökonomischen Interessen noch nicht ihre Eigendynamik entwickelt hatten, wurde die Atompolitik weit mehr als später in ihrem Charakter durch Individuen und Kleingruppen, durch persönliche Erinnerungen und Affinitäten bestimmt. Später sprach man gerne von der atomaren »Community«; diese war jedoch keineswegs eine harmonische Familie.
Atompolitik zwischen Adenauer, Erhard und Heisenberg
Seit 1951 drängte eine Reihe von Atomforschern mit Heisenberg an der Spitze – zunächst in einer Sonderkommission des Deutschen Forschungsrates, seit dem Februar 1952 in der Senatskommission für Atomphysik der Deutschen Forschungsgemeinschaft versammelt – bei der Bundesregierung darauf, nunmehr zielstrebig den deutschen Einstieg in die Kerntechnik zu betreiben. Schon im Januar 1952 bezeichnete Heisenberg in einem Schreiben an den Bundeskanzler den Bau eines Reaktors als »erste Etappe« eines deutschen Atomprogramms, obwohl er noch 1953 Schwierigkeiten hatte, sich einen »technisch brauchbaren« Reaktor vorzustellen. Dabei waren damals kraft Kontrollratsgesetz der Reaktorbau und die Herstellung von Uran- und Thoriummetall offiziell noch verboten. Immerhin war die Möglichkeit einer Sondergenehmigung für Besitz und Gebrauch dieser Kernspaltstoffe sowie der Moderatoren Schwerwasser und Graphit vorgesehen: Laborexperimente für die Reaktorkonstruktion waren also nicht ausgeschlossen. Im Übrigen gewinnt man den Eindruck, dass damals in Kreisen der Atomforschung die alliierten Restriktionen ohnehin nicht mehr sehr ernst genommen, sondern für vorübergehend gehalten wurden.
Neue Perspektiven schien der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) zu eröffnen, der im Mai 1952 von den Regierungen unterzeichnet wurde, aber 1954 an der Ablehnung des französischen Parlaments scheiterte. Seine Bestimmungen boten der Bundesrepublik die Möglichkeit, jährlich 500 Gramm Plutonium herzustellen und einen Versuchsreaktor von maximal 1500 kW zu errichten. In Anbetracht dessen, dass der damals einzige Strom erzeugende Reaktor der Welt, der US-Versuchsbrüter EBRI, nur eine Kapazität von ganzen 100 kW besaß, war das kein belangloser Spielraum. Auch daraus erklärt sich die wachsende Ungeduld Heisenbergs. Aber gerade der Konnex mit dem EVG-Vertrag, dessen parlamentarische Ratifikation in der Schwebe war und von Adenauer mit größter Sorge verfolgt wurde, macht verständlich, dass die Atomenergie für den Bundeskanzler damals ein nur behutsam anzufassendes Politikum war. Schon die allerersten Ankündigungen künftiger deutscher Atomaktivitäten riefen in Paris Unruhe hervor.
Im Februar 1952 berief die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Kommission für Atomphysik unter Vorsitz Heisenbergs ein; aber erst Ende des Jahres begann die Bundesregierung auf die Initiativen der Atomwissenschaftler zu reagieren. Die Zuständigkeit für die Kernenergie lag damals beim Bundeswirtschaftsministerium. Dort fand am 20. November 1952 unter Vorsitz Ludwig Erhards und in Anwesenheit Heisenbergs eine erste Besprechung »über die Bildung einer deutschen Kernenergie-Kommission« statt. Heisenberg ergriff als Erster das Wort; er bezog sich dabei auf den EVG-Vertrag wie auf eine bereits abgemachte Sache. Oberste Priorität gab er der Aufstellung eines »Atommeilers« in der Bundesrepublik und die Hauptaufgabe hierbei erblickte er in der Beschaffung des dafür notwendigen Urans; er dachte in erster Linie an Förderung aus deutschen Lagerstätten, »weil ein Kauf aus dem Ausland wegen der Aufkäufe Amerikas kaum möglich sei«. Die Direktheit, mit der er auf das Ziel des Reaktorbaus lossteuerte, ist bemerkenswert; erstaunlicher noch ist seine abschließende Feststellung, die Errichtung des Reaktors müsse »privat finanziert werden«.
In einer weiteren Besprechung im Wirtschaftsministerium am 23. Februar 1953, über die Heisenberg dem Bundeskanzler auf dessen Wunsch ausführlich berichtete – mit der Berichterstattung auf dem Dienstwege war Adenauer offenbar nicht zufrieden – wurde »das Planungsstadium der atomtechnischen Arbeiten eröffnet« und die Bildung von drei Ausschüssen – für Urangewinnung, für die Herstellung der Moderatoren des Reaktors und für »die allgemeine technische und finanzielle Planung« – beschlossen. Über die »Bildung einer eigentlichen Atomenergie-Kommission« dagegen – ein Thema, das bereits im Raum stand – wurde auf Weisung des Bundeskanzlers diesmal nicht gesprochen. In diesem Punkt hatten sich schon sehr rasch unterschiedliche, wenn auch diffuse Vorstellungen entwickelt, die zeitweise zu Differenzen zwischen dem Bundeskanzler und dem Wirtschaftsministerium führten und die Einrichtung eines gesonderten Atomministeriums mitbestimmt haben werden. Im Hintergrund erkennt man Meinungsverschiedenheiten, die ohnehin zwischen Erhard und Adenauer über das Ausmaß der Liberalisierung der Wirtschaft bestanden.
Heisenberg und die Vorsitzenden der Ausschüsse für Urangewinnung und Moderatoren – der Freiburger Geologe Franz Kirchheimer und Karl Wirtz – waren sich schon bald darin einig, dass die künftige Atomkommission möglichst unabhängig vom Wirtschaftsministerium agieren müsse, über dessen Reaktionsträgheit man verstimmt war. Kirchheimer versicherte Heisenberg, die Geschäftsstelle der Atomkommission könne »nur in Göttingen sein«, und bei der Verteilung der Sitze sollten die »Techniker und Wissenschaftler begünstigt« werden: »Sonst besteht die Gefahr, dass die von den wissenschaftlichen Mitgliedern gestellten Anträge am Widerspruch der Bürokratie oder der Vertreter aus der Wirtschaft scheitern.«
Derweil wurde auch im Wirtschaftsministerium ein Entwurf für die Atomkommission ausgearbeitet: Man dachte dabei offenbar an ein mehr repräsentatives als kompetentes und handlungsfähiges Beratergremium des Wirtschaftsministers. Ein Vertreter der Deutschen Forschungsgemeinschaft klagte Heisenberg gegenüber, ein solches Gremium sei eine »unglückliche Konstruktion« und der Entwurf kranke daran, »dass man nicht richtig weiß, was man eigentlich will«. Insbesondere missfiel ihm die dort vorgesehene Vertretung verschiedenster Ministerien und Wirtschaftsbranchen und der nur beratende Charakter, der die Verantwortung beim Wirtschaftsminister beließ. Stattdessen solle die Kommission besser aus »wenigen sehr hochgestellten Persönlichkeiten« bestehen und »vielleicht« »sogar die Befugnis haben, den gewissermaßen als Ausführungsorganen beteiligten Bundesministerien im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit verbindliche Anweisungen zu erteilen«. Derart realitätsferne Ideen einer Herrschaft der Wissenschaft kursierten zu einer Zeit, als man die Atomkraft als Herrscherin einer neuen Ära zu sehen beliebte!
Was nun den Bundeskanzler anging, so ließ Adenauer sich gewiss nicht ungern von der Inkompetenz und Trägheit seines Wirtschaftsministers in Sachen Kernenergie überzeugen; schon im Februar 1953 schrieb er an Erhard, den Vorsitz in einer künftigen Atomkommission müsse er, unbeschadet der Federführung des Wirtschaftsministeriums in »Einzelfragen«, sich selbst vorbehalten, da »die Bildung einer deutschen Kernenergie-Kommission« nicht nur – wie von Erhard betont – »wirtschaftliche(r) Natur« sei, sondern »auch eine Angelegenheit von großer politischer Tragweite« darstelle, die »in der ganzen Welt Widerhall finden« werde. Adenauer ließ Heisenberg eine Durchschrift des Schreibens zukommen. Wenn Heisenberg jedoch – wie nach seinen weiteren Plänen zu vermuten – daraus schloss, Adenauer wolle der Angelegenheit höchste politische Priorität geben und der Atomkommission ein Stück von seiner Richtlinienkompetenz abtreten, hatte er den Bundeskanzler gründlich missverstanden und sollte dies noch zu seiner bitteren Enttäuschung erfahren.
Was konnte Adenauer dazu veranlassen, den Vorsitz in der Atomkommission zunächst sich selber vorzubehalten? Deutlich ist sein Bestreben, zu verhindern, dass das Wirtschaftsministerium diesen neuen Bereich für sich in Beschlag nahm; man kann ebenfalls voraussetzen, dass Adenauer die Angelegenheit damals überwiegend unter militärpolitischem Aspekt und im Zusammenhang mit der EVG betrachtete. Wenn er die Kerntechnik vorwiegend als Sache der Wissenschafts- und Wirtschafts- beziehungsweise Energiepolitik gesehen hätte, hätte er schwerlich daran gedacht, sich dort persönlich einzuschalten. Das Wirtschaftsministerium suchte jedoch mit eindringlichen Vorstellungen nicht zuletzt verfassungsrechtlicher Art, den Bundeskanzler von dem Gedanken an den Vorsitz in der Atomkommission wieder abzubringen; 1955 bei der Gründung der Atomkommission war von diesem Plan keine Rede mehr. Aber auch das Wirtschaftsministerium musste auf den Großteil seiner atomtechnischen Kompetenzen verzichten. Die Herauslösung dieses Bereichs aus dem Wirtschaftsressort war insofern folgenreich, als die kerntechnische Entwicklung damit von der Energiepolitik abgekoppelt wurde.
Eine scharfe Kontroverse, deren Folgen noch geraume Zeit nachwirkten, entstand bezüglich der Frage der Standortwahl für das Reaktorzentrum. Heisenberg engagierte sich vehement für den Standort München, wo der Reaktor in Verbindung mit dem Max-Planck-Institut für Physik stehen sollte, dem neuen Sammelpunkt der Heisenberg-Gruppe. Adenauer dagegen, der sich hier die Entscheidung vorbehielt, verfuhr hinhaltend und mahnte den auf eine Entscheidung drängenden Heisenberg, alle öffentlichen Erörterungen der Sache zu unterlassen. Der aufbrechende Konflikt machte dennoch Schlagzeilen in der Presse. Heisenberg hatte die Klärung der Standortfrage schon 1953 herbeiführen wollen; jedoch erst im Juli 1955, nach dem Inkrafttreten der Pariser Verträge und der Konferenz von Messina, fiel die Entscheidung des Bundeskanzlers: nicht für München, sondern für Karlsruhe. München sollte dafür das »Atom-Ei« bekommen; die Initiative von Maier-Leibnitz hatte sich mit Heisenbergs Bemühungen überkreuzt. Franz-Josef Strauß charakterisierte als Atomminister intern das Gerangel um den Standort als Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel zwischen Bonn, München und Baden-Württemberg.
Heisenberg empfand den Standortentscheid als persönlichen Affront und hielt sich in der Folge nicht mehr von öffentlicher Kritik an der Bundesregierung zurück. Als Erstes zog er seine Zusage, die Bundesrepublik auf der unmittelbar darauf tagenden Genfer Atomkonferenz zu vertreten, wieder zurück, was die Selbstausschaltung aus einem wegweisenden Ereignis der Kernenergiegeschichte bedeutete. Einige Zeit bemühte er sich, München doch noch zum Zentrum der Reaktorforschung zu machen; Hahn schlug mit unüberhörbarem Sarkasmus in der Atomkommission als »Kompromiss« vor, man solle »sowohl in Karlsruhe bauen als auch für Herrn Professor Heisenberg einen Reaktor in München vorsehen«. Heisenberg hielt jedoch aus Mangel an deutschen Fachkräften eine gleichzeitige Reaktorentwicklung an mehreren Orten für unmöglich: »Wenn also die Entwicklung in Karlsruhe stattfindet, so kann sie nicht in München, nicht in Köln und nicht in Hamburg stattfinden.« Das bedeutete auch eine Abfuhr für die nordrhein-westfälischen Pläne, die zur Kernforschungsanlage Jülich führten, und für die Hamburger Schiffsreaktorentwicklung: eine vergrätzte Reaktion, durch die sich Heisenberg politisch isolierte.
Der damalige Atomminister Strauß verriet zur gleichen Zeit der neuen Atomkommission, Heisenberg habe ihm mit professoraler Primadonna-Allüre gedroht: »Werde Karlsruhe gewählt, so wolle er in seinem Leben nichts mehr mit Reaktoren zu tun haben.« Es blieb bei Karlsruhe und Heisenberg zog sich tatsächlich aus der Reaktorforschung zurück. Dafür hatte er maßgebenden Anteil an der Gründung des Instituts für Plasmaphysik (IPP), das in Garching bei München entstand, jedoch ohne Zusammenhang mit dem unmittelbar daneben liegenden »Atom-Ei«!
Wie Heisenberg in seinen Memoiren durchblicken lässt, wuchsen in ihm als Folge der Adenauerschen Entscheidung für Karlsruhe die Bedenken, ob die letzten Ziele der Bundesregierung bei der Entwicklung der Kerntechnik wirklich friedlicher Art seien. Ende 1952 hatte er noch die Bedenken eines pazifistischen Arztes gegen eine im Schlepptau des EVG-Vertrages vorangetriebene Atomforschung ziemlich brüsk als unqualifiziert zurückgewiesen und sich für das Konzept einer Atomkommission stark gemacht, die zuoberst das Vertrauen des In- und Auslandes in die Friedlichkeit der bundesdeutschen Atompolitik zu erbringen habe; als die Reaktorentwicklung jedoch mit dem Standort Karlsruhe in räumliche Distanz zu ihm rückte, hörte er auf, sich mit ihr zu identifizieren. Der Wunschtraum, dass an der Spitze der Atomforschung eine Elite von Gelehrten stehen solle, war zerstört; die Karlsruher Personalpolitik musste ihn mit Misstrauen erfüllen. Der Heisenberg-Schüler Wirtz wurde in Karlsruhe zunehmend isoliert.
Heisenbergs Unzufriedenheit mit dem aus seiner Sicht viel zu langsamen Tempo der Atompolitik drang bald an die Öffentlichkeit. Schon Ende 1954 war er aus Protest gegen die »Verschleppung der Entscheidungen über den Reaktorbau« aus dem atompolitischen Planungsausschuss des Wirtschaftsministeriums ausgetreten und hatte sich aus dem gleichen Grunde von der damals zur Vorbereitung des Reaktorbaus gegründeten »Physikalischen Studien-Gesellschaft« ferngehalten. In der Zeit der Genfer Atomkonferenz kritisierte er in einer für internen Gebrauch der Max-Planck-Gesellschaft bestimmten »Analyse der gegenwärtigen Atompolitik der Bundesregierung«: Diese Politik gehe im Gegensatz zu der »Atompolitik fast aller anderen Länder davon aus, dass die deutsche Teilnahme an der Atomtechnik nicht besonders dringend sei und es nichts schade, wenn der große Vorsprung des Auslandes sich vorerst noch weiter vergrößere, wogegen eine zu rasche Beteiligung Deutschlands an der Atomenergieverwertung außenpolitisch vielleicht Misstrauen erzeugen könnte und daher zu vermeiden ist.«
Heisenberg zeigte sich durch den Bericht eines von der Bundesregierung nach Genf entsandten Beobachters alarmiert, der unter der Schlagzeile »Lehren aus Genf für die Bundesrepublik« eher nüchterne und vor Übereilung warnende Folgerungen zog und ganz richtig darauf hinwies, dass – wie Genf »deutlich bestätigt« habe – »man zur Zeit nirgendwo in der Welt ein mit Atomenergie betriebenes Kraftwerk mit bestimmten Lieferbedingungen und -fristen bestellen und kaufen kann« und man nicht glauben solle, »dass nun etwa ein neuer Wirtschaftszweig entsteht, dass also eine Art Atomwirtschaft in Bildung begriffen ist«. Die sich abzeichnende Gefahr einer Unterreaktion der Bundesregierung auf Genf versetzte Heisenberg in Erregung; für ihn war längst die Zeit für die Errichtung einer deutschen »Atombehörde« und Verabschiedung eines Atomgesetzes gekommen.
Vor allem Heisenberg bewirkte, dass damals bei der SPD und anderen oppositionellen Kreisen der Eindruck entstand, als sei an der Atompolitik der Bundesrepublik vor allem die Langsamkeit zu kritisieren. Der nordrhein-westfälische Staatssekretär Leo Brandt erwähnte 1956 in seiner programmatischen Rede zur »zweiten industriellen Revolution« auf dem Münchener Parteitag der SPD, »einer der größten deutschen Wissenschaftler dieses Jahrhunderts« habe ihm kürzlich gesagt: »Seien Sie nicht optimistisch, wir werden es nicht mehr schaffen.« Dieser »große deutsche Wissenschaftler« habe sich »fünf Jahre lang mit seinen Warnungen wundgestoßen«. Kein Zweifel, er sprach von Heisenberg. Mit ähnlichen Äußerungen brachte Leo Brandt zur selben Zeit in der Atomkommission den Atomminister Strauß in Bedrängnis und dieser suchte seinerseits Heisenberg davon abzuhalten, »Misstrauen und Gegensätze in die Atomkommission hereinzutragen«.
Wissenschaft oder Wirtschaft als Ursprung der Atompolitik?
Kann man aus der Rolle Heisenbergs und anderer Atomphysiker in der Frühzeit der bundesdeutschen Kernenergieentwicklung generell folgern, dass der Ursprung der Bonner Atompolitik in der Wissenschaft liegt? Oder ist es bedeutsamer, dass die 1954 zur Vorbereitung des Reaktorbaus gegründete »Physikalische Studiengesellschaft« – die Bezeichnung war mehr ein Deckname – bereits eine ganze Galerie großer Namen der Industrie umfasste? Aber die bloße Mitgliedschaft in der Studiengesellschaft reicht als Indiz für ein echtes Interesse an der Kerntechnik nicht aus.
Ein ernsthaftes Engagement für die Kernenergie gab es – aus der Rückschau überraschend – am frühesten in Kreisen der Chemie, namentlich bei den Farbwerken Hoechst. Diese beschäftigten sich schon im Frühjahr 1954 als mögliche Schwerwasserproduzenten mit Vorbereitungen für den Reaktorbau, wobei dieses Interesse freilich, wie wir sehen werden, auf irrtümlichen Voraussetzungen beruhte. Der Hoechst-Chef Winnacker, in der Folge das Aushängeschild der entstehenden Atomwirtschaft, nahm als Vertreter der Studiengesellschaft an der Genfer Atomkonferenz teil, war allerdings mangels eigener Kompetenz, wie er gestand, darauf angewiesen, sich »im wissenschaftlichen Ruhm Hahns (zu) sonnen« – der jedoch von Reaktoren auch nicht viel verstand.
Selbst die Genfer Konferenz, die von den Beteiligten später in euphorischem Ton als Sternstunde der friedlichen Kerntechnik geschildert zu werden pflegte, stimmte Winnacker hinsichtlich der deutschen Chancen zunächst nicht sehr optimistisch. Ein industrielles Kernenergieinteresse hat sich offenbar erst danach, nicht zuletzt durch die von der Bundesregierung eingesetzte Atomkommission, formiert. Anfang 1953 hatte der Geologe Kirchheimer von der maßgeblichen Beteiligung der Wirtschaft an der künftigen Atomkommission sogar nur eine blockierende Wirkung befürchtet! Im Herbst 1954 gab es im Planungsausschuss »erhebliche Meinungsdifferenzen« zwischen Heisenberg und dem Chef der Industrie-Kreditbank, der dem Ausschuss vorsaß, die zu Heisenbergs Austritt führten und vermutlich auch seinen Argwohn weckten, bei der Verschleppung des Standortentscheides und der schließlich gegen München ausfallenden Wahl habe die Wirtschaft ihre Hand im Spiel gehabt.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Bechert, Ordinarius für theoretische Physik und 1962–1965 Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Atomkernenergie, äußerte 1960 in einem Vortrag auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer Frankfurts: Wenn man »viel zu früh mit dem Bau von Atomreaktoren begonnen habe«, so habe das seinen Grund: »Die geschäftstüchtigen Konzernherrn seien von der Wissenschaft überfahren worden und ständen nun ein wenig hilflos da.« Wenn man liest, dass Heisenberg Ende 1952 in einem Rundfunkvortrag verkündete – so jedenfalls verstand ihn eine Chemie-Korrespondenz –, dass »in absehbarer Zeit ein Großteil der Industrie Atomindustrie sein werde«, und dass 1955 der einflussreiche Nationalökonom Edgar Salin mit seiner suggestiven Rhetorik versicherte, dass es sich bei der Atomkraft »um die Wirklichkeit von morgen« handele und »infolgedessen schon heute die gesamten Groß- und Kleinbetriebe der Versorgungswirtschaft, der Kohlen- und Stahlindustrie, der Chemie usw. ihre langfristigen Pläne und Investitionen auf diese neue Situation ausrichten und einstellen sollten«, erscheint Becherts Behauptung nicht übertrieben.
Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Fritz Berg, von Haus aus ein Fahrradspeichen- und Matratzenfeder-Fabrikant, wollte zu jener Zeit von der Idee einer »zweiten industriellen Revolution« durch Atomenergie und Automation nichts wissen; das war zu jener Zeit eher ein Schlagwort der Linken. Selbst der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zeigte bis 1955 nur wenig Interesse an der Kerntechnik. Nicht ohne Grund erkannte Karl Jaroschek später aus der Sicht des Ingenieurs am Anfang der kerntechnischen Entwicklung eine »journalistische« und eine »naiv-physikalische Phase«, beide Phasen von Ingenieurserfahrung unbeleckt!
Die Atomphysik spielte in der Anfangszeit der Reaktorentwicklung eine viel größere Rolle als später; und doch war stets klar, dass der Reaktorbau vor allem eine Angelegenheit der Technik, nicht der Physik war. Die amerikanischen Erfahrungen der Nachkriegszeit, als die zivile Kerntechnik viele Jahre lang kaum vorankam, bewiesen eindrücklich, dass Physiker zwar zur Konstruktion einer Bombe, aber nicht zum Bau eines industriell brauchbaren Reaktors in der Lage waren. Dass der weitere Fortschritt des Reaktorbaus von der Lösung technischer Probleme abhing, musste auch Heisenberg schon 1953 zugeben, wenn er auch darauf beharrte, den »engsten Kontakt« mit der Max-Planck-Gesellschaft als »beste Gewähr für eine naturgemäße Entwicklung der Reaktorstation« zu empfehlen.
Unter Heisenbergs Einfluss entschied sich der Planungsausschuss 1954 zunächst für den Bau eines Kleinreaktors im Rahmen der vom EVG-Vertrag zugelassenen Größenordnung von 1,5 MW. Heisenberg war damals der Auffassung, nur solche Kleinreaktoren könnten in Forschungszentren gebaut werden, während »Großreaktoren« von 50 MW und mehr »ziemlich weit von jeder größeren Siedlung entfernt auf einem großen freien Gelände errichtet werden« müssten. Reaktoren von dieser geringen Kapazität waren jedoch industriell uninteressant; bereits der erste Karlsruher Forschungsreaktor (FR 2) war für eine Kapazität von 12 MW konstruiert und es folgte der »Mehrzweck-Forschungsreaktor« (MZFR) von 50 MW: trotz Heisenbergs Warnung unmittelbar im Kernforschungszentrum!
Dennoch ginge die Annahme zu weit, Heisenberg hätte die Interessen der Wissenschaft schlechthin gegenüber denen der Wirtschaft repräsentiert: Eher versuchte er, Interessen der Wirtschaft zu antizipieren, und das durchaus nicht unter allgemeinem Beifall der akademischen Zunft. Heisenberg und Wirtz entsprachen mit ihrem Bestreben, die Projektierung des Reaktors innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft zu halten, den Wünschen »verschiedener Industrieller«, während viele Wissenschaftler den Reaktorbau gerne ganz der Industrie überlassen hätten. Haxels Empfehlung, das Reaktorzentrum der Industrie zu unterstellen, war von der Sorge um die Aufrechterhaltung der bisherigen atomphysikalischen Forschung an den Hochschulen bestimmt und diese Sorge wurde von vielen Kollegen geteilt. Staatliche Organisation und projektgebundene Zusammenarbeit mit der Industrie empfand das Gros der Wissenschaftler als Bedrohung der akademischen Freiheit.
Schon Anfang der 1950er-Jahre war Heisenberg als Präsident des neu gegründeten Forschungsrates in seinem Bestreben, die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Staat zu intensivieren, heftig mit der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft kollidiert, die die Abschirmung der Wissenschaft gegen politische Einflüsse verfocht, wobei sich beide Seiten auf ihre Art und mit konträren Folgerungen auf die Erfahrungen der NS-Zeit beriefen. Heisenberg verkörperte bei seinem atompolitischen Engagement kein kollektives Interesse der Wissenschaft; zur Schlüsselfigur wurde er in der nuklearen Frühzeit durch sein Geschick, zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu vermitteln – zu »vernetzen«, um im heutigen Jargon zu reden. Das Zusammenwirken dieser drei Bereiche erfolgte schließlich jedoch auf eine eher planlose Art.
Das Erbe des Zweiten Weltkriegs:Schwerwasserreaktor und Uranzentrifuge