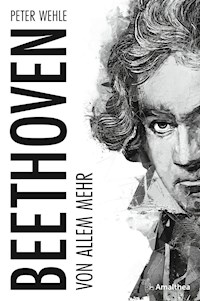Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hofrat Halb
- Sprache: Deutsch
Hofrat Magister Ludwig Halb will nur eines - endlich seine geliebte Delia heiraten! Als Leiter des »Referats 3.2.1 - Gewaltkriminalität« muss er sich trotz des privaten Glücks intensiv mit mysteriösen Raubritterüberfällen im Wienerwald beschäftigen. Die Vorfälle spitzen sich zu, bis ein erster Mord geschieht und Halb um das Leben seiner Angebeteten kämpfen muss. Zusammen mit seinem Team, das mit ihm durchs Feuer geht, erkennt Halb dank seines scharfen Verstandes gerade noch rechtzeitig die Dramaturgie der Ereignisse. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wehle
Auge um Auge, Mord um Mord
Wien-Krimi
Zum Buch
Mord hoch zu Ross Ein Ritterüberfall mit Helmen, Schilden und in Harnischen, mit Lanzen und Schwertern? Im Wienerwald des 21. Jahrhunderts, nur wenige Kilometer südlich der Bundeshauptstadt? Da auch Hofrat Magister Ludwig Halb und seine Angebetete Delia beinahe von diesen Raubrittergesellen überfallen worden wären, beginnen der Leiter des »Referats 3.2.1 – Gewaltkriminalität« im österreichischen Bundeskriminalamt und sein Team zu ermitteln. Weitere »Raubrittereien« folgen, es kommt zu einem ersten Mord. Rösser und Reiter wirken immer mysteriöser, erscheinen aus dem Nichts und lösen sich nach ihren Taten in Luft auf. Endlich erkennt Hofrat Halb den Bühnencharakter der Überfälle. Dass aber die »Aufführung« noch nicht zu Ende ist, begreift Halb erst, als Delia verschwindet. Noch einmal muss er seine, aber auch Delias Vergangenheit Silbe um Silbe durchgehen, um seine persönliche Hölle zu verhindern.
Peter Wehle, der Sohn des Autors und Komponisten DDr. Peter Wehle, stand von seinem fünften Lebensjahr an auf verschiedenen Konzertbühnen. Daneben war er in zahlreichen Radio- und Fernsehaufnahmen zu hören und zu sehen. Seit einigen Jahren widmet sich der promovierte Musikwissenschaftler und klinische Psychologe neben seiner Arbeit in der Erwachsenenpsychiatrie dem Schreiben. Dabei blickt er zum einen auf das Leben von berühmten Komponisten (Mozart, Haydn, Mahler und Beethoven), zum anderen spinnt er in seinen Kriminalromanen spannende Geschichten rund um die Figur des Wiener Kriminalisten Hofrat Halb.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
info@gmeiner-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Anja Kästle
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Hola53 / AdobeStock und mozZz / AdobeStock
ISBN 978-3-8392-7316-6
Sonntag, 1. Juni 2014, 15 Uhr
»Würde dir vorgestern in zwei Wochen passen?«
»Das wäre der …?«
Kaum, dass Ludwig Halb in seinem Kalender blätterte, begann er zu grinsen. »Der 13.«
»Willst du unsere Ehe an einem Freitag, den 13., beginnen lassen?«
»Egal, wann, Hauptsache, wir heiraten!«
»Oh, Ludwig, ich …« Inzwischen hatte Halb erlernt, Delias spontane Gefühlsäußerungen vorherzusehen, sodass ihre stürmische Umarmung ihn weder körperlich noch seelisch ins Wanken brachte. Und hier, in der Einsamkeit eines lieblichen Waldwegs rund 40 Kilometer von der Wiener Innenstadt entfernt, war sie ihm auch nicht unangenehm oder gar peinlich.
»Und, nehmen wir Freitag, den 13.?«
»Leider nein. Natürlich nicht wegen irgendeines Aberglaubens.«
»Natürlich nicht.« Halb bemühte sich, seine Stimme nicht allzu ironisch klingen zu lassen.
»Wirklich nicht. Aber mein Seminar …«
»Das, bei dem du etwas lernst, oder das, bei dem du lehrst?«
»Zweiteres. Ersteres ist eine Woche später.«
»Ich fasse zusammen: Nächste Woche habe ich keine Zeit, danach bist du zwei Wochen blockiert. Ich seh schon, bis wir einen gemeinsamen Hochzeitstermin finden, bin ich …«
»Ja?«
»… viel zu alt für eine strahlende junge Frau wie dich!«
Mit einem Lachen, in dem die Unbeschwertheit einer 18-Jährigen mit der Reife einer Enddreißigerin verschmolz, hängte sich Delia Schoitelmüller wieder bei ihm ein. »Dann werden wir weiterhin nur eine wilde Ehe führen und uns das Ja-Wort erst auf unseren Sterbebetten geben, weil …«
»Weil?«
»… weil wir dann endgültig keine Termine mehr haben werden.«
Halb schüttelte den Kopf. »Doch! Mit dem Notar, möglichen Erbschleichern, echten Erben, der Druckerei unserer Todesanzeigen, der Blumenhandlung für den Begräbnisschmuck, einem Grabkranzdesigner und einem Gedenkfeiermusikplaner, den Priester nicht zu vergessen.«
»Ludwig Halb, du bist ein Spielverderber! Aber gut, solltest du Recht haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als vorher einen Hochzeitstermin zu finden, zu heiraten und irrtümlich bereits im Diesseits offiziell miteinander glücklich zu werden.«
Der Duft des Waldes, die Ruhe, die Gleichmäßigkeit ihrer Schritte und Delias Nähe ließen ihn in einen ungewohnten Zustand verfallen – eine Mischung aus Glücksgefühl und Tagtraum, wenngleich mit einer ungewohnten Schärfe mancher Erinnerungen. Das erste Treffen mit Delia, damals war er noch ein junger Polizist bei der »Sitte« gewesen und sie auf der anderen Seite des Gesetzes. Aber bald hatte sich ihr Lebensweg in eine Passstraße verwandelt, Kurve um Kurve entfernte sie sich – auch dank seiner Hilfe – von ihrem alten Milieu und stieg zu einer anerkannten Bankfachfrau auf, die nichts mehr als den Blick in die Schluchten ihrer Vergangenheit fürchtete. Sein Weg hingegen hatte dem Betonband einer amerikanischen »Interstate« geähnelt. Beinahe linear war er vom kleinen Polizisten und Nebenbei-Studenten zum absolvierten Juristen und Chef einer Ermittlergruppe aufgestiegen, bevor er die Leitung des »Referat 3.2.1 – Gewaltkriminalität« im österreichischen Bundeskriminalamt übernommen hatte. Quasi als »Karriere-Dekor« war er zum Hofrat ernannt worden, eine Position, die Halb ihrer scheinbaren altmodischen Steifheit wegen zeitweise gerne unter den Tisch fallen ließ. Aber trotz ihrer beider höchst unterschiedlichen Lebenswege war das Band, das sie seit ihrer ersten Verhaftung verbunden hatte, nie ganz abgerissen. Und vor einem Jahr …
»Ludwig?«
Halb war abrupt stehen geblieben, hatte die Augen geschlossen und hielt seinen Kopf schief. Nach einigen Sekunden fiel die Spannung sichtbar von ihm ab.
»Ich dachte, hinter uns … also, ein Geräusch, das …«
»Meinst du das Wiehern? Was ist damit?«
»Delia, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich leide an einer Hippophobie.« Halbs verlegener Gesichtsausdruck ließ seine Zukünftige automatisch lächeln.
»Tatsächlich, du hast Angst vor Pferden? Das ändert natürlich … gar nichts, ich kann die Viecher auch nicht leiden. Umso besser, dass – sie entfernen sich von uns. Links die Hügel hinauf, glaube ich.«
»Das beruhigt mich doppelt. Also, dass auch du, und dass die … … weg von uns. Wollen wir vielleicht hier entlang weiterspazieren?«
Mit etwas zu raschen Schritten gingen sie weiter, aber da nur mehr das Pfeifen der Theresiental-Ausflugsbahn an ihre Ohren drang, löste sich ihre Anspannung, noch bevor sie das idyllische Ausflugs-Kaffeehaus »Zur geselligen Einschicht« erreicht hatten.
Sonntag, 1. Juni 2014, 15.10 Uhr
»Mathilde, selbst du musst zugeben, dass die heutige Jugend …«
»Mein lieber René, gar nichts muss ich, schon gar nicht gegenüber einem so eklatant konservativen …« Wie jeden Sonntagnachmittag begannen Mathilde Berthner-Přihoda und René Koskovicz auf ihrem wöchentlichen Spaziergang zu streiten. Und ebenfalls wie jeden Sonntagnachmittag wussten deren »bessere Hälften« Leopold Berthner und Amelie Koskovicz nicht, ob sie lieber im Erdboden versinken oder vermitteln sollten. Aber da diese Diskussionen ein lieb gewordenes Ritual waren, das jedes Mal mit einem ebenso köstlichen wie versöhnlichen späten Mittagessen im »Schloßrestaurant im Burghof« belohnt wurde, trafen sich beide Paare Sonntag für Sonntag am Anfang des Theresientals, um eben ihrem wöchentlichen »Disputations-Spazier-Mahl« zu frönen.
»Aber …«
»Nix aber, du liegst wie immer völlig fal…«
»Deus lo vult!« Das Gebrüll wirkte umso barbarischer, da es aus dem Nichts kam. Was folgte, war so irreal, dass noch Tage später kaum jemand den Schilderungen der beiden Ehepaare nur den geringsten Glauben schenkte. »Ritter! Allen Ernstes, es waren Ritter, die aus dem Gebüsch um uns herausbrachen! Wie man sie aus den guten alten Filmen kennt. Hoch zu Ross, sieben an der Zahl. Und sie waren einfach plötzlich da. Wie aus dem Nichts! Natürlich waren sie furchterregend, aber irgendwie auch imposant.« Die Rüstungen hätten mit den Rossharnischen um die Wette geglänzt, die Pferdedecken und Überwürfe in strahlendem Blau, Rot und Gelb geleuchtet. Und in Schwarz – dieser Reiter habe mit einer Bewegung seines rechten Panzerhandschuhs den wilden Haufen zum Schweigen gebracht. Daraufhin hätten sich sieben Schwerter auf ihre Kehlen gerichtet, in den anderen Händen hätten zwei der Ritter einen Streitkolben, zwei eine Armbrust, einer eine Axt und einer eine Lanze mit einem daran befestigten Lederbeutel gehalten. Nur der schwarze Befehlshaber habe als einzige Waffe ein Schwert geführt, mit dem er akrobatisch umgegangen sei. Dessen fließende Bewegungen hätten bedrohliche Gesten und unmissverständliche Signale vereint. Und seine Stimme, die sei »aus den Tiefen der Hölle« gekommen – zumindest, wenn man Amelie Koskovicz’ Aussage glaubte. Laut dem Ehepaar Berthner-Přihoda hingegen habe sie »nach dem Blechdosen-Monster aus einer Kinderfernsehserie« geklungen. Aber die Kommandos »Geld, Schmuck, Uhr, schnell!« seien trotz des Vollvisier-Helms für sie vier deutlich zu verstehen gewesen. Sie beide und Frau Koskovicz hätten sofort die geforderten Wertsachen in den Beutel getan, nur »der René, mein Gott, wie kann man nur so geizig, dabei so schreckhaft sein« – Herr Koskovicz habe seine teure Armbanduhr nicht herausrücken wollen. Als aber der Ritter mit der Axt auf sein Handgelenk gedeutet und sie erhoben habe, habe René plötzlich geröchelt, und dann sei er bereits am Boden gelegen. Sofort seien die Ritter verschwunden, beinahe wie vom Erdboden verschluckt. Sie hätten gleich die Rettung verständigt, René sei mit einem Hubschrauber ins nächste Schwerpunktkrankenhaus geflogen worden. Nein, die Polizei sei erst viel später gekommen, da seien sie schon längst wieder bei ihren Autos am Theresiental-Parkplatz gewesen. Nein, sie hätten nicht den Eindruck gehabt, dass ihnen die zwei jungen Polizisten auch nur ein Wort geglaubt hätten, auf die hätten sie wohl wie »die Ausflugsgruppe einer Demenz-Wohnstätte« gewirkt.
Montag, 2. Juni 2014, 8.55 Uhr
»Geh, erzähl keinen Blödsinn! Mit Schwertern und Helmen und Lanzen und der ganzen Hollywood-Kostümierung? Hoch zu Rössern? Ritter Balduin der Schreckliche gegen Hugo den Verwerflichen?«
»Nein, eben nicht gegeneinander, sondern gemeinsam! Gemeinsam gegen diese vier alten Leute, die …«
»Erstens heißt das ›ältere Herrschaften‹ und zweitens von welchem schrecklich verwerflichen Hugo Balduin redet ihr? Und drittens guten Morgen.« Als Halb die Räume des »Referat 3.2.1 – Gewaltkriminalität« betrat, verstummte der allmontägliche Informationsaustausch von Selbsterlebtem und Polizeimeldungen.
»Guten Morgen, Chef! Nach Jahrhunderten sind wieder bewaffnete Ritter unter uns, sie stehen vor den Toren der Stadt und überfallen wehrlose alte Leu… also ältere Herrschaften. Hier, lies.« Grinsend hielt ihm Franz Haschek die Pressemeldung hin.
»Sieben Raubritter, vier Opfer, ein Herzinfarkt. Wo und wann? Jessas, das darf nicht wahr sein, das Wiehern, das waren die!« Halbs Gesicht wurde blass. »Allein der Gedanke, die hätten Delia und mich statt der zwei Ehepaare überfallen. Sieben Pferde! Nix wär’s mit heldenhafter Verteidigung gewesen, den Herzinfarkt, den hätte ich bekommen, und zwar sofort.« Eine Sekunde lang schien Halb noch dessen Nachwehen zu spüren, bevor ein Ruck durch ihn ging. »Den Überfall nehme ich persönlich! Um den kümmern wir uns. Obwohl es keinen Toten gegeben hat. Besprechung in zehn Minuten. Nein, lieber erst um halb zehn, damit uns auch der ›Ingeniöhr‹ die Ehre gibt.«
Montag, 2. Juni 2014, 9.30 Uhr
»Noch einmal guten Morgen.« Als Halb den Blick über sein Team schweifen ließ, musste er lächeln. Er hätte nie gedacht, dass manche ihrer Charakterzüge so deutlich an ihren Sitzhaltungen abzulesen wären.
Zu seiner Linken saß Magistra Verena Planner mit geradem, aber nicht militärisch durchgestrecktem Rücken. Die studierte Pharmazeutin hatte sich im Laufe der Jahre als wandelnde Vernunft gezeigt, die aber auch mit gefühlsbetonten Situationen glänzend umzugehen verstand.
Daneben hatte es sich Franz Haschek zwischen Tischplatte und Rückenlehne bequem gemacht. Schwejk – seinen Spitznamen verdankte er seiner tschechischen Herkunft, der Namensgleichheit mit dem Autor Jaroslav Hašek wie einiger Eigenschaften, die er sich mit Hašeks »bravem Soldaten Schwejk« teilte – nahm auch im Leben häufig eine schlampige Position ein, die es ihm erlaubte, rasch die Seiten zu wechseln. Meist nützte er diese geistige »Beweglichkeit« vor allem in der Auslegung enger Vorschriften, wenn diese seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn widersprachen.
Rechts von Halb saß Anton Wilt … und das war alles, was zu Tonis Sitzhaltung zu sagen war. Vom Typ her völlig unauffällig, ermittelte er unaufgeregt und effizient bis zum Ende eines Falles.
Schwejk gegenüber kauerte der »Ingeniöhr«. Ingenieur Perikles Mayer liebte lange Nächte, die er wechselweise an seinen Computern oder mit seinen jeweiligen Angebeteten verbrachte. Entsprechend war er vor den frühen Nachmittagsstunden kaum zu gebrauchen, weshalb er für die meisten Morgenbesprechungen eine »Generalamnestie« – O-Ton Halb – genoss.
An der zweiten Stirnseite des Besprechungstisches thronte Helene Drobatschnig. Egal, wo Helli saß, vermittelte sie den Eindruck einer Herrscherin, was auch an ihren 187 Zentimetern Körpergröße und ihrem – laut eigener Definition – »Kampfgewicht von knapp unter … auf jeden Fall zu vielen Kilogramm« lag. Die leidenschaftliche Mehrfach-Mutter und Ehefrau eines Rechtsanwalts hielt Halb und seinem Team den »bürokratischen Rücken« frei. Als Herrin über die Aktenzahlen und internationalen Termine diverser Inter- und Europol-Ausschüsse lehrte sie sogar Hofrat Doktor Ernst Straka das Fürchten – und das sollte etwas heißen.
Denn er, der heute ausnahmsweise durch Abwesenheit glänzte, war als Leiter des »Büro 3.2. – Allgemeine Kriminalität« der uneingeschränkte Herrscher über alle und alles im »Referat 3.2.1 – Gewaltkriminalität«, zumindest seiner Meinung nach. Halb überlegte nur kurz, welche Körperhaltung Straka eingenommen hätte. Keine sitzende – zumindest wäre er nicht länger sitzen geblieben, sondern nach maximal zwei Minuten aufgesprungen, um in raumgreifenden Bewegungen seinen Emotionen freien Lauf zu lassen.
»Und, wissen wir inzwischen mehr über diesen Raubritter-Überfall?« Halb bemühte sich, alle anzusehen und seinen Blick nicht nur auf dem beinahe schlafenden Ingeniöhr ruhen zu lassen.
»Etwas mehr. Ich habe inzwischen mit den Kollegen telefoniert, die als Erste vor Ort waren. Aber vorher würden wir alle gerne wissen, was du vorhin gemeint hast mit Wiehern, heldenhafter Verteidigung und Herzinfarkt?« Demonstrativ ließ Wilt seine Hände auf dem Blatt Papier vor ihm liegen.
»Toni, das erfüllt fast den Tatbestand der Erpressung mit und von Informationen. Aber gut! Gestern Nachmittag waren Delia und ich im Theresiental spazieren. Und, Achtung, jetzt kommt eine kleine Sensation! Ihr kennt mich wahrlich lange und gut, aber was ihr noch nicht wisst, ist, dass wir beschlossen haben, also, Delia und ich beschlossen haben, zu … zu gestehen, dass ich an einer Hippophobie leide. Und weil ich mich eben vor Pferden fürchte, sind wir rasch wegspaziert, als wir gestern – wenngleich in einiger Entfernung – Wiehern gehört haben. Vielleicht war das aber unsere, vor allem meine Rettung, weil wenn diese sieben sechsbeinigen Kostümhelden uns statt … Toni, wie heißen die Opfer?«
»Berthner-Přihoda und Koskovicz.«
»Also statt diesen Herrschaften Delia und mich überfallen hätten, säße jetzt hier vor euch bereits ein neuer interimistischer Leiter. Mein Posten würde nächste Woche neu ausgeschrieben werden, und ihr müsstet übernächste Woche wohl oder übel bei meinem Begräbnis Spalier stehen. Mit anderen Worten, ihr würdet mindestens zwei Wochen keinen Handgriff arbeiten. Und weil ich das nicht verantworten kann, bin ich zum einen noch am Leben und fühle mich zum anderen verpflichtet, diese verkleideten Vollidioten zu verhaften. Wobei – natürlich werdet ihr sie verhaften, weil ich mich nicht in ihre Nähe traue. Zumindest nicht, solange sie auf ihren hohen Rössern hocken. So, und jetzt bist du dran, Toni.«
Halbs Pseudo-Outing und seine Selbstironie hatten sogar den Ingeniöhr geweckt, sodass nun alle Anton Wilt interessiert zuhörten.
»Wie erwähnt kam es gestern gegen 15.15 Uhr im Theresiental zu einem skurrilen Überfall auf zwei ältere Ehepaare. Leopold Berthner und seine Frau Mathilde Berthner-Přihoda, 74 und 75 Jahre alt, haben ihr ganzes Berufsleben als Ärzte in verschiedenen Wiener Spitälern gearbeitet. René Koskovicz, ebenfalls 74, stand im diplomatischen Dienst der Republik Österreich, seine Frau Amelie, mit ihren 68 die Jüngste des Quartetts, war ihr Leben lang nie berufstätig gewesen. Die Herren Doktor Berthner und Magister Koskovicz haben vor über 50 Jahren in derselben Klasse maturiert und trotz der unterschiedlichen Lebenswege ist die Freundschaft immer erhalten geblieben, weshalb sie in der Pension begonnen haben, sich regelmäßig an Sonntagnachmittagen zu treffen. So auch gestern. Alles war wie immer, bis zu dem denkwürdigen Moment, als sieben Ritter über sie herfielen. Laut übereinstimmenden Aussagen seien diese aus dem Nichts gekommen und wieder dorthin verschwunden. Am Rande bemerkt, dieses ›Nichts‹ war undurchdringliches Gestrüpp entlang des Weges. Ebenfalls laut übereinstimmender Zeugenaussagen seien die Reiter und Pferde bunt gekleidet gewesen, mit Ausnahme des Anführers, eines schwarzen Ritters, der einen – ich zitiere Frau Koskovicz – ›höllenschwarzen Riesenhengst‹ geritten habe. Zu Beginn hätten die Täter ›Deus lo vult‹ geschrien, laut Herrn Koskovicz sei das eine okzitanische Verballhornung eines ursprünglich lateinischen Ausrufs, der um den ersten Kreuzzug Ende des elften Jahrhunderts herum …«
»Toni, wir bewundern die Geschichtskenntnisse von Herrn Magister Koskovicz. Bitte weiter!«
Wilt zögerte kurz, bevor er wieder den roten Faden aufnahm. »Also dieses ›Deus lo vult!‹ beziehungsweise ›Gott will es!‹ dürfte so eine Art akustisches Logo der damaligen Kreuzritter gewesen sein. Heute wird dieses Motto nicht nur verschieden zitiert, es wird auch von sehr unterschiedlichen Gruppierungen verwendet. Für viele ist es schlicht und einfach ein Synonym für die Ritterzeit, Ritterfeste, Ritterburgen, Ritterfilme …«
»… und Ritterüberfälle. Danke für deine umfangreiche Recherche in der kurzen Zeit! Sonst noch relevante Informationen?«
»Durchaus. Wie gesagt, zu Beginn hätten alle dieses ›Deus lo vult!‹ gebrüllt, danach habe lediglich der Anführer mit Zeichen kommuniziert. Ah ja, gesprochen habe er doch noch, wenngleich nur die sehr modernen Worte ›Geld, Schmuck, Uhr, schnell!‹. Die Stimme beziehungsweise die Aussprache sei aber aufgrund der Verzerrung durch den blechernen Helm kaum näher zu beschreiben gewesen, auch diesbezüglich stimmen …«
»Lass uns raten, auch diesbezüglich stimmen die vier Aussagen überein.«
»Stimmt, Chef.« Da Wilt die Ungeduld seines Vorgesetzten seit Jahrzehnten kannte, brachte ihn dieser Zwischenruf nicht aus der Ruhe. »Alle waren mit einem Schwert bewaffnet, wobei die sechs bunten Ritter jeweils noch eine zweite Waffe – Keulen, Streitkolben, Armbrüste und Lanzen – trugen. Und mindestens eine Axt, weil die war schuld an Herrn Koskovicz’ Herzinfarkt.«
»Wegen ihres zu hohen Cholesteringehalts?« Um nicht allzu ironisch zu klingen, schenkte Verena Planner Anton Wilt ihr charmantestes Lächeln.
»Nein, nichts Metabolisches, sondern etwas Diabolisches. Einer der Ritter drohte Herrn Koskovicz, ihm die Hand abzuhacken, woraufhin …« Wilt griff sich an die linke Brust, um sogleich die Augen zu verdrehen und den Kopf theatralisch nach hinten sinken zu lassen.
»Bravo, Toni, welch dramatische Todesszene. Aber wenn ich die Pressemeldung richtig verstanden habe, ist Herr Koskovicz erfreulicherweise noch am Leben. Sonst hätte er uns nicht mit seinem historischen Lateinwissen erfreuen können. Oder …«
»Nein, nein … also, ja, stimmt. Da habe ich wohl etwas übertrieben, Herr Koskovicz hat dank der perfekten Rettungskette überlebt. Im Gegensatz dazu haben sich die Kollegen von der örtlichen Dienststelle nicht mit Ruhm bedeckt. Zuerst hielten sie den Anruf für einen Scherz, und als sie gnädigerweise zum Tatort fuhren, benahmen sie sich gegenüber den drei Opfern vor Ort laut deren Aussagen herablassend und geradezu kindisch. Sie hätten mit ihnen gesprochen, als ob … ich zitiere Frau Doktor Berthner-Přihoda: ›Als ob wir demente Zombies wären.‹«
»Fragt sich nur, wessen Hirnfunktionen eingeschränkt waren.« Halbs Kiefer knirschten hörbar vor Ärger.
»Chef, aber … also entschuldigt bitte, ich will die Kollegen nicht prinzipiell verteidigen. Aber wenn man uns von einem solchen Überfall – Ritter! Heute! Hier quasi um die Ecke! – erzählen würde, würden auch wir die Zeugen für … offen gesagt, für völlig daneben halten. Und bei dem Alter nimmt man eben an, dass …«
»Schwejk, eine Frage.« Halbs Lächeln verhieß nichts Gutes. »Würdest du von Demenzpatienten erwarten, dass sie sich Details merken können?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Wie würdest du dann die beinahe völlig übereinstimmenden Aussagen erklären? Als Zufallstreffer? Als Gruppenhysterie?«
»Du meinst, dass …«
»Natürlich!« Halb schüttelte genervt den Kopf. »Übereinstimmende Aussagen können nur gemacht werden, wenn die Beteiligten etwas tatsächlich erlebt oder aber sich abgesprochen haben. Gut, sie können auch nur glauben, etwas erlebt zu haben, aber auf jeden Fall bedarf es einer Gedächtnisleistung. In der vorliegenden Situation haben die Herrschaften sicher ordentlich Adrenalin ausgeschüttet, das heißt, um sich an die zahlreichen Details zu erinnern, bedarf es vielleicht sogar einer höheren Gedächtnisleistung. Also kann ich nicht automatisch von Demenz ausgehen, nur weil die Zeugen nicht mehr taufrisch sind. Abgesehen von der fehlenden Kinderstube der Kollegen.«
Eine Sekunde lang schien Schwejk noch das letzte Wort haben zu wollen, aber er beließ es bei einem Nicken.
Noch einmal wandte sich Halb Wilt zu. »Toni, zum Schluss lass mich raten. Als die Spurensicherung aufgetaucht ist, hat sie nur in unmittelbarer Nähe des Überfalls zahllose Hufabdrücke entdecken können. Bereits ein paar Meter weiter war der Boden so glatt wie ein gepflegter Babypopo. Daher wissen wir weder woher diese Kostümaffen geritten kamen noch wohin sie geflohen sind. Stimmt’s oder hab ich Recht?« Eine Sekunde lang schien Halb auf Beifall zu warten, aber als seine »Team-linge« keine Miene verzogen, begann er unversehens zu lachen. »Mir scheint, ich bin hier nicht der einzige Fan von Westernfilmen, der die Tricks der Indianer zum Spuren-Verwischen kennt.«
»Aber Chef, das weiß heutzutage jedes Kind! Die letzten Reiter ziehen dichte Äste wie Rechen hinter sich her, und schon sind alle Hufabdrücke und Pferdeäpfel wie von Geisterhand verwischt.« Verena Planner bemühte sich, möglichst belehrend zu klingen.
»Zuletzt reiten sie noch ein paar Kilometer fluss- oder bachaufwärts, um sogar mögliche Suchhunde abzuschütteln. Verena hat Recht, Chef, das alles«, Schwejk unterdrückte ein Gähnen, »lernt jeder spätere Kriminalist bereits in den Windeln.«
»Allerdings sind wir hier weder im Wilden Westen noch bei den Kreuzzügen, weshalb sieben Reiter in Ritterrüstungen irgendwem auffallen müssten. Und daher …«
»… wissen wir, dass sie vor wie nach dem Überfall einen geheimen Ort benötigen, an dem sie sich umziehen und die Ausrüstung verbergen können.«
»Und dieser muss in der Nähe des Tatortes sein, denn einen zu langen Ritt können sie nicht riskieren, um nicht von der Polizei gestellt zu werden.«
»Aber dieses Versteck werden wir wegen der Spurenlosigkeit kaum finden.«
»Ja und nein, Ingeniöhr. Würde es nur als Garderobe und Requisitenkammer dienen, würden wir es nie finden. Aber sie müssen auch ihre Pferde verschwinden lassen, und das stelle ich mir in der heutigen Zeit nicht so einfach vor. Sieben solcher Tiere, erst recht ein höllisch schwarzes Riesenexemplar, kann man nur schwer in einer Parkgarage oder in den Seitengassen rund um den Hauptplatz einfach so stehen lassen, ohne aufzufallen. Daher …«
»… müssen wir als Erstes alle Orte finden, an denen Pferde nicht auffallen. Reiterhöfe, Gestüte, …«
»Oder Schlachthöfe.« Wie meist erzielte Haschek die größte Aufmerksamkeit, wenn er etwas vor sich hin murmelte.
»Schwejk, du … also, manchmal bist du wirklich ein Ekel!« Verena Planners Augen schienen zu klein für ihr Entsetzen.
»Okay, ich entschuldige mich! Also Reiterhöfe, Gestüte und eventuell eine Pferderennbahn.«
»Und das Ganze in einem Tatort-Umkreis von nicht mehr als, sagen wir, zehn Kilometern. Gut, das wär’s, auf zum …«
»Nicht ganz, Herr Hofrat!« Helene Drobatschnig hob ihre Hand wie eine aufmerksame Schülerin, was angesichts ihrer imposanten Erscheinung etwas skurril wirkte. »Da gäbe es noch ein Kriminalisten-Leben abseits unedler Raubritter, ganz besonders in einer Montagmorgen-Dienstbesprechung. Übers Wochenende sind drei Anfragen eingetrudelt. Erstens, die Kollegen vom Suchtgift verzeichnen in letzter Zeit mehrere Attentate auf angeblich friedliche Geschäftsleute, die so harmlos aber nicht sein dürften. Am vergangenen Freitag gab es die erste Tote, eine kleine, feine Autobombe. Die Anschläge fanden zwar alle in Wien statt, aber die Kollegen vermuten, dass dieser Krieg um neue Verteilungsrouten und -räume aus den Bundesländern geführt wird, weshalb wir um Mitarbeit gebeten werden. Zweitens wurden wir von polnischen Kollegen kontaktiert. Der Fall klingt etwas skurril. Weil ein Mann über Nacht die Zahlungen seiner Alimente gestoppt hat, wollte ihn die Polizei aufsuchen und siehe da, er war verschwunden. Daher steht Herr Zbigniew Wojciechowski inzwischen auf der internationalen Fahndungsliste. Und da seine Spur nach Österreich führt und ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden wir angefragt …«
»Moment, liebe Helli! Habe ich das richtig verstanden? Nur, weil so ein polnischer Lump die Alimente für sein Kind nicht mehr zahlt, wird …«
»… die Alimente für insgesamt sieben Kinder nicht mehr zahlt! Sieben Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Noch dazu ist eine davon die Tochter eines Ministers und der gute Mann ein bekannter polnischer Schauspieler und Model und Stuntman, weshalb …«
»… der gute Mann die Einleitung einer internationalen Fahndung wert ist. Weil wir sonst eh nichts zu tun haben.« Grimmig schüttelte Halb seinen Kopf. »Sonst noch was?«
»Drittens eine Anfrage aus Lyon. Die kam auf Französisch, weshalb das für mich Chinesisch ist.«
»Das verstehe ich gut. Lyon? Vermutlich von Interpol. In dieser Runde kann niemand den Text übersetzen, oder? Non? Macht aber nichts, weil …«
»Du fragst Monsieur Korber?«
»Oui, mon cher Toni. Also her damit.« Noch während der Zettel von einem Tischende zum anderen wanderte, wandte sich Halb Verena und Schwejk zu.
»Weil ihr zwei wieder ein Herz und eine Seele seid. Suchet und besuchet alle Orte, an denen Pferde verstaut werden können, ohne aufzufallen.«
»Chef, Pferde verstaut man nicht, man …«
»In meiner Welt schon! Sie werden verstaut oder – da muss ich Schwejk Recht geben – verdaut! Und ihr, Toni und Ingeniöhr«, um jeder weiteren hippologischen Diskussion zu entkommen, drehte sich Halb abrupt nach rechts, »ihr beschäftigt euch offiziell mit den Anfragen der Kollegen, aber inoffiziell dürft ihr gerne über fünf Fragen nachdenken und recherchieren. Ihr wisst ja …«
»Alles klar, Chef!« Wieder einmal bewies der Ingeniöhr, wie rasch seine grauen Zellen arbeiten konnten, wenn er munter war. »Welchem Zweck diente dieser Überfall? Warum wurde er just an diesem Ort verübt? Wieso wurden genau diese beiden Ehepaare überfallen? Weshalb überfällt ein kleines Heer von sieben Rittern gerade einmal vier Spaziergänger, bei denen logischerweise kaum was zu holen ist? Und die fünfte Frage …«
»Ist die, deren Antwort ich am meisten fürchte! Wozu diese Maskerade?«
Montag, 2. Juni 2014, 10.30 Uhr
Halb überlegte kurz. Vor über einem Jahr hatte er das Haus geerbt, seither hatte er es pro Tag mindestens ein, wenn nicht mehrere Male verlassen und war logischerweise auch jeweils wieder zurückgekehrt. Er hatte also – 13 Monate mal 30 Tage mal 2 – mindestens 780 Mal den Haustorschlüssel in seinen zahlreichen Taschen gesucht, gefunden, im Schloss umgedreht und daraufhin sein Haus betreten. Und trotzdem bereitete ihm dieses Ritual nach wie vor so viel Freude wie am ersten Tag!
Dabei hatte sein Hausherrentum völlig überraschend begonnen – klarerweise, denn von seinem damaligen Polizistengehalt hätte er sich ein Zinshaus mit elf Wohnungen nicht einmal in dieser Lage leisten können. Überraschend und irrtümlich – selbst heute noch musste Halb insgeheim grinsen, wenn er an seine Zeit im Sittendezernat dachte. Um ganz sicher als »harter Bursch« akzeptiert zu werden, hatte er sich damals in Kleidung, Sprache und Umgangsformen den ärgsten Zuhältern angepasst. Und genau zu diesem Zeitpunkt hatte ihn sein Onkel Alois nach Jahren wieder zufällig auf der Straße getroffen und ihn prompt für einen Zuhälter gehalten. Und da sein lieber Verwandter massenhaft Dreck am Stecken gehabt und sich wegen »geringfügiger Steuerschulden«, wenngleich in Millionenhöhe, nur kurz nach ihrem Wiedersehen nach Venezuela abgesetzt hatte, war ihm sein scheinbarer Zuhälter-Neffe in liebster Erinnerung geblieben. So lieb, dass er ihm einen Teil seines Vermögens in Form eines bestandsfreien Zinshauses vererbt hatte. In der Annahme, dass Halb daraus ein Laufhaus machen und von den Erträgen seiner stundenweisen Mieterinnen ein vergnügliches Leben führen würde.
Ein absurder Gedanke … nicht nur, was die Art der Mieterinnen betraf. Natürlich war es für Halb undenkbar gewesen, eines der zahlreichen Kaufangebote diverser Unterwelt-Größen anzunehmen, die aus diesem Haus tatsächlich ein Etablissement der Erwachsenenunterhaltung hätten machen wollen. Aber darüber hinaus hatte sich Halb vom ersten »Erb-Moment« an schwergetan, überhaupt irgendwem eine Wohnung zu vermieten. Denn er, der als Waise bei einem höchst liebevollen Großvater aufgewachsen war, hatte zwar nie Liebe und Zuwendung missen müssen, aber richtig viel Platz, nein, den hatte er nie gekannt. Und plötzlich breiteten sich gefühlt Kilometer um Kilometer an leeren Wohnungen, Gängen und Stiegenhäusern vor ihm aus, die er genüsslich einem Geist gleich nächteweise durchwandelte.
Zwar war er selber bald in sein neues Haus gezogen, außerdem hatte er der jungen Familie eines besonders fähigen und sympathischen Justizbeamten und etwas später einer vielfach bemerkenswerten Gerichtsmedizinerin jeweils eine Wohnung zu sehr günstigen Konditionen vermietet, aber den verbliebenen Freiraum wollte er sich bewahren.
Wie immer begann sich an diesem Punkt einerseits sein schlechtes »Sozial-Gewissen« bemerkbar zu machen, er wusste nur allzu gut, wie viele Menschen verzweifelt nach bezahlbaren Wohnungen suchten. Dazu gesellte sich sein »Geld-Gewissen«, da die Erhaltung eines solchen Riesenkastens ohne entsprechende Einnahmen immer stärker Konto wie Seele belastete.
»Wie ma’s macht, macht ma’s falsch!«, murmelte er vor sich hin, aber bevor er noch in einer seiner Verdrießlichkeiten versank, riss ihn ein martialisches Gebrüll heraus.
»Ich bin der edle Ritter! Und du, Onkel Luzi, du bist … ja, schon auch mein Lieblingsonkel. Aber jetzt bist du der Böse. Und ich muss dich besiegen.«
Friedrich Korber hatte zu seinem vierten Geburtstag unter anderem ein Tretauto sowie eine Ritterrüstung geschenkt bekommen, weshalb das edle Ritterchen nun statt hoch zu Ross trabend tief im Sitz rollend mit Plastikschwert und -schild wild um sich schlug.
»Flitzi! Du weißt, dass du nicht auf den Gang – oh, grüß dich, Ludwig.« Gilles Korbers Lächeln ging unmittelbar in einen besorgten Blick über. »Alles in Ordnung bei dir?«
»Ja, warum nicht?«
»Weil du nie um diese Zeit nach Hause kommst.«
»Offiziell bin ich hier, weil ich deine Zweisprachigkeit brauche.«
»Und inoffiziell?«
»Auch. Außerdem muss ich nachdenken.«
»Dann … hereinspaziert in die wundersame Welt motorisierter Miniatur-Männer. Flitzi, ja, du auch!«
Montag, 2. Juni 2014, 10.45 Uhr
»… nos meilleures salutations! Um es kurz zu machen, sie bitten dich, bei fünf Fachsitzungen den Vorsitz zu führen.«
»Auf Französisch oder Mandarin?«
»Mandarin würden sie nicht akzeptieren. Nein, im Ernst, natürlich auf Deutsch, du würdest in insgesamt 23 Sprachen simultan übersetzt werden.«
»Zuerst einmal vielen Dank, Gilles.« Vorsichtig nahm Halb den Brief wieder an sich, als ob dessen Worte zerbrechlich wären.
»Gerne! Und weiter? Du machst ein Gesicht, als ob ich dir mindestens dein Todesurteil übersetzt hätte. So schlimm ist es doch nicht, nach Lyon eingeladen und als berühmter Spitzenkriminalist behandelt zu werden. Magst du keine roten Teppiche?«
»Überhaupt nicht! Die erinnern mich immer an Blut. Und gerade die, die man mir ausrollt, muten mich an, als ob es mein eigenes wäre. Eine Art Opferstein meiner Lebenszeit. Diese Repräsentations- und Netzwerk-Massenaufläufe sind für mich der reinste Masochismus. Lieber schlage ich einem Mörder das Messer aus der Hand, als dass ich diverse Hände wichtiger Leute schüttle. Apropos Handschütteln – wo sind Maria und das Füchslein?« Demonstrativ ließ Halb seinen Blick kreisen, als ob er Frau Korber und den einjährigen Antoine im Korber’schen Wohnzimmer übersehen hätte.
»Beim Kinderarzt. Und ich bin zuhause, weil ich Wochenend-Dienst …«
»Ah-Wah-Wah-Wah-Wah!« Ein wüstes Potpourri aus Gebrüll, geschwungenem Ritterschwert und modernem Spielzeugauto mit Hupe ließ beide Herren zusammenzucken.
»Flitzi, bist du wahnsinnig?« Dass Vierjährige noch kein Gefühl für soziales Timing hatten, schien Halb normal, aber offenbar schaffte es sein Wahlenkel Friedrich mühelos, selbst seinen eigenen Vater zu erschrecken. Da half nur eines – die Opa-Rolle zu übernehmen und Flitzis gekränktes Gesicht wieder aufzuhellen.
»Flitzi, hast du gewusst, dass echte Ritter oft sehr leise waren? Die haben sogar flüstern geübt.«
»In echt, Onkel Luzi? Wieso?«
»Weil, weil …« Da Flitzis Miene puren Zweifel ausdrückte, sah sich Halb plötzlich unter Zugzwang, eine seriöse, aber kindgerechte Begründung zu liefern.
»… weil die Ritter nicht wollten, dass ihre Gegner hören, aus welcher Richtung sie kommen. Und weil ihre Rüstungen sowieso laut geklappert haben, haben sie sich extra bemüht, leise zu sein.« Offenbar hatte Gilles Korber viel mehr Übung darin, »pädagogische Nervenschonkost« gekonnt aus dem Ärmel zu schütteln, sodass sie Flitzi begeistert aufnahm.
»Dann geh ich«, das Flüstern des Vierjährigen hätte jedem großen Schauspieler zur Ehre gereicht, um selbst im Burgtheater in der letzten Reihe gehört zu werden, »leise sein üben ins Kinderzimmer, damit ich ein echter Ritter werd.«
Mit einer Mischung aus Erleichterung und Begeisterung blickten die beiden Erwachsenen dem Ritter in der kindlichen Gestalt nach, der mühsam Brustpanzer, Schwert und Schild in seinem Tretauto verstaute und dieses erstaunlich geschickt in sein Zimmer bugsierte.
»Maximal 15 Minuten.« Als Gilles Korber Halbs Ratlosigkeit sah, musste er lachen. »In spätestens einer Viertelstunde ist Flitzi wieder da. Länger hält er es nicht alleine im Kinderzimmer aus, erst recht nicht, wenn du zu Gast bist. Also, nützen wir die Ruhe. Was hast du vor? Wegen Lyon, meine ich.«
»Ich könnte … nein, ich habe eine bessere Idee! Du kennst doch unser aller Ernst, also Hofrat Doktor Ernst Straka, meinen Vorgesetzten und langjährigen Freund. Einerseits liebt er solche Repräsentations-Events, wobei er … na ja, ich will ihn nicht schlechtmachen, aber er ist anderen durchaus neidig, wenn die im Rampenlicht stehen. Andererseits kriegt er dauernd die Panik, ich könnte zu wenig von der verhassten Schreibtischarbeit erledigen, zu der er mich so gerne verdonnert. Daher werde ich ihn ganz unschuldig fragen, ob ich hinfliegen und einige Tage dort sein kann. Es wird ihm nicht recht sein, er wird … nein, natürlich wird er es mir nicht wirklich verbieten, aber herumdrucksen, sodass ich den Guten spielen und ihm großzügig anbieten werde, nicht zu fahren. Zum Schluss kann ich Interpol wahrheitsgetreu antworten beziehungsweise du übersetzen, dass … leider nein, weil … warte, ich hab’s, wie gefällt dir Folgendes? ›Um atmosphärische Störungen mit meinem Vorgesetzten zu vermeiden, sehe ich mich leider zur Absage gezwungen.‹ Na, wie bin ich?«
Korber zog die Augenbrauen hoch, bevor er vorsichtig zu formulieren begann. »Ludwig, auch wenn du das jetzt nicht hören möchtest … und ich das nicht gerne sage, weil du immerhin unser Vermieter und ein wunderbarer Beute-Opa bist. Du bist viel mehr Hofrat, als du dir jemals hättest träumen lassen. Oder, vielleicht sogar befürchtet hättest.«
Halb seufzte tief. »Leider! Du weißt gar nicht, wie Recht du hast! Ich bin inzwischen einer derer, die ich immer verachtet habe. Eine bürgerliche Fassade, die nur auf den Verputz schaut. Und das Schlimmste ist, ich stehe mir und meinem Glück damit derart im Weg, dass ich …«
»Onkel Luzi, hast du im Kindergarten mit den Rittern gekämpft?«
»Flitzi!« Weder Halb noch Korber hatten Flitzis Heranschleichen bemerkt.
»Wieso, ich mit Rittern? Im Kindergarten?« Dank Korbers amüsiert-entsetzten Gesichtsausdrucks ahnte Halb im selben Atemzug Flitzis Antwort.
»Weil du doch schon so alt bist. Wie die Ritter. Und die waren doch auch einmal Kinder und im Kindergarten. Und du auch. Und dort hast du mit den Rittern kämpfen müssen. Und gewonnen, gell?«
»Flitzi! Der Luzi-Opa ist doch nicht so alt, dass er …«
»Lass nur, Gilles!« Mühsam unterdrückte Halb ein schallendes Lachen. »Flitzi, ich bin zwar alt, aber nicht so alt. Nein, mit Rittern habe ich nie gekämpft. Aber, wieso bist du heute nicht im Kindergarten?«
»Der ist zu, weil dort haben wir was ganz Schlimmes, wir haben Haarmäuse.«
»Läuse, Flitzi, nicht Mäuse.« Prompt begann sich Gilles Korber am Kopf zu kratzen, nur um sofort verschämt innezuhalten. »Leider ja, aber bisher gab es bei uns in der Familie erfreulicherweise nur blinden Laus-Alarm. Und übermorgen …«
»… darf ich wieder in den Kindergarten und Ritter werden. Und dann kämpfe ich so und so und …« Mit den ersten beiden Fuchtel-Hieben schlug Flitzi lediglich »Luftpudding«, aber mit dem dritten landete er einen Volltreffer und eine Schreibtischlampe auf dem Boden.
»Nicht so wild! Du musst dir vorher überlegen, was du willst. Schau, so.« Noch bevor Tränen rannen, hatte Gilles Korber seinem Sprössling Plastikschwert und -schild aus den Händen genommen. Nebenbei hob er die Lampe wieder auf, platzierte sie auf dem Tisch und focht einige Paraden, als ob er die Lampe entwaffnen wollte. Einen Moment strahlte Flitzis Gesicht vor Begeisterung, um daraufhin in kindliches Entsetzen zu kippen.
»Papi, du bist ja ein ursuper Ritter! Aber das schaut so urschwer aus, das kann ich nie! Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich nie ein toller Ritter, und dann werde ich nie im Kindergarten gegen die anderen kämpfen und …«
»Du sollst auch nicht gegen die anderen kämpfen, sondern mit ihnen spielen! Und das kannst du, aber du musst es eben üben. Ich zeig’s dir.« Bei Korber Senior sah es ganz einfach aus, die Bewegungen flossen ineinander über, die »gegnerische Lampe« schien keine Chance zu haben, obwohl sie Korber nicht im Geringsten berührte. »Siehst du, du musst immer auf deine Umgebung achten, schauen, was die Kinder um dich herum machen. So könnt ihr gemeinsam wunderbar Ritterburg spielen. Da hat jeder seine Aufgabe, und du bist eben einer, der auf die anderen aufpasst.«
Als Flitzi geradezu ehrfurchtsvoll Spielzeugschwert und -schild aufs Neue aus seines Vaters Händen entgegennahm, fühlte sich Halb in die Zeit von König Artus und seiner Tafelrunde versetzt. Die Feierlichkeit war aber noch im selben Atemzug zu Ende, als Flitzi im eifrigen Bemühen, die Bewegungen nachzuahmen, in sein Zimmer hopste.
»Danke für die Übersetzung! Und Gratulation dem Vater und Schwertkämpfer, in beidem bist du ebenso gelassen wie zielsicher.«
»Bitte gerne, Ludwig. Es geht doch nichts über drei Monate Ausbildung in einer Clownschule und zwei Stunden Aikido die Woche.«
»Ai… was bitte?«
»Aikido, eine japanische Kampfkunst, die nur auf Verteidigung ausgelegt ist. Glaube mir, in manchen Augenblicken sogar bei einem Vier- und einem Einjährigen durchaus zu empfehlen. Und sie hilft auch, manches leichter zu verstehen. Vielleicht sogar ›bürgerliche Fassade-Selbstzweifel‹, also wenn du willst …«
Beinahe erschrocken hob Halb die Hände. »Sehr lieb, aber ich weiß leider ganz genau, weshalb mein Seelen-Verputz derzeit dermaßen abbröckelt. Nur will, nein, kann ich nicht … doch, ich will nicht … egal, es ist halt so! Aber solange ich liebe Freunde habe, bei denen ich mich ausjammern kann, ist alles in Ordnung. Handküsse der Maria und Onkel-Luzi-Bussi den zwei Wirbelwinden. Und noch einmal vielen lieben Dank!«
Als Halb die Tür hinter sich zuzog, hatte er das vage Gefühl, etwas Wesentliches erkannt zu haben. Nur was?
Montag, 2. Juni 2014, 13.10 Uhr
»Verena, wenn ich mich hier auf diesem Waldweg vor dir auf die Knie würfe …«
»… dächte ich, du wärst über eine Wurzel gestolpert.«
»Danke! Aber nein, ich würde dich nur formvollendet um Verzeihung bitten.«
»Wie lieb von dir, Schwejk. Weshalb?«
»Wegen meiner garstigen Worte bei der Besprechung.«
»Aber dafür hast du dich bereits entschuldigt. Erinnerst du dich nicht mehr? Oje, zu viel Stress, zu kurzes Kurzzeitgedächtnis?«
»Was hast du gerade gesagt? Nein, im Ernst«, genüsslich sog Franz Haschek die Luft ein, die trotz der nahen Bundesstraße beinahe nach Bäumen roch. »Ich habe mich geirrt, Pferde sind nicht erst als Leberkäse beeindruckend.«
»Zumindest dann, wenn es in ihrer Umgebung von hübschen jungen Damen nur so wimmelt, nicht wahr? Oder, sag bloß, dir wären die zahlreichen feschen Reiterinnen in den engen Hosen und den blitzenden Stiefeln vor lauter Konzentration auf die Ermittlungen gar nicht aufgefallen? Erst recht nicht, da du mindestens, wenn ich mich nicht verzählt habe, sieben Mal betont hast, dass du vom österreichischen Bundeskriminalamt wärst und in einem Kapitalverbrechen ermitteln würdest. Wohlgemerkt – du, nicht wir! Und in einem Kapitalverbrechen – bei dir klang das nach wenigstens einem Massenmord … der zwar einstweilen gar nicht stattgefunden hat, aber dafür waren dir die bewundernden Blicke umso sicherer.« Verena Planners Stimme war vor Ironie kaum zu erkennen.
»Ist ja gut! Wirklich sieben Mal? Außerdem, was ist schon dabei, wenn ich mich mit potentiellen Zeuginnen intensiv austausche? Du musst zugeben, dass wir erstaunlich rasch erstaunlich viele Details über die Stallungen dieses Nobelhotels herausbekommen haben.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: