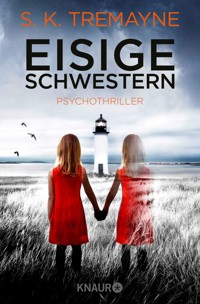4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eiskalte Thriller
- Sprache: Deutsch
Vom Schlimmsten, was in einer Nacht passieren kann - ein Kurz-Thriller von S. K. Tremayne, dem britischen Star-Autor der "Eisigen Schwestern" und der "Stimme" Eine Frau erwacht in einem vollkommen dunklen, stillen Raum. Es ist ihr unmöglich festzustellen, wo sie ist. Da keinerlei Licht an ihre Augen dringt und ihre Ohren nicht das geringste Geräusch wahrnehmen, fragt sie sich in ihrer Panik, ob sie erblindet oder plötzlich taub ist. Ganz langsam aber kann sie winzige Unterschiede in der Finsternis erkennen; winzige Lichtmengen scheinen sich manchmal in den Raum zu verirren. Sie weiß jetzt, sie muss weg von diesem schrecklichen Ort. Aber wer hat sie dort hingebracht? Wer hält sie gefangen? Und warum? S.K. Tremayne schrieb diesen spannenden Kurz-Thriller exklusiv für seine deutschen Fans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
S. K. Tremayne
Augen ohne Licht
Thriller
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Frau erwacht in einem gänzlich dunklen, stillen Raum. Ist sie erblindet oder plötzlich taub? Aus einer Panik-Situation, die jede/r von uns kennt, wird blanker Horror, als ihr klar wird: Sie muss weg von diesem schrecklichen Ort! Aber wer hat sie dort hingebracht? Und warum?
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
1
Ich wache auf. In meinem Bett. Ich schaue mich um, aber ich sehe nichts. Gar nichts, nicht die kleinste Andeutung von Licht, durch die Vorhänge dringt nichts herein, unter der Tür schimmert nichts hervor, nicht der blasseste Schein aus dem Flur oder von irgendwo sonst im Haus. Es ist unglaublich, unfassbar dunkel. Und still.
Warum?
In unserem großen Schlafzimmer ist es immer eher still, eher dunkel. Ich mag es so, weil ich mich mit dem Schlafen schwertue und die kleinste Störung – Licht, ein Geräusch, eine Bewegung – mich zurückholen kann; dann liege ich qualvolle Stunden lang wach, schwitze, wälze mich hin und her, störe Jake und bin am nächsten Morgen so gerädert, dass ich an nichts anderes denken kann als den Schlaf, den ich nicht gekriegt habe. Deshalb habe ich Jake überredet, diese schweren dunkelblauen Vorhänge anzubringen, deshalb haben wir den Hochflorteppichboden, der verhindert, dass durch den Spalt unter der Tür Licht hereinfällt, deshalb habe ich darauf gepocht, dass wir uns das größtmögliche Bett kaufen – damit ich, ungestört, in Stille und Dunkelheit ruhig daliegen kann. Denn dann kann ich, wenn ich Glück habe, auch schlafen.
Manchmal macht Jake sich über mein Bedürfnis, die Welt auszusperren, lustig, behauptet, wir schliefen in einem Grab – mir war nicht bewusst, dass ich eine ägyptische Mumie heirate –, aber er sträubt sich nicht dagegen, und zwar weil es ihm, so mein Verdacht, selbst sehr recht ist. Seine Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend, er hat Stress und macht Überstunden bis zur Erschöpfung, da bietet unser schummriges, ruhiges eheliches Schlafzimmer eine echte Zuflucht.
Nur eine Störung ist mir immer willkommen: wenn meine Tochter Nancy hereinschneit. Wenn unser geliebtes einziges Kind, hellwach und strotzend vor Energie, mit der ganzen Lebendigkeit und überschäumenden Freude einer Siebenjährigen sonntags morgens zur Tür hereinstürmt, Mami, Mami, Mami, komm und guck dir Mitzi an, er versucht, eine Fliege zu fangen, wenn sie auf dem großen Bett herumhüpft wie auf einem Trampolin und versehentlich auf ihren Vater springt, dass er stöhnt und gleichzeitig lacht und schließlich aufsteht und Mitzi dem Hund zuschaut, der versucht, eine Fliege zu fangen, wenn ich noch einen Moment liegen bleibe und ans Aufstehen denke, wobei ich manchmal auch nur kurz aufspringe, alles wieder dunkel mache und mir noch zehn weitere kostbar-köstliche Minuten Sonntagsschlaf gönne, denn an allen anderen Tagen muss ich halb sieben aufstehen, Nancy etwas zu essen einpacken und ihr Sachen rauslegen, damit Jake sie zur Schule fahren kann, während ich in die Stadt radele und um acht die kleine Weinhandlung aufmache und mich um die Organisation kümmere, um Bestellungen und Lieferungen und Sonderangebote. Kleine unabhängige Weinhandlungen öffnen sich nämlich nicht von selbst, und ich habe zwar zwei Angestellte, einundzwanzig und vierundzwanzig Jahre alt, kann es mir aber nicht leisten, sie viele Stunden zu beschäftigen, denn für hohe Personalkosten machen wir nicht genug Umsatz.
Trotzdem habe ich Spaß daran, neue Weine zu entdecken, Verkostungen zu veranstalten, Liebhabern große, unbekannte Weine zu verkaufen: kanadischen Eiswein, mazedonische Rote, diesen großartigen Tokajer, den wir letztes Jahr hatten. Wie ein Nektar mit Schuss.
Und mir gefällt die Portion Unabhängigkeit, die der Laden mir gibt. Darauf habe ich von Anfang an bestanden, schon bei der Heirat, dass ich mich nicht komplett von meinem etwas dominanten Mann vereinnahmen lasse, dass ich mein eigenes Konto habe, dass ich meinen Mädchennamen behalte, eigenes Geld und ein eigenes Geschäft, dass ich ich selbst bleibe und mich nicht an einen anderen verliere. Nicht einfach geschluckt werde.
Warum ist es so dunkel?
Mein Blick geht zur Decke, die in dieser Düsternis kaum auszumachen ist. Grauschwarze Leere. Also bin ich zumindest nicht blind aufgewacht wie in einem Verstümmelungshorrorfilm. Etwas sehe ich ja. Trotzdem ist die Stille genauso erdrückend und befremdlich wie die Dunkelheit.
Jake muss früh aufgestanden sein. Warum? Es ist Sonntag.
Oder?
Ich will mein Telefon. Es liegt ausgeschaltet auf dem Nachttisch. Sehen kann ich es nicht, dafür ist es zu dunkel, aber ich weiß, dass es da ist, es ist immer da. Abend für Abend lege ich es gewissenhaft dahin, auf das kabellose Ladegerät.
Irgendwie bin ich kaputt, habe das Gefühl, mich nicht rühren zu können. Mein Körper ist bleischwer. Trotzdem rege ich mich nicht auf, ich kenne dieses Gefühl, es ist mir vertraut.
Valium, Zopiclon, Xanax. Unter meinem Bett ist ein ganzes Depot versteckt. Jake hat nette Arztfreunde, die sich meiner erbarmen.
Habe ich gestern Abend eine Schlaftablette genommen? Dass ich was getrunken habe, weiß ich. Eine verschwommene Erinnerung sagt mir, dass ich mit Jake getrunken habe, vielleicht gab es etwas zu feiern, oder ich wollte etwas vergessen, was war es noch mal? Die Erinnerung ist vage, aber das ist oft so, wenn ich Schlaftabletten genommen habe, es kann bis zu einer Stunde dauern, bis ich wieder klar bin, doch das nehme ich in Kauf, denn manchmal ist es selbst in unserem großen Schlafzimmer nicht still und dunkel genug, dann droht die altbekannte, ererbte Schlaflosigkeit mich bis zum Morgengrauen mit ihren Dornen und Stacheln zu foltern – und dann gebe ich mich hin und wieder geschlagen. Ich weiß, das sollte ich nicht, schon gar nicht nach Alkohol, aber ich tue es. Ich werfe die geliebte Pille ein.
Weiß steht für Val, Blau für Zop, Orange für Xan. Gelegentlich, in unregelmäßigen Abständen, kommt sogar Grün dran, Rohypnol. Ein hübscher kleiner Regenbogen, ordentlich verwahrt in einer Ledertasche unter dem Bett. Mein Mann hat es gern, wenn das Schlafzimmer aufgeräumt ist, und obwohl ich, genau wie Nancy, eher Messie bin, füge ich mich bereitwillig, denn es bedeutet, dass wir auch im Dunkeln alles finden, weil immer alles an seinem Platz ist.
Wie auch mein Handy.
Okay, es reicht, lange genug faul sinniert. Ich muss die Hand ausstrecken, mein Handy aktivieren, nachsehen, wie spät es ist, und dann aufstehen und Nancy Frühstück machen. Mitzi Wasser und Futter hinstellen. Den Tag beginnen.
Es sei denn, Jake hätte das alles schon gemacht und sie wären draußen, Vater und Tochter zusammen im Park, vielleicht mit Mitzi dem Hund? Das würde erklären, warum es so extrem still ist im Haus, warum nicht der kleinste Laut zu mir hereindringt. Jake muss mit den ohnehin dicken Vorhängen noch zusätzlich etwas angestellt haben, so vollständig, wie sie das Licht draußen halten. Sehr aufmerksam, mein Ehemann.
Ich gestatte mir ein ausgiebiges Gähnen und greife nach meinem Handy. Das geht blind, auch in totaler Finsternis, das Telefon liegt immer genau da, wo ich es haben will.
Ich strecke die Hand aus. Weiter. Meine Finger greifen in Luft.
Ins Nichts.
Ins Leere. Eine Schwärze, die vor meinen Augen verschwimmt.
Das Handy ist nicht da.
Ein Gefühl, als würde ich fallen. Ich lasse die Hand kreisen, bewege sie auf und ab, versuche, wie ein Pantomime, wenigstens den Nachttisch zu ertasten. Und jetzt ist mir, als stürzte ich ins Bodenlose, in endlose Tiefen. Nicht nur das Handy ist nicht da. Auch der Nachttisch nicht. Wo ist er hin? Warum hat Jake ihn entfernt, wie, wann, warum? Mitten in der Nacht?
Ich wäre doch aufgewacht, es hätte doch Geräusche verursacht.
Das ist mehr als unheimlich. Ich schwinge die Beine über die Bettkante – es ist so dunkel, dass ich selbst meinen Schlafanzug kaum erkennen kann. Gleich stelle ich die Füße auf den Boden. Gleich werde ich auf dem warmen weichen Teppich stehen, diesem luxuriösen, teuren Teppichboden, den wir haben verlegen lassen, weil er verhindert, dass durch den Spalt unter der Tür Licht hereinfällt, aber auch, weil ich einfach gern weichen Teppich unter den Zehen habe. Überall sonst in dem hübschen viktorianischen Haus haben wir glänzende Holzböden und türkische Teppiche. Es erfüllt mich mit Stolz, wie Jake und ich unser Zuhause hergerichtet haben, es ist nicht spektakulär, aber es ist unseres: einladend und sauber. Jake legt großen Wert auf Sauberkeit.
Meine Knie knicken ein, und ich sacke zurück aufs Bett.
Kein Teppich.
Der Boden ist weich, aber das ist kein Teppich. Es fühlt sich an wie Kunststoff, wie Vinyl.
Dieser Boden sendet Kälte aus, schmerzhaft wie Nadelstiche, als würde mir Eisregen den Rücken hinunterlaufen.
Dass Jake mein Handy genommen hat, kann ich glauben. Auch, dass er den Nachttisch weggeholt hat, das wäre denkbar. Den Teppichboden kann er nicht entfernt und komplett durch eine andere Oberfläche ersetzt haben. Oder? Das ist unmöglich. Also ist das hier vielleicht nicht mein Schlafzimmer. Vielleicht bin ich irgendwo anders aufgewacht. An einem Ort ohne jeden Laut, ohne Licht, einem Ort, an dem ich nichts erkenne, keine Chance habe, etwas zu sehen. Und ich weiß nicht, wie ich hierher geraten bin.
2
Panik naht, es ist schwer, sie abzuwehren. Kaskaden von Fragen jagen mir durch den Kopf, während ich mich auf dem Bett zusammenkauere, die Arme um die Knie schlinge und versuche, nicht vor und zurück zu schaukeln wie das Klischee von einer Geistesgestörten.
Ich bin gestern Abend in meinem eigenen Schlafzimmer ins Bett gegangen, das weiß ich genau. Ich war angetrunken, leicht benebelt, aber ich erinnere mich doch. Oder nicht? Jedenfalls war ich ziemlich hinüber.
Ein neuer, beunruhigender Gedanke taucht auf. Könnte es sein, ja, ist es überhaupt möglich, dass ich unter Drogen stand? Das würde erklären, warum ich so groggy bin. Diese Schwere, die mich dazu verleitet hat, lange Zeit einfach nur dazuliegen und in die rabenschwarze Dunkelheit zu starren. Sollte ich unter Drogen gestanden haben, wäre auch geklärt, warum meine Erinnerungen so vage sind. Ich sehe den gestrigen Abend, wenn es denn gestern war, wie durch eine mit Vaseline bestrichene Linse. Lachen mit Jake, ein paar Drinks, ein ernstes Gespräch – aber worum ging es? Bei diesem Gespräch? Schon ist das Guckfenster der Erinnerung wieder vernebelt. Aber ich muss es versuchen, muss den Schleier beseitigen, das Glas säubern, hindurchschauen. Was geht hier vor? Das kann nicht sein.
Aber es ist so.
Und Nancy?
Was ist meine letzte Erinnerung an Nancy?
Bohrende Angst, schmerzhaft bis ins Innerste. Wo ist meine kleine Tochter? Ist sie wach? Weiß sie, dass ihre Mutter weg ist, irgendwie woandershin gebracht … Wohin? Vielleicht bin ich auch freiwillig hierhergekommen – wo zum Henker hier auch ist – und habe es nur vergessen. Aber Nancy! Meine Süße.
Ich sehe sie vor mir, wie sie an einem Sonntagmorgen aufsteht, wie gewohnt zu uns ins Zimmer kommt und auf ein leeres Bett starrt, sehe, wie sie ein leeres Haus absucht und immer ängstlicher wird. Mama ist weg. Maaamiii!
Vielleicht ist Jake ja da und kann sie beruhigen. Aber warum sollte mein Mann da sein und ich nicht? Möglich, dass der, der mich geholt hat, auch Jake geholt hat. Einen Grund kann ich nicht finden, und trotzdem ist es so: Ich könnte überall sein, ich könnte drei Kilometer von unserem kleinen Haus entfernt sein. Genauso, stelle ich mir vor und erschauere, könnte ich dreitausend Kilometer weit weg sein. Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Und noch ein Gedanke kommt mir. Woher weiß ich, dass es Sonntagmorgen ist? Womöglich war das nicht die erste Nacht, die ich in diesem seltsamen dunklen und stillen Raum zugebracht habe, vielleicht liege ich schon seit Tagen hier, unter Drogen gesetzt, bewusstlos – was auch heißt, dass es jemanden gibt, der sich um mich kümmert. Ich kann zwar kaum glauben, dass ich schon eine ganze Nacht hier liege, geschweige denn, vierundzwanzig Stunden oder noch länger, aber wenn es doch so ist, hat jemand nach mir geschaut. Und mich sauber gehalten. Sicher, weiter als einen Meter kann ich nicht sehen, und ich höre kein einziges Geräusch, aber mein Geruchssinn ist intakt: Ich habe meinen Schlafanzug an, ich hebe den Arm an die Nase und schnuppere, und der Stoff riecht gewaschen. Mein gewohntes Waschpulver. Sauber. Jemand ist reingekommen und hat …
Nein. Nein, nein, nein, nein. Das ist lächerlich! Ganz sicher liege ich in meinem Bett und war irgendwie durcheinander. Bin nur halb aufgewacht, habe mir was eingebildet, war kaputt, verkatert, verschlafen. Vielleicht hat Jake den Nachttisch weggeräumt und den Teppich aufgerollt. Das scheint kaum möglich, aber noch viel weniger möglich, unmöglicher als unmöglich erscheint mir, dass ich durch irgendeine Magie von einem Zimmer in einem Haus in ein anderes Zimmer an einem komplett anderen Ort gebracht worden bin.
Ich richte mich auf und rufe.
»Jake? Jake!?«
Nichts.
Ich versuche es noch mal.
»Jake. Jake, Jake, Jake! Nancy!«
Nichts.
Genau genommen schlimmer als nichts, weniger als nichts.