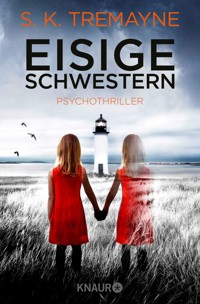9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein morbides Hotel, eine traumatisierte Heldin, Wintereinbruch auf einer einsamen Insel: »Schwarzes Wasser« von Bestseller-Autor S. K. Tremayne ist ein hochatmosphärischer Gänsehaut-Thriller mit einem Mix aus Locked-Room-Setting und Psycho-Grusel. Eine einzige Nacht verwandelt den Traum der jungen Hotelmanagerin Hannah in einen Alptraum: Die Mittsommerparty sollte der Höhepunkt der Saison für ihr Luxushotel auf einer einsamen kleinen Insel mitten im wildromantischen Fluss Blackwater werden. Doch das rauschende Fest endet in einer Katastrophe, als mehrere Gäste im mondbeschienenen Fluss ertrinken. Hannah entwickelt daraufhin panische Furcht vor Wasser, die sie buchstäblich auf der Insel gefangen hält. Selbst als sich das Hotel mit dem Wintereinbruch endgültig leert, kann sie nicht fort. Mittlerweile ist sie überzeugt, dass die schreckliche Nacht kein Unfall war. Warum weigert sich ihre Schwester, die auch im Wasser war, darüber zu sprechen? Hannah ist allerdings nicht so einsam auf der Insel, wie sie glaubt: Nicht nur die Geister der Toten sind bei ihr geblieben, sondern auch jemand, der um jeden Preis verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wie schon in seinem Bestseller »Eisige Schwestern« spielt S. K. Tremayne virtuos auf der Klaviatur unserer Ängste. Mit der wildromantischen Insel mitten im Fluss Blackwater hat der Thriller-Autor das perfekte Setting für einen Psychothriller geschaffen, in den sich Schritt für Schritt das Grauen einschleicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
S. K. Tremayne
Schwarzes Wasser
Psychothriller
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine einzige Nacht verwandelt den Traum der jungen Hotelmanagerin Hannah in einen Alptraum: Die Mittsommerparty sollte der Höhepunkt der Saison für ihr Luxushotel auf einer einsamen kleinen Insel mitten im wildromantischen Fluss Blackwater werden. Doch das rauschende Fest endet in einer Katastrophe, als mehrere Gäste im mondbeschienenen Fluss ertrinken.
Hannah entwickelt daraufhin panische Furcht vor Wasser, die sie buchstäblich auf der Insel gefangen hält. Selbst als sich das Hotel mit dem Wintereinbruch endgültig leert, kann sie nicht fort. Mittlerweile ist sie überzeugt, dass die schreckliche Nacht kein Unfall war. Warum weigert sich ihre Schwester, die auch im Wasser war, darüber zu sprechen?
Hannah ist allerdings nicht so einsam auf der Insel, wie sie glaubt: Nicht nur die Geister der Toten sind bei ihr geblieben, sondern auch jemand, der um jeden Preis verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Inhaltsübersicht
Anmerkung des Autors
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
Danksagung
Anmerkung des Autors
Dawzy ist eine Fiktion: ein Amalgam aus mehreren Inseln vor den einsamen, schönen, flussnahen Küsten von Essex, Suffolk und Norfolk. Keine Fiktion ist natürlich der River Blackwater, den gibt es: mit seinen Austernbänken und Marinas, Kraftwerken und Vogelschutzgebieten. Allerdings habe ich mir hinsichtlich seiner Geografie gewisse Freiheiten erlaubt, habe Dörfer verschoben, Namen geändert, Merkmale woanders entlehnt, konkrete Orte abgewandelt. Ich hoffe, diejenigen, die das Glück haben, diese einzigartige, stimmungsvolle Ecke Englands zu kennen, sehen mir das nach.
Für Star, nach wie vor
1
Hannah, heute
Wasser. Einfach Wasser.
Mehr ist es nicht.
Krieg dich ein.
Noch während ich mir das sage, mit dem Blick zur Decke, die weiß gestrichen, jetzt aber dunkel ist, meldet sich in meinem Kopf eine andere Stimme: Einfach Wasser? Einfach?
Alles ist Wasser. Mein Körper ist Wasser, der Mutterleib ist Wasser, und Wasser war der Traum. Ich bin damit aufgewachsen, aufs Wasser zu schauen, auf den Fluss, der zum Meer geht; als Mädchen war ich voller Sehnsüchte, hoffte, ich würde eines Tages die Welt bereisen und über die Wasser segeln.
Einfach Wasser? Wir nutzen es jeden Tag, zum Waschen, zum Trinken, zum Kochen; wir tauchen darin, wir schwimmen darin, wir laufen zu ihm hin, wir sehnen uns danach, an ihm zu leben.
Wir versinken darin.
Ich drehe mich um, kneife die Augen zu.
Wir segeln darauf, wir spielen darin, planschen und platschen, prusten, spritzen, strampeln, sprühen. Sex ist vor allem Wasser, feucht, nass, das Blut, das die bitzelnde Haut durchströmt, ein weicher, nasser Kuss auf die Wange.
Steh auf, Hannybobs.
Ich hebe den Blick, schaue auf meine kleine Uhr, auf die freundlich grün leuchtenden Ziffern. 5:36.
Warum wache ich immer um diese brutale Zeit auf? Das ist jetzt mein persönliches Morgengrauen. Nahezu täglich, zwischen fünf und sechs. Seit ES passiert ist. Manchmal finde ich, wenn ich ganz still liege, die Augen fest schließe, die Decke um mich ziehe und hässliche Gedanken wegscheuche, zurück in eine Art Schlaf, aus dem dann eine grelle Traumparade wird, eine Zirkustruppe, die niemand bestellt hat: eine Kavalkade von Zombie-Clowns, grinsende Akrobaten, übereinanderpurzelnde Freaks, riesige trompetende Elefanten, ich selbst.
Oft liege ich da, weiß, dass ich wohl nicht wieder einschlafen werde, und frage mich, ob ich nicht einfach aufstehen sollte, und zugleich ist mir klar, dass ich dann meine beste Zeit, die Zeit, in der mein Hirn am produktivsten ist, damit zubringen werde, dazusitzen und ins Leere zu starren, während mein Verstand sich ergebnislos abstrampelt, Erinnerungen wegsortiert und wieder hervorholt. Und dann, eine Stunde später, kommt langsam Leben in das große Gebäude um mich herum, ein pfeifender Souschef, das Klappern und Scheppern aus den Küchen, das Flüstern und Kichern eilender Zimmermädchen, die ersten brutzligen Frühstücksgerüche dringen zu mir, und ziemlich sicher höre ich die Gäste in Zimmer 14 ein Stück den Flur runter bei ihrem stürmischen Morgensex, und dann weiß ich, dass ich wirklich aufstehen muss.
Duschen – mit Wasser. Tee kochen – mit Wasser. Kaffee schlürfen – mit möglichst wenig Wasser. Klein und schwarz und doppelt und dreifach stark, und ich werde nachher im Büro über der Rezeption noch unzählige Kaffees brauchen, um gegen das Gähnen anzukämpfen, mit dem ich täglich für das frühe Aufstehen bezahle.
Steh auf.
Diesmal gehorche ich. Schubse die Decke weg, überlege, ob ich die Lampe anmachen soll, entscheide mich aber dagegen. Ich mag die Dunkelheit. Sie verbirgt Dinge. Außerdem ist es nicht vollständig dunkel, wir haben fast Vollmond, ein zarter silbriger Schein umgibt die halb zugezogenen Vorhänge. Die dazu dienen, mich gegen den quälenden Ausblick abzuschirmen, den Blick auf den Blackwater.
Ich strecke die Hand Richtung Tür und ertaste meinen blauen Morgenmantel, schön warm und kuschlig weich und definitiv keine Hexe, die da am Haken hängt.
Das ist eine superdeutliche Erinnerung, die unaufgefordert wiederkehrt.
Ich bin sieben oder acht, wache auf, fröstele und sehe im Schummerlicht meines Zimmers einen langen Wintermantel an der Tür hängen, nur sieht er aus wie eine von den Hexen aus dem Buch, eine Hexe, die mit schiefem Hals am Galgen baumelt, und ich schreie, bis Mama hereinstürmt und mich in die Arme nimmt, mich umfängt wie warmes Wasser ein Atoll. Sie beruhigt mich, redet mir gut zu, drückt mir einen Kuss auf die Stirn, im Atem ein Gemisch aus Wein und Pfefferminzzahnpasta. Und so voller Liebe. Selbst heute noch kann der leicht säuerliche Geruch von Wein für mich Liebe bedeuten.
War Papa nicht da, waren die besten Nächte die, in denen Mama sagte: Na gut, Hannybobs, du kannst, dann waren alle Hexen vergessen, dann sprang ich glücklich auf, packte den Bären Toffee beim abgewetzten Arm, folgte ihr durch den Flur bis zu ihrem warmen Bett und durfte den Rest der herrlichen traumlosen Nacht bei ihr schlafen, das Herzklopfen ging weg, die Ängste verflogen, mein Atem war tief und ruhig wie das Meer im Sommer, und ich sog ihren Duft ein, selbst gemachtes Parfum, selbst gemachte Seife, Mamaduft.
Der Morgenmantel hüllt mich ein und hält mich warm. Meine nackten Füße finden die Hausschuhe auch in der mondbeschienenen Dunkelheit. Ich erkenne Kessel und Teekanne, aber unweigerlich angezogen wird mein Blick von der Aussicht. Ich werde es tun. Ich werde einen Blick auf den Blackwater werfen.
Es ist immer das Gleiche. An manchen Tagen kann ich unmöglich hinschauen. Dann lasse ich rund um die Uhr die Vorhänge zu, verstecke mich. An ganz üblen Tagen drehe ich mich, wenn ich durch die Brasserie gehe, um mir Frühstück zu holen, bewusst von dem großen Erkerfenster weg, von der Aussicht, dem Herzstück des Hotels. Dann merke ich, dass manche Gäste komisch gucken. Warum dreht sie sich weg?
Dann wieder, an Tagen wie heute, lasse ich es zu, schaue hin. Auf meinen Feind. Mein Leben. Mein Zuhause. Meine Mauern. Auf den fließenden Blackwater, teils Meer, teils Fluss, teils salzig, teils Sarg. Vier Teile, die eine einzige schiere Angst ergeben.
Mit einem Ruck, als würde ich mir ein Pflaster abziehen, reiße ich die Vorhänge zurück. Da ist er. Er ist nicht verschwunden, der Blackwater. Er fließt am Hotel vorbei, gleitet als tiefes, pochendes Dunkel von West nach Ost. Darin spiegelt sich der Septembermond als silberne Kopfsteinpflasterbahn. Der Nachthimmel ist wolkenlos. In der Ferne flimmern am Rand der schwarzen Fläche die winzigen orange- und scharlachroten Lichter von Goldhanger.
Ich möchte ihn riechen. Ich muss ihn atmen. Sonst kann die Angst wiederkommen.
Das ist die mir verordnete Therapie, mich aussetzen.
Passend zum historischen Kern des Hotels aus Regency-Zeiten hat mein Zimmer ein schönes Schiebefenster. Ebenso passend ist es alt und klemmt und lässt sich nur mit Mühe öffnen, aber als ich es endlich schaffe, werde ich belohnt. Es muss Hochwasser sein, jedenfalls riecht die Luft großartig, süß und salzig und eher nach Sauerstoff als nach Watt und gärendem Schlickgras.
Ich atme tief durch. Die Morgendämmerung ist erfüllt von den nicht endenden Schreien der Wasservögel. Pfeifenten, Brandenten, Steinwälzer? Ich bin nie ganz sicher, auf dieser Insel gibt es so viele Arten, sie singen fast den ganzen Tag und oft auch die ganze Nacht. Wenn ich mich anstrenge, sehe ich sie; vielleicht hat das Öffnen des Fensters sie aufgeschreckt. Wie kleine ängstliche Gespenster flattern sie ins Dunkel davon.
Und was ist das?
Da unten am Steg liegt ein kleines, aber elegantes Speedboot. Ich habe es noch nie gesehen. Wem auch immer es gehört. Freddy? Sein Ersatzboot? Aber es wirkt so schnittig. Teuer. Vielleicht gehört es einem Gast? Es gibt welche, die mit dem eigenen Boot kommen. Wenn ich mich mal traue, über den Blackwater zu schauen, sehe ich so einige Boote.
Die Angst rumort.
Ich werde. Ich kann. Warum nicht? Jetzt? In dieses schicke kleine Boot springen, die Leine einholen und losfahren. Es muss ja mal ein Tag, eine Stunde, ein Augenblick kommen, da die hereinströmende Flut in meinem Kopf sich zurückzieht. Mir ist gesagt worden, dass das irgendwann passiert, vielleicht ist der Augenblick jetzt da, unerwartet, aber ersehnt. Eine Tür, die sich öffnet.
Kann das sein? Jetzt?
JETZT.
Diesen kostbaren Moment der Unerschrockenheit darf ich nicht vergeuden.
Wenn ich das Boot nehme, ist das Diebstahl, aber wen kümmert’s? Sobald ich drüben bin, gebe ich es ab.
Eine brennende Hoffnung. Kaum auszuhalten.
Anziehen. Fertig. Ich öffne die Zimmertür und spähe hinaus, als hätte ich vor, eine Straftat zu begehen. Wahrscheinlich tue ich das.
Im Flur herrscht Stille, der Rauchmelder betrachtet mich mit einem roten Insektenauge. Bei den Gästen in Zimmer 14 ist es ruhig. Noch kein Zimmermädchen in Sicht.
Nichts und niemand hält mich auf.
Ich laufe den Flur hinunter und biege links ab. Der Weg durchs Haus wäre der kürzeste, aber den will ich nicht nehmen. Da könnte ich gesehen werden. Ich habe schon für genug Scherereien gesorgt.
Ein zweites Mal linksherum, dann komme ich zur äußeren Feuertreppe. Mit einem Metallriegel abgesperrt. Ich weiß, dass hier kein Alarm ausgelöst wird. Man kann die Tür einfach öffnen. Und hinter der Tür, das weiß ich auch, beginnt der steil abfallende steinige Strand. Über den werde ich laufen, knirschenden Kies unter den Stiefeln, dann klettere ich auf den Steg, rutsche hinunter ins Boot, mache es los, lasse den Motor an und fahre davon. Entkomme meinem Gefängnis.
Schweißnass vor Aufregung, nervös, voller Zweifel angesichts der Unmöglichkeit, ziehe ich den Metallriegel zurück. Mit einem Laut, der klingt wie ein Vogelkreischen, schwingt die Tür auf. Und kaum betrete ich den rasselnden Kies, passiert es.
Natürlich. Ich wusste es. Wem hab ich hier was vorgemacht? Was hab ich mir gedacht? Wozu?
Angst brütet neue Angst aus.
Die Ringelgänse schimpfen, sie spotten. Buhen die dumme Frau auf dem Strand aus, diese ängstliche junge Frau, die da reglos im Mondlicht steht, während ihr Hirn kreuz und quer schießende Blitze produziert wie die Leitungen im Ostflügel, den wir noch nicht fertig haben.
Als Erstes schnürt sich mir die Kehle zu, als würde ich gewürgt. Was hat die Therapeutin gesagt? Das Wort Angst geht auf das lateinische angustus zurück, Beklemmung, oder ango: zusammenschnüren, würgen.
Jetzt kommt die Taumeligkeit, schrecklich, wie Wasser im Gehirn, verschwommene Sicht, manchmal erblinde ich ganz. Dann spüre ich mein Herz, es schlägt, wie wenn ein Pavian auf eine Trommel eindrischt, bum, bum, bum, schmerzhaft, wild, bedrohlich. Und ich weiß, wohin das führen kann: Manchmal ist es so schlimm, dass ich das Bewusstsein verliere. Ich habe gelesen, dass das tatsächlich tödlich sein kann – selten, aber es kommt vor –, extreme Tachykardie, eine Panik, so schlimm, dass man daran stirbt. Und allein das zu denken macht es noch schlimmer.
Angst brütet Angst aus, die Angst ausbrütet. Mein Herz schmerzt, heftig, viel zu sehr. Beängstigend, wie weh das tut. Als wollte es im Brustkorb zerspringen.
Zurück, nichts wie zurück. Hastig, zitternd, gehe ich wieder ins Haus, kehre dem Fluss den Rücken. Heute werde ich nicht noch mal hinschauen.
Die Tür fällt zu, und mich umgibt Stille. Ich bin geschlagen. Wie üblich.
Voller Scham angesichts meiner Feigheit lehne ich mich rücklings an die Wand und lasse mich zu Boden gleiten.
Der Herzschlag verlangsamt sich, die Panik geht zurück – statt ihrer kommt nun die Trauer. Tränen laufen. Heißes, salziges Wasser. Warum produzieren wir, wenn wir traurig sind, heißes salziges Wasser?
Es ist einfach Wasser. Und ich produziere es in Mengen. Es tropft mir vom Kinn und läuft zwischen den bleichen Fingern hindurch.
Ach, Hannah, kleine Hannyboby, du wirst einfach nicht damit fertig.
2
Meine Jeans sind sauber, die Tränen getrocknet, das Hemd makellos, weiß und frisch gebügelt, und der knallrosa Kaschmirpulli liefert das kleine Extra, ist passend für eine, die in einem High-End-Hotel arbeitet, wenn auch nur im Büro. Ich brauche kein Business-Outfit wie Leon, der Concierge, oder Alistair, der Manager, aber wenn ich in den öffentlichen Bereichen auftauche, wird doch ein »respektables« Aussehen erwartet.
Es wird nicht erwartet, dass ich im Morgengrauen an den Strand runtergehe und Boote klaue, das wäre nicht »respektabel«; und es ist auch nicht erwünscht, dass ich, wenn Elena, das polnische Zimmermädchen, mit einem Stapel frischer Kissenbezüge den Flur entlangkommt, auf dem Boden hocke und vor Angst und Kummer heule.
Zum Glück konnte ich mich in einen dunklen Winkel zurückziehen und bin nicht gesehen worden.
Jetzt ist Elena hier. Winkt mir zu, als ich mich auf den Weg zur Rezeption mache. Sie schiebt ihren Wagen mit Wischmopp, Lappen und Putzmitteln, mit schicken kleinen Seifen, Earl-Grey-Teebeuteln, winzigen The-White-Company-Shampoo-Flaschen und Nespresso-Kapseln vor sich her. Das Management hält große Stücke auf sie, denn sie braucht gerade mal achtzehn Minuten, um ein Zimmer perfekt neu herzurichten.
»Schöner Tag heute!«, sage ich und täusche prächtige Laune vor.
Elena lächelt gewohnt schräg. Dann wedelt sie mit der Hand, als wüsste sie von einem delikaten Geheimnis. »Die Leute in der 14, mein Gott, Hannah!«
»Haben sie das Bett endlich kleingekriegt?«
Sie beugt sich vor, doch gerade da kommt Owen vorbei, der rosige junge Souschef, hastet Richtung Küchen, knöpft sich noch im Laufen die weiße Kochjacke zu. Öffentlich über Gäste zu tratschen ist strikt verboten, also weichen wir schuldbewusst voneinander zurück.
»Bis später, Elena!«, zwitschere ich, und sie grinst, und wir gehen jeweils unserer Wege, ich den Flur hinunter zur Rezeption. Ich begrüße Danielle – sie stammt aus der Gegend, ist blondiert, auf herbe Art hübsch, stark geschminkt, dreißig, klug, freundlich, wenn auch immer eine Spur distanziert. Kann sein, dass sie mit Logan Mackinlay schläft, dem Obermacker von genialem Chefkoch. Vielleicht hat sie auch mit ihm geschlafen, und sie haben Schluss gemacht. Auch über Angestellte kursieren Gerüchte; ich höre so einiges.
Danielle beugt sich über das BUCH.
Seit dem Tag der Wiedereröffnung führt das Stanhope ein großes, altmodisches Gästebuch. Ganz bewusst altmodisch, als eine Art Nachklang aus der Blütezeit des alten Stanhope. War meine Idee.
Genauso gut hätten wir mit Tablets und E-Signaturen arbeiten können, wie alle es tun, aber wir wollten lieber ein altes Reservierungsbuch mit Schnörkeln auf dem Ledereinband, und dazu haben wir ein paar edle Visconti-Füller gekauft. Das sagt dem neuen Gast: Dieses Hotel ist anders, hier herrscht Luxus. Bitte tragen Sie sich hier ein. Wir bestehen darauf, dass wirklich jede und jeder sich einträgt. Dieses Buch ist die Familienbibel des Stanhope. Es lügt nicht, es enthält die ganze Wahrheit.
Der Anblick des Buches versetzt mir regelmäßig einen kleinen Stolz-Kick. Meine Idee.
Ich betrete die große Wendeltreppe, eins der Prunkstücke in dem historischen Gebäude. Letztes Jahr ist sie renoviert worden, jetzt hängen hier auf blau-weiß gestreifter Regency-Tapete typische Bilder, Szenen von den Küsten East Anglias, Boote mit roten Segeln auf dem Stour, Austernfischer auf der Insel Mersea.
Und wenn ich die Treppe hochgehe, erlebe ich in der Regel ein zweites kleines Hoch, denn ich habe das Design-Team auf diese Tapete gebracht, eine Art Spiegel für den Himmel, die Luft und das Wasser draußen. Die wunderschönen Ölbilder und Zeichnungen kamen von Oliver, der sie vermutlich ohnehin besaß; wahrscheinlich hingen sie in einem seiner vielen Häuser.
Hinein ins Büro. Es ist modern, ein Großraum, aber stilvoll.
Loz, schon in die Arbeit vertieft, starrt auf ihren Bildschirm. Stellvertretende Chefin. Dreiundvierzig. Geschieden. Humorvoll. Dunkler Typ. Halbitalienerin. Gern ironisch. Abtrünnige E-Dampferin, zur Zigarette zurückgekehrt. Loz Devivo. Als ich hier anfing – scheint mir ewig her, war aber vor gerade mal zwei Jahren –, habe ich sie gefragt, wie sie zu diesem ungewöhnlichen Namen gekommen ist. »Süße!«, sagte sie. »Getauft bin ich auf Lola Devivo. Überleg mal, wie es ist, Lola Devivo zu heißen. Die Leute denken sofort, du bist Sexarbeiterin. Und wenn ich mich Lolly Devivo nenne, denken sie, ich bin Sexarbeiterin im Mini-Schottenrock. Also hab ich mich für Loz entschieden.«
Jetzt ist Loz still. Ihr Mund formt ein halb abwesendes, halb freundliches Hallo, dann wendet sie sich wieder der Arbeit zu.
Ich lasse mich in einen von Olivers Tausend-Pfund-Bürostühlen plumpsen und drehe mich so, dass ich meinen Bildschirm im Blick habe. Eine Großaufnahme aus der salzweißen Atacama-Wüste: meine Desktop-»Tapete«. Kein Wasser. Nicht ein Tropfen. Der buchstäblich trockenste Ort der Erde, Copiapó, Chile. Mit ein paar Klicks gelange ich auf die Website, die ebenfalls ich gestaltet habe, gleich nach meiner Ankunft.
Das war, nachdem ich von meinem Job als PR-Frau auf den Malediven abgeworben und zur Markenmanagerin befördert worden war, eine meiner Hauptaufgaben. Eine Marke aufzubauen. Uns eine schicke Website einzurichten. Uns wieder zu Glamour zu verhelfen. So hat es mir Oliver voller Eifer, einen geradezu leidenschaftlichen Ausdruck auf dem hübschen Gesicht, eingeschärft.
Und genau das habe ich getan. Wobei meine erste echte Aufgabe darin bestand, den Namen des Hauses zu ändern. Über Jahre kannte man es als das Stanhope Gardens Island Hotel. Das war meiner Meinung nach nicht nur abtörnend lang, sondern auch eine Lüge. Es gibt keine großartigen Landschaftsgärten, sondern nur ein paar kleine Rasenflächen und grüne Winkel; die Insel ist viel zu klein, achtundneunzig Prozent der Fläche sind ohnehin öffentliches Eigentum und stehen unter höchstem Naturschutz, ein urwüchsiges Waldgebiet, Blumenpflücken verboten, ein Ort von wissenschaftlichem Interesse, lauter ehrwürdige alte Bäume, seltene Vögel und Säugetiere. Rote Eichhörnchen, Haselmäuse, Feldhasen, Baummarder.
Auf unsere Gärten, die gerade so als Gärten durchgehen, sind wir weniger stolz. Also habe ich das »Gardens« rausgeschmissen und den Namen auf The Stanhope verkürzt. Und ich wusste sofort, das ist es. The Stanhope. Das knüpft an die Geschichte an, kommt aber nicht pompös daher. Als ich Oliver den Vorschlag unterbreitet habe, trat ein Leuchten in seine graugrünen Augen. Yes!
Ich lehne mich zurück und klicke mich durch die Website. Darauf bin ich immer noch stolz. Die vielen ausgeklügelten Fotos! Monatelange Arbeit. Weinkaraffen kunstvoll vor den Fenstern der Brasserie arrangieren. Abwarten, bis die Sonne so steht, dass ein Strahl die rote Flüssigkeit zum Funkeln bringt. Auf dem Wasser im Hintergrund Jachten mit weißen Segeln.
Allein für dieses Bild haben wir zwei Tage gebraucht; die Kunst war, eine Atmosphäre von diskretem, unangestrengtem Luxus zu erzeugen, der nichts Protziges hat. Nachdem wir live gegangen waren – Website, Anzeigen, Info-Aufenthalte für Journalisten –, hat sich die Zahl der Buchungen innerhalb eines Monats verdoppelt und dann noch mal verdoppelt. Oliver hat Champagner ausgegeben.
Klick. Das nächste Bild. Draußen. Der Fluss, blau und gutartig. Ein Tisch, auf dem Austern in ihren halben Schalen im Sonnenlicht schimmern, daneben eine kleine Schüssel mit Mignonette; eine hübsche junge Frau im Sommerkleid mit einem Sonnenschirm; ich weiß noch, dass sie elend gefroren hat, es war Herbst, sie hat die ganze Zeit auf den Fotografen geflucht, komm endlich aus dem Knick, du Idiot.
Und noch ein Foto. Der Anleger. Freddy Nix, der Fährmann. Diese Aufnahme soll zeigen, wie besonders das Stanhope ist: abgeschieden – in sechs Jahren Hotel-PR-Arbeit lernt man, dass Touristen auf das Wort »abgeschieden« fliegen –, auf einer eigenen kleinen Insel gelegen, mit Muntjak-Hirschen im Märchenwald. Der ultimative Schlupfwinkel Englands.
Plötzlich fällt mir etwas auf; ich beuge mich stirnrunzelnd vor. Auf dem Foto ist ein Boot zu erkennen. Ist das das kleine Speedboot, das ich heute früh im Dunkeln gesehen habe? Könnte sein. Schwer zu sagen.
Ein unbehagliches Kribbeln, stärker als sonst, kriecht bis in meine Fingerspitzen auf der Tastatur. Ich drehe mich vom Bildschirm weg und will Loz fragen, ob sie das Boot auch gesehen hat oder jemanden kennt, der ein schwarzes Speedboot besitzt, aber sie ist nicht da. Ich habe nicht gehört, wie sie gegangen ist, war wohl zu vertieft. Es muss schon Mittagszeit sein.
Mein Telefon gibt einen Gong von sich. Eine Nachricht. Der verrückte Verlobte. Ben!
Han, Süße, wir habens gerade getan.
Sofort muss ich lächeln. Mein Mann meldet sich. Der Mann, den ich liebe. Mein Pub-Koch mit den sexy Tattoos. Allein, indem er eine Nachricht schickt, macht er mir klar: Das Leben ist nicht nur schlecht. Immerhin habe ich ihn. Ich antworte.
Was getan? Den Pub in die Luft gejagt? Ich hab dir gesagt, Schnellkochtöpfe sind gefährlich.
Haha, sehr witzig, nein, wir haben Mittagstisch angeboten, das erste Mal, 30 Gedecke, alle Tische besetzt, Kev sagt, wir mussten Leute wegschicken!!!
Mein Grinsen wird breiter. Er ist so offenkundig begeistert, und das soll er auch sein. Kaum jemand hat eine Vorstellung davon, wie schwer es ist, einen Pub mit Küche aufzuziehen. Vielleicht, weil man so selten etwas davon mitbekommt.
Wow! Ich bin stolz auf dich, Schatz! Ich wünschte, ich wär da, dann könnten wir in Sekt untergehen. Es wäre so was von verdient. Du hast so hart gearbeitet. Das musst du feiern
Pause. Er schreibt …
Wir werden feiern, Hannah. Wie wär’s mit einem kurzen Drink morgen im Stannie? Und du kommst von dieser Scheißinsel runter. Wenn es sein muss, trag ich dich.
Oh! Sehr männlich. Gefällt mir. Ja, morgen, bitte
Okay, muss Schluss machen, der Wahnsinn hier, aber yay, xx
Schon ist er offline. Ich lege das Telefon weg und strecke mich, das Grinsen noch im Gesicht. Ben glaubt an mich. Vielleicht hat er recht damit? Noch besser gefällt mir aber die Vorstellung, wie er mich buchstäblich über das Wasser trägt, weg von hier. Eine Braut über der Schwelle.
Ich stehe auf, gehe hinüber zur Fensterfront, nutze den Schub guter Energie und befehle mir, mich an der großartigen Aussicht über den Blackwater zu erfreuen. Positiv zu denken.
Ein Blick hinaus. Das kleine schwarze Boot liegt nicht mehr am Steg. Es ist im Dunkeln gekommen, und jetzt ist es verschwunden. Über den Blackwater. Da ist nichts dabei, schätze ich. Oder? Wir haben einige richtig reiche Gäste; die tun grundsätzlich, was ihnen gefällt.
3
Der englische Schampus ist alle, die Flasche liegt auf dem Boden. Wir müssen sie im Getümmel runtergeschubst haben. Die Sektflöten sind geleert, eine ist umgefallen. Mein Herz rast noch vom Sex. Ein angenehmes Rasen.
Ben steigt aus dem Bett und in seine Klamotten, Rugbyspielerbeine in dunkle Jeans, muskulöse Arme in die Ärmel eines weißen Hemds. Ich würde gern liegen bleiben und ihn anhimmeln, aber ich will ihn auch zur Fähre bringen, denn jede Minute mit ihm ist kostbar. In meiner Isolation.
»He, nicht so schnell, ich will mit zum Anleger.«
Er knöpft das Hemd zu und schaut vage zu mir.
»Das ist doch nicht nötig, Süße.«
Ich fange seinen Blick ein, werde ernst.
»Doch. Du ahnst gar nicht, wie sehr du mir fehlst.«
Seine schönen Züge werden weicher, jungenhaft freundlich, sodass er eher aussieht, als wäre er achtundzwanzig, wie ich, und nicht vierunddreißig. Er beugt sich über mich und küsst mich sanft und zärtlich, viel sanfter als noch vor einer halben Stunde. Dann lässt er seinen Blick durchs Zimmer schweifen, über die Flasche, die Gläser, das zerwühlte Bett.
»Sieht aus, als wär eine Bombe hochgegangen.«
»Gib nicht so an. Vielleicht eine kleine Granate.«
Er lacht, während ich schnell meine Sachen zusammensuche. Dann schaut er mich an und sagt: »Na, dann komm, Frau. Beeil dich.«
Gehorsam ziehe ich mich an bis hin zu Mantel und Stiefeln, obwohl es ein milder Abend ist. Arm in Arm gehen wir den Flur hinunter, an der Rezeption vorbei und über den klirrenden Kies zum Anleger; die hellrote Fähre, die hier ständig verkehrt, ist nicht mehr weit; heiter gleitet und schaukelt sie durch die leichte Dünung des Blackwater. Ein Boot wie aus einem Kinderbuch. Eins, das mit Lokomotiven reden kann.
Mein Kopf liegt an Bens Schulter. Ich fühle mich immer noch postkoital, leicht verträumt. Dämmrig. Ben ist sehr still.
Ich hebe den Blick, sehe ihn an. »Alles okay?«
Nachdenklich schaut er über die Insel, auf den Teil des Hotels, der noch ungenutzt dasteht, den Ostflügel mit seinen leeren Räumen. Vielleicht aber auch auf den dunklen Wald, der gleich dahinter beginnt. Oder er starrt einfach ins Leere und denkt nach, denkt zurück. Hin und wieder hat Ben Anwandlungen von Traurigkeit, sie kommen ohne Vorwarnung. Er hat früh die Mutter verloren, wie ich, das ist eins der Dinge, die uns von Anfang an verbunden haben.
»Ben?«
Plötzlich ist er wieder da.
»Oh, entschuldige, Han. Ist nur wegen des Pubs. Bestellungen. Mehrwertsteuer. Und, und, und.«
Ich drücke seine zerkratzte, kräftige Kochhand.
»Ich bin stolz auf dich. Dass du es gemacht hast. Alle waren so voller Zweifel – und jetzt?«
»Danke, mein Schatz, aber … es liegt noch ein langer Weg vor uns.« Sein Blick wandert zum Fluss. »Okay, die Fähre ist da. Ich muss zurück, bevor Charlie sich an den Rouladen versucht. Wir haben für heute Abend eine Menge Reservierungen.«
Er grinst, ich lächle zurück, wir winken, und er springt hinunter auf die Fähre, auf der sonst so gut wie niemand ist. Ein Weilchen bleibe ich stehen und sehe zu, wie das Schiff etwas zurücksetzt, wendet und aufs Festland zusteuert, wie ich es nicht kann.
Sofort verdüstert sich meine Laune. Ich bin wirklich stolz auf meinen Verlobten. Der Mann, den ich liebe, vollbringt Großes. Koch war er schon länger in dem Pub, aber ganz übernommen hat er den Laden erst vor ein paar Wochen. Umso schöner ist dieser schnelle Erfolg.
Aber was, wenn es zu gut läuft? Wenn es ihn auffrisst? Dann wird er noch weniger Zeit haben, herzukommen und mich zu besuchen.
Was meine Einzelhaft noch verschärfen wird.
4
Wo bist du, Han?«
»Ach. Dreimal darfst du raten.«
Im Hintergrund von Kats Schweigen summt es wie in einem Londoner Restaurant oder einer Bar. Es ist drei Uhr nachmittags. Um was handelt es sich: ein spätes Mittagessen, eine Ganztagssauftour, einen megafrühen ersten Drink?
»Okay«, sagte sie schleppend, »dreimal darf ich raten …« Die Bargeräusche ebben kurz ab, und etwas neidisch stelle ich mir vor, wie sie nach ihrem Glas greift. Den Drink schwenkt. Eine Olive hin und her schubst, während sie fortfährt: »Ich weiß! Du bist in Buenos Aires. In dem tollen Steakhouse, in dem wir damals waren, in unserem Gap Year, da am Wasser. Cabaña Las Linas. Weißt du noch? Da bist du also noch mal hin! Wow. Nicht schlecht. Nein, Moment, warte, da kannst du gar nicht hin, da sind wir ja abgehauen, war meine Idee, stimmt’s? Soz boz apolibobs.«
Lachend gehe ich weiter auf einem der Wege, die sich durch den Dohlenwald schlängeln. Äste knacken unter meinen Wanderschuhen, und in den Eichen krächzen Elstern. Man nimmt an, dass die Insel vor mehreren Hundert Jahren nach ihnen benannt worden ist, nach den Krähen und Elstern und Dohlen. Es gibt so viele Vögel in diesen Wäldern, genau wie draußen auf den Salzmarschen. Überall Vögel. Vögel, die im Geäst sitzen und sich streiten, die das Watt absuchen oder über die Wellen schlittern. Die uns beobachten. Mich beobachten.
Beobachtet mich jemand?
Aufgescheucht drehe ich mich um, spähe durch Schwarzdorngestrüpp. Dieser östliche Weg ist schon sehr verlassen.
Nichts. Paranoia ist auch eins der Symptome, die zu meinem Syndrom gehören. Ich muss sie in den Griff kriegen.
»Han?«, sagt meine Schwester.
»Das funktioniert nicht.«
»Was?«
»Soz und boz an apolibobs anhängen.«
»Ja, okay, okay, ich mach’s besser, versprochen, Robinson-bobs Crusoe-dogs. Oh, ja? Noch ein Martini? Warum nicht? Danke. Sechs sind bestimmt genau richtig. Ja.«
Ich habe keine Ahnung, mit wem sie da nuschelt. Wahrscheinlich gibt es einen neuen reichen Freund. Sie hat so viele. Sie spielt mit ihnen, und es scheint ihnen zu gefallen. Ich kann froh sein, dass sie zwischen den Drinks auch noch mit mir redet. Ich vermisse meine Schwester schrecklich. Mit am schlimmsten daran, Robinson-bobs Crusoe-dogs zu sein, ist, dass ich physisch von ihr getrennt bin, von der Person, die mir – neben Ben – im Leben, in meiner Welt, in allem am nächsten ist.
Schon als kleine Mädchen waren wir unzertrennlich, wir sind im Abstand von nur einem Jahr geboren, sahen gleich aus, waren praktisch Zwillinge. Nur dass Kat schon immer viel hübscher und klüger war als ich. Es ist, als wäre ich die Betaversion, der Prototyp, und sie die Alphavariante, das vollendete Geschöpf.
Ihre Wangenknochen treten makellos hervor, meine fallen kaum auf; ihre Stupsnase ist perfekt geschwungen, meine hat einen hässlichen Höcker. Ihr blondes Haar sieht immer toll aus, meins so einigermaßen – wenn ich mir viel Mühe gebe.
Als wir klein waren, hieß es immer, wie hübsch wir seien, und als wir heranwuchsen, blieb es für mich dabei, ich war »hübsch«, »irgendwie hübsch«. Meine Schwester dagegen, meine so geliebte wie verwöhnte kleine Schwester Katalina Langley, Kattydogs, KattyKat, Kat, die Tarotkarten lesende, Sterne deutende, Witze reißende, Handtaschen verlierende, lustige, mehrsprachige, Superminis tragende, Unterwäsche vergessende, Ukulele spielende, ultratollpatschige, Gras rauchende, französische Chansons singende, Runen entziffernde, rebellische Schulhofkönigin der St-Osyth-Gesamtschule Maldon, war und ist schön.
Das habe ich jedenfalls bei Teenie-Partys von Jungen zu hören bekommen. Sie schlichen sich, ein Bier in der Hand, an mich heran, als hätten sie vor, mich anzubaggern, doch dann schlürften sie ihr Bier und blickten versonnen hinüber ins Zentrum des Geschehens, wo Kat war, in ihren Jeans-Hotpants oder ihrem »albernen« kleinen roten Cheerleader-Rock und auf jeden Fall umringt von einem Haufen Jungs, die wie Welpen um ihre Aufmerksamkeit rangelten. Und irgendwann seufzten die Typen mit dem Bier wehmütig, beugten sich zu mir herüber und sagten: »Deine Schwester sieht echt super aus.«
Ab dann starrten sie trübsinnig in ihr Bier, wobei es hin und wieder vorkam, dass ein etwas höflicherer schnell hinterherschickte: »Entschuldigung, ich wollte nicht … du weißt schon … du bist, also, du siehst auch echt gut aus …«
Manchmal habe ich mit einem von denen, die so gelogen haben, geknutscht, manchmal habe ich sogar mit einem geschlafen; es waren die Brosamen, die unbemerkt von Kats Tisch gefegt wurden.
Das hat mich nicht gestört. Es stört mich nicht. Nichts stört mich. Kat ist Kat, ich liebe sie abgöttisch, und sie liebt mich genauso. Wir machen alles zusammen. Sind beste Freundinnen, Schwestern, Seelenverwandte, manchmal noch mehr. Kat war es, die mit vielleicht sechs Jahren angefangen hat, aus Quatsch an jedes Wort »bobs« oder »dogs« anzuhängen oder auch »jogs« oder »pops« oder »gogs«. Eine ganz persönliche Kunstsprache. Unsere Eltern haben ein bisschen mitgespielt, aber eigentlich war es unser Schwesternding, etwas nur zwischen uns, und über die besonders gelungenen Formen, die albernsten, die am aberwitzigsten verdrehten, konnten wir uns stundenlang amüsieren.
Soz boz apolibobs.
Eigentlich nicht schlecht.
»Kat?«
Immer noch Bargeräusche.
»Kat, sag was, sprich mit mir! Ich sitze auf einer beschissenen Insel fest.«
»Entschuldige, Han. Ich hab gerade versucht, diesem Barmann zu zeigen, wie ein Dirty Martini geht. Aber er hat’s vermasselt und Angostura genommen. Jetzt bin ich durch, glaube ich. Am liebsten würde ich nach Hause fahren und Hundejäckchen stricken. Für blinde Hunde. Blinde Hunde für die Helfer. Superidee für eine Wohltätigkeitssache. Oder Katzen, die auf den Hinterbeinen tanzen, eine Katze mit einem Gesicht wie Jane Witham. Weißt du noch? Alles in Ordnung bei dir?«
»Ja, alles in Ordnung.«
»Wirklich, Süße?«
»Ja. Es ist nicht einfach, aber ich komme klar.«
»Okay, okay. Ich besuche dich, sobald es geht, versprochen.« Wieder verstummt sie, wehmütig lausche ich dem Gelächter, dann sagt sie: »Wie geht’s Ben? Wie geht’s dem verrückten Verlobten?«
»Gut. Bei ihm ist es hektisch. Mit dem Pub läuft’s fantastisch.«
In meinen Ton hat sich ein Hauch Selbstmitleid geschlichen. Es klingt durch, dass ich einsam bin. Ich versuche, das in den Griff zu kriegen, indem ich schneller gehe. Bald öffnet sich der Wald zu einem weiteren steilen Kiesstrand hin. Zum x-ten Mal heute werde ich daran erinnert, dass ich auf einer Insel bin. Der riesige Himmel über der Küste von Essex ist blässlich blau, aber in Bewegung, denn ein warmer, auffrischender Wind treibt eine Regatta von Wolken über ihn hin. Sportwetter.
Es muss Ebbe sein. Im beigegrauen, nass schimmernden Watt jenseits des Kiesfeldes sind die Spuren von Wasservögeln zu erkennen. Säbelschnäbler? Austernfänger? Die Abdrücke sind filigran, immer gleiche japanische Schriftzeichen, die sich in einer traurigen, schön geschwungenen Schleife aneinanderreihen.
Kat ist wieder verstummt. Und das Flirren und Rauschen der Bar höre ich auch nicht mehr. Wo ist sie?
»Schwesterchen?«
»Draußen. Uber. Hab nachher noch ’ne Tarotsession. Dann Deliveroo. Entspannen. Bett. Ich hab zu viel getrunken.«
»Es ist noch nicht mal vier!«
»Ich weiß. Mein Gott, ich weiß. Bin ich ein Alkibobs?«
»Vielleichtibobs.«
Wir lachen beide … ich allerdings nur kurz. Die Frage bleibt. Warum schiebt Kat den so oft angekündigten Besuch auf Dawzy ständig vor sich her? Ich weiß, sie ist superbeschäftigt in London, liest gegen Geld Tarotkarten, geht mit Geschäftsleuten essen, die sie aussichtslos anhimmeln und ihr teure Wäsche kaufen, hilft einmal die Woche ehrenamtlich im Obdachlosenasyl, tritt ab und zu in einer Comedy-Burlesque-Show auf – sie hat aus ihrer Tollpatschigkeit eine Art Erotikkunst gemacht: stürzt von Poledance-Stangen ab, verliert ihren BH –, aber trotzdem; sie ist keine voll geforderte Herzchirurgin, sie hat genug freie Zeit und kann sich aussuchen, an welchen Tagen sie arbeitet und in welchen Wochen sie auf alles pfeift und Kerala bereist. Immer wieder.
Aber sie setzt sich nicht hinters Steuer, um hierherzukommen, schafft es nicht auf Freddy Nix’ Fähre. Ich bin keine zwei Stunden von London entfernt. Und meine Schwester? Seit Ewigkeiten nicht gesehen.
Mir kommt ein Gedanke.
Ein trauriger, schlimmer Gedanke.
Bestimmt ist es das.
»Sag mir, was der eigentliche Grund ist, warum du nicht kommst, Kat.«
Schweigen. Eine Autotür fällt zu.
»Sag’s mir, Kat!«
Sie seufzt. Tief. Ausgiebig. »Han, Süße, ich …«
»Wegen dem, was passiert ist, stimmt’s? An dem Abend. Das ist es, oder?«
Wieder Schweigen, kürzer diesmal. »Natürlich ist es das! Es verfolgt mich. Ich habe Albträume. Für dich ist es viel schlimmer, ich weiß, aber … mein Gott, es war so furchtbar. Ich meine, es war meine Schuld. Ich hab damit angefangen. Nackt baden? Um Mitternacht? Tolle Idee, Kattidogs, wirklich toll, Mann, Kat, du bist so bescheuert! Warum bin ich so bescheuert? Es tut mir so leid!«
»Es war nicht deine Schuld! Alle haben mitgemacht, alle waren betrunken.«
»Nein. Du kannst mich davon nicht freisprechen. Mein Gott.«
»Kat?«
»Ach, Scheiße, Mann, jetzt heule ich. Du fehlst mir so, Han, ich bin betrunken, und ich bin traurig, und der Fahrer ist besorgt, der guckt ständig in den Rückspiegel.« Sie lacht und schluchzt zugleich. »Ich mach lieber Schluss, sonst kommt der noch nach hinten und will mich trösten. Warum wollen sie mich immer trösten? Tschüs, Süße. Mein zarter Brandfackelschatz! Mach’s gut! Ich komme, ich versprech’s dir. Ich hab dich lieb. Ich komme bestimmt!«
Das Gespräch ist zu Ende, und ich stecke das Telefon ein. Beobachte einen grau-weißen Wasservogel, der direkt vor mir über dem salzigen Blackwater kreist. Elegant. Frei.
Mir geht durch den Kopf, was Kat gesagt hat, und ich fühle mich schlecht. Es war nicht Kats Schuld, nicht allein, jedenfalls nicht an dem Abend. Ich hätte etwas unternehmen müssen. Schließlich war ich immer die mit der Verantwortung, die große Schwester, diejenige, die ihren Abschluss gemacht und einen beruflichen Werdegang hingelegt hat. Und an dem Abend war ich im wahrsten Sinne des Wortes die Verantwortliche, ich war Hotelangestellte – und habe sie nicht aufgehalten.
Schlimmer noch, ich bin sogar mit ihnen ins Wasser gegangen, war voll dabei, in Hochstimmung, begeistert. Das habe ich nie zugegeben. Nicht einmal, als ich per Video in den Gerichtssaal in Colchester zugeschaltet war und aussagen musste. Da habe ich gesagt, ich sei beunruhigt gewesen und deshalb ebenfalls ins Wasser gegangen.
Das war gelogen. Ich musste lügen. Ich bin eine Lügnerin.
5
Es wird jetzt deutlich früher dunkel. Ich habe länger nicht darauf geachtet, aber heute merke ich es. Es wird schummrig in meinem Zimmer, ja, ich muss Licht machen, mein kläglicher Widerstand gegen die heranrückenden Heere des Herbstes.
Wie wird es im Winter sein?
Lieber nicht daran denken. Stattdessen starre ich auf das Fenster. Heute Abend ziehe ich die Vorhänge zu, verhülle meinen Kerkermeister. Ich kann nicht anders. Scheiß auf die Therapie, von wegen mich aussetzen! Es gibt Grenzen.
Langsam trete ich ans Fenster. Und … ziehe die Vorhänge nicht zu. Ich schaue raus und sehne mich.
Der Herbsthimmel ist von einer traurigen Schönheit. Wie Gaze treibt ein zarter Nebel über dem Blackwater Richtung Bradwell on Sea, als sei er die lang gezogene, schlanke Seele des sterbenden Flusses und schwebe bereits über ihm.
Hoch oben glimmen die ersten Sterne durch den Dunst über der Mündung. Wie Diamantnägelchen auf blauem Samt. Venus? Jupiter? Kat wüsste es.
Ich blinzle in die Dämmerung. Freddy Nix hat wieder angelegt und belädt sein Fährschiff. Leute mit riesigen Koffern: Die reisen ab. Es sind einige. Andere hüpfen mit kleinem Gepäck oder ganz ohne runter auf das große rote Boot: Angestellte. Freddy hat für jeden ein freundliches Grinsen. Freddy ist einmalig, an die fünfzig. Kennt praktisch jeden Pub rund um die Mündung, von Jaywick bis Heybridge, und ist in jedem gern gesehen. Er wohnt in Goldhanger, mit seiner fünfundzwanzigjährigen Freundin. Der neuesten. Georgia Quigley. Arbeitet bei Mersea Oysters. Liefert dem Mackster seinen Fisch.
Grob die Hälfte der Stanhope-Angestellten pendelt täglich auf Freddys Boot. Die meisten anderen haben ein Zimmer hier, fahren am Wochenende oder im Urlaub aber rüber aufs Festland. Die Chefetage kommt und geht, wie es ihr passt.
Nur eine bleibt immer hier. Robinson-bobs Crusoe-dogs. Ich. Gestrandet bei Iltis und Kreischeule. Die werden bald meine einzigen Freunde sein. Ich werde im Wald hocken und Beschwörungen vor mich hin murmeln. Mit den Eiben Zwiesprache halten.
Es reicht. Noch einen Abend in meinem Zimmer sitzen und lustlos Bücher weglesen, die ich vor allem der Länge wegen ausgesucht habe – damit sie Zeit ausfüllen –, oder apathisch in den Social Media herumwischen und grimmig alle beneiden, die ein Leben haben, das schaffe ich nicht.
Ich könnte Ben anrufen. Nein, kann ich nicht. Der Verlobte wird knietief in jus und moules stecken. Wer einen Drei-Mann-Gastro-Pub betreibt, hat abends um sieben keine Zeit für ausgiebige Videotelefonate.
Also trinken, im Spinnaker, der etwas lässigeren Bar hier im Hotel. Auch im Großsegel, der Brasserie, können Angestellte sitzen und trinken, aber eigentlich ist sie für die Gäste gedacht. Und zum Essen.
Schnell ein paar bessere Klamotten – schöner Pulli, anständige Schuhe –, und los geht’s.
Die Bar befindet sich im Zentrum des Hotels, nicht weit von der Rezeption, auf der anderen Seite der Brasserie. Ein schicker, heller, luftiger Raum mit Blick auf die kleine Terrasse hintenraus, wo unter Heizpilzen fünfeckige Holztische stehen. An den Wänden hängen Bilder von berühmten Jachten, riesigen aristokratischen Schiffen aus den 1920ern. Bestimmt hat manch einer von diesen Seglern damals, während der ersten Inkarnation des Stanhope als Vergnügungspalast, Kurs auf die Insel genommen, um sich ein paar der berühmten Cocktails zu gönnen.
Heute Abend ist der Spinnaker belebt, aber nicht hoffnungslos überfüllt. Das ist gut. Party brauche ich nicht. Wahrscheinlich brauche ich nie wieder Party. Auf der Suche nach einem Platz zum Trinken schaue ich auch hinaus zu den Tischen, dem Swimmingpool und dem Waldrand, der dasteht wie eine dunkle Wand. Die Heizpilze sind aus, die Terrasse verlassen. Komplett leer.
Ich rücke mir einen Barhocker zurecht und lächle Eddie, dem Barkeeper, kurz zu.
»Alles klar?«
Er lächelt zurück. Netter Typ, dieser Eddie. Australier. Sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, er schläft mit einem von den Zimmermädchen. Jeder schläft mit irgendwem. So ist es nun mal in großen und einsam gelegenen Hotels. Auf den Malediven gab es nur zwei Dinge, die man machen konnte: schnorcheln (was traumhaft war) oder mit irgendwem aus der Crew (variabel) Sex haben.
»Hallo. Wie immer, Hannah?«
»Jadi dadi.«
Keine Ahnung, wo das plötzlich herkam. Jadi dadi? Vielleicht einer von Papas schrägen Sprüchen? Eddie scheint es nicht aufgefallen zu sein. Er hat zu tun. Ich sehe ihm zu. Es ist immer interessant, Experten zuzusehen, die gern tun, was sie tun. Als Erstes gießt er einen guten Schuss von einem preisgekrönten Gin aus Mistley in das große Glas, dann gibt er eine silbrige Schaufel Eiswürfel dazu, wirft schwungvoll eingelegte Orange, Wacholderbeeren, Kardamom und etwas von seinem besonderen Chili hinterher, und dann füllt er das Ganze mit schäumendem Framlingham-Tonic auf.
Eddie nimmt das Mixen seiner Drinks sehr ernst. Mir ist es ernst mit dem Trinken. Es ist mein einziger Ausweg, meine persönliche Fähre nach Goldhanger. Ich bin die Einzige, die nicht mit irgendwem schläft, nicht einmal mit meinem Verlobten, dessen Besuche immer seltener werden.
Ich hebe das Glas, atme den Duft und den Sprudel, koste die Vorfreude aus. Eddies Gin Tonics sind grandios.
»Sind Sie schon länger hier?«
Oh Gott. Ein redseliger Gast. Oft finde ich es nett, mich mit Gästen zu unterhalten, heute nicht. Ich möchte einfach allein in einer Bar sitzen und mir in aller Ruhe einen anduseln. Aber ich darf nicht unhöflich sein.
Also pappe ich mir ein professionelles Lächeln aufs Gesicht und drehe mich zu dem Typen auf dem Hocker neben mir um. Um die vierzig, schöne Jacke, Samt-Loafer.
»Ja, schon … eine ganze Weile. Und Sie?«
Er streckt mir die Hand hin. »Ryan. Bin mit meiner Frau da, Hochzeitstag. Zwölf Jahre! Großer Gott!«, ruft er und lacht, als sei Verheiratetsein an sich schon ein Scherz. »Aber nur für eine Nacht. Wir haben einen Tisch im Großsegel. Ist es so gut wie sein Ruf?«
»Ja«, sage ich, »absolut.«
Das Hotel zu promoten ist mein Job, aber das Restaurant braucht keine Promotion. Es ist schlicht ausgezeichnet. Als Oliver das Stanhope gekauft hat, war ihm klar, dass er ein exzellentes Restaurant mit einem exzellenten Koch braucht. Das Haus bietet einen netten kleinen Fitnessraum, einen süßen Spa-Bereich und einen eleganten beheizten Pool, aber das war’s auch. Wenn man nicht gerade ein Segelnarr ist oder gern Vögel beobachtet oder Strandwanderungen macht oder sich Geschichten über Jungfrauen anhört, die von Piraten und Schmugglern entführt worden sind, oder sich gern mit Leon abgibt, unserem schweizerisch-deutschen Concierge mit seinem Imponiergehabe und den extrem tollen Armbanduhren, hat man eigentlich keinen Grund herzukommen, schon gar nicht in der Nebensaison, wenn der Pool dicht ist und das Wetter zum Segeln zu frostig. Deshalb wartet Oliver mit einer Küche und Weinen auf, die alle anderen im Umkreis von fünfzig Kilometern übertreffen.
Heilfroh greife ich das Thema auf. »Von unserem Koch haben Sie sicher gehört, oder? Logan Mackinlay. Schotte. Aus dem Connaught in London abgeworben. Es heißt, nächsten Monat kriegt er seinen ersten Michelin-Stern. Aber das ist ihm egal, er macht einfach sein Ding. Ein echtes Genie.«
Ryan strahlt. »Das klingt gut. Ich bin gar nicht so der Feinschmecker, aber meine Frau. Und solange sie glücklich ist …« Er zuckt die Achseln. »War sowieso ihre Idee, herzukommen, sie arbeitet für das Management hier. Wir kriegen Rabatt. Also …«
Er grinst und hebt seine Champagnerflöte. Eine Weile plätschert das Gespräch so dahin, wobei er es darauf anlegt, mich wissen zu lassen, dass er in der Immobilienbranche ist, und zwar sehr erfolgreich. Während ich an meinem Drink nippe, geht mir durch den Kopf, was er über seine Frau gesagt hat. Melissa. Den Namen habe ich schon gehört. Aus Olivers Mund. Irgendwas mit Finanzen. Vielleicht eine von der Bank? In London? Keine Ahnung. Ryan kippt den letzten schaumigen Schluck, und dann wirft er mir einen verschwörerischen Blick zu.
»Haben Sie gehört, was letzten Sommer hier los war?«
Stille. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, jeden Abend im Spinnaker zu sitzen und zu trinken: die Angst, dass jemand mir diese Frage stellen könnte. Was soll ich sagen? Ja, klar, ich war dabei, ich war besonders schlimm. Rufen Sie doch die Polizei.
»Nein. Irgendwas mit einer Party, die … aus dem Ruder gelaufen ist?«
Ein bisschen, Han.
Ryan schüttelt den Kopf. »Ein Freund von mir war an dem Abend hier. Er sagt, es ging hoch her.« Jetzt wird er auch noch rot … »Die Frauen, na ja … nackt. Nackte Frauen. Und was da so geredet wird!«
Es wird geredet? Mehr, als ich weiß? Was wird geredet?
Ich will das Gerede unbedingt hören, und ich will es überhaupt nicht hören. Was, wenn ich darin vorkomme? Oder Kat?
Ob ich will oder nicht, ich werde es hören. Ryan schwafelt sofort drauflos, er will den Tratsch unbedingt loswerden.
»Es wird ja noch verrückter: Anscheinend gibt es eine Frau, die seit dieser Sache mit dem Untergehen hier festsitzt. Hat wohl so eine Angst vor Wasser entwickelt. Stellen Sie sich das mal vor! Die kommt von dieser blöden Insel nicht weg.«
Ich öffne den Mund, habe aber keinen Schimmer, was ich sagen soll.
Ryan ist das egal, er fährt genüsslich fort. »Die reinste Freakshow, was? Aber es geht noch weiter. Melissa sagt, in der Geschäftsführung gibt’s Leute, die diese Irre loswerden, sie nicht mehr hier haben wollen. Die wollen sie loswerden. Aber das geht nicht, weil sie ja hier festsitzt, sie kommt nicht übers Wasser!«
Er lehnt sich zufrieden zurück und beobachtet, wie ich auf seine Geschichte reagiere. Ich versuche, das Zittern zu unterdrücken, mich nicht zu verraten, nicht zu erkennen zu geben, dass ich genau diese Irre bin.
»Ah!« Jetzt schaut er an mir vorbei. »Hallo, Schatz!«
Bemüht, mir die Angst nicht anmerken zu lassen, drehe ich mich um.
Eine große blonde, gut aussehende Frau mit diskreter Perlenkette. Ryan erhebt sich und küsst sie auf die Wange. »Das hat ja ewig gedauert, Schatz.«
Die Frau seufzt und setzt sich. »Die Babysitterin hat angerufen. Louis hat Theater gemacht. Ich musste ihm ein Lied vorsingen.«
Ryan lächelt und blickt zwischen seiner Frau und mir hin und her.
»Ach, Mel, sie ist auch Gast hier. Ich hab ihr gerade von der Verrückten erzählt, die auf der Insel festsitzt.«
Mein Herz meldet sich, es schmerzt. Ich beobachte Melissa aus dem Augenwinkel. Sie starrt mich an. Diesen Blick kenne ich, ich bin ihm schon öfter begegnet. Er bedeutet, sie kennt mich. Sie hat Bilder gesehen, in den Social Media oder sonst wo. Oder jemand hat auf mich hingewiesen. Die Leute aus der Geschäftsführung, die mich offenbar hassen.
Sie weiß genau, wer ich bin.
Ryan kommt richtig in Fahrt. »Ist doch unheimlich, oder? Jeder kann hier weg und diese Frau nicht, die geistert ewig hier rum.«
Melissa versetzt seinem Barhocker einen Tritt. Es klirrt, als die Spitze ihres eleganten Schuhs auf das metallene Stuhlbein trifft. Er dreht sich um, und sie nickt diskret, wenn auch nicht besonders diskret, in meine Richtung. Teilt ihm mit: Das ist sie, du Ochse.
Sein eben noch leicht gerötetes Gesicht läuft dunkelrot an.
Sie bleibt kühl. »Es ist gleich acht, Ryan. Wir sollten zum Essen nicht zu spät kommen. Sie haben Brancaster-Austern.«
Immer noch krebsrot, steht Ryan auf, verabschiedet sich stotternd und trottet hinter Melissa her wie ein ergebener Hund.
Ich bleibe mit meinem Gin, meinem Chili, den Wacholderbeeren und meinen düsteren Gedanken zurück.
Die wollen sie loswerden.
6
Kat, damals
Kat Lanley schlenderte, eine große, wunderbar weiche Ledertasche am Arm, durch die kleine Werft von Golhanger und genoss die heiße Junisonne auf ihren nackten Armen. Genoss, wie die Männer auf ihre langen, gebräunten Beine starrten. Um sie herum wimmelte es von Männern, die Boote anstrichen, Segel entrollten, einen Kiel untersuchten – und innehielten, um der jungen Frau auf dem Kai nachzusehen. Mit offenem Mund.
Sollen sie ruhig gucken, dachte sie, das wird nicht immer so sein. Vielleicht ging sie mit ihren sechsundzwanzig noch als einundzwanzig durch, aber eines Tages würde sie die Grenze unweigerlich überschritten haben, dann würde es nicht mehr so einfach sein, Männerblicke auf sich zu ziehen.
Das war der Schlüssel zum Leben, der Überzeugung war sie seit Langem. Lebe, als wärst du heute Morgen geboren und müsstest heute Abend sterben. Koste jeden Tag aus, als sei er Nahrung und du müsstest deinen Hunger stillen. Vor allem war sie entschlossen, die große Party am nächsten Abend zu genießen. Das Mittsommerfest im Stanhope, das ihre kluge, fleißige Schwester zu neuem Leben erweckt hatte. Gut gemacht, Schwesterherz. Du hast es verdient. Auf deine Insel!
Aber wo war die Fähre? Kat spähte zwischen ein paar hochgehievten Ruderbooten hindurch und sah den Fluss silbrig glitzern, den Blackwater, und in der Ferne, grün, undeutlich, die Insel. Dawzy. Der kleine Anleger aber war leer. Normalerweise warteten hier doch sicher Gäste mit Koffern, die übersetzen wollten, oder auch Angestellte. Gerade heute, vierundzwanzig Stunden bevor das große Ding stieg.
Hatte sie sich mit der Zeit vertan? Es war Mittag. Doch, da war sie sicher. Mittag.
Sie stellte die große Tasche ab, hockte sich hin und wühlte darin herum, suchte das kostbare Stück Papier. Warum hatte sie sich das nicht einfach im Handy notiert?
In der Tasche herrschte das übliche unfassbare Chaos. Sie hatte es geschafft, ihre zweitliebste Ukulele einzupacken, Jeansshorts, eine Maultrommel, ihr abgegriffenes Tarotdeck – Rider Waite –, ein sensationell durchsichtiges Kleid für morgen Abend, zwei Paar Schuhe, Flipflops, Badezeug, ein dickes Buch von Ursula Le Guin, ein paar schöne Steine aus Avebury, eine reinweiße Vogelfeder, die sie eben gefunden hatte, ungefähr ein Achtel Gras, einen halb gerauchten Joint, zwei Kreditkarten, eine verschmiert mit Arganöl, das gestern Abend ausgelaufen war, aber tatsächlich, verdammt, das Einzige, was sie wirklich brauchte, hatte sie vergessen: den Zettel mit den Abfahrtszeiten der Fähre.
»Scheiße.«
Wahrscheinlich hatte sie ihn am Morgen bei ihrem Vater liegen gelassen. Sie hatten über ihre Mutter geredet: dass sie, Kat, ihre Schusseligkeit geerbt hatte, ihre Vergesslichkeit, aber auch ihr gutes Aussehen und ihre Lebendigkeit.
So war es immer, wenn sie ihren Vater in seiner verlotterten Bude besuchte, er machte ihr mit kleinen Anspielungen, Scherzen, Umarmungen und besonders süßen Keksen aus seiner Dose deutlich, dass sie sein Liebling war, die gehätschelte Kleine. Und ihr war das von Mal zu Mal unangenehmer, sie hätte das gern unterbunden. Hör auf, Papa, das reicht, denk auch mal an Hannah.
So war es nämlich schon ihr Leben lang. Wenn Kat mit sieben Jahren ein Glas runtergeworfen hatte, was mindestens einmal die Woche vorkam, dann war das bloß ihre Dyspraxie, ihre Tollpatschigkeit, es wurde verziehen, er lachte darüber, ach, mein Dummerchen; wenn Hannah so etwas passierte, was vielleicht einmal im Jahr der Fall war, hatte es ein Donnerwetter gegeben.
Tut mir leid, Hannybobs.
Der letzte Besuch bei ihm war besonders unangenehm gewesen, denn er hatte ihr endlich die wahre Geschichte über Dawzy und ihre Mutter erzählt. Wie sehr ihre Mutter die heilige Insel mit ihren Füchsen und Raben und verwunschenen alten Eiben geliebt hatte, dass sie sie aber auch noch auf andere Weise geliebt hatte, auf falsche und traurige Weise. So falsch, dass es ihm jetzt noch die Tränen in die Augen trieb.
Kat blinzelte in die Sonne und dachte darüber nach, ob sie es Hannah erzählen sollte. Eines Tages würde sie es tun müssen, aber nicht an diesem Wochenende. Es würde sie runterziehen, wäre ein Stimmungskiller. Warum die Party verderben?
Lebe, als wärst du heute Morgen geboren und müsstest heute Abend sterben.
Auch ein letztes Wühlen brachte nichts. Der Zettel war weg.
Seufzend holte Kat ihr Handy hervor und schrieb an Hannah.
Hey, Schwesterherz, ich dumme Nuss hab den Zettel mit den Fährzeiten liegen lassen.
Hannah schrieb.
Ach nee. Ausgerechnet Kat Langley hat was verloren? Das gab’s ja noch nie.
Jaja, Mrs Schlauibobs, aber was soll ich machen? Wo ist er? Sie? Der Fährmann. Frankie Fred, Dingens? Ich erinner mich an ihn. War es nicht Mittag? Es ist Mittag. Es ist Mittag, und ich bin da. Daaaaaaa
Abwarten.
Gerade nachgeschaut. Sorry, nächste Fähre um 16. Stündlich geht sie nur MORGEN, wegen der Party.
Piss. Bis um vier häng ich hier fest? Wie doof. Hier kann man nix machen außer Bojen angucken. Oder sich von Bootstypen anglotzen lassen.
Warte. Idee! Der Fährmann ist Freddy Nix. Trinkt immer in dem Pub an der Marina, Discovery. Siehst du? Grau, 50, Seehundtyp. Aufreißer. Geh hin, mach ihm schöne Augen, frag, ob er dich mit dem Taxi rüberbringt. Du hast doch bestimmt einen riesigen Ausschnitt.
Jep.
Bingo.
Bin ich so berechenbar? Neiiin. Bis gleich, Süße, hab dich lieb. Xxx
Ich dich auch.
Kat steckte das Handy weg und marschierte zum Pub. Kaum hatte sie die Tür aufgestoßen, sah sie ihn: Freddy Nix saß allein vor einem fast leeren Glas Bier und quatschte mit dem Mann hinterm Tresen.
Hannah hatte recht. Sie brauchte sich nicht groß anzustrengen. Freddy warf einen Blick auf ihr Gesicht. Einen auf ihr Top. Einen auf ihre Beine.
»Klar, Süße, ich bring dich gleich rüber.«
Er hielt ihr die Tür auf und führte sie in einen ruhigeren Teil der Marina.
»Hier. Dein persönliches Wassertaxi.«
Kat schaute hinunter auf ein schnittiges schwarzes Speedboot. Ein teures kleines Spielzeug. Unerwartet chic.
»Spring rein, Kleine. Setz dich nach vorn, damit ich ans Steuer kann.«
Sie gehorchte, er kam hinterher.
Während sie langsam aufs offene Wasser hinaustuckerten, ging Kat auf, dass er sie extra vorn sitzen ließ, deutlich höher, als er selbst saß, damit er ihr unter den Rock gucken konnte. Was er unverhohlen tat.
»Schickes Boot«, sagte sie.
Freddy grinste. Leicht anzüglich.
»Ja. Schön schnell. Aber heute besteht kein Grund zur Eile, oder? Ich hab Zeit, die Sonne zu genießen.«
Und noch mehr Zeit, mir unter den Rock zu gucken, dachte Kat, aber sie sagte nichts. Dieser Männerblick, das hoffnungslos Verlangende darin, rührte sie eher. Und die Überfahrt war einfach schön. Im Fahrtwind lag der Geruch der nahen See.
»Du bist Hannahs Schwester, oder? Ich hab dich doch schon mal gesehen.«
»Ja.«
»Gute Frau, diese Hannah. Hat viel bewegt. Der Chef liebt sie. ’n netten Verlobten hat sie auch, die passen gut zusammen, die zwei, er ist Koch, drüben in Maldon. Aber das weißt du sicher alles.«
Kat nickte und blickte hinaus aufs Wasser.
So plauderten sie eine Weile. Über ihnen kreisten laute Seevögel. Kat lehnte sich zur Seite und hielt eine Hand ins Wasser. Trotz der Sonne war es unerwartet kalt.
Dann spürte sie plötzlich, wie das Boot abtrieb, nach links, flussabwärts. Wie ein Auto, das von einem Windstoß weggeschoben wird. Sie sah Freddy fragend an.
Er nickte, zog eine kleine Grimasse.
»Ja, hier wird’s ’n bisschen kabbelig, unberechenbar. Weil der Fluss hier auf die Nordsee trifft. Bei den Inseln. Das hat sogar einen alten Namen. Die Fischer nennen es so. Oder haben es so genannt.«
Kat sah ihn an, wartete auf eine Erklärung.
Freddy starrte in den Blackwater, als gäbe es da in der Tiefe jemanden oder etwas zu sehen. Nachdenklich. Dann hob er den Blick und deutete auf eine andere Insel, grün und flach.
»Beim Stumble und da, bei der Insel Royden, da ist die Strömung gefährlich. Aber nicht lange.« Er runzelte die Stirn.
»Wie gefährlich?«
»Na ja, früher haben sie es Schwarzes Wasser genannt oder auch Zeit des Ertrinkens