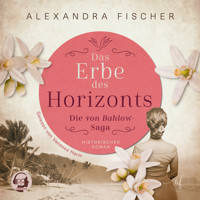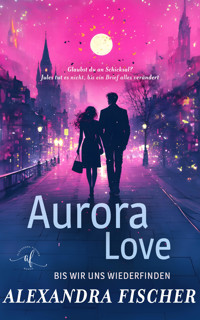
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manche Sommer verändern alles! Ein Brief, der ins Herz trifft. Eine Verbindung, die Raum und Zeit überdauert. Eine Liebe, die leuchtet wie die Nordlichter am Himmel. Eine bezaubernde Liebesgeschichte über zwei Jahrzehnte, die sowohl in der kanadischen Wildnis als auch im romantischen Paris spielt. Jules steckt fest! In einer Kleinstadt inmitten der kanadischen Wälder und in ihrem eigenen Leben. Seit ihr Vater die Familie verlassen hat, trägt sie die Verantwortung für ihre psychisch labile Mutter und kümmert sich um alles, nur nicht um ihr Glück. Das ändert sich, als der geheimnisvolle Cassian einen Brief in ihrem Zimmer hinterlässt. Seine Worte berühren Jules auf eine Weise, die sie sich nicht erklären kann, und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Jahre später begegnet sie Cassian unter den magischen Nordlichtern wieder und begreift, dass er nicht nur der Mann ist, der ihr Herz schneller schlagen lässt. Er ist auch auf schicksalhafte Weise mit ihr verbunden. Doch gibt es so etwas wie Seelenverwandtschaft überhaupt? Und hat sie im komplizierten Leben von Jules eine Chance?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
aurora love
BIS WIR UNS WIEDERFINDEN
ALEXANDRA FISCHER
Dieses Buch ist für alle, die an echte, beständige Gefühle glauben. Für die, die sich nicht von der Hektik der Welt blenden lassen, sondern wissen, dass wahre Nähe Zeit und Hingabe braucht. Für alle, die das Leben manchmal als zu laut empfinden, und für die, die wissen, was es heißt, in ein schwarzes Loch zu fallen. Ihr seid nicht allein Außerdem ist dieses Buch für alle Slow Reader, die sich auf die Entwicklung von Charakteren einlassen wollen, und solche, die es zu schätzen wissen, wenn Probleme auch mal ausdiskutiert werden. Und natürlich ist dieses Buch für alle, die gerne Liebesgeschichten lesen
inhalt
Charakter des Buches
Prolog
Teil eins
Wunsch und Wirklichkeit
Das Flüstern der Wälder
Paris, mon amour
Zwei Wochen knotenfrei
Zurück zur Normalität
Bruderliebe
Spiel, Satz und Niederlage
Schlussstrich
Blick ins Fotoalbum
Teil zwei
Urknall
Die Kraft der Anziehung
Der Anfang von allem
Kugelmenschen
Unsinn und Sinnlichkeit
Endstation Sehnsucht
Oktoberglühen
Die Wahl der Qual
Blick ins Fotoalbum
Teil drei
Es war einmal…
Ende. Punkt.
Die Wahrheit von gestern
Das Lächeln des Schicksals
Ein neues Wir
O Canada
Geister der Vergangenheit
Aurora Love
Du möchtest mehr von mir lesen?
Hallo, das bin ich!
Impressum
charakter des buches
Genre: New Adult | Liebesroman
Erzählweise: Ich-Perspektive aus Sicht der beiden Hauptprotagonisten in der Vergangenheit (außer der Prolog)
Stimmung: langsame Entwicklung der Charaktere über mehrere Jahre, Seelenverwandtschaft, Alltags- und Familienprobleme, kulturelle Unterschiede
Tropes: Fastburn, 2 POVs, Healing Love, Second Chance, Small Town Romance, Mental Health & Romance, Coming of Age
Zeitspanne: 2003 - 2024
Alter der Hauptprotagonisten: 15 - 35
Handlungsort: hauptsächlich Kanada (Quebéc) und Paris
Einzelband/Serie: in sich abgeschlossener Einzelband
Triggerwarnung: Depression, Borderline
Zeitsprünge: vorhanden
Dramaelemente: vorhanden
Spicy Scenes: teilweise vorhanden (kein Schwerpunkt)
Thriller-/Krimielemente: nicht vorhanden
LGBTQ-Elemente: nicht vorhanden
Cliffhanger: nicht vorhanden
Happy/Unhappy Ending: Happy Ending
prolog
Der Himmel über den nördlichen Breiten leuchtete in einem mystischen Rot, als im März 1989 ein Sonnensturm die Erde traf und die Ionosphäre zum Glühen brachte. Während die Menschen fasziniert den Tanz der Polarlichter beobachteten, ahnte niemand, dass dies der Beginn einer außergewöhnlichen Geschichte war, die zwei Seelen auf magische Weise zusammenführen würde. In einer kleinen Stadt, versteckt in den Wäldern Kanadas, bereitete sich das Schicksal darauf vor, seine geheimnisvolle Macht zu entfalten.
SAGUENAY, KANADA, HOPE HOSPITAL, 13. MÄRZ 1989, 23:43 UHR
Caroline Leblanc konnte nicht aufhören, aus dem Fenster zu schauen. In dieser Nacht waren die Nordlichter intensiver als je zuvor. Wie flüsternde Geister tanzten sie über den Himmel und schienen Geschichten zu erzählen, die nur die Sterne verstanden. Man konnte die Energie förmlich spüren. Es war, als würde sie durch die Wände ins Innere des Krankenhauses dringen, und so wunderte es Caroline nicht, dass die Lichter in den neonbeleuchteten Gängen zu flackern begannen. Kurz darauf erloschen sie vollständig. Tiefe Dunkelheit senkte sich über das Wartezimmer der Kinderstation und ein ersticktes Keuchen ging durch die wenigen Menschen, die sich zu dieser nächtlichen Stunde in der Notaufnahme aufhielten. Nur Caroline war froh, dass niemand mehr auf die Wunde über ihrer linken Augenbraue starren konnte. Sie senkte den Kopf und betrachtete ihre kleine Tochter Juliette, die von dem roten Flimmern des Nordlichts in ein warmes Licht gehüllt wurde. Ihre Schreie erschütterten das Wartezimmer.
Lass ihr nichts passiert sein, betete sie innerlich und wiegte das Baby in den Armen. Es war doch nur ein dummer Unfall.
Die Erinnerung an das Geräusch der umfallenden Wiege zog ihr den Magen zusammen. Der Streit mit Yann war der schlimmste seit Juliettes Geburt vor vier Monaten gewesen. Dabei hatte sie nur vergessen aufzuräumen. Eine Tatsache, die Yann nach seiner Rückkehr aus den Wäldern aus der Fassung gebracht hatte. Er hatte sie angeschrien. Derart heftig, dass sie sich die Ohren zugehalten hatte und rückwärts gegangen war. Dabei war sie über den Korb mit den Spielsachen gestolpert und dann gegen die Wiege geknallt. Die schlafende Juliette war herausgeschleudert worden und Yann war noch wütender geworden. Seit dieser einen Sache war er ständig wütend auf sie. Dieses Mal hatte er Caroline vorgeworfen, eine schlechte Mutter zu sein, weil sie das Baby nicht in seinem Zimmer schlafen ließ. Dabei wollte sie nur Gesellschaft haben. Yann arbeitete als Holzfäller und war oft tagelang unterwegs. Damit konnte Caroline nur schwer umgehen. Sie hasste es, allein zu sein. Jeden Abend, wenn ihr Sohn Orson brav ins Bett gegangen war, klammerte sich Caroline an die kleine Juliette. Ihr kleiner Körper spendete ihr Trost und Nähe. Solange sie nicht schrie. Denn dann explodierten Carolines Nerven. Genau wie in diesem Moment. Sie grub ihre Fingernägel mehrmals so heftig in den Unterarm, bis sie Haut unter den Nägeln spürte. Der Schmerz half ihr, die überschießenden Gefühle in ihrem Inneren unter Kontrolle zu bekommen. Sie wollte eine gute Mutter sein! Yann sollte sehen, dass sie in der Lage war, sich um ihre Kinder zu kümmern.
Doch Juliettes anhaltendes Geschrei brauchte ihre Energie auf. Am liebsten hätte sie dem Baby den Mund zugehalten. Halt durch, ermahnte sie sich selbst und fuhr fort, den Unterarm mit ihren Fingernägeln zu bearbeiten. Ihre Augen blinzelten gegen die Dunkelheit an, die bis tief in ihre Seele vorzudringen schien. Sie hatte gehofft, die Kinder würden etwas an ihrem Leben ändern, aber sie machten alles noch auswegloser, noch beengter. Ständig fühlte sich Caroline erschöpft, selbst wenn sie eine Nacht durchgeschlafen hatte. Bücher, die ihre einsame Kindheit erträglicher gemacht hatten, lagen unbeachtet herum, ihre ungelesenen Seiten ein Symbol für das Desinteresse, das sich in ihr ausgebreitet hatte. Lieder, die einst ihr Herz zum Tanzen gebracht hatten, waren nur noch Hintergrundgeräusch in einer stillen Leere. Auch die eigenen Gedanken waren nicht mehr ihre Verbündeten. Stattdessen waren sie voller Selbstzweifel und Kritik. Jeder Fehler, jede Schwäche wurde in ihrem Kopf zu einem unüberwindlichen Berg, und sie konnte nicht aufhören, sich dafür zu verurteilen. Yann war nur wegen ihrer Nachlässigkeit aus der Haut gefahren und jetzt war sie auch noch schuld an Juliettes Verletzungen. Brennende Tränen stiegen auf und Caroline konnte sie kaum zurückhalten. Alles war so laut. Die Dunkelheit, das Geschrei, selbst die Nordlichter vor dem Fenster. Sie sehnte sich nach den Wäldern, nach ihrem Haus, dem einzigen Ort, der sie Ruhe finden ließ. Und nach Yann, dem einzigen Menschen, der sie je wirklich geliebt hatte.
Abrupt stand Caroline auf. Ihr Herz raste und sie fühlte Panik in sich aufsteigen. Die Vorstellung, den Ärzten zu erzählen, warum Juliette aus der Wiege gefallen war, überforderte sie mit einem Mal. Ihr Unterarm brannte und die Wunde über ihrem Auge pulsierte. Weshalb war sie überhaupt ins Krankenhaus gefahren? Unsicher machte sie ein paar Schritte durch die Dunkelheit, während sie in ihrem Kopf drei Worte wie ein Mantra wiederholte: Juliette fehlt nichts. Juliette fehlt nichts!
Leise setzte sie einen Fuß vor den anderen, als sie plötzlich mit jemandem zusammenstieß.
»Aua!«
Caroline blieb stehen. In diesem Moment drang das mechanische Brummen der Notstromaggregate durch die Wände des Gebäudes. Zunächst schwach, dann kräftiger, begann das Notlicht aufzuleuchten, zuerst in blassem Rot, kurz darauf in hellem Weiß. Die kalten Strahlen enthüllten die Gesichter der Menschen im Raum, die sich erleichtert umsahen. Nur langsam gewöhnten sich Carolines Augen wieder an das Licht. Sie sah Schwestern und Ärzte durch die Gänge eilen und hörte in der Ferne das gleichmäßige Piepen medizinischer Geräte, die zum Leben erwachten. Alles kam ihr überwältigend laut und grell vor. Am liebsten hätte sie sich unter einen der Stühle verkrochen wie ein verängstigter Hund. Jetzt sah sie auch, mit wem sie zusammengestoßen war. Vor ihr stand ein kleiner Junge mit braunen Haaren und Sommersprossen auf der Nase. Er blickte stumm zu ihr auf und machte keine Anstalten, ihr aus dem Weg zu gehen.
Eine Krankenschwester betrat den Warteraum. »Der Notstrom ist angesprungen«, sagte sie, »wir haben die Situation unter Kontrolle.« Sie lächelte Caroline freundlich an. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Madame?«
Caroline nickte und kehrte hastig zu ihrem Sitzplatz zurück. Dann senkte sie den Kopf, um den Blicken der Wartenden zu entgehen. Sie hatte das Gefühl, dass sich jeder bereits ein Urteil über ihre Anwesenheit in der Notaufnahme gebildet hatte. Langsam wiegte sie ihren Oberkörper vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück.
»Wie heißt sie?« Der kleine Junge, mit dem sie zusammengestoßen war, war ihr gefolgt und starrte auf das weinende Baby.
»Juliette«, flüsterte Caroline und spürte, wie ihre Nervenenden zu kribbeln begannen. Sie wollte fliehen. Weg von all dem Licht und dem Lärm.
»Etwas tut ihr weh.«
»Juliette fehlt nichts.« Caroline schielte zum Ausgang. »Wo sind deine Eltern?« Keiner der Anwesenden schien sich für den Jungen verantwortlich zu fühlen, der Juliette wie gebannt ansah.
»Bei meinem Bruder. Er hat hohes Fieber.«
»Du solltest sie suchen gehen.«
»Ich weiß nicht, wo sie sind.«
»Hier kannst du nicht bleiben«, wisperte sie und fühlte sich überfordert. Am liebsten hätte sie den Jungen weggestoßen. Er zog die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. Und damit auch auf sie. Caroline konnte die prüfenden Blicke förmlich spüren. Sie brannten auf ihrer Haut.
Der Junge reagierte nicht. Doch für einen kurzen Moment sah er sie an, als wüsste er genau, was in ihr vorging. »Juliette ist aus der Wiege gefallen«, erklärte Caroline in dem plötzlichen Bedürfnis, sich dem Kleinen gegenüber zu rechtfertigen. »Aber es war nicht meine Schuld. Bestimmt fehlt ihr nichts. Ich passe immer gut auf sie auf.« Die Augen des Jungen richteten sich wieder auf das Baby. Um ihm den Anblick leichter zu machen, beugte Caroline sich vor. »Ich würde sie nie alleinlassen. Das darfst du nicht denken.«
Der Junge lächelte Juliette an. »Hallo«, sagte er, als wären sie alte Bekannte.
»Du solltest jetzt gehen.«
»Ich warte noch ein bisschen.« Er berührte Juliettes Finger und in diesem Moment hörte sie auf zu weinen. Anstelle des Geschreis folgte ein heftiger Schluckauf und mit ihren verquollenen Augen blinzelte sie zu dem fremden Gesicht hinauf.
»Oh!« Caroline wagte kaum zu atmen. »Sie ist still.« Die plötzliche Ruhe war wie Balsam auf ihrer geschundenen Seele. Sie beobachtete, wie die Kinder einander ansahen. Ein paar Herzschläge lang gab es nur dieses Bild. Juliette und der fremde Junge, die sich in die Augen sahen, während ihre Gesichter vom feuerroten Nachthimmel vor dem Fenster erleuchtet wurden.
»Ihr fehlt nichts.« Erleichterung durchflutete Caroline. »Sie weint nicht mehr. Alles ist gut.« Sie stand auf. »Ihr fehlt nichts. Alles ist gut. Ich kann jetzt gehen.«
Der kleine Junge zupfte an ihrer Jacke. »Bleib hier«, sagte er, doch Caroline ignorierte ihn. Hastig verließ sie das Wartezimmer und eilte über den Flur.
»Cassian! Wo bist du denn?« Unsanft stieß sie mit einem Mann zusammen, der ihr entgegenkam. Er blieb stehen, um sich zu entschuldigen.
Caroline wagte nicht, ihm ins Gesicht zu sehen. Sie hatte das Gefühl, als würde der Fremde genau wissen wie es in ihr aussah. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, erkundigte er sich. »Sie bluten. Ich könnte einen Arzt …«
»Nein!« Heftig schüttelte sie den Kopf und presste das Baby an sich. »Lassen Sie mich!«
»Es tut mir leid. Ich wollte Ihnen nicht zu nahetreten.« Er zögerte. »Kennen wir uns? Ich habe früher in der Gegend gelebt.«
»Nein!«, wiederholte Caroline und spürte, wie die Anspannung wuchs. Das alles war … es war … Sie blinzelte. Zu viele Dinge stürmten auf sie ein. Worte, Geräusche, Erinnerungen. »Gehen Sie!«
»Entschuldigung, dass ich sie erschreckt habe.« Der Mann trat beiseite und Caroline setzte ihren Weg fort. Mit letzter Kraft hetzte sie durch die Eingangshalle, passierte die Schiebetüren und inhalierte die klare Nachtluft. Dann hob sie den Kopf und beobachtete, wie ein Flüstern aus Licht über den Himmel waberte, ein schimmerndes Band aus Rot und Weiß, das wie ein Traum über die dunkle Landschaft floss und Carolines Namen rief.
teil eins
manchmal begegnen sich zwei seelen und verabreden sich stillschweigend für später, um ihren menschen die zeit zu lassen, die sie brauchen.
Verfasser unbekannt
wunsch und wirklichkeit
JULES
SAGUENAY, KANADA, JULI 2003
Aus dem Ghettoblaster, der neben der offenen Garage stand, dröhnte Crazy in Love von Beyoncé in voller Lautstärke. Ich saß mit angezogenen Knien im Gras und starrte auf die langen Beine meines Bruders, die unter seinem Chevrolet Camaro hervorlugten.
»Bist du bald fertig?«, fragte ich, bekam aber keine Antwort. Also fügte ich etwas lauter hinzu: »Ava und Marnie warten auf mich.«
Orson kroch ein Stück unter dem Auto hervor. Teile seines Gesichts waren ölverschmiert, ebenso die rote Kappe der Montréal Canadiens, die er verkehrt herum trug. »Frag Maman«, antwortete er knapp, »das hier dauert länger.«
»Ich will sie aber nicht fragen«, murmelte ich. »Du weißt doch, wie sie ist.«
Orson legte den Kopf schief. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. »Ich dachte, heute wäre einer ihrer guten Tage.«
Ich rupfte Gras, um mich vor einer Antwort zu drücken. Maman war wie ein Rouletterad, auf das jeden Morgen eine neue Kugel geworfen wurde. Meist fiel sie auf Schwarz, was bedeutete, dass es Tränen oder Gefühlsausbrüche geben konnte. Manchmal fiel sie auf Rot und man konnte sich auf einen guten Tag freuen. Aber das war nie eine Garantie dafür, dass aus Rot nicht plötzlich wieder Schwarz werden konnte. »Ich möchte, dass du mich fährst«, sagte ich und wagte es, meinen Bruder anzusehen.
Er kroch unter dem Auto hervor und setzte sich neben mich. Eine Weile schwiegen wir zu Beyoncés Gesang, dann ertönte die Stimme des Radiomoderators, der den Slogan von CKOI-FM und die Uhrzeit ansagte. Kurz darauf forderte uns Sean Paul zu Get Busy auf. Orson trommelte auf seinem Knie den Rhythmus des Songs mit. »Die Ölwanne ist undicht«, sagte er und stupste mich entschuldigend mit der Schulter an. »So kann ich dich nicht in die Stadt fahren.«
»Aber es sind Sommerferien.« Ich rieb einen vermeintlichen Fleck von meinen ausgelatschten Nike-Turnschuhen. »Und hier kann man einfach nichts machen.«
»Das sehe ich anders.« Orson stupste mich erneut an. Diesmal auffordernd. »Nachher kommen die Jungs. Wir wollen mit den Quads durch den Wald heizen.«
»Pffff!« Ich blies die Backen auf. Seit ich klein war, musste ich ständig mit Jungs rumhängen. Orsons Freunde waren genau wie er verrückt nach allem, was Benzin schluckte, Krach machte und eine adrenalingeladene Geschwindigkeit erreichen konnte.
»Komm schon, Jules!« Er zog an meinem Schnürsenkel. »Du fährst schneller als all die anderen.«
»Natürlich tue ich das.« Ein flüchtiges Lächeln huschte über mein Gesicht. Ich hatte es nie darauf angelegt, aber über die Jahre hatte ich auf geheimen Waldwegen sowohl das Auto- als auch das Quadfahren gelernt. Und aus irgendeinem Grund war ich gut darin. Allerdings hatte ich dabei nicht halb so viel Spaß wie Orson. Doch was gab es sonst zu tun? Wir lebten so abgelegen, dass man jedes Mal ins Auto steigen musste, wenn man zum Einkaufen, in ein Café oder ins Kino wollte. Wofür andere Leute fünf Minuten zu Fuß brauchten, benötigten wir eine Stunde mit dem Auto.
»Louis’ Cousin aus Paris ist zu Besuch«, lockte mein Bruder. »Erinnerst du dich an ihn?«
»Nein, ich bin ihm nie begegnet.« Ich pustete mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Normalerweise hätte Orson damit mein Interesse geweckt. Neue Leute kennenzulernen war immer etwas Besonderes. Neue Leute aus Frankreich, das war eine Sensation. Seit ich mit Maman den Film French Kiss gesehen hatte, träumte ich davon, nach Paris zu reisen. Aber an diesem Tag wollte ich etwas anderes tun. »Ava fliegt am Wochenende zu ihren Großeltern nach Vancouver und Marnie verbringt den Rest der Ferien bei ihrem Vater in Montreal. Wir sehen uns erst wieder, wenn die Schule anfängt. In anderthalb Monaten!« Ich ließ mich rückwärts ins Gras fallen. »Das ist echt nicht fair!«
»Okay«, Orson legte sich neben mich und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, »ich frage Maman, ob ich ihr Auto haben kann.«
»Das gibt sie dir niemals.«
»Du könntest sie darum bitten.«
»Ors!« Ich sah meinen Bruder an und hob eine Augenbraue. Mehr musste ich nicht machen, um ihm einen resignierten Seufzer zu entlocken. Maman ließ ihr Auto niemals jemand anderen fahren. Der rostige Ford Pick-Up mit der Delle am Kotflügel hatte einst unserem Vater gehört. Er hatte ihn nicht mitgenommen, als er Maman und uns eines Nachts einfach verlassen hatte. Ich war damals noch klein gewesen und hatte kaum Erinnerungen an die Zeit danach. Maman sprach nur selten darüber, aber sowohl Orson als auch ich wussten, dass sie nie über den Weggang unseres Vaters hinweggekommen war und immer noch hoffte, dass er eines Tages zu uns zurückkehren würde.
»Dann bleibt dir nichts anderes übrig«, stellte mein Bruder fest. »Wenn du Ava und Marnie sehen willst …«
»… muss ich Maman fragen«, vollendete ich den Satz.
»Du hast die Wahl.« Orson nahm die Kappe von seinem Kopf und setzte sie mir auf. »Wenn du bleibst, hättest du mehr Spaß.«
»Ganz bestimmt nicht.« Ich sprang auf und zog die Kappe mit spitzen Fingern aus meinen Haaren. Dann warf ich sie meinem Bruder zu. »Das Ding stinkt nach Öl!«
»Das ist gut, oder nicht?« Federnd kam auch er wieder auf die Beine. »Du verpasst etwas.«
»Oh ja«, rief ich, während ich zum Haus schlenderte. »Auspuffgase, picklige Kerle und Schlamm im Gesicht.«
Orsons Lachen verhallte in meinem Rücken, als ich die Fliegengittertür aufstieß und ins Innere trat.
* * *
»Ich bin müde.« Maman inhalierte den Rauch ihrer Zigarette und ließ ihn durch das offene Fenster nach draußen entweichen. Wie immer fuhr sie viel zu schnell, doch daran war ich gewöhnt. »Du hättest mir früher sagen sollen, dass du eine Verabredung hast. Ausgerechnet heute, an meinem freien Nachmittag, muss ich wieder ins Auto steigen.«
»Ich dachte, Orson würde mich fahren.« Angespannt blickte ich auf die Bäume, die an uns vorbeiflogen. Hemlocktannen, Fichten und Kiefern wechselten sich mit Birken, Ahorn und Espen ab. Sonst gab es neben der Straße nicht viel zu sehen.
»Du weißt, wie hart ich arbeite, um unser Leben zu finanzieren.«
»Ja, Maman.«
»Heute ist das Druckerpapier ausgegangen und Willie war wütend, weil ich ihm nicht eher Bescheid gegeben habe. Er ist manchmal so streng. Ich mag das nicht. Er kennt mich, er sollte wissen, dass ich mich bemühe.«
»Das tut mir leid.«
»Er sollte mehr Rücksicht auf mich nehmen. Und du auch.«
»Ava und Marnie sind den Rest der Sommerferien unterwegs. Du brauchst mich ab morgen nirgendwo mehr hinzufahren.« Die Aussicht war deprimierend. In meiner Klasse war ich zwar nicht die Einzige, die die ganzen Sommerferien zu Hause verbrachte, aber zumindest die Einzige, die zu Schulbeginn absolut nichts Aufregendes zu erzählen haben würde.
»Ist das ein Vorwurf, Jules?« Maman warf die Zigarettenkippe aus dem Auto und suchte hektisch nach der Schachtel, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Kaum hatte sie sie gefunden, angelte sie nach einer neuen Zigarette, steckte sie sich in den Mund und zog den runden Zigarettenanzünder heraus, der sich direkt vor der Handbremse befand. Die Zigarette begann zu glühen und Maman inhalierte den Rauch wie eine Ertrinkende.
»Nein, das ist kein Vorwurf«, flüsterte ich.
»Gut, gut.« Sie schaute in den Rückspiegel und richtete ihren Pony. »Es sind in diesem Sommer viele Touristen hier. Willie möchte eventuell noch jemanden einstellen. Du könntest fragen, ob er dich in den Ferien beschäftigt.«
Ich konnte mir Besseres vorstellen, aber Maman lächelte mich an. »Wir würden mehr Zeit miteinander verbringen«, sagte sie.
»Ich denke darüber nach.«
»Wunderbar!« Sie zupfte am Kragen ihres grünen Poloshirts, auf dem das Logo der Nationalparkverwaltung prangte, für die Maman arbeitete. Früher war sie im Kassenhäuschen gesessen, an dem die Besucher des Saguenay Fjord-Nationalparks in ihren Autos vorbeifuhren. Doch je mehr Touristen gekommen waren, desto überforderter hatte sich Maman gefühlt. Deshalb war sie seit einiger Zeit im Büro des Besucherzentrums beschäftigt, das von William Pelletier geleitet wurde, den alle in der Gegend nur Willie nannten. Ich kannte ihn seit meiner Kindheit. Er war ein guter Freund meines Vaters und hatte sich nach dessen Weggang immer um Maman und uns gekümmert.
»Wir sollten uns ein Haustier zulegen«, schlug ich spontan vor. »Wie wär’s mit einer Katze?«
»Nein! Was ist denn heute nur in dich gefahren, Jules? Du weißt doch, was ich von Haustieren halte.«
»Sie machen Dreck.« Ich nagte an meiner Unterlippe. Manchmal fühlte ich mich einfach allein. »Hast du eigentlich nochmal über meinen Vorschlag nachgedacht?«, wollte ich wissen und biss mir sofort auf die Zunge, als ich sah, wie meine Mutter den Rauch eine halbe Ewigkeit in ihrer Lunge behielt, bevor sie antwortete.
»Ich will nicht umziehen. Warum fragst du mich das ständig?« Wütend schlug sie aufs Lenkrad und die Glut der Zigarette verteilte sich im Innenraum des Autos.
»Schon gut«, beeilte ich mich zu sagen. »Es war nur eine Idee.«
»Behalte sie in Zukunft für dich!«
»In Ordnung.«
»Es ist unfair, dass du mich immer hinstellst, als sei ich nicht zu eigenen Entscheidungen fähig.« Tränen schossen Maman in die Augen und ich ärgerte mich über meine gedankenlose Frage. Hektisch rieb ich die Handflächen an meiner Hose und schwieg, um sie nicht weiter zu triggern.
»Wir leben da, wo andere Urlaub machen.« Maman zündete sich noch eine Zigarette an. Die fünfte, seit wir losgefahren waren. »Hier ist dein Zuhause.«
»Ich weiß.« Die Worte ließen mich beinahe ersticken. »Ich dachte nur, dass wir in der Stadt vielleicht …« Ich biss mir auf die Zunge, weil ich wusste, wie das Gespräch enden würde. So wie es immer endete. Maman würde weinen und ich würde sie fragen, warum sie es vorzog, mitten in der Wildnis zu leben, anstatt in einer Stadt, wo man bessere Jobs finden und neue Leute kennenlernen konnte. Daraufhin würde sie noch mehr weinen, ständig den Kopf schütteln und wirres Zeug stammeln, bis sie schließlich einen Heulkrampf bekäme. Dann würde sie rauchen, ins Leere starren, während ihr die Tränen über das Gesicht liefen, und alles um sich herum vergessen. Das waren keine guten Voraussetzungen für eine Autofahrt.
Schnell drehte ich das Radio lauter und Mamans Gemütszustand besserte sich. »Ich mag den Song.« Sie ließ die Schultern kreisen und stimmte den Refrain an. »Es ist kein Lied von Johnny Hallyday, aber ich mag es trotzdem. Sing mit mir!«
»If you could read my mind …«, trällerte ich und war erleichtert, dass die Stimmung nicht gekippt war. Vielleicht war heute doch ein Tag, an dem die Kugel bei Maman auf Rot gefallen war. Mit dem Song von Gordon Lightfood im Ohr erreichten wir das Ortsschild von Saguenay. Die Stadt, die drei Autostunden von Québec entfernt lag, schmiegte sich malerisch an einen Fjord, war aber eigentlich keine Schönheit. Bei Touristen war sie jedoch bekannt für ihren alten Hafen, die historische Innenstadt und das kleine weiße Haus auf den Klippen, das bei der großen Flut 1996 auf mysteriöse Weise unversehrt geblieben war. Jeder Einwohner von Saguenay kannte die Geschichte. Im Juli 1996 war nach zweiwöchigem Dauerregen ein Damm gebrochen. Die folgende Flutwelle überrollte die Stadt und zerstörte unzählige Gebäude. Nur das kleine weiße Haus nicht. Es trotzte den Wassermassen vier Tage lang und als die Flut aufhörte, stand es immer noch und wurde seitdem als Symbol des Durchhaltens und der Wunder gefeiert. Ich war damals gerade eingeschult worden und hatte meine ersten beiden Schuljahre in einem Container verbracht, weil unsere Schule wieder aufgebaut werden musste. Wer Saguenay heute sah, konnte sich kaum vorstellen, wie zerstört die Stadt einst gewesen war und wie viele Menschen damals ihr Zuhause verloren hatten.
»Wo soll ich dich rauslassen?« Maman überquerte die Brücke über den Saguenay-Fluss.
»Wir treffen uns bei Francy’s.« Aufgeregt kaute ich an meinen Fingernägeln. Ich war nicht oft in der Stadt. Außer natürlich, um zur Schule zu gehen. Aber da fuhr ich mit dem Bus und musste mich an die Fahrpläne halten. Ungeduldig verfolgte ich, wie Maman am Hafen vorbeifuhr, beim Fremdenverkehrsamt rechts abbog und kurz darauf in die Rue Racine einbog.
»Um sechs hole ich dich wieder ab«, sagte sie. »Sei pünktlich, heute Abend läuft eine neue Folge der Sopranos. Die möchte ich nicht verpassen.«
»Okay!« Ich winkte meinen Freundinnen zu, die schon auf der Terrasse der Eisdiele auf mich warteten. Noch bevor Maman das Auto zum Stehen brachte, riss ich die Tür auf und sprang hinaus. Mit einem kurzen Hupen verschwand der Ford Pick-up um die nächste Ecke und ich rannte über die Straße.
»Jules!« Ava fiel mir stürmisch um den Hals. Ihre Mutter war Professorin an der örtlichen Universität und stammte von der Westküste. Ava sah also nicht aus wie eine von uns, sondern eher wie ein Mädchen aus der Ginger Ale-Werbung. Das war auch ihr Spitzname an meiner Schule. Ginger Ava. An diesem Tag trug sie rosa Shorts, ein weißes T-Shirt mit einem Regenbogen drauf und weiße Sneaker. Ihre langen kastanienbraunen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, der wild hin und her wippte, als sie anfing, auf mich einzureden.
»Warum kommst du so spät und warum hat dich dein Bruder nicht gefahren? Stimmt es, dass Ors jetzt mit Aurelie geht? Marnie sagt, sie hätte die beiden letzte Woche zusammen am Hafen gesehen.«
»Ich weiß nicht«, antwortete ich überrascht.
»Ich sagte, ich glaube, es war Ors«, korrigierte Marnie und umarmte mich ebenfalls. Sie war ein typisches Kind dieser Gegend und trug ein Holzfällerhemd über ihrer abgeschnittenen Jeans. Ihre Eltern waren geschieden. Ihre Mutter arbeitete in der Aluminiumfabrik von Arvida und ihr Vater lebte mit seiner neuen Frau in Montreal. Manchmal fragte ich mich, warum hier keine Ehe zu halten schien. Avas Eltern waren eine Ausnahme. Sie waren immer so nett zueinander, dass ich oft nicht glauben wollte, dass sie wirklich existierten. Ors hielt sie für Schauspieler, die extra aus Vancouver in die kanadische Wildnis gekommen waren, um uns zu ärgern. Ich beneidete Ava oft um ihre intakte Familie.
»Ich kann es nicht glauben!« Ava sank dramatisch zurück auf ihren Stuhl. »All die Jahre habe ich deinen Bruder angehimmelt und jetzt, wo ich endlich gelernt habe, richtig zu küssen, schmeißt sich diese Aurelie an ihn ran.«
Marnie kicherte. »Du denkst, du lernst von Bobby Boo das Küssen? Er sieht eher wie eine sabbernde Schlange aus, wenn er dir die Zunge in den Hals steckt.«
Ich lachte und ließ mich auf den freien Platz zwischen Marnie und Ava plumpsen. Ich hatte meine Freundinnen vermisst, obwohl wir erst eine Woche Ferien hatten.
»Schlangen sabbern nicht.« Ava schnaubte. »Außerdem werde ich in diesem Sommer üben, das kannst du mir glauben. Meine Großeltern gehen mit mir nach Playland. Das ist ein Vergnügungspark. Da gibt es jede Menge heiße Typen!«
»Das klingt herrlich«, seufzte ich. »Meine Mutter hat gerade vorgeschlagen, dass ich mir einen Ferienjob suchen soll.«
»Meine auch!« Marnie verdrehte die Augen. »Sie meinte, ich sei jetzt alt genug, um etwas zu unserem Haushalt beizutragen. Zum Glück habe ich Dads Einladung schon vor Wochen angenommen. Auch wenn ich seine neue Frau nicht ausstehen kann.«
»Besser, als hier rumzusitzen.« Ich studierte die Karte und bestellte ein Eiscremesoda, als die Kellnerin vorbeikam.
»Was macht Ors denn diesen Sommer?«, erkundigte sich Ava mit unschuldigem Augenaufschlag.
»Ich schätze, das Übliche.« Ich zuckte mit den Schultern. »Entweder schraubt er an seinem hässlichen Camaro herum oder er hängt mit seinen Kumpels ab. Heute kommt Louis und bringt seinen Cousin aus Frankreich mit.«
»Was?«, schrie Ava auf. »Und das erzählst du mir erst jetzt? Ich wäre zu euch gekommen, wenn ich das gewusst hätte.«
»Louis ist heiß«, bestätigte Marnie. »Seit er diese hässliche Zahnspange nicht mehr trägt, könnte ich mir sogar vorstellen, ihn zu küssen.«
»Du musst doch jedes Mal niesen, wenn es so weit ist.« Ava grinste.
»Das stimmt nicht! Falls du auf Isabelles Geburtstagsparty anspielst, da hatte ich eine Erkältung.«
»Immer, wenn die Flasche beim Flaschendrehen auf dich zeigte? Im Ernst, Marnie, Flirten funktioniert bei dir so lange, bis du dich aktiv dran beteiligst.«
Marnie streckte Ava scherzhaft die Zunge heraus. »Ein Cousin aus Frankreich?«, hakte sie dann nach. »Warum kennen wir ihn nicht?«
»Keine Ahnung«, gab ich zu. »Louis hat mal erwähnt, dass er Verwandte in Paris hat. Ich glaube, der Bruder seiner Mutter wohnt dort. Die Familie war früher oft da, als Louis’ Großmutter noch lebte. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Oh Mann, wie aufregend! Endlich hätten wir die Chance, einen neuen Typen kennenzulernen. Wir hätten uns bei dir treffen sollen.«
Ich lächelte schief. Ava und Marnie wohnten beide in Saguenay. Sie konnten nicht nachvollziehen, wie es war, mit Bäumen reden zu müssen, wenn man sich einsam fühlte, oder von einem Internetanschluss zu träumen. Mein Highlight der Woche war der Besuch der Videothek im Besucherzentrum des Nationalparks, wo sich die Touristen, die in den Blockhütten am Eingang des Parks übernachteten, Filme ausleihen konnten. »Lasst uns ins Kino gehen«, schlug ich vor und sah auf die Uhr. Fünf wertvolle Stunden lagen vor mir, die ich nicht ungenutzt verstreichen lassen wollte.
»Lass uns lieber beim weißen Haus rumhängen«, sagte Marnie. »In einer Stunde legt der Ausflugsdampfer an und dann kommen die ganzen Touristen. Vielleicht ist ja ein süßer Typ dabei.«
»Tolle Idee!« Ava klatschte in die Hände.
Ich runzelte die Stirn. Seit wann waren meine Freundinnen derart süchtig nach Jungs? Ich verstand es nicht.
Beide sahen mich an. »Was ist los, Jules?«, wollte Marnie wissen. »Du siehst aus, als ob dir schlecht ist.«
»Nein, alles in Ordnung«, wiegelte ich ab und rief mir ins Gedächtnis, dass ich ein Gesicht mit Untertiteln besaß. Man sah mir immer an, was ich gerade dachte. »Ich hab nur angenommen, dass wir etwas Cooles zusammen unternehmen. Schließlich sehen wir uns ab morgen wochenlang nicht.«
»Aber nach neuen Typen Ausschau zu halten, ist doch etwas Cooles!« Ava wickelte eine ihrer kastanienbraunen Strähnen um den Zeigefinger.
»Jules versteht das nicht. Sie hängt ständig mit Jungs rum.«
»Und deshalb weiß ich, dass sie die ganze Aufregung nicht wert sind.« Ich nuckelte genervt am Strohhalm meines Eiscremesodas.
»Wie kannst du das sagen?« Ava wirkte empört. »Du solltest endlich mal einen von Ors’ Freunden küssen. Oder hast du das etwa schon getan?«
»Was?« Marnie bekam ganz runde Augen. »Wer war es denn? Doch nicht Louis?«
»Natürlich nicht.« Langsam fragte ich mich, warum ich unbedingt in die Stadt hatte fahren wollen. Gegen dieses Gerede erschien mir Quadfahren im Schlamm plötzlich geradezu himmlisch.
»Komm schon, Jules!« Ava beugte sich vor. »Du kannst es uns verraten.«
»Ich habe noch nie jemanden geküsst, okay?« Obwohl ich es nicht wollte, spürte ich, wie mir das Blut in die Wangen schoss. Warum musste es bei Ava und Marnie immer um dieses eine Thema gehen?
»Magst du es nicht?« Meine Freundinnen sahen aus, als hätte ich ihnen offenbart, dass ich an einer seltsamen Krankheit litt. »Oder hat sich noch keine Gelegenheit ergeben?«
»Beides.« Ich schob das Glas mit dem Eiscremesoda von mir. »Ist auch nicht so wichtig, oder?«
»Na ja, ich meine …« Ava sah Marnie an, die ihr sofort zu Hilfe kam.
»Du hast ständig Orsons Freunde um dich herum. Ich glaube, ich würde total ausflippen, wenn ich so leben würde wie du. Ist dir eigentlich bewusst, dass du von all den Typen umgeben bist, deren Namen mit einem Herz umrandet an den Wänden der Mädchentoiletten stehen?«
»Die sind nicht halb so cool, wie ihr denkt.« Ich verschränkte die Arme vor dem Oberkörper.
»Aber irgendeinen von denen musst du doch gut finden.« Ava blinzelte verständnislos.
»Ich finde es gut, mit euch abzuhängen.« In Gedanken fügte ich hinzu: Denn so entkomme ich Maman, unserem Haus in der Wildnis und all den Tränen, die meinen Alltag bestimmen. Natürlich sagte ich das nicht laut. Mamans Zustand war ein offenes Geheimnis in der Gegend und sie war nicht die Einzige mit diesem Problem. Bei vielen kam zu den Zigaretten noch der Alkohol hinzu. Jeden Freitagnachmittag, wenn das Sägewerk schloss und die Holzfäller aus den Wäldern zu ihren Familien zurückkehrten, sah man überall Männer und Frauen mit verdächtigen braunen Papiertüten aus den Alkoholshops pilgern. Wer hier lebte, tat dies meist schon seit Generationen, und es gab nur zwei Arten von ihnen. Die einen, die weggingen und nie wiederkamen, und die anderen, die für immer blieben. Manchmal fragte ich mich, zu welcher Art ich wohl eines Tages gehören würde.
»Hallo?« Ava wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht herum. »Bist du noch da, Jules?«
»Klar«, nickte ich, »lasst uns beim weißen Haus rumhängen«. Mehr als das und Kino gab es in Saguenay sowieso nicht zu tun.
Marnie winkte der Kellnerin, die kurz darauf an unseren Tisch kam und ihren Block zückte. Sie musterte mich. »Du bist die Tochter von Caroline und Yann, oder?«, erkundigte sie sich beiläufig, während sie aufschrieb, was wir bestellt hatten.
»Mhm.« Ich atmete tief durch. Die Weite und Einsamkeit dieser Gegend trieb die Menschen nicht nur in den Alkoholismus, sondern schien ihnen auch ein ewiges Gedächtnis zu verleihen. Obwohl mein Vater schon seit 13 Jahren nicht mehr hier lebte, blieb ich für alle Carolines und Yanns Tochter. Es war wie ein Brandzeichen auf meiner Stirn.
»Drei Dollar fünfzig«, sagte die Kellnerin und lächelte mich an. »Ich bin mit Yann in die Grundschule gegangen. Wie geht es ihm?«
Ava und Marnie senkten ihre Blicke. »Gut«, murmelte ich und fügte etwas leiser hinzu: »Glaube ich jedenfalls.«
»Grüß ihn von mir, wenn du ihn wieder siehst.« Sie deutete auf ihr Namensschild. »Lucie Fortin.«
»Okay, das werde ich.« Schnell schob ich ihr das Geld zu. »Schönen Tag noch, Lucie.«
»Danke, euch auch.« Sie nahm unsere Münzen und steckte sie in die breite Geldbörse, die sie um ihre Hüfte trug.
Auf der Straße angekommen, musterte mich Marnie. Sie und Ava hatten mich fürsorglich in ihre Mitte genommen. »Hast du in letzter Zeit etwas von deinem Vater gehört?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf. »Er hat Orson und mir die übliche Weihnachtskarte geschickt. Und zwanzig Dollar zu meinem Geburtstag.«
»Und von wo war diesmal der Poststempel?« Ava schlenderte die Straße hinunter und wir folgten ihr.
»Aus Krakau. Das ist in Polen.«
»Wow!« Marnies Stimme klang sehnsüchtig. »Ich will unbedingt mal nach Europa.«
»Aber wenn, dann in den Süden. Italien oder Spanien.« Jetzt geriet auch Ava ins Schwärmen. »Sobald ich Model bin, gehe ich nach Paris. Und von dort aus erobere ich die Welt!«
»Ich komme dich auf jeden Fall in Paris besuchen«, versprach ich, obwohl mir Avas Satz einen Stich versetzte. Es war mein Traum, nach Paris zu gehen, und jetzt fühlte es sich an, als würde Ava ihn mir wegnehmen. Vielleicht war der Ferienjob doch keine so dumme Idee, dachte ich. So könnte ich Geld zurücklegen und auf den Flug nach Paris sparen.
»Wir kommen dich besuchen«, rief Marnie und hakte sich bei mir unter. »Wir drei lassen uns nie im Stich, versprochen?«
»Niemals!« Ava spreizte Zeige-, Mittel- und Ringfinger, hielt sie an ihr Herz und streckte sie in die Höhe. »Jam forever!« Die Abkürzung stand für die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen. Jules, Ava, Marnie.
Meine trüben Gedanken lösten sich in Luft auf und ich umarmte meine Freundinnen. »Jam forever«, bestätigte ich, bevor wir lachend die Straße hinunterrannten.
* * *
Als ich am Abend nach Hause kam, fand ich Orson beim Kochen am Herd vor.
»Was gibt’s?«, fragte ich mit einem Blick über seine Schulter. Er trug immer noch das rote Cap, aber er hatte geduscht und sich umgezogen.
»Makkaroni mit Käse.« Seine Stimme klang gedämpft. »Wie war sie?« Ich wusste, dass er damit Maman meinte.
»Ganz okay, warum?«
»Sie ist vor meinen Kumpels in Tränen ausgebrochen.« Er verdrehte die Augen. »Das war echt peinlich.«
»Tut mir leid.« Ich öffnete die Kühlschranktür und nahm eine Tüte mit bereits gezupftem Salat heraus. Mein Bruder und ich hatten schon früh kochen gelernt. Vor allem an Mamans schwarzen Tagen konnte sie sich zu nichts aufraffen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. »Warum hat sie denn geweint?«
»Wer weiß?« Orson drehte die Temperatur der Herdplatte herunter und holte eine Dose mit Salatkräutern aus dem Schrank. »Louis’ Cousin hat sie irgendwie aus der Fassung gebracht.«
Ich schüttete den Salat in eine Glasschüssel, während mein Bruder die Kräuter mit dem Öl vermischte. »Wie war’s denn?«, fragte ich.
»Als wir endlich im Wald waren, war es der absolute Wahnsinn!« Orsons Augen glänzten. »Frankie ist auf seiner neuen Honda TRX 400 gekommen. Das Ding geht ab wie eine Rakete! Nächstes Mal musst du unbedingt mitkommen.«
»Ich glaube, ich werde in den Ferien arbeiten.«
»Was?« Er drehte den Kopf. »Warum?«
»Macht man das nicht normalerweise, um Geld zu verdienen?«, neckte ich ihn und fing an, den Tisch zu decken.
»Jules!« Er folgte mir und stellte die Salatschüssel mit einem lauten Knall auf die Tischplatte. »Die Jungs und ich haben so viel geplant! Wir wollen am See zelten und Louis’ Vater nimmt uns vielleicht mal mit auf die Jagd.«
»Oh, das klingt toll.« In meiner Stimme schwang Ironie mit. »Dann ändere ich meine Pläne sofort und schiebe meinen Traum von Paris einfach auf die lange Bank.«
»Ich meine es ernst.« Er knuffte mich. »Wir könnten viel Spaß haben.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, kam Maman in die Küche. Ausnahmsweise hatte sie keine Zigarette im Mundwinkel, doch ihrem fahrigen Gesichtsausdruck nach zu urteilen, sehnte sie sich schon nach einer. Eigentlich hatte sie mit Orson und mir vereinbart, dass im Haus nicht geraucht wurde, doch sie hielt sich nicht immer daran.
»Ich fühle mich nicht gut. Die Fahrt war anstrengend«, sagte sie und setzte sich an den Esstisch. »Was gibt es?«
»Makkaroni mit Käse«, antwortete ich. »Und Salat.«
»Hm«, sie betrachtete die Salatschüssel, »ich nehme nur die Makkaroni.«
»Kommt sofort.« Mein Bruder brachte den Topf und präsentierte ihn wie ein Profikoch. »Wie viel Pasta darf es für Sie sein, Madame?«
»Eine kleine Portion, bitte.« Maman seufzte. »Was würde ich nur ohne dich machen, mein Großer? Du bist meine Stütze.«
Wir setzten uns an den Tisch und begannen schweigend zu essen.
»Nimmst du mich morgen mit ins Besucherzentrum?«, fragte ich nach einer Weile. »Ich möchte Willie wegen eines Ferienjobs fragen.«
»Oh, Jules!« Maman griff über den Tisch hinweg nach meiner Hand. »Ich bin so froh, dass du dich dazu entschlossen hast. Wir werden einen fantastischen Sommer zusammen haben.«
»Mhm.« Ich traute mich nicht, Orson anzusehen. »Ich spare für Paris, weißt du. Irgendwann will ich da unbedingt hin.«
»Paris …« Maman erstarrte. »Du wirst mich doch nicht verlassen, oder?« Panik schlich sich auf ihr Gesicht. »Das könnte ich nicht ertragen, Jules! Nicht nach dem, was euer Vater mir angetan hat.«
»Nein, das werde ich nicht.« Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie mein Bruder die Stirn in Falten legte.
»Wir bleiben bei dir«, versicherte er und deutete auf die Makkaroni. »Noch mehr Nudeln?«
»Nein.« Maman wirkte entrückt. »Es war seltsam heute, wisst ihr.« Ihre Stimme wurde zu einem Flüstern. »Ich musste an die Nacht denken, in der du aus der Wiege gefallen bist, Jules. Damals gab es einen Sonnensturm und im Krankenhaus von Saguenay fiel der Strom aus.«
Ich streichelte Mamans Hand. »Das ist lange her«, sagte ich beruhigend. Ich kannte die Geschichte gut. Sie hatte eine Narbe auf der Seele meiner Mutter hinterlassen.
»Der Himmel stand in Flammen.« Maman presste zitternd die Lippen zusammen und Orson und ich tauschten einen Blick aus. Er schob seinen Stuhl zurück, ging zum Kassettenrekorder und drückte den mittleren Knopf.
»Hör mal!« Ich setzte ein Lächeln auf und bewegte mich im Rhythmus des Liedes, das aus den Lautsprechern dröhnte. »Das ist Marie! Das magst du doch so.«
Normalerweise konnten wir Maman immer mit Musik ablenken. Sie schwärmte für Johnny Hallyday, aber in diesem Moment konnte sein Song sie nicht erreichen. Aufgewühlt starrte sie mich an. »Er wusste, dass du Schmerzen hattest. Ich nicht.«
Ich wechselte einen weiteren Blick mit Orson. Diese Version der Geschichte hörte ich zum ersten Mal. »Wen meinst du?«, fragte ich.
Maman reagierte nicht. »Er hat dich nur angeschaut und du warst still. Nur deshalb bin ich gegangen.«
Ich schaute demonstrativ auf die Küchenuhr und mein Bruder verstand sofort. »Zeit fürs Sofa!« Er klatschte in die Hände. »Die Sopranos fangen gleich an.«
»Ist es schon so spät?« Maman schüttelte den Kopf. »Ich habe völlig die Zeit vergessen.« Sie legte ihre Gabel beiseite. »Ich freue mich schon den ganzen Tag auf die neue Folge. Ich muss unbedingt wissen, ob Adriana die Familie verrät.«
»Geh nur, wir räumen auf.« Ich wartete, bis Maman die Küche verlassen hatte, dann drehte ich mich zu meinem Bruder um. »Was zum Teufel war das?«, formte ich die Worte mit den Lippen und vergewisserte mich, dass Maman außer Hörweite war. »Die Geschichte wird immer absurder.«
Er nickte zustimmend und fügte hinzu: »Du willst doch nicht wirklich nach Paris durchbrennen, oder?«
»Ich … keine Ahnung.« Meine Schultern sanken nach unten. »Wir können doch unmöglich unser ganzes Leben in diesem Haus verbringen. Mit ihr.«
Orson fing an, den Tisch abzuräumen, und ich half ihm dabei. Gemeinsam trugen wir Teller, Besteck und die Salatschüssel zur Spüle und begannen mit dem Abwasch. Einen Geschirrspüler hatten wir nicht. Auch keine Mikrowelle. Zwei weitere Gründe, warum ich am liebsten sofort ausgezogen wäre.
»Bist du sauer?«, fragte ich wegen des plötzlichen Schweigens meines Bruders.
»Nächstes Jahr mache ich meinen Abschluss.« Sein Gesicht war schlagartig wie versteinert. »Louis hat mich gefragt, ob ich mit ihm auf einen Roadtrip gehen will.«
»Wie bitte?« Fast hätte ich den Teller fallengelassen, den ich gerade abtrocknete. »Du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, oder?« Angst kroch mir den Nacken hinauf. Die Vorstellung, dass Orson mich mit Maman alleinlassen könnte, schnürte mir die Kehle zu.
»Doch.« Er schaute mir fest in die Augen. »Louis möchte bis nach Feuerland fahren.« Sehnsucht schwang in seinen Worten mit. »Wir würden Monate unterwegs sein. Vielleicht sogar länger als ein Jahr.«
Ich schluckte. »Ors, das kannst du mir nicht antun.«
»Ich weiß.«
»Du tust es trotzdem?«
Die Frage hing in der Luft, doch nach ein paar Sekunden schüttelte er den Kopf. »Ich habe Louis gesagt, dass ich nicht mitkommen werde.« Seine Stimme klang heiser. »Aber nicht wegen Maman, sondern wegen dir. Das könnte ich dir nie antun.«
Unendliche Erleichterung überkam mich und ich lehnte mich an meinen Bruder. Er legte einen Arm um mich. Im Hintergrund hörten wir die Titelmelodie der Sopranos. Der Fernseher lief wie immer viel zu laut. Wahrscheinlich, weil Maman vor der Tür stand und nebenbei rauchte.
»Du solltest dir trotzdem mal Paris ansehen«, hörte ich meinen Bruder murmeln, bevor er mir einen Kuss auf die Stirn gab. »Ich komme hier schon klar.«
»Irgendwann«, antwortete ich leise und nahm den nächsten Teller aus der Spüle, um ihn abzutrocknen. Doch tief in meinem Inneren weinte ich, weil Paris in unendlich weiter Ferne lag.
das flüstern der wälder
CASSIAN
SAGUENAY, KANADA, JULI 2003
Das Knistern des Lagerfeuers erfüllte die Nacht, während die Flammen vor meinen Augen tanzten und zuckende Schatten auf die Bäume um uns herum warfen. Ich sog den Geruch von brennendem Holz und frischer Erde in meine Lungen und lauschte den Gesprächen. Louis und seine Freunde lachten leise miteinander, aber ich begnügte mich damit, in die lodernden Flammen zu starren. Die Hitze des Feuers wärmte mein Gesicht und ich fühlte eine tiefe Ruhe in mir aufsteigen. Die Zeit schien stillzustehen und für einen Moment war es, als bestünde die Welt nur aus diesem magischen Kreis aus Licht, Wärme und Freunden, verborgen in der unendlichen Weite des Waldes.
»Magst du ’ne Cola?« Mein Cousin griff in die Kühlbox neben sich, aber ich schüttelte den Kopf. Er grinste. »Vielleicht lieber was Härteres, um dich gesprächiger zu machen?«
»Nein, danke.«
»Das war ein Scherz. Wir trinken keinen Alkohol.«
»Okay.«
»Herrje, Cass«, Louis öffnete zischend eine Dose und trank ein paar Schlucke, »hast du deine Zunge verschluckt?«
»Nein.« Ich legte mein Kinn auf die Arme, die ich über meinen angezogenen Knien verschränkt hatte, und hing wieder meinen Gedanken nach. Ich hatte Kanada vermisst. Als ich klein war, waren meine Eltern einmal im Jahr hergeflogen, um meine Oma zu besuchen, aber nach deren Tod waren die Besuche seltener geworden. In diesem Sommer kam ich zum ersten Mal allein. Louis, mein Cousin, war ein Jahr jünger als ich, und wir hatten uns immer gut verstanden. Er war ein typischer Kanadier, bescheiden, eishockeyverrückt und naturverbunden. Das wusste ich zu schätzen. In meiner Heimatstadt Paris gab es nur Parks statt Wälder und laute Partys statt Lagerfeuerromantik. Meine Eltern, mein Bruder und ich wohnten im 12. Arrondissement, auch Bercy genannt. Von meinem Zimmer aus blickte ich auf das benachbarte Hochhaus, drei Bäume und eine schmale Rasenfläche dazwischen. Wenn ich mehr Grün sehen wollte, musste ich mit dem Rad zehn Minuten bis zum Parc de Bercy fahren, einer städtischen Grünanlage, die genau das war: städtisch. Es gab begrenzte Grünflächen, künstliche Seen und Rundwege, auf denen sich am Wochenende unzählige Menschen drängten. Unter der Woche besuchte ich eine Privatschule und in den Pausen diskutierten meine Freunde über die Haltung des französischen Präsidenten Jacques Chirac zum Irak-Krieg, über die Streiks gegen die Rentenreformpläne der Regierung und über die Notwendigkeit von Wirtschaftsreformen. Das alles war nichts im Vergleich zu einem Campingausflug in die Wildnis.
»Hörst du das?« Louis hob den Zeigefinger und riss mich aus meinen Gedanken. »Das ist Wolfsgeheul.«
»Aber es ist weit weg.« Orson, der beste Freund von Louis, brummte beruhigend. »Kein Grund zur Sorge.«
»Ich mache mir keine Sorgen.« Im Gegenteil. Meine Neugier war geweckt. »Meint ihr, wir werden welche sehen?«
»Eher nicht. Wölfe sind scheu. Es ist viel wahrscheinlicher, dass uns ein Bär über den Weg läuft. Die sind ziemlich neugierig. Aus diesem Grund müssen wir vor dem Schlafengehen unseren gesamten Proviant in Tüten packen und in die Bäume hängen.«
»Deshalb habt ihr das Seil mitgebracht«, spekulierte ich und Orson nickte.
»Das stimmt. Wir binden ein Ende um einen Stamm, fädeln die Trageschlaufen der Tüten ein, ziehen das Seil straff und binden das andere Ende um einen zweiten Stamm. So hängen die Tüten in der Luft. Bären sind gute Kletterer. Wenn man die Tüten nur an einen Ast hängt, kommen sie trotzdem dran.«
Ich lächelte. Das waren genau die Dinge, die mich interessierten. Mehr als Musikvideos auf MTV, Computerspiele oder Modetrends. Aber anscheinend sah man mir das nicht an, denn Orson zupfte amüsiert an meiner weiten Hose.
»Versteckst du darunter Zigaretten oder sowas?«, fragte er.
»Das sind Baggy Pants. Die tragen Skater.« Ich deutete auf das Logo, das mein T-Shirt zierte. Es war das Trendlabel für alle, die Skateboard fuhren, doch Orson schien es überhaupt nichts zu sagen.
»Wir skaten hier nur auf dem Eis.« Neugierig beugte er sich vor. »Gibt es in Paris eine Eishockeymannschaft?«
»Ich habe keine Ahnung«, gestand ich. »Die Leute an meiner Schule interessieren sich vor allem für Fußball und Kickboxen.«
»Kickboxen?« Orson zog die Augenbrauen hoch. »Ist das Boxen mit den Füßen?«
Ich grinste. »Das ist eine Kombination aus Boxen und Karate. Boxschläge dürfen nur oberhalb der Gürtellinie erfolgen, Tritte können sowohl auf den Kopf als auch auf den Körper des Gegners zielen.«
»Hast du das mal gemacht?«
»Bis vor einem Jahr, ja. Inzwischen finde ich es nicht mehr so interessant.«
»Machst du einen anderen Sport?«
»Ich habe mal Tennis gespielt. Ist lange her.« Ich dachte an meine Eltern, die gerade in London waren, um meinen älteren Bruder Tommy zu unterstützen, der dort sein Debüt in Wimbledon gab. Fahrig fuhr ich mir durch die Haare. »Momentan interessiere ich mich hauptsächlich fürs Skateboard fahren.«
Wir schwiegen eine Weile, dann wandte sich Orson wieder an mich: »Wie ist es in Paris?«
»Laut und hektisch und voller Menschen.«
»Hm.« Er starrte ins Feuer. »Meine Schwester träumt von Paris. Ich kann nur nicht glauben, dass es ihr dort wirklich gefallen würde.«
»Jules würde wahrscheinlich als Kickboxerin zurückkommen und uns allen den Hintern versohlen«, scherzte Louis und die anderen Jungs stimmten ihm lachend zu.
»Warum fliegt deine Schwester nicht nach Paris?«, wollte ich wissen und das Gelächter um mich herum verstummte.
»Das ist nicht so einfach zu erklären«, murmelte Orson und stach mit einem Ast so heftig ins Feuer, dass die Funken sprühten. »Wer will Marshmallows?«, fügte er hinzu und begann in seinem Rucksack zu kramen, ohne die Antwort der anderen abzuwarten.
»Wo ist eigentlich deine verrückte Schwester?« Louis riss die Tüte mit den Süßigkeiten auf, die Orson ihm hinhielt. »Hat sie die Nase voll von uns?«
»Sie arbeitet den Sommer über.«
»Wirklich? Wo denn?«
»Im Besucherzentrum. Willie hat sie eingestellt. Sie kopiert irgendwelches Zeug, erneuert die Aushänge in den Schaukästen, wischt die Böden und putzt die Fenster.«
Louis rümpfte die Nase. »Wie aufregend«, murmelte er, spießte ein Marshmallow auf einen angespitzten Ast und hielt ihn über das Feuer. »Aber dann müssen wir uns wenigstens keine Sorgen machen, dass uns ein Mädchen bei unseren Wettrennen schlägt.«
Ich hörte nur mit halbem Ohr zu und beobachtete, wie die Jungs in die Tüte mit den Marshmallows griffen. Auf den Partys, die ich kannte, wurde so viel geraucht, dass die Wände der Wohnungen voller Nebel waren. Neben Alkohol waren auch Cannabis und manchmal sogar Kokain im Umlauf. Wenn man in diesem Zustand ein Mädchen küsste, konnte man sich am nächsten Tag kaum ihren Namen ins Gedächtnis rufen. Passierte mehr, erinnerten zumindest verkehrt herum angezogene T-Shirts, verlorene Socken oder verdrehte Gürtel daran, dass die nächtliche Ekstase nicht nur ein aufregender Traum gewesen war. Hier im Wald gab es das alles nicht und doch fühlte ich mich an diesem Ort bedeutend wohler.
»Willst du einen?« Louis hielt mir seinen verkohlten Marshmallow unter die Nase. Ich zögerte, bevor ich zugriff. Süßigkeiten waren nichts, was ich kannte, denn in unserem Haushalt wurde auf gesunde Ernährung geachtet. Aber dem Marshmallow konnte ich nicht widerstehen. »Und?« Louis sah mich an. Er verstand nicht, warum ich seit meiner Ankunft lieber Gemüse statt Fleisch, Wasser statt Cola und Obst statt Schokolade zu mir nahm. »Gut, oder?«
Ich nickte langsam. Das Marshmallow war pappsüß, aber okay. »Gib mir noch einen«, bat ich Louis, der daraufhin lachte.
»Was ist los, Cass? Macht dich der Wald hungrig? Oder bist du nun endlich auf den Geschmack gekommen?«
Ich leckte mir die klebrigen Finger ab. »Beides«, antwortete ich und sah die anderen Jungs zustimmend nicken. Außer Louis und Orson saßen noch vier weitere mit uns am Feuer. Frankie, ein rothaariger Hüne, der uns alle um mindestens einen Kopf überragte. Robert, den jeder nur Bobby Boo nannte und der immer in kurzen Hosen herumlief, egal wie kalt es war. Elijah, der Älteste von allen, der nach eigener Aussage schon dreimal eine Klasse wiederholen musste und inzwischen den Rekord als ältester Schüler seiner Schule hielt. Und Tawit, der noch weniger sprach als ich und dessen Vater vom Volk der Innu abstammte. So unterschiedlich die Jungen auch waren, so vertraut war ihr Umgang miteinander. Es schien, als würde die Einsamkeit dieser Gegend sie trotz aller Gegensätze zusammenschweißen. Etwas, das ich bewunderte und in meiner Heimat vermisste. In meiner Schule galt man vor allem dann als cool, wenn man mit den coolen Leuten zusammen war. Und wer cool war, hing davon ab, welchen Sport man machte, welche Klamotten man trug und welche Musik man hörte.
Wieder spürte ich Orsons neugierigen Blick auf mir. Ich kannte ihn schon von meinen früheren Besuchen in Saguenay. Als Kind war Orson schüchtern gewesen und hatte kaum ein Wort mit mir gesprochen, wenn er Louis besucht hatte. Wir hatten nie viel miteinander zu tun gehabt. Meistens waren Orson und Louis hinter meinem Bruder Tommy hergelaufen. Er war immer derjenige von uns beiden gewesen, der die Leute beeindruckt hatte. Aber jetzt war Orson wie ich fast volljährig und hatte nichts mehr mit dem schüchternen Jungen gemein, an den ich mich erinnerte.
»Wie geht es eigentlich deinem Bruder?«, fragte er prompt. »Man sagt, er sei jetzt berühmt.«
Ich senkte den Kopf. »Na ja, er ist auf dem besten Weg, Tennisprofi zu werden.«
»Er spielt gerade in Wimbledon, könnt ihr euch das vorstellen, Leute?«, warf Louis ein.
»Wow!« Orson war sichtlich beeindruckt. »Warum bist du dann hier und nicht in London, Cass?«
Diese Frage hatte ich befürchtet. Meine Tante hatte sie mir schon kurz nach meiner Ankunft am Flughafen in Québec gestellt. »London ist nicht so mein Ding«, antwortete ich ausweichend und sah mich um. »Außerdem, was gibt es Schöneres, als im Wald den Wölfen zu lauschen?«
»Da hast du recht.« Louis legte den Kopf in den Nacken und ahmte Wolfsgeheul nach. Die anderen stimmten ein und brachen schließlich in Gelächter aus. Ich lehnte mich zurück und starrte wieder in die Flammen. Seit ich denken konnte, trug ich eine brennende Sehnsucht in mir, die ich nicht in Worte fassen konnte. Es war ein Gefühl, das tief in mir wühlte, ein ständiges Ziehen und Zerren, das ich weder benennen noch verstehen konnte. Wie ein Geist war es immer da, lauerte in den Schatten meiner Gedanken, manchmal leise und zart, manchmal so überwältigend, dass es mich förmlich verschlang. Es war, als ob mich ein unsichtbarer Faden mit etwas Unbekanntem und Unbegreiflichem verband, das ich nicht fassen konnte. Dieses Gefühl war keine bloße Melancholie oder flüchtige Traurigkeit, sondern eine unaufhörliche Unruhe, ein Durst nach etwas, das jenseits meines Horizonts lag. Es war ein unerbittliches Pochen in meiner Brust, ein dumpfes Klopfen, das mich nachts wachhielt und meine Träume heimsuchte. Ich spürte es in jedem Atemzug, in jedem Herzschlag, eine ewige Suche nach etwas Verlorenem oder vielleicht nie Gefundenem. Oft versuchte ich, diese Regung zu ignorieren, sie zu unterdrücken, aber sie war wie ein wilder Fluss, der sich seinen Weg bahnte, ungeachtet der Dämme, die ich errichtete. Sie war wie der ferne Ruf eines Vogels, der in der Dunkelheit sang, ein Lied, das nur ich hören konnte und dessen Melodie mich quälte, weil ich ihre Bedeutung nicht verstand. Manchmal glaubte ich, es sei die Sehnsucht nach einem Ort, den ich nie gesehen hatte, nach einem Gesicht, das ich nie berührt hatte, nach einer Zeit, die längst vergangen war. Aber diese Gedanken brachten keine Klarheit, sondern nur noch mehr Verwirrung. Es war, als ob mein Herz selbst ein Geheimnis vor mir verbarg, ein Rätsel, das es nicht preisgeben wollte. Als ob meine Seele nach etwas suchte, das sie einmal gekannt hatte, etwas, das jenseits der greifbaren Welt existierte. All das waren Gefühle, die ich niemandem erzählen konnte, aus Angst, man würde mich für verrückt halten. Ich redete mir ein, ich sei einfach nur ein Junge in der Pubertät oder eifersüchtig auf meinen älteren Bruder. Er war mein ganzes Leben lang von meinen Eltern bevorzugt worden. Ich wusste nicht, was es war. Aber eines wusste ich: Jedes Mal, wenn ich an diesem Ort im Wald war, hörte es auf. Und deshalb wollte ich am liebsten nie mehr weg.
* * *
»Was für ein krasser Wahnsinn!« Louis setzte seinen Helm ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seine raspelkurze Frisur litt weit weniger unter dem Helm als meine halblangen Haare, die in meiner Heimat gerade in Mode waren. Ich strich mir die störrischen Strähnen aus dem Gesicht, stellte den Motor ab und atmete tief durch. Wir waren bei Orsons Haus angekommen, das mitten im Wald lag, und wie jedes Mal zog mich dieser Ort in seinen Bann.
»Alles in Ordnung?« Louis warf mir einen Blick zu, wie er es immer tat, wenn ich nicht so reagierte, wie er es von mir erwartete.
»Es war der absolute Wahnsinn«, bestätigte ich und sah, wie sich ein breites Grinsen auf dem Gesicht meines Cousins ausbreitete.
»Nicht wahr?« Er stieg von seinem Quad. »Komm, lass uns reingehen. Wir haben noch etwas Zeit und du musst dir unbedingt Orsons Camaro ansehen.«
Ich folgte ihm in einigem Abstand und bemühte mich, nicht zu neugierig zu wirken. Das Blockhaus von Orsons Familie lag auf einer Lichtung. Die Sonne brach sich in den Zweigen der Bäume und warf tanzende Schatten auf die massiven Holzstämme, aus denen das Haus gebaut war. Es sah aus wie auf einem dieser Poster, die man in den Touristenshops kaufen konnte. Überall war Vogelgezwitscher zu hören und Mückenschwärme tanzten in der Luft. Schon rannte Louis los. »Komm, die Viecher fressen uns noch auf! Es ist wirklich teuflisch hier im Sommer.« Er sprintete zum Haus, wo Orson uns bereits die Tür aufhielt.
»Schnell, schnell!« Er winkte uns durch das Fliegenschutzgitter ins Innere und verschloss es hinter uns. »Wenn ihr was trinken wollt, bedient euch. Ich ziehe mich rasch um.«
Während Louis sich sofort auf den Weg machte, blieb ich stehen. Bisher hatte ich das Haus immer nur von außen gesehen, aber nun betrat ich zum ersten Mal sein Inneres. Eine Mischung aus dem Duft von Kiefernholz, kaltem Zigarettenrauch und dem Vanille-Potpourri, das auf einer Bank neben dem Eingang stand, hüllte mich ein. Gemütlich und einladend breitete sich das Wohnzimmer vor mir aus. Ein großes Ledersofa dominierte den Raum, abgewetzt und doch charmant mit vielen bunten Kissen und einem Plaid bedeckt. Vor dem Sofa lag ein grob gewebter Teppich, dem man ansehen konnte, dass er schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. An jeder freien Wand reihten sich prall gefüllte Bücherregale aneinander, in einer Ecke stand ein Korb mit Wolle, Strickzeug und einem halbfertigen Pullover. Auf einer schmalen Anrichte neben dem Sofa thronten ein kleiner Fernseher und ein Videorecorder. Daneben stapelten sich säuberlich beschriftete Videokassetten. Doch das Herzstück des Zimmers war ein massiver Steinkamin und obwohl in ihm kein Feuer brannte, konnte ich mir vorstellen, wie es hier im Winter aussah, wenn sich der Schnee vor den Fenstern türmte.
Ich durchquerte das Wohnzimmer und blieb vor den vielen gerahmten Fotos stehen, die in wildem Durcheinander neben Kinderzeichnungen auf vergilbtem Papier im Flur zur Küche hingen. Ich erkannte Orson als Kind. Damals war er strohblond gewesen, jetzt war sein Haar etwas dunkler. Genau wie das seiner jüngeren Schwester. Ich beugte mich vor. Jules. Ich erinnerte mich, dass Louis von ihr gesprochen hatte. Mit ihren sportlichen Klamotten und den zerzausten, langen Haaren sah sie aus wie ein Junge, doch sie hatte grüne Augen, die mich faszinierten. Wir waren uns nie begegnet, aber an dieser Wand war ihre ganze Entwicklung dokumentiert. Auf den meisten Fotos, auf denen sie mit ihrer Mutter zu sehen war, blickte sie ernst, doch einmal lachte sie auch. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog, sah auf und erstarrte.
»Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.« Orson kam auf mich zu und zog sich im Gehen ein frisches T-Shirt über den Kopf.
Ich blinzelte und deutete auf das Bild, das meine Aufmerksamkeit erregt hatte. »Hast du das gemalt?«
»Nein, das war Jules. Sie ist besessen von den Nordlichtern. In ihrem Zimmer liegen noch hundert andere solcher Bilder. Sie malt in jeder freien Minute.«
»Wirklich?« Ich folgte ihm in die Küche, wo Louis es sich bereits mit einer Familienpackung Frosties am Esstisch gemütlich gemacht hatte, die er direkt aus der Tüte aß.
Ich sah mich unauffällig in der Küche um. Die Schränke waren aus dunkel gebeiztem, in die Jahre gekommenem Holz und der riesige Kühlschrank erdrückte den kleinen Raum beinahe. Auf der Arbeitsplatte waren die Reste eines unvollendeten Frühstücks zu sehen: ein paar Brotkrümel, ein Marmeladenglas, ein Glas Erdnussbutter und eine Flasche Ahornsirup.
»Möchtest du etwas trinken?« Orson holte einen Gallonenkanister Orangensaft aus dem Kühlschrank und schenkte sich ein Glas ein.
»Habt ihr nichts anderes?« Louis klang missmutig.
»Tut mir leid, Maman wollte nach der Arbeit noch einkaufen gehen.« Orson grinste schief. »Wenn sie es nicht vergisst.«
»Lebt ihr hier allein mit eurer Mutter?«, wagte ich zu fragen.
»Ja, schon unser ganzes Leben lang. Unser Vater hat dieses Haus selbst gebaut. Er wollte mit seiner Familie mitten im Wald wohnen. Bis zu dem Tag, an dem er uns verlassen hat.«
»Sorry …«, murmelte ich.
»Nein, schon gut, ist kein Geheimnis.« Orson winkte ab und trank sein Glas Orangensaft in einem Zug aus. »Er schreibt Jules und mir ab und zu eine Karte. Wir vermissen ihn nicht.«
»Ich habe Hunger, Bro.« Louis stöhnte. »Kann ich ein Sandwich haben?«
»Ich mache uns gegrillte Käsesandwiches.« Orson warf mir einen Blick zu. »Magst du auch eins?«
»Gerne«, antwortete ich erstaunt. »Kannst du kochen?«
»Und wie er kochen kann!« Louis tat so, als würde er sabbern. »Du solltest mal seine Spaghetti mit Hackbällchen probieren. Mann, die sind vom anderen Stern!«
Ich setzte mich und beobachtete, wie Orson sich ans Werk machte. Alles schien ihm leicht von der Hand zu gehen und ich war fasziniert. Bei uns zu Hause war meine Mutter für das Kochen zuständig und sie liebte die südfranzösische Küche. Deshalb gab es bei uns oft Fisch, gegrilltes Gemüse oder Salade Niçoise. Das war etwas ganz anderes als das, was hier auf den Tisch kam. Mein gesundheitsbewusster Bruder wäre wahrscheinlich in den Hungerstreik getreten. Doch ich fand allmählich Gefallen daran.