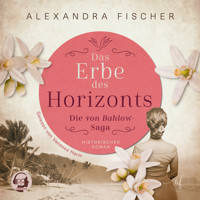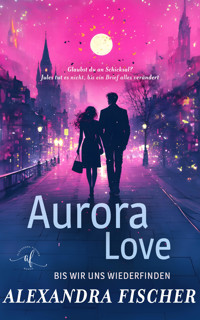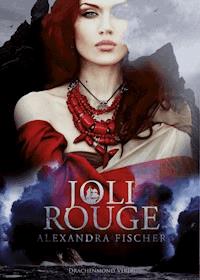
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ich werde niemals einen Mann heiraten, der über mich befiehlt", schmetterte Jacquotte ihm entgegen. "Ebenso wenig wie ich jemals einen Mann heiraten werde, über den ich zu befehlen vermag." La Española, 1656: Das Gesicht der Westindischen Inseln beginnt sich zu verändern. Einst von Spanien dominiert, beginnen sich die Mächte mit den eintreffenden Seefahrernationen England, Frankreich und Holland zu verschieben. Es ist die Welt der Bukaniere, in der die junge Jacquotte Delahaye aufwächst. Eine Welt der Männer, wie sie sehr bald feststellt, beherrscht von der Bruderschaft der Küste, die nach ihren eigenen Regeln lebt und in der Frauen nicht erwünscht sind. Mit dem ihr eigenen Stolz stellt sie sich den Herausforderungen dieser unsteten Zeit, in der man nur selbstbestimmt leben kann, wenn man ein Mann ist. Wird es ihr gelingen, der Bruderschaft beizutreten und ihren eigenen Weg zu gehen? Ein historischer Roman über eine der wenigen Piratinnen, die in diesen harten Zeiten überleben konnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Fischer
JoliRouge
Historischer Roman
Astrid Behrendt Rheinstraße 60, 51371 Leverkusenwww.drachenmond.de, [email protected]
KorrektoratMichaela Retetzki
Satz, Layout Martin Behrendt
UmschlaggestaltungMarie Graßhoff
BildmaterialShutterstock
ISBN: 978-3-95991-074-3 ISBN der Druckausgabe: 978-3-95991-073-6
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Geschichtlicher Hintergrund
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Epilog
Beteiligte Personen
Historische Personen
Danksagung
s
Für alle meine Mädels,in denen ebenfallsein Piratenherz schlägt!
< Geschichtlicher Hintergrund >
Anfang des 17. Jahrhunderts lebten auf der Karibik-Insel La Española (heute: Haiti und Dominikanische Republik) vor allem Franzosen. Unter ihnen waren entflohene Sklaven, gescheiterte Plantagenbesitzer und politisch Verfolgte, die sich ihren Lebensunterhalt dadurch verdienten, dass sie die wilden Stiere und Schweine der Region einfingen.
Die Art, das erbeutete Fleisch zu räuchern, um es haltbar zu machen, brachte diesen Männern den Namen ›Bukaniere‹ ein.
Einige von ihnen wurden auch zu ›Flibustier‹, zu Kaperfahrern, die in kleinen Booten die Galeonen der Spanier angriffen.
Sie alle organisierten sich unter dem Zusammenschluss der sogenannten ›Bruderschaft der Küste‹, um sich gegenseitig Sicherheit zu geben.
Ihr Markenzeichen war die Joli Rouge, die rote Flagge, die stets dann gehisst wurde, wenn ein Überfall blutig enden sollte.
Es wird vermutet, dass dieser Begriff der Ursprung für die spätere Jolly Roger ist, die legendäre Totenkopfflagge der Piraten der Karibik.
< Prolog >
Windward Passage, Winter 1638
In Émile keimte der Wunsch auf, sich über Bord der Barke zu stürzen. Keine Sekunde, glaubte er, könnte er noch die Selbstbeherrschung aufbringen, um trotz Hunger und Durst auf der ihm bestimmten Position auszuharren. Doch er konnte nicht schwimmen und dieses Unvermögen verdammte ihn dazu, sich in sein Schicksal zu fügen, während sie in die Dunkelheit glitten. Kein einziges Wort kam über die Lippen der Männer. Seit Tagen schon waren sie den Gezeiten ausgeliefert und lauerten mit wachsender Ungeduld auf das Eintreffen der versprochenen Silbergaleonen.
Die Windward Passage oder paso de los vientos, wie sie die Spanier nannten, erstreckte sich zwischen La Española und der Ostküste der Insel Kuba. Sie war bekannt für ihre günstigen Winde, die die spanischen Schiffe im Winter in Richtung Festland führten. Einem Fluch gleich hatte sich jedoch eine Flaute über die verheißungsvolle Meerenge gelegt, und die knapp fünfzig Männer kauerten zusammengesunken im feuchten Bauch der Barke, den Blick auf die wortlosen Befehle ihres Kapitäns gerichtet.
Die Ruder machten schmatzende Geräusche, als sie aus dem schwarzen Wasser gezogen wurden, und verharrten in der Nacht. Émile fror vor Anstrengung und jeder Knochen tat ihm weh. Aufgewachsen am Meer, hatte er die See schon immer gefürchtet. Bevor er das französische Festland verließ, um in diesem Teil der Welt neu anzufangen, hatte er nicht gewusst, dass es Männer gab, die den Mut besaßen, vollbeladene Galeonen von Bord eines Ruderboots aus anzugreifen, das in seinen Augen bestenfalls Kanonenfutter für die schweren Geleitschiffe der Spanier darstellte. Hätte er nicht selbst gesehen, dass diese wagemutigen Aktionen von Erfolg gekrönt waren, hätte er keinen Fuß in das schaukelnde Gefährt gesetzt, das nach Moder roch und dessen Zustand auch durch den Namen La Foi, Zuverlässigkeit, nicht vertrauenserweckender wirkte.
Der Wunsch nach Anerkennung und ein Anflug von Habgier hatten ihn dazu getrieben. In diesem Moment verabscheute er sich besonders dafür. Müde fragte er sich, wie er es schaffen sollte, an Bord eines turmhohen Schiffes zu gelangen, dessen Mannschaft aus über hundert Mann bestand. Wie sollte er, Émile Vigot aus der Normandie, sich gegen diese Übermacht durchsetzen? Seine Kühnheit holte ihn mit ganzer Härte ein, und er erschauerte. Das Salzwasser juckte auf der Haut. Er leckte sich die Lippen. Den Geschmack des Meeres kannte er bereits sein Leben lang, und obwohl er versucht hatte, vor seiner Vergangenheit zu fliehen, verfolgte ihn dieser Geschmack bis hierher und ließ unliebsame Erinnerungen aufsteigen.
Während sie warteten und über die Wellen schaukelten, sah er das Dorf seiner Kindheit vor sich. Die Häuser von La Haye du Puits waren aus schroffem Stein gebaut und sahen aus, als würden sie sich ducken, um nicht vom Wind erfasst zu werden. Er spürte den Hunger. Dieses verzehrende Gefühl, das ihm bereits morgens beim Aufwachen jede Lebensenergie raubte und die Gedanken verlangsamte.
Wenn Émile an seine Kindheit dachte, war es dieses Gefühl, das ihm einfiel. Neben seiner Mutter Alizée. Hätte er dem Hungergefühl eine Farbe geben müssen, wäre es Schwarz gewesen. Ein schwarzes Loch, das sein Leben bestimmte und ihn innerlich auffraß. Eine passende Farbe für seine Mutter wäre Rot, denn sie war das Licht in Émiles Leben. Ihre Haare leuchteten wie Herbstlaub und es war, als ob selbst an kalten Tagen eine beruhigende Wärme von ihr ausging. Émile umkreiste sie wie die Sonne, denn sie brachte ihn zum Lachen und überließ ihm das meiste der täglichen Mahlzeit, obwohl ihr eigener Körper bereits ausgezehrt war. Seinen Vater hatte Émile nie gekannt. Ob er fortging oder starb, blieb das Geheimnis seiner Mutter. Ebenso wie ihre Arbeit.
Sie wusste um die Wirkung von Kräutern, die sie tagsüber im sumpfigen Umland sammelte und in Büscheln entlang der rückwärtigen Hauswand trocknete, um sie anschließend zu zerreiben und zwischen gegerbten Tierhäuten aufzurollen. Diese Päckchen versteckte Alizée hinter lockeren Mauersteinen. Zurück blieb der würzige Duft, der jeden Winkel ihres winzigen Hauses erfüllte. So lebten sie zehn Jahre unbescholten in dem kleinen Ort. Bis zu jenem Tag im Frühjahr, als ein Pulk Menschen aus dem Dorf auftauchte und die Mutter der Hexerei beschuldigte. Bereits Tage vorher hatte jemand ein Zeichen an ihre Tür gemalt, das man den ‚Drudenfuß‘ nannte, wie Émile später erfuhr.
Die Erinnerungen an die Heimat katapultierten Émile zurück in die Gegenwart. Im Dunkeln spürte er Jérôme, seinen besten Freund und Gefolgsbruder, neben sich. Ungeduld ging von ihm aus, sowie der Wille, endlich in den Kampf zu ziehen. Émile fragte sich, wie lange sie noch ausharren mussten, bis Michel d’Artigny, ihr Kapitän, die Kaperfahrt abblies. Die schwarze See schien diesmal kein Glück zu bringen und Émile hoffte inständig, dass er bald zurück an Land durfte. Doch bisher deutete nichts darauf hin.
Die Wellen klatschten träge an den Bug der Barke und versetzten die Männer in einen tranceartigen Zustand. Selbst der seit einigen Stunden auffrischende Wind gab ihnen kaum Zuversicht. Schlimmer noch als eine aufgewühlte See, war eine mondlose Nacht in ruhigem Gewässer. Sie ließ den Gemütszustand der Mannschaft auf den Nullpunkt sinken und sie Dinge sehen und hören, die ihre müden Sinne ihnen vorgaukelten.
»Wenn ich nicht bald meinen Enterhaken benutzen und meinen Säbel in wertloses Spanierfleisch bohren kann, versenke ich eigenhändig dieses Stück Treibholz! Mögen wir mit ihm absaufen. Ohne Prise kein Anteil!«, knurrte Jérôme und verlagerte sein Gewicht, um die steifen Muskeln zu entlasten.
»Aye! Was ist los mit Michel, dem Basken? Verlässt ihn sein Glück?« Es waren die Brüder Lormel. Fast Kinder noch, der eine hübsch, jedoch von einem beängstigenden Geschwür unterhalb der Nase gekennzeichnet, der andere rebellisch und hart, standen sie Michel d’Artigny seit ihrer Ankunft in einer stürmischen Nacht stets zur Seite.
»Wo sind die Schiffe, die man uns versprochen hat?«, fragte Antoine Hantot.
»Wann dürfen wir kämpfen?«
Ein Dutzend Stimmen erhob sich, die der laue Wind in die Nacht trug.
»Schweigt!« Michels tiefe Stimme sorgte augenblicklich für Ruhe. »Ihr winselt wie feige Hunde und macht die Spanier auf uns aufmerksam. Wie könnt ihr es wagen, euch Bukaniere zu nennen und dann nicht zu bemerken, dass ihre Schiffe seit über einer Stunde backbord voraus an uns vorüberziehen? Wacht auf, Brüder, und erinnert euch an den Schwur. Die Zeit des Wartens ist nun vorüber. Macht euch bereit zum Kampf!«
Ein Ruck ging durch die Mannschaft. Tatsächlich, bei genauem Hinhören war das Knarren der Taue und das Schlagen der Segel auszumachen. Die spanischen Schiffe glitten wie geisterhafte Schatten durch die Meerenge. Sie hatten es eilig, denn sie nutzten jeden Lufthauch und segelten vor dem Wind mit Kurs gen Südosten. Michel vermutete, dass ihre Decks mit Silber gefüllt waren, das sie an die Küste von Caracas brachten. Er hatte der Mannschaft vor der Abfahrt erklärt, dass die sogenannten galeones de la plata keinen Geleitschutz benötigten, sondern derart bewaffnet waren, dass sie allen Widrigkeiten standhielten. Sie waren mit schweren Kanonen bestückt und machten sie untertags mit ihren geschickten Manövern uneinnehmbar gegen angreifende Schiffe, aber Michel war überzeugt, dass sie wehrlos gegen ein im Schutz der Nacht längsseits gehendes Ruderboot waren. Émile empfand diese Idee mit einem Mal als große Dummheit.
Doch um ihn herum klirrten bereits die Waffen seiner Kameraden, die wild darauf waren, ihre Taschen mit Silber zu füllen. Émiles Puls beschleunigte sich. Mehr noch als das Meer fürchtete er den Kampf. Sein Talent mit dem Säbel war leidlich und eine Muskete in der Hand versetzte ihn in Angst. Während sich die Männer ihre Zeit an Land oft mit Wettschießen auf Pomeranzenbäume vertrieben, bei denen derjenige gewann, der die meisten Früchte abschoss, ohne sie zu beschädigen, war es Émile genug, seine neue Heimat zu erkunden, ohne ihr Leid zuzufügen.
»Wenn wir auf dem Schiff sind, bleib an meiner Seite, Freund!«, raunte Jérôme und legte Émile die Hand auf den Arm.
Dieser nickte beklommen. Jérômes Augen glitzerten, und Émile glaubte, ein Grinsen in seinem Gesicht auszumachen.
»Sei unbesorgt! Du wirst bald zurück an der Küste sein. Diesmal nur mit einigen Achterstücken mehr und einer Sorge weniger.« Jérôme klang amüsiert, und Émile fragte sich, ob er sich über ihn lustig machte.
Eine herrische Geste von Michel, die sie mehr wahrnahmen, als dass sie sie sahen, brachte sie endgültig zum Schweigen. Die Männer griffen in die Ruder. Fast lautlos hielten sie Kurs auf eine Galeone, die hinter dem Tross zurückgeblieben war. Wie ein schwarzer Felsen ragte sie aus dem Wasser, während ihr mächtiger Leib beim Eintauchen in die Wogen gluckste.
Émile nahm den brackigen Geruch der Algen wahr und hörte den Anflug von Gesprächsfetzen an Bord. Mit der Arroganz eines lebendigen Wesens blickte die Galeone auf sie herab und spuckte verächtlich beim Anblick der kleinen Barke. Émile wischte sich das Salzwasser aus den Augen und versuchte, sein pochendes Herz unter Kontrolle zu bringen. Die Galeone war höher, als er erwartet hatte, und so imposant, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass sie leicht einzunehmen war. Wenn überhaupt. Doch diesen Gedanken verdrängte er rasch wieder, denn jetzt gab es kein Zurück mehr.
Die Männer gingen in Position. Jeder kannte seinen Platz und wusste, was er zu tun hatte. Dies war nicht ihre erste Kaperfahrt und alle waren lüstern nach den verborgenen Schätzen im Laderaum. Kurz vor dem Entern waren sie besonders angespannt, denn in der bevorstehenden Schlacht war jeder auf sich allein gestellt, und selbst der sanftmütigste Mann wurde zu einer Bestie, wenn er Blut geleckt hatte. Doch noch wusste keiner, was sie erwartete.
Mit dem Werfen der Enterhaken stellten sie sich ihrem Schicksal. In weitem Bogen flogen die klauenförmigen Haken durch die Luft, bevor sie klirrend mittschiffs auf dem Deck landeten. Die Männer zogen straff an und verankerten sie im Holz. Dann erst schwangen sich Michel und die Mutigsten unter ihnen hinauf, gefolgt von ihren angespornten Kameraden.
Wie behände Affen erklommen sie mit Hilfe ihrer Äxte den gewölbten Rumpf, vorbei an den Kanonenluken und über die Reling, wo sie sofort die Waffen zückten. Während Émile noch am Seil baumelte und sich zwang, nicht nach unten zu sehen, hörte er die ersten Schreie und das Getrampel der aufgeschreckten Mannschaft. Schüsse zerrissen die Dunkelheit und erfüllten die Luft mit Pulverdampf.
Als Jérôme ihn an Deck zog, war der Kampf bereits in vollem Gange. Spärlich erhellt durch Öllampen und gedämpft durch den Rauch, sah Émile nur schemenhafte Gestalten. Es war ihm unmöglich, seine Brüder von den spanischen Seeleuten zu unterscheiden. Jérôme schubste ihn umher, immer darauf bedacht, dass er nicht zwischen die Gegner geriet, und hielt die Angreifer mit seiner Pistole in Schach. Von überall her kam die Mannschaft der Galeone gelaufen, und spanische Befehle wurden über Deck gebrüllt.
Bald verlor Émile die Orientierung. Einzig die Enterhaken behielt er im Blick, um sich im Zweifel auf die Barke zurückziehen zu können. Jérôme, der mit Feuereifer bei der Sache war, sah aus wie der leibhaftige Teufel. Mit der linken Hand schwang er den Säbel, mit der rechten feuerte er die Pistole ab. Seine Schüsse waren präzise, seine Hiebe wirkungsvoll. Jeden Treffer quittierte er mit Gebrüll, Gnade kannte er keine.
Émile dagegen drosch den Säbel ziellos durch die Luft und tat sein Bestes, Jérôme den Rücken freizuhalten. Ein angreifender Matrose lief ihm genau in die Parade. Wie aus dem Nichts tauchte er auf, und die scharfe Klinge bohrte sich tief in seinen Hals. Gurgelnd griff er nach Émile und strauchelte mit erstauntem Blick, bevor er zu Boden sank.
Entsetzt wich Émile zurück und brachte Jérôme damit aus dem Gleichgewicht. Sie taumelten gegen die Reling. Nach Luft schnappend, fiel Émiles Blick auf die Barke, die er noch längsseits wähnte. Doch anstatt das Boot als letzte Rückzugsmöglichkeit an seinem Platz vorzufinden, sah er mit Entsetzen, dass es dabei war, mit Wasser vollzulaufen. Der Bug war bereits abgesackt und einzelne Ruder trieben auf den Wellen. Ungläubig verharrte er eine Sekunde zu lange, sodass auch Jérôme nach unten sah. Sein Fluchen verriet mehr als tausend Worte, und er zog Émile energisch mit sich fort.
»Das Boot sinkt!«, brüllte er seinen Kameraden zu, während er sich nach achtern durchkämpfte.
Émile stolperte hinterher und fand kaum noch Halt auf den von Blut glitschigen Planken. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, dass es keine Umkehr gab. Einem Donnern gleich erhoben sich die Stimmen der Männer über das Gemetzel, um sodann in barbarischem Geheul zu enden. Die Erkenntnis, dass sie entweder sterben oder bis zur endgültigen Kapitulation der Spanier kämpfen mussten, mobilisierte all ihre Kräfte.
Émile wurde übel. Die Schmerzensschreie der Verwundeten, der Gestank nach Eingeweiden und die fühlbare Klaue des Todes setzten ihm zu. Wie in Trance folgte er Jérôme, stieg über leblose Körper hinweg und hieb auf gesichtslose Feinde ein. Als Jérôme ihm eine Luke öffnete, die unter Deck führte, schwang er sich erleichtert hinein, ohne nachzudenken, was ihn im Inneren erwartete.
Schwer atmend sondierten sie die Lage. Die Luke sperrte den Pulverdampf aus und die Luft um sie herum wurde klarer. Jérôme legte den Zeigefinger an die Lippen und lauschte auf die Geräusche um sie herum.
Am Ende des Niedergangs befand sich ein langer Korridor, der mit einer massiven Holztür abschloss. Dahinter war das Geschrei mehrerer Personen auszumachen. Bevor sie an Rückzug denken konnten, wurde die Tür aufgerissen und Émile und Jérôme erstarrten. Einen Herzschlag lang glaubte Émile, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Eingepfercht zwischen den Decks, den Gegner im Angesicht, gab es nicht viel, was sie hätten tun können. Doch der dunkle Mann, der mit seiner Gefolgschaft durch die Tür stürmte, war niemand anderes als Michel.
Als er Émile und Jérôme bemerkte, nickte er kurz und wies sie an: »Da entlang! Seht zu, dass sich von unten niemand nähert, und haltet mir den Rücken frei!«
Während Michel in Richtung der Kapitänskajüte drängte, die über dem Oberdeck am Heck des Schiffes lag, steuerten Émile und Jérôme auf eine weitere Leiter zu, die sie zum nächsten Deck führte. Immer tiefer ging es in das Innere der Galeone hinein. Ein schweres Ächzen des Gebälks erweckte den Eindruck, als ob das Schiff unter dem überraschenden Angriff der Bukaniere aufstöhnte.
Jérôme übernahm die Führung. Zielsicher hastete er durch das Labyrinth von Gängen, durchschnitt einem wachhabenden Leutnant die Kehle, erschoss einen Matrosen und stürmte in einen mit Pulverfässern überfrachteten Laderaum. Gerade als sie der düsteren Kammer wieder den Rücken kehren wollten, vernahm Émile ein Wimmern. Er hielt Jérôme zurück und gab ihm ein Zeichen. Sie trennten sich und schlichen in entgegengesetzter Richtung um die Fässer herum. Stetiges Tropfen offenbarte die eindringende Feuchtigkeit unterhalb der Wasserlinie und übertönte ihre Schritte. Émile glaubte schon, seine Sinne hätten ihm angesichts der Anspannung einen Streich gespielt, als er Jérômes leisen Pfiff hörte.
»Indioweiber!«, zischte er Émile zu und dieser eilte zu seinem Freund.
Dunkle Gesichter starrten sie an. Die beiden Frauen waren mit Seilen aneinander gefesselt und mit einem Tuch geknebelt worden. Ihre erschrockenen Blicke und verrenkten Gliedmaßen erweichten Émile auf der Stelle. Ähnlich wie der streunende Welpe, der ihn erst kürzlich derart in seinen Bann gezogen hatte, dass er ihm ein Heim gab. Sofort schickte er sich an, die Fesseln zu lösen, doch Jérôme trat ihm herrisch in die Seite.
»Komm jetzt! Um die kümmern wir uns später.« Er lachte lüstern, und Émile ließ sich von ihm fortziehen.
Sie durchkämmten das Schiff weiter auf der Suche nach wehrhaften Matrosen, aber die Mannschaft hatte sich offensichtlich geschlossen an Deck begeben, um den Angriff abzuwehren. Das zeigte, dass die Hinterlist und der damit verbundenen Überraschungseffekt, den Michel d’Artigny für sich nutzen wollte, aufgegangen waren.
In der Tat war der Kampf am Abflauen, als sie schließlich ans Oberdeck zurückkehrten. Michel war es gelungen, den Kapitän des Schiffes in seine Gewalt zu bringen und machte sich gerade daran, ihn an den Besanmast zu fesseln. Aufgebracht verfolgte die spanische Crew das Geschehen und wurde von den Bukanieren in Schach gehalten. Émile konnte es kaum glauben. Michel hatte es geschafft! Einen kurzen Moment glaubte er, ohnmächtig zu werden, so groß war die Erleichterung, noch am Leben und unversehrt zu sein.
Nicht allen Brüdern war das Glück derart hold gewesen. Als er sich umsah, bemerkte er viele von ihnen zwischen den Leichen der spanischen Seeleute, während andere aus klaffenden Wunden bluteten.
Im Verhältnis zu den Spaniern wirkte ihre Einheit lächerlich klein und plötzlicher Stolz erfasste Émile. Trotz seiner Besorgnis zu Beginn der Kaperfahrt, fühlte sich nun mehr denn je als vollwertiges Mitglied dieser Gruppe. Freudig bemerkte er, dass Jérôme ihm anerkennend auf die Schulter klopfte und lächelte dabei so strahlend, dass das getrocknete Blut von seinem Gesicht abbröckelte. Er war nicht länger Émile Vigot aus der Normandie! Zum ersten Mal fühlte er seinen neuen Namen, den er nach der Aufnahme in die Bruderschaft gewählt hatte, mit einer nie gekannten Intensität. Seine Vergangenheit lag endlich hinter ihm, vor ihm lag die strahlende Zukunft, in der er für alle Zeit der Bukanier Émile Delahaye, Émile aus dem Ort Haye, sein würde.
Er sah Jérôme an und bemerkte mit einem Mal eine Bewegung in seinen Augenwinkeln, die ihn misstrauisch werden ließ. Seine Nackenhaare stellten sich auf und er zog intuitiv den Säbel. Alle Sinne schärften sich und Émile nahm die Drehung seines Körpers bis ins Detail wahr. Sein Becken bog sich nach links, seine Oberarmmuskeln spannten sich, während er die Waffe nach oben riss, und sein Kopf folgte der Richtung, aus der er die Gefahr vermutete. Als er den Mund zu einem stummen Schrei öffnete, taumelte Jérôme seitwärts. Blut spritzte aus seiner rechten Schulter. Dann erst hörte Émile den Knall. Kurz darauf roch er es. Das verbrannte Pulver, das ihn husten ließ und ihm das Ziel vorgab. Endlich sah er ihn auch. Die dunkelblaue Samtjacke mit den roten Umschlägen und goldfarbenen Abnähern wies den Angreifer als Offizier aus. Sein Gesicht war zu einer Fratze verzerrt, und er hob eine zweite Pistole, während er losrannte.
Blitzschnell registrierte Émile, dass es der Spanier nicht auf Jérôme abgesehen hatte, sondern dass sein eigentliches Ziel Michel war. Der Offizier wollte seinem gefesselten Kapitän zu Hilfe eilen!
Émile sah die Köpfe der Brüder zucken, bemerkte die Verwirrung in ihren Gesichtern und die Unschlüssigkeit, ob sie es sich erlauben durften, ihre Aufmerksamkeit von den spanischen Seeleuten abzuziehen. Gleichzeitig erkannte Michel die Gefahr und tastete nach seiner Pistole. Bevor sie alle reagieren konnten, stach Émile zu. Nach einem kurzen Moment des Widerstands glitt die Klinge in den Bauch des Mannes. Mit einem pfeifenden Geräusch sog er Luft ein, und Émile ließ augenblicklich den Säbel los. Sekunden verharrte der Offizier völlig starr, während sich eine lähmende Stille über die Galeone senkte. Dann brach er röchelnd zusammen.
Émile schnürte es die Kehle zu und er trat von dem Sterbenden zurück. Die Welt normalisierte sich mit einem Schlag wieder. Sein Puls raste und Émile bemerkte Jérôme, der auf dem Boden lag und Verwünschungen ausstieß.
»Ich will verdammt sein und zur Hölle fahren! Unser kleiner Émile hat den Mistkerl tatsächlich erdolcht«, rief Michel in das Schweigen hinein und löste damit den Bann.
Erst lachten die Brüder vereinzelt, bis sie schließlich anfingen zu johlen und Émiles Namen riefen. Verlegen reichte dieser Jérôme die Hand und zog ihn auf die Beine. Er vermied es bewusst, den toten Offizier anzusehen, der in einer Blutlache neben ihm lag.
»Teufel auch«, lachte Jérôme und umarmte ihn. »Was bist du nur für ein verflixter Lump! Erst willst du die Weiber retten und dann spielst du den Helden.«
Auch Michel d’Artigny trat heran und hieb Émile derart auf die Schulter, dass er schwankte.
»Danke, Delahaye, ich schulde dir etwas«, sagte er. »Von welchen Weibern redet ihr?«
»Von denen unter Deck«, erklärte Jérôme. »Dort liegen zwei gefesselte Indioweiber. Sind uns zufällig in die Hände gefallen.«
Lachend schlug sich Michel auf den Oberschenkel.
»Habt ihr das gehört, Männer? Kein Wunder, dass die Spanier ins Verderben gesegelt sind und wir leichtes Spiel mit ihnen hatten. Sie haben Weiber an Bord!«
Er schritt auf den angeketteten Kapitän zu und griente: »Was sagt man dazu, du spanischer Prasser? Hast du die Weiber nur zu deiner eigenen Unterhaltung mitgebracht oder wurde deinen Offizieren dieselbe Ehre zuteil? Vielleicht sind eure Gesetze etwas milder, aber in unserer Bruderschaft droht demjenigen der Tod, der eine Frau, und sei es nur sein eigenes Eheweib, mit an Bord bringt. Du hast dir das Unglück höchstpersönlich aufs Schiff geholt und jetzt wirst du den Preis für diese Dummheit bezahlen. Dein Untergang und der deiner Mannschaft ist besiegelt!« Michel spuckte dem Kapitän ins Gesicht, was dieser mit einem unbewegten Gesichtsausdruck quittierte, und wandte sich an Émile.
»Holt die Frauen!«, befahl er. Die Männer jubelten.
Begleitet von Jérôme, machte sich Émile erneut auf den Weg in den Frachtraum. Ihm war unwohl zumute, denn er wollte nicht, dass den beiden Gefangenen etwas zuleide getan wurde. Zu sehr hatte ihn ihre ausweglose Lage berührt. Beseelt durch seinen unerwarteten Mut, bat er Jérôme mit stummem Blick um Gnade für die Frauen.
Verständnislos schüttelte sein Freund jedoch den Kopf, während er den am Boden Knienden die Fesseln durchschnitt.
»Pass auf, um was du bittest, Émile. Man mag dir deinen Wunsch aufgrund deiner Tat gewähren, aber sie werden dich bald wie diesen dummen Vogel schimpfen, den man ohne Gegenwehr fangen kann: feige Memme!« Er grinste. »Andererseits, wenn ich’s recht bedenke, gehören sie zur Prise, und da man sie nicht gerecht aufteilen kann, bietet sich’s an, dass man um sie würfelt.« Jérôme zog die Frauen auf die Beine, packte eine jede am Arm und schob sie vor sich zur Tür hinaus.
Émile folgte und konnte den Blick nicht von der kleineren der beiden lösen. Sie war wunderschön! Das pechschwarze Haar fiel ihr glatt über den Rücken und ihre üppige Figur war so angenehm anzusehen, dass Émile schluckte. Sie erinnerte ihn an seine Mutter Alizée, obwohl ihr Äußeres das genaue Gegenteil der Frau war, die er einst verloren hatte.
Zurück an Deck ließ sich Michel nicht zweimal bitten und unterzog die Frauen einer intensiven Betrachtung, bei der er spöttisch die Augenbrauen hochzog.
»Beim Thron des Teufels, das sind wahrlich zwei prächtige indianische Frauenzimmer!«, stellte er fest und zwang seine Männer mit einer nachdrücklichen Geste seines Säbels zurückzubleiben. Manchen von ihnen quollen bereits die Augen über, denn Frauen waren im Leben der Bukaniere eine Seltenheit. »Du hast dir hübsche Stuten an Bord geholt, Spanier. Sieh sie dir noch einmal genau an, bevor du stirbst. Waren sie die Nächte wert?« Er kniff der Größeren in die Brust. Sie schrie auf und Émile tat einen Schritt nach vorne. Michel bemerkte seine Reaktion.
»Was ist, Delahaye, gefallen sie dir?« Émile spürte Jérômes eisernen Griff um sein Handgelenk. Dennoch nickte er beherzt.
Das dröhnende Gelächter von Michel hallte in seinen Ohren wider.
»Verdammt, Delahaye, du wirst an einem einzigen Tag erwachsen! Erst schlachtest du einen Mann ab und rettest mir damit das Leben, und dann begehrst du eine Frau. Ich versprach dir, in deiner Schuld zu stehen, und mein Wort ist Gesetz an dieser Küste. Also wähle! Eine gehört dir. Das ist doch so, Männer?« Säbelrasseln und derbe Worte waren die Zustimmung der Brüder.
Émile deutete auf die Kleinere und Michel nickte.
»Gute Wahl«, meinte er beifällig und riss die Frauen voneinander los.
Ohne die tröstende Umarmung schluchzten sie auf. Michel zerrte die Auserwählte zu sich heran, drückte ihr einen Kuss auf die Lippen und schleuderte sie zu Émile. Dieser fing sie auf und empfand jähe Dankbarkeit. Eine Familie zu haben, war etwas, an das er in der Einsamkeit der neuen Heimat nicht mehr geglaubt hatte. Schützend legte er die Arme um das Mädchen und sie drängte sich schutzsuchend an ihn. Émile seufzte verzückt.
»Balourd!«, hörte er Jérôme hinter sich murmeln. »Du armer Trottel!«
< Eins >
Nordwestküste von La Española, Frühjahr 1656
Der Wind fegte die Wolken wie stolze Pferde über den Himmel, während Jacquotte landeinwärts ging. Die Männer waren losgezogen, um zu jagen, und sie wollte einen neuen boucan für ihren Vater herstellen; ein Holzgestell, auf dem das Fleisch getrocknet und geräuchert wurde. Die frischen Äste schlug sie von den Blutholzbäumen, die in großer Ansammlung unweit der Siedlung standen.
Der Pfad dorthin führte durch mannshohes Gestrüpp, und sie nutzte ihn stets, um mit ihrer Machete zu üben. Die Waffe wog schwer in ihrer Hand, aber sie ließ sie locker und ohne Zeichen der Anstrengung durch die Luft kreisen. Abrupt stach sie zu, drehte sich um die eigene Achse und bekämpfte imaginäre Angreifer. Sie war stolz auf ihre Geschicklichkeit und setzte jeden ihrer Schritte bedacht, damit sie nicht ins Straucheln geriet. Mit einem letzten kraftvollen Schlag zerteilte sie das Buschwerk, um freien Blick auf die Lichtung der rotbraunen Bäume zu haben, die sie gesucht hatte.
Ein Knacken im Unterholz ließ Jacquotte erstarren. Wachsam sah sie sich um. Ihre Nasenflügel bebten. Sie zwang sich, ruhig zu atmen, obwohl ihr das Herz in den Ohren pochte. Ihre Zehen gruben sich in die weiche Erde und sie war gespannt wie ein Bogen, bereit, sich zu verteidigen. Langsam drehte sie den Kopf in die Richtung, in der sie das Geräusch vermutete, und schob entschlossen ihr Kinn vor. Mit erhobener Machete machte sie einen Schritt nach vorne. Die Sehnen ihrer Arme spannten sich und sie spürte das Blut an ihrem Hals pulsieren.
In diesem Moment sprang ein schreiender Junge aus dem Dickicht, vollführte eine Reihe Purzelbäume und streckte Jacquotte schließlich die Zunge heraus. Der aufgewirbelte Staub tanzte durch die warme Luft und legte sich auf seine Haut, deren Farbe gleich der Bäume um sie herum war.
»Pierre! Zum Donnerkiel, du hast mich erschreckt!«, rief sie und drückte mit dem angestauten Atem auch ihre Anspannung aus den Lungen. Dann lachte sie, stützte ihre Hände auf die Knie und beugte den Rücken. Die hohe Luftfeuchtigkeit klebte ihr das Hemd an den Oberkörper, die Hose aus kratzigem Wollstoff juckte. Beim Aufrichten fuhr sie sich mit der Hand über Mund und Stirn und bemerkte einen metallischen Geschmack. Vor Aufregung hatte sie sich gebissen und leckte sich ärgerlich über die blutige Unterlippe.
Pierre schlenderte auf sie zu und grinste.
»Was tust du hier? Du willst doch nicht etwa langweilige Frauenarbeit verrichten?«
Jacquotte stemmte die Hände in die Hüften und sah gereizt zu ihm empor. »Hüte deine Zunge, wenn sie dir lieb ist! Weshalb bist du nicht mit den anderen auf der Jagd?«
Pierres Grinsen wurde breiter. Er hob seine Muskete auf, die gut viereinhalb Fuß maß, und schulterte sie mit jugendlicher Lässigkeit. Erst jetzt gesellte sich auch sein gefleckter Hund zu ihnen und beschnupperte Jacquotte freundlich.
»Durch den Wind sind die Moskitos nicht so blutrünstig wie sonst und ich dachte mir, wir könnten einen Ausflug zu unserer Höhle machen«, erwiderte er.
Sie tat desinteressiert, obwohl es ihr schmeichelte, dass Pierre von ihrer Höhle sprach. Das klang nach einer besonderen Verbundenheit, obwohl ihr bewusst war, dass er dort einfach gerne saß und die vorbeiziehenden Schiffe beobachtete. Als sie nicht sofort antwortete, knuffte Pierre sie in die Seite und ging in Abwehrhaltung, denn er wusste nur zu gut um ihre Reaktionen.
Sofort hielt sie ihm die Machete unter die Nase und sagte: »D’accord, ich gehe mit dir! Aber zuerst müssen wir Manuel holen. Und ich erwarte, dass du meinem Vater erklärst, warum ich ohne Holz für das boucan zurückkomme.«
»Dein Vater wird nichts sagen. Er ist sanftmütig wie eine Schildkröte. Erst vor Kurzem sah ich, dass er das verlassene Ei eines Buschhuhns fand, es mitnahm und den Haushühnern zum Bebrüten ins Nest legte. Dabei weiß doch jeder, dass das Küken wieder in den Busch läuft, sobald es das Geschrei seiner Sippe hört.«
»Er sorgt sich eben!« Jacquotte verteidigte ihren Vater, obwohl sie wusste, dass Pierre recht hatte.
Nebeneinander schlenderten sie zur Siedlung zurück. Dort angekommen, hörte man nur das Rascheln der Blätter im auflandigen Wind. Jacquottes Blick streifte die ajoupas, jene palmengedeckten Holzhütten, die großzügig verteilt in einer natürlichen Senke lagen. Limonenbäume spendeten Schatten und schützten die Gemeinschaft vor feindlichen Spähern. Vereinzelt sah man Hunde, die in der Kühle selbst gegrabener Mulden dösten. Ansonsten rührte sich nichts. Um diese Tageszeit hielten sich nur die alten oder verletzten Männer in der Siedlung auf.
Jacquottes Vater saß entspannt vor einer der Hütten und ging seiner Arbeit nach. Neben ihm lag einem Schatten gleich sein alter hellbrauner Hund, der ihn schon so lange begleitete, wie Jacquotte denken konnte. Er war grau im Gesicht, die Augen waren trüb, aber seine Nase funktionierte bestens und er bellte heiser auf. Sie hob die Hand zum Gruß.
Émile hielt inne und kniff die Augen zusammen. Er sah nicht gut auf die Distanz, aber die Gestalt seiner Tochter konnte er jederzeit ausmachen. Er war erfreut, sie zu sehen, und beobachtete ihr Näherkommen. Der Bronzeton der Haut, die hohen Wangenknochen, das schmale Becken und die kräftigen Waden waren eindeutig das Erbe ihrer Mutter Anani. Mit einer vertrauten Geste strich sie sich das lockige Haar hinter die Ohren und atmete tief durch.
An diesem Tag brachte der Wind salzige Meeresluft ins Landesinnere, die sich mit den herben Aromen der Limonen vermischte. Er wusste, dass dieser Geruch auf Regen hindeutete. Seiner Tochter war das ebenso bewusst. Sie war in der Natur aufgewachsen und verstand die Zeichen zu deuten. Ihre Beine waren durch die Dornen zerkratzt, die jeden Tag ihren Weg kreuzten. Verblassende Schrammen bildeten mit den neuen ein bizarres Muster auf ihrer Haut. Eine auffallend breite, gezackte Narbe schlängelte sich quer über ihren linken Arm und verschwand unter dem Ärmel ihres Hemdes. Sie war ein Mahnmal für Jacquottes Übermut, entstanden bei einem ihrer Scheinkämpfe, als sie stolperte und sich mit der Machete den Arm aufschnitt. Émile schüttelte lächelnd den Kopf. Seine Tochter war ein Wildfang, aber das liebte er so an ihr.
In diesem Moment brach die Sonne durch die Wolken und ließ Jacquottes dunkelrotes Haar aufleuchten. Die Männer sagten, es hätte das Blut aufgesogen, das die Mutter bei ihrer Geburt verloren hatte. Das Blut, mit dem Anani das Leben aus dem Körper geflossen war. Er wusste, dass niemand Schuld an ihrem Tod trug, aber die Sorgenfalten auf Jacquottes Stirn zeugten davon, dass hinter ihren großen Augen ein innerer Kampf tobte, den er nur erahnen konnte.
Als sie mit energischen Schritten auf ihn zuging, verbarg er sein Lächeln hinter dem buschigen Bart. Im Gegensatz zu ihrem ansehnlichen Äußeren gab sich seine heranwachsende Tochter ansonsten jungenhaft. Nicht das erste Mal brachte sie ihm so zu Bewusstsein, dass das mütterliche Element in ihrem Leben fehlte. Und so sehr er es sich auch wünschte, es war ihm unmöglich, ihr diese Seite ihres Seins nahezubringen. Sie war in der rauen Gesellschaft von Männern groß geworden, es war daher nicht verwunderlich, dass sie sich selbst wie einer benahm.
Jacquottes Begrüßung fiel aus, wie Émile es von ihr gewohnt war: Freundliche Worte und ein Nicken in seine Richtung waren alles, was er von ihr bekam. Gesten der Zuneigung, wie eine Umarmung oder ein Kuss, waren nichts, wofür sie etwas übrig hatte.
»Pierre geht zu den Pflanzern, um Fleisch gegen Tabak zu tauschen. Er bat mich um Hilfe, und wenn du einverstanden bist, werde ich ihn begleiten.«
Émile nickte zustimmend. Er konnte seiner Tochter nichts abschlagen, denn er wollte stets, dass es ihr gut ging. Außerdem war sie in Begleitung von Pierre unterwegs und das beruhigte ihn. Pierre war wie ein Sohn für ihn, und das lag nicht nur daran, dass seine Mutter ebenfalls viel zu früh verstorben war und Pierre die Härten des Lebens in einem Alter erfahren musste, in dem ein Junge noch nicht bereit dafür war.
»Danke, Papa!« Jacquotte schenkte Émile ein bezauberndes Lachen und er vergaß für einen Moment die Schmerzen in seinen geschwollenen Gliedmaßen.
Mit einem Seufzer beobachtete er, wie seine Tochter sich bückte und ins Innere der Hütte kroch, um Manuel aus seinem Joch zu befreien. Er hörte das Gekicher des Jungen, als er tollpatschig ins Licht krabbelte. Der Anblick seines Erstgeborenen brach Émile jedes Mal das Herz.
Manuels Kopf war zu schwammig für seinen Körper, und seine eng beieinanderliegenden Augen gaben ihm einen dümmlichen Ausdruck. Die meisten hielten ihn für verrückt und schenkten ihm kaum Beachtung. In der Gesellschaftsstruktur dieser Insel wurde ihm keine Überlebenschance eingeräumt. Wäre es nach Jérôme gegangen, dann hätte Manuel sein erstes Lebensjahr nicht erreicht. Eine Tatsache, die Émile seinem Freund nicht verzeihen konnte. Gleichzeitig bekannte er sich selbst schuldig, mit dem Sohn nichts anfangen zu können.
Nur Jacquotte wachte stets über Manuel und konnte es nicht ertragen, wenn man ihn zu seiner eigenen Sicherheit festband. Bewegte er sich frei, behielt sie ihn wie eine Glucke im Auge und ließ zu, dass er mit unsicheren Schritten den Schmetterlingen und Vögeln nachjagte.
Gerne hätte Émile seine Tochter noch länger um sich gehabt, doch nach einem kurzen Abschied entfernte sich das ungleiche Dreigespann wieder. Je mehr ihr Bild vor seinen Augen verschwamm, desto größer wurde seine Unruhe. Ihm war klar, dass sich seine Tochter langsam verselbstständigte. Sie begann, ihre eigenen Wege zu gehen, und die Angst rumorte in Émiles Magen wie eine roh verzehrte patate, jene wilde Kartoffel, die überall auf der Insel wuchs.
Das Großziehen von Jacquotte war das Erfüllendste gewesen, das Émile je erlebt hatte. Er genoss jeden einzelnen Tag mit seiner kleinen Sonne und es war, als böte ihm der Vater im Himmel eine Chance, um an Jacquotte gutzumachen, was bei Alizée verfehlt wurde. Zu deutlich verfolgte ihn noch das Bild seiner Mutter, die wegen des Aberglaubens einiger Leute ein unwürdiges Ende fand, vor dem er sie nicht hatte beschützen können.
Es verging kein Tag, an dem er nicht ihr Gesicht vor sich sah und sich fragte, warum sie so enden musste. Doch all das konnte er Jacquotte nicht anvertrauen. Er wollte der Held sein, den seine Tochter in ihm sah. Die Geschichten über die Rettung von Michel d’Artigny und die Befreiung von Anani waren das, was Jacquotte von klein auf über ihn gehört hatte. Die Dinge, die er als Émile Vigot in der Normandie erlebt hatte, gehörten nicht in ihre Welt. Émile versteckte sie tief in seinem Inneren. Und weil er nichts mehr an seiner Vergangenheit ändern konnte, sah er seine wichtigste Aufgabe als Vater darin, Jacquotte vor jeder Gefahr zu schützen.
Wenn ihre Zukunft eine glückliche war, konnte auch Émile wieder Ruhe finden. Seine Tochter besaß schon jetzt ein Selbstbewusstsein und einen Tatendrang, den er nur bewundern konnte, und er glaubte daran, dass sie ihr Leben gemeinsam mit Pierre meistern würde, wenn es so weit war.
Er wollte fortfahren, das grobe Salz zu mahlen, aber seine steifen Gelenke widersetzten sich. Die Zuversicht, dass sein Wille stärker als sein Gebrechen war und ihn noch eine Weile durchhalten ließ, schwand mit jedem Tag. Umso größer wurde dagegen die Furcht, seine Kinder ohne Vater zurückzulassen.
Jérôme scherzte oft, Émiles Schultern würden bald so weit herunterhängen, dass er mit den Fingern die Zehen berühren konnte, ohne sich zu bücken. Émile verzog das Gesicht vor Schmerz. Er wünschte sich, Jérôme würde sesshaft werden, auch wenn er daran zweifelte, dass sein Freund sich der Kinder im Falle seines Todes annahm. Dafür kannte Émile ihn zu gut.
Jérôme die Verantwortung einer Vaterrolle zu übertragen, war, als sperrte man die bei Nacht leuchtenden Glühkäfer in ein Gefäß: Ihr Licht erlosch augenblicklich. Jérôme war für das Meer gemacht, er war keine Landratte. Deshalb brachte Émile es nicht über sich, seinen Freund um diesen Gefallen zu bitten. Zu sehr stand er bereits in seiner Schuld. Unfähig, zu jagen oder auf sonstige Weise von Nutzen zu sein, war Émile in jeder Hinsicht auf seinen Gefolgsbruder angewiesen. Und Jérôme kam dieser Aufgabe pflichtbewusst nach.
In regelmäßigen Abständen brachte er Kleidung, Waffen, Zucker und Mehl vorbei. Er verweilte eine Zeit lang in der Siedlung, bis ihn die Sehnsucht zurück aufs Meer trieb. Émile hustete schwer und tätschelte seinem Hund das Fell. Zu lange war er den eigenen Gedanken nachgehangen, dabei musste er die Vorbereitungen für den Abend zu Ende bringen. Energisch sammelte er sich und ließ den Stein erneut über die Salzkristalle rollen.
Unterdessen spazierten Jacquotte und Pierre schweigend nebeneinander her. Der steinige Pfad schlängelte sich südwärts an imposanten Baumriesen vorbei und führte sie tief ins grüne Herz der Insel, die sie als La Española kannten. Je weiter sie vordrangen, desto mehr flaute der böige Wind zu einer leichten Brise ab, die von den Stimmen der Tiere überlagert wurde. Das Zirpen der Grillen um sie herum war ihnen so wohlbekannt wie das Schreien der blau-gelben Papageien in den Baumkronen.
Pierre peitschte spielerisch einen abgebrochenen Zweig durch die Luft, während Jacquotte Abstand zu ihm schuf. An diesem Tag bedrängte seine Anwesenheit sie, denn Pierre hatte angefangen, sich zu verändern. Seine Schultern wurden breiter, seine Stimme tiefer und seine Muskeln begannen sich stärker auszuprägen. Die meiste Zeit lief er mit nacktem Oberkörper herum, als wollte er allen von seiner Entwicklung kundtun. Neben der Wandlung an sich erschreckte Jacquotte aber vor allem die Tatsache, dass es ihr auffiel und sie ihn vermehrt beobachtete.
»Warum hast du deinen Vater belogen?« Pierre drehte den Kopf zur Seite und Jacquotte sah schnell in eine andere Richtung.
»Ich will nicht, dass er sich sorgt.«
»Aber er sorgt sich ständig um dich! Du hast wohl nie in sein Gesicht geblickt, wenn du frühmorgens die Hütte verlässt. Wenn er könnte, würde er dich wie Manuel anbinden.«
»Sei still!«
»Ich sag ja nur…«, murrte Pierre. »Vielleicht ginge es ihm besser, wenn er um deine Fähigkeiten wüsste.«
»Ganz bestimmt nicht! Als Jérôme ihm vorgeschlagen hat, mich zur eigenen Sicherheit an den Waffen zu unterrichten, da wurde er so bleich, als hätte er zu viele Landkrabben gegessen.«
Um Pierres Mundwinkel zuckte es. »Besucht euch Jérôme deswegen immer seltener? Was fürchtet er wohl mehr, den Hund deines Vaters oder seinen schnellen Säbel?«
»Noch ein Wort und du wirst den Tag verfluchen, an dem du mir die Machete in die Hand gegeben hast«, drohte Jacquotte. »Mein Vater ist ein guter Mann!«
»Gut darin, die Augen zu verschließen und zu glauben, dass die Spanier nie mehr über die Küste hereinbrechen werden. Warum verschweigst du ihm unsere Höhle?«
»Die Höhle ist unser Geheimnis!«, erwiderte Jacquotte brüsk und zeigte Manuel einen schwarz-weiß gestreiften Schmetterling am Wegesrand. Mit einem glücklichen Blubbern klatschte er in die Hände und verscheuchte das Insekt. Mit zackigem Flug erhob es sich und ließ einen enttäuschten Manuel zurück.
»Es gibt Hunderte Höhlen auf der Insel! Warum sprichst du niemals über unsere?« Pierre ließ nicht locker.
Jacquotte zuckte die Schultern. Natürlich wusste jeder von der Existenz dieser Höhlen. Besonders deshalb, weil sie ein gruseliges Erbe in sich bargen: Immer noch verrotteten in vielen von ihnen menschliche Gebeine im dunklen Inneren und verseuchten die Luft. Die Männer erzählten sich, dass die Insel einst von Indianer bevölkert gewesen war. Als die Spanier eintrafen, beanspruchten sie das Land jedoch für sich alleine. Deshalb töteten sie die Urbevölkerung. Besonders gerne hetzten sie die Indios mit ihren Hunden und warfen sie ihnen zum Fraß vor. Aus Furcht verbargen sich die Überlebenden in den einfachen Höhlen, wo sie meist vor Hunger zu Tode kamen, denn ihre Angst vor den Spaniern war größer als ihr körperliches Leiden.
Von Pierres aufforderndem Blick in die Enge gedrängt, entgegnete Jacquotte: »Stell dich nicht dumm, Pierre! Die Sicherheit der Höhle hat uns am Tag des spanischen Überfalls das Leben gerettet. Niemand soll wissen, wo sie liegt. Auch nicht mein Vater. Im Gegensatz zu ihm verschließe ich meine Augen nicht vor der Realität.«
Pierre schwieg und Jacquotte wusste, dass ihre Gedanken um dasselbe Erlebnis kreisten. An einem Nachmittag vor einigen Jahren hatten marodierende Spanier die Siedlung überfallen und viele Männer getötet. An diesem Tag zerbrach Jacquottes heile Welt, in der sie arglos durch die Wälder streifte. Mit eigenen Augen musste sie mit ansehen, wie aus ihrem friedlichen Alltag ein blutiges Massaker wurde, und wie jeder Einzelne um sein Überleben kämpfte.
Sie sah Nachbarn sterben und beobachtete, was die Spanier mit den Frauen ihrer Feinde taten. Beinahe wäre sie selbst zum Opfer geworden. Ein Spanier war über sie hergefallen und würgte sie beinahe bis zur Bewusstlosigkeit, während er versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Ihr Entkommen verdankte sie einzig Pierre, der ihren Peiniger getötet hatte. Anschließend brachte er sie und Manuel zu einer Höhle, die er während eines Streifzugs entdeckt hatte. Auf Jacquottes heftiges Drängen hin lehrte er sie dort in den nachfolgenden Wochen den Umgang mit Machete, Säbel und Muskete. Niemals, das hatte Jacquotte sich damals geschworen, sollte ein Mann je wieder derart Hand an sie legen.
»Solange ich an eurer Seite bin, könnt ihr unbesorgt sein!«, Pierre klopfte sich prahlerisch auf die Brust.
Jacquotte verdrängte die Erinnerungen und warf ihm ein Schneckenhaus an den Kopf, das sie gefunden hatte. »Deine Überheblichkeit wird dich noch in den Himmel wachsen lassen, wo dir die Raben deine schrecklichen Schlangenaugen rauspicken!«
Pierre zog eine Grimasse, stieß zischelnde Laute aus und lief hinter Manuel her, der kreischend das Weite suchte. Jacquotte musste lächeln und beobachtete das fröhliche Spiel. Sie war dem Freund dankbar, dass er sie tagtäglich von diesem schrecklichen Erlebnis ablenkte.
Gut gelaunt erreichten sie einige Zeit später die baumlose Ebene mit den Tabakfeldern der Pflanzer. Ihr Gelächter verstummte. Jacquotte fürchtete diese Männer. Die meisten zeigten unverhohlenen Hass auf die Bukaniere im Norden, die ihre tägliche Arbeit angeblich viel leichter verrichteten, indem sie auf Tiere schossen, anstatt sich körperlich zu verausgaben.
Die Pflanzer dagegen mussten Bäume fällen, Buschwerk roden und eine Reihe von Fruchtreihen anlegen, bevor der Boden genug Nährstoffe enthielt, damit Tabak auf ihm gedieh. Glücklicherweise lagen ihre Holzhütten, auf deren Dächern die Pflanzer schmackhafte Wurzeln trockneten, an diesem Tag verlassen zwischen den Fluren.
Pierre formte mit der rechten Hand einen Becher, den er zum Mund führte. Jacquotte nickte wissend. Vermutlich hatte der wycou, eine Art Bier, das die Pflanzer aus Maniok brauten, wieder ganze Arbeit geleistet. Lautlos bewegten sie sich vorwärts. Obwohl die Pflanzer auf den Handel mit Fleisch angewiesen waren, machten sie sich einen Spaß daraus, vorbeiziehenden Bukanieren aufzulauern und ihnen Angst einzujagen.
Jacquotte beobachtete die Felder ganz genau. Die brusthohen Pflanzen wogten im Wind und wenn man genau hinsah, konnte man fingerdicke Raupen auf ihren Blättern erkennen. Sie fuhr im Vorübergehen sachte über die feinen Härchen der Larven und folgte Pierre, der den Weg vorgab und Manuel abschirmte. Erst als sie wieder unter Bäumen waren und einen Bachlauf gekreuzt hatten, ließ ihre Anspannung nach.
Auf einer Anhöhe angelangt, verschnauften sie kurz. Sie hatten gutes Tempo vorgelegt. Jacquottes Blick schweifte über die Landschaft. Schlanke Palmen wechselten sich mit gewaltigen Acajou- und Mapou-Bäumen ab und schufen ein harmonisches Miteinander. Am Horizont konnte man ein Stück der Küstenlinie erkennen. Der Sand zog sich wie eine goldene Grenze durch das Reich der Pflanzen und trennte sie vom Ozean, der mit seinen rätselhaften Geschöpfen ein eigenes Imperium bildete.
Pierres Hund knurrte, als auf einer Schneise vor ihnen einige Pferde den Hügel querten. Die Tiere hoben schnaubend die Köpfe und ließen ihre Ohren spielen. Es waren gedrungene Kreaturen mit stämmigen Beinen und langen Hälsen. Verwilderte Verwandte ehemaliger spanischer Reitpferde, die inzwischen in großer Anzahl über die Insel wanderten. Die Jäger fingen sie bisweilen, um die Felle und das Fleisch ihrer Jagdbeute an die Küste zu transportieren.
Jacquotte hasste jedoch die brutale Art, mit der man die Pferde zähmte. Sie wurden mit Schlingen gefangen, die man auf ihren Trampelpfaden auslegte, und dann so lange geschlagen, bis ihr Wille gebrochen war und sie sich fügten. In ihrer natürlichen Umgebung aber besaßen sie einen ursprünglichen Stolz, der Jacquotte immer wieder aufs Neue staunen ließ. Auch dieses Mal konnte sie sich nur schwer von ihrem Anblick losreißen.
Kurze Zeit später erreichten die kleine Gruppe die abfallenden Felsen und Jacquotte hob Manuel auf Pierres Rücken. Sein Hund blieb als Wachposten zurück und legte den Kopf betrübt auf die Vorderpfoten.
Der Weg entlang der Felswand war tückisch und erforderte bei jedem Schritt Konzentration. Lose Steine konnten ins Rollen geraten und schwere Stürze zur Folge haben. Aber sie erreichten sicher ihr Ziel. Versteckt unter einem Vorsprung grub sich eine kleine Höhle mit natürlich geformten Sitzbänken in den Fels, die durch dichtes Gestrüpp vor einfallender Sonne geschützt wurde.
Eine Lücke im Buschwerk ermöglichte freien Blick aufs Meer, das sich viele Meter unter ihnen befand. Von den tief hängenden Ästen eines Baumes pflückte Jacquotte hühnereigroße Früchte, aus denen weißer Milchsaft quoll, wenn man hineinbiss, und die wunderbar schmeckten. Mit ihnen stillten sie den Durst, bevor sie von dem geräucherten Fleisch nahmen, das in Palmblätter gewickelt im hinteren Teil der Höhle lagerte. Dort lagen außerdem Muscheln, bunte Federn und Pfeilspitzen, die Manuel mitgebracht hatte, sowie frisches Wasser in Rinderblasen. Jacquotte überprüfte die Vorräte bei jedem Besuch und sorgte dafür, dass sie nicht zur Neige gingen.
Während Manuel mit seinen Schätzen spielte, setzte sie sich mit Pierre an den Rand der Höhle und ließ die Füße über den Überhang baumeln. Durch den Wind war die Sicht an diesem Tag so klar, dass die Île de la Tortue, die von den Spaniern auch Tortuga genannt wurde, zum Greifen nahe schien. Jacquotte erkannte den weißen Schaum, der auf den Wellen tanzte, wenn sie an den Klippen des schildkrötenförmigen Eilands zerschellten.
Zwei Schiffe glitten mit gebauschten Segeln über das Wasser und versuchten, gegen den Wind zu kreuzen, um in die geschützte Hafenbucht zu gelangen. Schwarze Fregattvögel, deren Geschrei von den Felsen widerhallte, flankierten sie. Die Île de la Tortue war eine sagenumwobene Insel, Zankapfel der großen Seefahrernationen, die ihre Kolonien provokant neben den spanischen Niederlassungen gründeten.
»Man mag den Hugenotten Le Vasseur nennen, wie man will, aber nur ihm verdanken wir, dass Tortue befestigt und über Jahre unangreifbar wurde.« Pierre reckte den Hals, als könnte er das Fort de Rocher an der Südseite der Île de la Tortue erkennen.
»Le Vasseur war grausam! Er sperrte Gefangene in kleine Käfige, in denen sie weder sitzen noch stehen konnten, und hat sie in der Sonne geröstet. Das klingt mir eher nach einem Mann, der Macht demonstrieren will und nicht nach einem Wohltäter. Ich denke, er wurde nicht umsonst ermordet.« Jacquotte, der besonders die blutrünstigen Erzählungen über den ersten Gouverneur von Tortuga im Gedächtnis geblieben waren, wollte Pierres Meinung nicht teilen.
»Du verstehst das nicht! Niemand vor ihm hat sich in solchem Maß für Tortue eingesetzt. Sieh dir bloß seinen Nachfolger an. De Fontenay hat sich von nur zwei spanischen Schiffen besiegen lassen und die Insel aufgegeben. Und was ist die Folge? Die niederträchtigen Spanier besetzen sie noch immer mit nur einer einzigen Garnison.«
»Und die großartige Bruderschaft lässt sich davon einschüchtern«, spottete Jacquotte.
»Sie lauern im Geheimen und formieren sich bereits. Noch fehlt es ihnen an Kanonen und Schiffen, weil der französische König sich aus solchen Angelegenheiten heraushält. Leider scheut er den Machtkampf mit Spanien in diesem Teil der Welt. Ein großer Fehler, wie ich finde.«
»Was geht es dich an?« Pierres Leidenschaft für die Küstenbrüder nagte an Jacquotte. Je mehr Zeit er mit den seefahrenden Männern verbrachte, desto mehr wurde ihre politische Gedankenwelt zu der seinen.
»Glaub mir, in nicht allzu ferner Zukunft werden sich die Brüder der Küste die Île de la Tortue zurückholen. Und ich werde dabei sein!«
»Aber du bist kein Mitglied der Bruderschaft! Warum kämpfst du ihren Kampf?« Jacquotte legte den Finger bewusst in die Wunde, die Pierre am meisten schmerzte.
Er biss die Zähne aufeinander und starrte gekränkt zu Boden. Das tat er immer, wenn er verärgert war, und sie schämte sich ein wenig, weil sie so garstig zu ihm war.
»Die Bruderschaft wird mich aufnehmen«, schwor er und musterte Jacquotte mit seinen eigentümlichen Augen. Sie waren dunkelbraun wie die ihren, aber in ihrem Inneren schien etwas zu lauern, das bei bestimmten Gemütslagen ein gelbes Leuchten hervorrief. Es erinnerte sie an das Funkeln der Golddublonen, die ihr Vater für Notfälle unter dem knorrigen Baum am Rand der Siedlung verborgen hielt.
»Was geben dir die Küstenbrüder, was du hier nicht findest?«, wollte sie wissen.
»Siehst du das nicht? Hier führen alle das ruhige Leben der Jäger. Tagein, tagaus dieselben Beschäftigungen. Ich aber will aufs Meer! Ich will dorthin, wo sich all die Brüder versammeln, die etwas bewegen wollen. Ich will gegen die Spanier kämpfen und Vergeltung üben für das, was sie unseren Müttern und ihrem Volk antaten.«
Jacquotte sank kaum merklich in sich zusammen. Sie verstand ihren Freund nur zu gut. Auch in ihr loderte die Sehnsucht nach einer Aufgabe im Leben, die Gier nach Abenteuern und der Rache für die Gräueltaten der Spanier. Aber anders als Pierre hatte sie Familie auf La Española und der Gedanke, ihren Vater und Manuel zurückzulassen, war unerträglicher als der Wunsch, gegen unbekannte Feinde zu kämpfen.
»Du machst unsere Mütter nicht wieder lebendig, indem du dein Leben aufs Spiel setzt!« Ihre Hilflosigkeit, Pierre nicht sagen zu können, was sie bewegte, ließ Jacquotte aufbrausend werden.
»Mon dieu, was bist du heute in schlechter Stimmung!« Er warf einen Stein in den Abgrund und lauschte, wie der Aufprall gegen die Felsen immer leiser wurde, bis der Stein schließlich kaum hörbar im Wasser landete.
Sie ignorierte ihn und zupfte an dem eng anliegenden Band aus gefärbter Baumwolle, das sich unterhalb ihres linken Knies befand. Es hatte einst ihrer Mutter gehört, der Frau, die man Anani nannte, und Jacquotte trug es als Anerkennung des Indio-Volkes, dessen Blut auch in ihren Adern floss.
»Sie wäre stolz auf dich gewesen«, hörte sie Pierre nach einiger Zeit murmeln, und das schlechte Gewissen schlug über ihr zusammen.
»Es tut mir leid«, presste sie hervor, da sie sich mit Entschuldigungen nicht besonders leichttat. »Der Sturm fegt heute durch meinen Kopf und wirbelt meine Gedanken durcheinander.«
»Hast du nicht immer den Sturm in deinem Kopf, nanichi?« Pierre versetzte ihr einen freundschaftlichen Stoß gegen die Schulter und hielt ihre Hände fest, damit sie sich nicht wehren konnte.
In Anbetracht ihres Spitznamens fragte Jacquotte zum wiederholten Male: »Sag mir endlich, was das bedeuten soll, Pierre! Du nennst mich womöglich eine Schlange hinter meinem Rücken, und ich weiß es nicht.«
»Jujo heißt Schlange, also sei unbesorgt.« Er griente spitzbübisch und tippte an ihre Stirn: »Cimu’«, sagte er. Dann zeigte er aufs Meer hinaus und sah sie fragend an.
Jacquotte zögerte. »Bagua?«
Pierre nickte anerkennend. Als Nächstes zeigte er auf sich und sie erwiderte sofort: »I’ro!«
Auch als er auf sie zeigte, folgte die Antwort prompt: »I’naru’!«
»Sehr gut«, lobte Pierre. »Heute ist es windig. Kannst du dich an das Wort für Wind erinnern?«
»Hura?« Sie lächelte, als Pierre den Daumen hob.
»Sonne?«
»Guey!«
So ging es weiter. Was einst als Spiel zwischen ihr und Pierre begonnen hatte, nahm Jacquotte inzwischen sehr ernst. Die gutturale Sprache der Indios beschwor den Geist ihrer Mutter herauf. Es war tröstlich, wenigstens auf diese Art mit Anani verbunden zu sein.
Sie waren so konzentriert bei der Sache, dass sie nicht bemerkten, wie Manuel zu ihnen trat. Erst als er mit dem Fuß aufstampfte, drehte sich Jacquotte zu ihm um.
»Jawa«, forderte er, und das Wort war aufgrund seiner dicken Zunge kaum verständlich. »Jawa!«
»Ich glaube, er will die Geschichte von Yaya hören«, vermutete Jacquotte und zwinkerte Pierre zu.
Die Männer der Siedlung waren der Meinung, dass Manuel wegen seiner Andersartigkeit nichts von seiner Umwelt wahrnahm, aber sie wusste, dass das nicht stimmte. Manuel liebte es, wenn man ihm Geschichten erzählte.
Pierre begann mit übertrieben schauriger Stimme zu sprechen: »Lasst mich erzählen von Yaya, dessen Name kaum jemand in den Mund zu nehmen wagt. Er war ein bedeutender Kazike, dem seine Untertanen größte Ehre entgegenbrachten. Doch sein Sohn, Yayael, trachtete ihm aus Neid nach dem Leben. Als sein Vater von seinem Plan erfuhr, ächtete er den Sohn und verbannte Yayael aus seiner Heimat. Entwurzelt irrte Yayael umher und kehrte schließlich demütig in das Haus seines Vaters zurück. Yaya aber konnte in das Herz seines Sohnes blicken, sah dort immer noch böse Absichten und tötete ihn. Er verwahrte seine Gebeine in einer Kalebasse auf und hängte sie an die Decke seiner Hütte, wo sie eine Zeit lang unentdeckt blieben. Eines Tages jedoch drangen hungrige Diebe in Yayas Behausung ein und vermuteten Nahrungsmittel in der Kalebasse. In der Eile rutschte ihnen das Gefäß aus den Händen, fiel zu Boden und zerbrach. Doch anstatt der Gebeine kam Wasser aus der Kalebasse. Es floss so viel Wasser aus ihr heraus, dass es die Erde bedeckte und sich immer weiter ausbreitete. Und mit ihm kamen die Fische in so reicher Zahl, dass niemand mehr hungern musste. Auf diese Weise entstand unser Meer und Yayaels Tod hat allen Menschen etwas Gutes gebracht!«
Manuel verzog sein Gesicht. Nur wer ihn gut kannte, wusste, dass dies ein Ausdruck von Freude war. »Semmi«, rief er.
»Dein cemi passt immer auf dich auf«, bestätigte Jacquotte und berührte den Talisman, der um Manuels Hals hing.
Es war ein rötlicher Stein, dem durch regelmäßige Einkerbungen eine menschliche Gestalt verliehen worden war. Ursprünglich hatte sie ihn von ihrem Vater als Andenken an die Mutter bekommen, aber als Pierre ihr später die Bedeutung des Steins erklärte, gab sie ihn an Manuel weiter. Nach Pierres Aussage waren die cemi gute Götter, die ihre Träger vor Krankheiten, Naturkatastrophen und Kriegen beschützten, und Jacquotte war der Meinung, dass Manuel diesen Schutz nötiger hatte als sie selbst. Denn obwohl sie nie zugegeben hätte, abergläubisch zu sein, so war sie doch geneigt, der Geschichte zu vertrauen, die die Männer in der Siedlung erzählten. Demnach war ihre Mutter Anani vom sterbenden spanischen Kapitän der Galeone, auf der sie gefangen gehalten wurde, verflucht und deshalb mit einem Kind wie Manuel bestraft worden.
Jacquotte wusste, dass Pierre dieses Gerede für Unsinn hielt. In seinen Augen lebte ein guter Geist in Manuels deformiertem Körper. Pierre behauptete, dass dieser Geist sich nur den Menschen zeigte, die über Manuels Andersartigkeit hinweg sahen und ihm wohlgesonnen waren. Jacquotte beschlich nicht zum ersten Mal das Gefühl, dass sich Pierre das überlieferte Wissen seiner Indio-Mutter zunutze machte, um die Welt schöner darzustellen, als sie in Wirklichkeit war. Im Prinzip war es jedoch einerlei, denn seine Version beschrieb Manuel besser, als sie es je auszudrücken vermocht hätte.
»Nanichi?« Pierre sah sie an und Jacquotte hob schuldbewusst den Kopf. Sie wollte nicht träumerisch wirken. »Wollen wir aufbrechen?«
Sie nickte und ergriff seine ausgestreckte Hand. Als er sie hochzog, wurde sie sich mit einem Mal der Wärme seines Körpers bewusst und ihr Magen begann zu kribbeln, als hätte sie eine Handvoll Ameisen verschluckt. Erschrocken über ihre Empfindungen, hielt sie mitten in der Bewegung inne.
Sie sah die feinen Haare auf Pierres Brust und nahm seinen Geruch wahr. Obwohl so vertraut, wirkte der Freund in diesem Moment befremdlich, und Jacquotte spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Sie wünschte sich, Pierre von ihren Gedanken erzählen zu können, von den Ängsten, die sie quälten und der eigenartigen Sehnsucht in ihrem Herzen. Aber sie fand keine passenden Worte. Zu lange waren sie Kinder gewesen, doch je älter sie wurden, desto komplizierter wurde ihre Freundschaft. Die Unbeschwertheit von einst verflog wie der Morgennebel, der die Küste des Öfteren einhüllte, und ließ die Realität in jenem gleißenden Licht zurück, das kleinste Details offenbarte.
»Was ist?«, fragte Pierre und sah sie forschend an. »Ist dir nicht gut?«
Jacquotte stieß ihn von sich. »Es ist warm heute, das ist alles.«
Pierre hob die Hände und schüttelte den Kopf. »Deine Laune ist so wandelbar wie das Wetter. Erst ziehen graue Wolken über dein Haupt, dann zeigst du mir ein Lächeln, schöner als die Sonne, und jetzt ist wieder ein Gewitter im Anzug. Versteh einer die Frauen!« Er wandte sich ab.
Jacquotte horchte auf. »Was weißt du schon darüber? Seit dem Überfall der Spanier leben keine Frauen mehr in unserer Siedlung.«
»Ich kenne dich und du bist ja wohl zweifellos eine Frau. Noch dazu eine besonders nervtötende. Außerdem habe ich die Männer über die Frauen aus Frankreich reden gehört und finde, du stehst ihnen in nichts nach!« Pierre half Manuel dabei, auf seinen Rücken zu klettern.
»Was erzählt man sich über die Frauen aus Frankreich?« Jacquotte wurde neugierig.
»Sie sind launenhaft und selbstverliebt. Sie weinen ohne Grund, sind ängstlich und schnattern wie Papageien, wenn sie untereinander sind. Sie schlagen dir ins Gesicht, jammern aber, wenn man sie zu hart anpackt. Sie meckern und klagen, sind nie zufrieden und spucken dir ins Essen, wenn du nicht nach ihrer Pfeife tanzt.«
»Immerhin tun sie etwas«, murrte Jacquotte. »Ihr Männer sitzt nur herum, bohrt in der Nase, esst und furzt und erzählt von euren heldenhaften Taten, die mit jedem Mal besser werden.«
Pierre stapfte den engen Weg bergauf. Obwohl sie sein Gesicht nicht sah, spürte sie seinen Ärger deutlich.
»Deine spitze Zunge wird dir eines Tages zum Verhängnis werden«, hörte sie ihn sagen.
»Wer die Wahrheit meiner Worte nicht ertragen kann, sollte besser seine Ohren verschließen.«
»Hah!«, rief Pierre. »Und das aus dem Mund einer harmlosen Karotte, die vorgibt, eine beißende Zwiebel zu sein. Du solltest besser unter all den Schichten nach deiner eigenen Wahrheit suchen.«
»Im Gegensatz zu dir habe ich keine Angst, sie zu finden, du vaterloser Balg«, empörte sich Jacquotte.
»Casse-pieds! Wenn du keine Frau wärst, würde ich dir für diese Worte ein paar langen!« Pierres Nackenmuskeln spannten sich, und sie wusste, dass sie einen Schritt zu weit gegangen war. Trotzdem ließ sie nicht von ihm ab.
»Du traust dich wohl nicht, gegen mich zu kämpfen?«
»Ich scheue keinen Kampf, aber ich lege nicht Hand an meine eigene Schülerin und schon gar nicht gegen eine wehrlose Frau!«
»Verflucht sollst du sein, Schwarzaugen-Pierre!« Aufgebracht stieß Jacquotte ihm den Knauf ihrer Machete in die Kniekehle, was Pierre straucheln ließ. Für einen kurzen Moment löste er die Hand, mit der er Manuel hielt, um sich abzustützen. Doch dieser Augenblick reichte aus, Manuel abgleiten zu lassen.
Mit einem hilflosen Schrei rutschten die dicken Ärmchen von Pierres Hals und er fiel wie ein Sack nach hinten. Bevor Jacquotte reagieren konnte, traf sie sein Gewicht mit voller Wucht. Sie wurde zurückgeschleudert und keuchte erschrocken auf.
Geistesgegenwärtig versuchte sie sich an der Felswand einzukrallen. Die Wucht des Stoßes riss ihr jedoch lediglich die Fingerkuppen auf, ohne ihrem Fall Einhalt zu gebieten. Wie zwei balgende Welpen kullerten sie den Pfad hinunter, den sie gerade mühsam hinaufgeklettert waren. Jacquotte sah, dass sie immer näher an den Abgrund gerieten, und stemmte ihre Füße in den Boden, um zu bremsen. Auffliegender Staub brannte in ihren Augen.
Endlich stoppte ein Felsbrocken ihren Sturz. Der Aufprall raubte ihr den Atem und nahm ihr die Sinne. Als sie wieder zu sich kam, spürte sie den Schmerz, der alles andere überlagerte. Ihr Rücken brannte wie Feuer und in ihrem Kopf schien jemand gegen die Schädeldecke zu hämmern. Instinktiv tastete sie nach Manuel, doch ihre Hand griff ins Leere. Jacquotte blinzelte. Sie war unfähig, zu rufen oder sich zu bewegen. In ihren Ohren klang alles seltsam gedämpft, und außer einem hohen Sausen vernahm sie keine weiteren Geräusche.
Vorsichtig rollte sie sich auf Arme und Knie. Jeder Knochen in ihrem Leib fühlte sich an, als hätte er seine Position verändert. Nach einer Verschnaufpause richtete sie sich auf. Kurzzeitig wurde ihr schwarz vor Augen. Mit wackligen Schritten versuchte sie sich zu orientieren. Verschwommen erkannte sie Pierre, der mit einem weinenden Manuel im Arm an ihr vorbeiging. Sie hatte nicht bemerkt, dass er ihnen gefolgt war. Seine Schulter streifte sie barsch und der Blick, den er ihr zuwarf, sprach Bände.