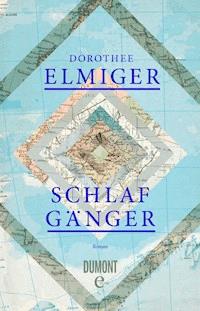Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sollten die Zusammenhänge dieser Welt einmal aufgelöst sein, man wäre froh, das Buch „Aus der Zuckerfabrik“ von Dorothee Elmiger zu finden, um zu verstehen, was in der Vergangenheit vor sich ging. 'My skills never end' steht auf dem T-Shirt eines Arbeiters, der gerade seinen Lohn ausbezahlt bekommt. Am Strand einer karibischen Insel steht der erste Lottomillionär der Schweiz und blickt aufs Meer hinaus. Nachts drängen sich Ziegen am Bett der Autorin. Dorothee Elmiger folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens durch die Jahrhunderte und die Weltgegenden. Sie entwirft Biographien von Mystikerinnen, Unersättlichen, Spielern, Orgiastinnen und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn. Aus der Zuckerfabrik ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen, Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Sollten die Zusammenhänge dieser Welt einmal aufgelöst sein, man wäre froh, das Buch »Aus der Zuckerfabrik« von Dorothee Elmiger zu finden, um zu verstehen, was in der Vergangenheit vor sich ging.'My skills never end' steht auf dem T-Shirt eines Arbeiters, der gerade seinen Lohn ausbezahlt bekommt. Am Strand einer karibischen Insel steht der erste Lottomillionär der Schweiz und blickt aufs Meer hinaus. Nachts drängen sich Ziegen am Bett der Autorin. Dorothee Elmiger folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens durch die Jahrhunderte und die Weltgegenden. Sie entwirft Biographien von Mystikerinnen, Unersättlichen, Spielern, Orgiastinnen und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn. Aus der Zuckerfabrik ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen, Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt.
Dorothee Elmiger
Aus der Zuckerfabrik
Carl Hanser Verlag
Für J.
Body my house
my horse my hound
what will I do
when you are fallen
Where will I sleep
How will I ride
What will I hunt
May Swenson: Question
Wo ist Zucker, ich find’s nicht
Zucker!
Wolfram Lotz: Heilige Schrift I
— So ungefähr: Ich gehe durchs Gestrüpp. Es tschilpen auch einige Vögel.
— Und dann?
— Weiter nichts, es geht einfach immer weiter so.
— Es gefällt dir aber, dieses Gestrüpp.
— Was soll ich dazu sagen?
— Ob es dir gefällt, das Gestrüpp, das kannst du doch sagen; was du dir davon erhoffst, was da für dich drinsteckt.
— Aber ich selbst stecke ja mittendrin, du hast offenbar überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie das da ist.
— Ich stelle es mir sehr unordentlich vor, also ohne Ordnung und Übersicht. Und schön, weil fast alles darin vorkommen kann und weil das Licht je nach Tageszeit einmal hierhin und einmal dorthin fällt, und manchmal liegt Schnee, und ärgerlich ist es auch, weil man ständig hängenbleibt an den Ästen der Sträucher, vor allem, wenn sie Dornen haben und weil du ja so gerne diese Samthose trägst.
— Na gut.
— Also gehst du dann herum in diesem Gestrüpp oder was machst du da?
— Nichts, gar nichts. Gut, ich gehe vielleicht einige Schritte, und dann bleibe ich manchmal stehen und rauche eine Zigarette.
— Und die Vögel?
— Ja, die gefallen mir schon.
Plaisir
Immer scheint jetzt schon die Sonne, wenn ich aufwache.
Im Fernsehen ein Dokumentarfilm über eine Ananasfarm in der Nähe von Santo Domingo. Weiter, weiß bewölkter Himmel. In den Feldern werfen sich die haitianischen Arbeiter die reifen Früchte zu.
Dann tritt der Ananaskönig ins Bild, er steht auf dem Acker und redet in die Kamera. Bevor er die 180 Hektar in den Achtzigerjahren kaufte, war er Gemüsebauer im Zürcher Unterland.
Die Sembradores setzen die Setzlinge im Akkord in die Erde.
Der Ananaskönig misst für das Fernsehen den Zuckergehalt seiner Früchte.
Später zahlt er die Löhne aus.
Auf dem T-Shirt eines Arbeiters: MY SKILLS NEVER END
*
Ein zweiter Film: Der Schnapsbrenner Karl Feierabend aus Rotkreuz, der in die Tropen auswanderte, um Großbauer zu werden, treibt auf seinem Pferd vier Gänse vor sich her durch die grüne Landschaft. Gräser, Wiesen, Palmgewächse. Der Himmel ganz farblos.
*
Nachricht aus Frankreich: Ich soll im Winter an einer Schule in einem Pariser Vorort über meine Arbeit sprechen. Die Schulleiterin, teilt man mir mit, wolle mich mit dem Auto im Quartier Latin abholen und nach Plaisir fahren, wo sich das Collège Guillaume Apollinaire befindet, und anschließend auch wieder zum Hotel zurückbringen.
*
Die behelfsmäßigen Erklärungen, wenn jemand fragt, woran ich arbeite.
Der philadelphische Parkplatz (NEW WORLD PLAZA)
Das Begehren
Zucker, LOTTO, Übersee
Annette beim Abendessen: Sie habe vor zwei Jahren den Roman eines australischen Schriftstellers gelesen, in dem eine lange Reihe von plötzlich aufscheinenden Bildern beschrieben werde, Bilder, die sich gegenseitig hervorriefen, also in einer zumindest losen Verbindung stünden und so eine Art Pfad bildeten, einen leuchtenden Pfad, der durch die Dinge hindurchführe.
Wenn ich meine Hefte und Kopien durchblättere, die Abbildungen, Schemata und Fotografien, wenn ich die im Verlauf der vergangenen Monate erstellten Dateien öffne, sehe ich keinen Pfad, keine sich an den Rändern überlagernden, aufeinander hinweisenden Bilder, Illuminationen, sondern einen Platz, einen Punkt, von dem ich vor vier oder fünf Jahren ausgegangen bin; seither habe ich alles, was mir in die Hände fiel, alles, was ich so sah, das in einem Zusammenhang mit diesem ersten Ort zu stehen schien, dorthin zurückgetragen und vorläufig abgestellt auf diesem weitläufigen Platz.
So auch die Eiben aus dem Schlosspark von Plaisir, die wie Zuckerstöcke geschnitten sind. Das Einkaufszentrum im Norden der Stadt (GRAND PLAISIR), la mosquée de Plaisir.
Es gibt an diesem Ort keine feststehende Ordnung: Mit jedem Gang durch das Chaos, über die Ananasfelder von Monte Plata, durch die Pariser Vorstädte oder den längst verlassenen Garten eines Sanatoriums, über die sizilianischen Berge, vorbei an den Russischen Bädern von Philadelphia zu den Ufern des Swan River in Australien, scheinen die Dinge in neue Verhältnisse zueinander zu treten.
*
Durch die Landschaften, diese versuchsweise Anordnung der Dinge, diesen essai hindurch kehre ich immer wieder zurück zu jener einen Szene, in der sich mir damals, als ich sie zum ersten Mal sah, etwas zu zeigen schien, das ich nicht formulieren, sondern höchstens wiederfinden konnte in Verhältnissen von ähnlicher, von analoger Struktur, als Verwandtschaften, Wiederholungen, Parallelen.
1986: Die Männer, die dicht gedrängt im niedrigen Saal eines Gasthauses in Spiez, am südlichen Ufer des Thunersees, stehen, zwischen ihnen die Söhne, Jungen von zwölf, dreizehn Jahren vielleicht, und einige Frauen, Ehefrauen, Mütter. Das warme Licht, das die versammelte Bevölkerung des Ortes, die sich bis in den Flur hinaus drängt, beleuchtet. Jener schließlich, dem sich alle zuwenden in diesem Augenblick, als handelte es sich um den Prediger einer vulgären Messe: In seinen Händen zwei Figuren, die er über die Köpfe der Anwesenden streckt, zwei Frauenfiguren aus Holz oder aus blank poliertem, schwarzem Stein, dreißig Zentimeter hoch vielleicht. Die im Licht glänzenden Körper sind bis auf ein lose um die Hüfte, den Kopf gewundenes Tuch, bis auf eine goldene Halskette unbekleidet. Sie knien, scheinbar selbstvergessen. Dann erhebt der Versteigerer die Stimme: Wer macht ein Angebot Ich bitte um Ruhe Zwanzig Zwanzig Franken Mehr Angebote Ein Fünfliber Fünfundzwanzig Fünfundzwanzig Weitere Angebote Schaut nur diese Brüste an Fünfunddreißig Wer geht noch ein bisschen höher Fünfunddreißig Fränkli sind geboten Fünfunddreißig Franken zum ersten Fünfunddreißig zum zweiten und zum dritten Mal Dann sind diese alten N———— auch weg da
Je öfter ich zurückkehre in diesen Saal, den ich nur aus einem in den Achtzigerjahren gedrehten Dokumentarfilm kenne, desto deutlicher steht es mir vor Augen, dass mein Verlangen, diesen Ort immer wieder aufzusuchen, nichts damit zu tun hat, dass sich mir dort etwas in besonderer Klarheit zeigen würde. Im Gegenteil vermute ich mittlerweile, dass diese wiederkehrenden Besuche, meine neurotischen Pilgerfahrten ihren Grund in der Tatsache haben, dass es sich um eine gewissermaßen unlösbare Szene handelt, um eine wenige Augenblicke dauernde Konvergenz verschiedenster Stränge der Geschichte — so als kollidierten unterschiedliche Gesteinsobjekte, Himmelskörper, die sich zuvor lange Zeit scheinbar losgelöst voneinander um die Sonne bewegten, und als sorgte ihr Aufprall für eine sekundenlange Erleuchtung der Dinge, des Gerölls und des Staubs.
*
Eine Strophe aus John Berrymans Dream Song 311: »Hunger was constitutional with him, / women, cigarettes, liquor, need need need / until he went to pieces. / The pieces sat up & wrote. They did not heed / their piecedom but kept very quietly on / among the chaos.«
Was ich da tue, wenn ich mich aufhalte mit dieser seltsamen Ansiedelung, diesen geografischen Flicken und den mit ihnen verbundenen Zeugnissen, Artefakten und Phantasmen, scheint etwas zu tun zu haben mit diesem Hunger als Verfassung, mit dem »Drang«, wie es bei Ortega y Gasset heißt, »aus sich herauszugehen«, der allem Orgiastischen zugrunde liege (»Trunkenheit, Mystik, Verliebtheit usw.«): Vielleicht wäre es richtig zu sagen, dieser Hunger sei der eigentliche Gegenstand meiner Forschung, der Platz, auf dem der haitianische Arbeiter (MY SKILLS NEVER END) im Schatten der Bäume im Schlosspark von Plaisir schläft usw., und zur gleichen Zeit der Grund meiner Recherche, die Triebfeder dieser kleinen Produktion.
*
Mit dem letzten Zug zwischen den Bergen des Oberwallis hindurch nach Hause gefahren. Die noch immer schneebedeckten Flanken hell in der Nacht, darüber die dunklen, hohen Gipfel vor dem tiefblauen Himmel. Spiez, Thun, Bern. Unterwegs eingeschlafen, geträumt, ich hätte einen Band mit dem Titel »Das lyrische Maß der Maßlosigkeit« herausgegeben.
*
Wieder Chantal Akermans »J’ai faim, j’ai froid« (1984) angesehen. Éducation sentimentale der jungen Frau in zehn Minuten. Die schönen Haarschnitte der zwei Siebzehnjährigen. Hungrig gehen sie durch die französische Hauptstadt, ihr Appetit ist unermesslich und umfasst alles, denke ich, Dinge und Menschen und Landschaften.
Ihr Blick in die Auslagen der Imbisse und Geschäfte, durch die Fenster ins Innere der beleuchteten Speiselokale. Sie sind nicht hungrig, weil sie lange nichts gegessen haben, sondern weil ihnen das Essen ein so wahnsinniges Vergnügen bereitet.
— J’ai faim.
— Viens.
— Combien il reste d’argent?
— Rien.
— Bon, c’est maintenant que la vie commence.
— Qu’est-ce qu’on fait?
— On cherche du travail.
— Bon. Où c’est qu’on va?
— Je ne sais pas.
— Qu’est-ce que tu sais faire, toi?
— Je sais coudre, écrire, compter, lire, chanter.
— Moi aussi, mais j’aime pas coudre, écrire, compter, lire. J’aime que chanter.
— Moi, je chante faux et je crie quand je chante.
— Moi, j’aime crier, je chante juste.
— On va chanter alors.
Wie die zwei danach ein Restaurant betreten und zu singen beginnen, ohne richtig zu wissen, wie die Melodie verlaufen wird; wie sie mit weit offenen Mündern zwischen den Tischen stehen, linkisch und deplatziert und schön. Und wie schmal ihre Hälse sind.
So etwas versuche ich ja hier auch, so habe ich es mir zumindest immer vorgestellt.
Eine der letzten Szenen: Während eine der beiden mit einem Mann im Bett liegt
(»J’ai envie de t’aimer.« »Aime-moi, alors.«),
schlägt die andere in seiner Küche Eier am Pfannenrand auf.
*
C., als wir gerade an der Saalsporthalle vorbeigehen: Er verspüre selten Hunger, das Hungergefühl sei ihm eigentlich schon immer ganz fremd gewesen.
Wie er so blass und groß in seinem Mantel über die weiten Wiesen des ehemaligen Waffenplatzes geht, als entstammte er einem verarmten Adelsgeschlecht.
In meinem Fall hingegen heißt jeder Satz, den ich zurzeit schreibe, immer auch:
J’ai faim./Aime-moi, alors.
Aber alle meine Darreichungen lehnt der Appetitlose seit vielen Wochen höflich ab,
auch die Früchte, die ich immer sorgfältig mit einem Taschentuch poliere, bevor ich sie ihm offeriere.
Wir gehen durchs offene Gelände, goldene Felder, Tümpel, irgendwann überqueren wir die Autobahn, weit unter uns die kleinen Fahrzeuge, die über die Fahrbahn in den Feierabend hinausschießen.
*
In der Post ein Buch von S., eine Sammlung von »Biographien der Wahnsinnigen« aus dem späten 18. Jahrhundert. Er habe sich gedacht, schreibt er, die Texte könnten womöglich interessant für mich sein.
Das Hospital der Wahnsinnigen zu P.
Der liebeswahnsinnige Jakob W***r, der meint, eine gläserne Brust zu haben und also ein Herz, das jede und jeder einsehen kann.
Die junge Frau zu B., die, von einem Mann, einem großen, »gleich einer Pappel am wasserreichen Flusse« gewachsenen Mann verlassen, immer wieder in die Kronen der Bäume steigt.
Als sie vom Dach des elterlichen Hauses stürzt und stirbt, als die Bevölkerung dem Sarg durch die Straßen der Stadt nachfolgt, deklamiert der Priester: Er hat mich verlassen, aber der Herr nahm mich auf!
*
Gegen zwei Uhr morgens quer über die Wiesen des Parks nach Hause, die trockenen Halme brechen knisternd unter den Schuhen.
*
Ich kenne, schreibe ich an C., ich kenne ein fremdes, ein tropisches Gebiet, Rebhühner wandern dort durch das schattige Gehölz, rotäugige Schildkröten liegen regungslos im stehenden Gewässer, silberne Täubchen nisten dort in den Kronen hoher Bäume, und während ich schreibe, fängt draußen schon das allgemeine Zwitschern der Vögel an.
*
Traum: Nach Mitternacht wache ich auf und steige die Treppe hinunter. Ich weiß, dass ich mich im Haus meiner Eltern befinde. Schon im Flur sehe ich, dass noch Licht brennt in der Küche, was mich nicht überrascht, denn meine Mutter, eine Grundschullehrerin, hat viele Nächte meiner Kindheit über den Küchentisch gebeugt zugebracht, zu ihrer Rechten die bereits durchgesehenen, zu ihrer Linken der Stapel der noch unkorrigierten Hefte, und auch in meiner Jugend saß sie oft noch dort, unter der tief hängenden Lampe, und arbeitete, wenn ich abends mit dem letzten Zug nach Hause kam.
Als ich mich nun der Küche nähere, sehe ich, dass meine Mutter keinen Stift, sondern eine Spindel in der Hand hält, eine Spindel, die ich, so meine ich mich augenblicklich zu erinnern, wenige Wochen vor dem Tod meiner Großmutter, der Mutter meiner Mutter, noch im Obergeschoss ihres Hauses zwischen überwinternden Pflanzen, alten Puppen und Dürrenmatts »Panne« herumliegen gesehen hatte. Ich musste bei meinen Besuchen im Laufe der Jahre unzählige Male daran vorbeigegangen sein, hatte ihr aber nie viel Aufmerksamkeit geschenkt: Seit langer Zeit schien sie keine Verwendung mehr gefunden zu haben.
Kurz bevor mich das Licht erfasst, das durch die Küchentür in den Flur fällt, bleibe ich stehen. Ich trage ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift »International Institute for Sport«, das mir fast bis zu den Knien reicht. Ich bin ungefähr elf Jahre alt.
Meine Mutter, die ihre ganze Aufmerksamkeit dieser Spindel zu schenken scheint, hat mich bisher nicht bemerkt. Ich schaue ihr zu dabei, wie sie mit außerordentlicher Geschwindigkeit geschickt mit dem Gerät umgeht. Als wäre ein unbekannter Geist in sie gefahren oder als wäre ihr ein lange vergessenes Wissen wieder zugefallen, hantiert sie mit der Spindel, und während sie dies tut, verändert sich ihr Gesicht; neue Züge legen sich über die alten oder es sind frühere Züge, die wieder hervortreten unter der mir vertrauten Gestalt ihres Gesichts.
Noch immer stehe ich im Dunkeln, und es ist mir peinlich, diese Verwandlung, diese Zustände meiner Mutter, deren Bedeutung ich nicht kenne, mit anzusehen. Ich betrete die Küche und reiße meiner Mutter das Ding aus der Hand, und in diesem Moment passiert es, dass ich mich damit steche; ich ramme mir die Spitze dieser dummen Spindel tief unter die Haut des linken Zeigefingers, Blut tropft auf mein T-Shirt, und ich denke noch, oh nein, nicht die linke Hand, da ich doch Linkshänderin bin.
Die Hand vor mir hertragend, als gehörte sie nicht zu mir, steige ich die Treppe wieder hoch und lege mich in mein Kinderbett. Wochen und Monate, dann Jahre verbringe ich in einem Zustand der Lethargie. Oft rühre ich mich kaum im Laufe eines Tages. Ab und zu gehe ich die Treppe hinunter und lasse mir in der Küche einige Handvoll Kellogg’s Cornflakes in den Mund rieseln, dann lege ich mich wieder hin.
Als meine Mutter ins Kino fährt, um »Independence Day« zu schauen, und dann ein zweites Mal, um den Film noch einmal zu sehen, fahre ich mit und sehe mit meinen eigenen, adoleszenten Augen, wie sich die großen außerirdischen Scheiben vom Mutterschiff entkoppeln und langsam vor die Sonne schieben.
Bellevue
Ich betrete den Platz, auf dem die Dinge vorläufig lagern, diesen hypothetischen Speicher, so wie ich manchmal die italienischen Kirchen und Kapellen um die Mittagszeit betreten habe, um der Hitze zu entkommen: Kurze Visiten, ein rascher Gang durch die opulenten, im Halbdunkel liegenden Seitenschiffe, von dem niemand Notiz zu nehmen schien.
Fahre mit den Händen über die Oberflächen, berühre alles, was da ist.
Zu Laura in der Kantine: In Wahrheit würde ich zurzeit nur dasitzen und lesen.
*
In Marie Luise Kaschnitz’ letzten, mit »Orte« überschriebenen Aufzeichnungen die Beschreibung ihrer selbst, wie sie einmal tanzte mit den Patienten einer »vornehmen Irrenanstalt«, deren Namen sie nicht nennt; dann die Erinnerung an ein Kind, den Sohn des Anstaltsleiters, der sich im nächtlichen Garten des Sanatoriums »mit zwei brennenden Kerzen einem starken dicken Baum näherte und diese Flämmchen an die Rinde hielt, überzeugt davon, daß es ihm gelingen wird, den mächtigen Baum aufflammen zu lassen«. In derselben Nacht Feuerwerk, das in die Luft steigt: »Lichtgewächs«, schreibt Kaschnitz, Heiterkeit, in den Fenstern die klatschenden Patienten.
Seit Tagen habe ich nun diesen Jungen vor Augen, der sich schlafwandlerisch, geisterhaft fast, durch den dunklen Garten bewegt, flackernde Kerzen in den Händen; hin und wieder beleuchten die über ihm explodierenden Feuerwerkskörper die Szenerie und sein Gesicht. Als folgte er einer Eingebung, einer an ihn allein gerichteten Aufforderung, sucht er den Baum auf und versucht, ihn anzuzünden, ihn aufflammen zu lassen, ihn zu verwandeln in ein leuchtendes Zeichen im Garten des Sanatoriums.
Die sekundenlange Beleuchtung im Text als Markierung einer Stelle. So wie bei Hermann Burger das Glas plötzlich zu zittern beginnt, als er einmal im Speisewagen an Badgastein vorbeifährt: »als wolle sich ein Medium mir mitteilen«.
Er habe gewusst, »dass etwas los war, aber nicht was«.
*
Wie oft ich ja Kaschnitz’ Aufzeichnungen zuvor schon an einer beliebigen Stelle aufgeschlagen oder ihren Anfang gelesen habe — die erste Seite, auf der sie, Kaschnitz, schreibt, hier stehe, was ihr eingefallen sei in den letzten Jahren, aber »nicht der Reihe nach«, ungeordnet, und die zweite, deren erste Zeilen ich beinahe auswendig hersagen kann: Oder Orte, nie gesehene, zum Beispiel Stockholm oder Aden am Roten Meer oder Samarkand und so weiter,
die Vorstellung von Öltürmen, Ölschiffen, von der großen Hitze in Aden,
die Fremdenschiffe, die Vergnügungsschiffe, fahren alle vorbei.
Und nun auf einmal das Sanatorium auf Seite 64, das ich sofort wiedererkenne: Im Winter vor drei oder vier Jahren bin ich ab und zu an dem ausschweifenden Gelände vorbeigefahren, und noch früher, als Kind, hatte ich mit meiner Tante manchmal ganz in der Nähe in einer kleinen, schattigen Bucht gebadet.
*
Mit dieser Stelle, in diesem Garten anzufangen: Als hätte ich lange unentschlossen auf dem Zaun einer Koppel gesessen und hin und her überlegt, wie so ein Pferd, wie diese Tiere, die ja vielleicht fünfhundert oder sechshundert Kilogramm wiegen, geschickt aufzuzäumen seien; mich schlussendlich, verärgert über mein eigenes Zaudern, kurzerhand auf eines der Pferde geworfen, mich festgehalten, so gut es mir eben möglich war.
Die Sache mit dem Zaumzeug als illusorisch verworfen.
*
In Kaschnitz’ Aufzeichnung: Zu jenem Sohn, der die Flammen vor den Augen der Patienten auf den Baum zuführt, um ihn brennen zu lassen, tritt ein zweiter hinzu. Er (Robert), der sich kurze Zeit später, so Kaschnitz, vor einen Zug legen wird, ist es, der in dieser Nacht den Feuerträger aufhält.
Ein Bild, das der Maler Ernst Ludwig Kirchner 1917 oder 1918 während seines Aufenthalts in der geschlossenen Abteilung für sechsundzwanzig männliche Kranke anfertigt: »Der Kopf des Studenten Robert Binswanger«. Das Gesicht des Jungen als Holzschnitt: Seitenscheitel, weit aufgerissene Augen.
*
Als Kaschnitz am nächsten Tag über den Anstaltsgrund geht, trifft sie dort auf Vaslav Nijinsky, den russischen Tänzer, von dem man zu Beginn des letzten Jahrhunderts sagt, niemand vollführe Sprünge wie er, der dabei hoch in die Luft aufsteigt und dort einen Augenblick lang stillzustehen scheint oder springend seine Beine fünf Mal überkreuzt.
Nijinsky, der am 19. Januar 1919 im Hotel Suvretta in St. Moritz zum letzten Mal auftritt: Er werde nun den Krieg tanzen, habe er gesagt und tatsächlich so ausgesehen, als tanzte er um sein Leben. Sei dann in den Tagen danach wieder ganz zu seinen Tagebüchern zurückgekehrt.
»Ich werde eine Brücke zwischen Europa und Amerika bauen, die nicht teuer sein wird«, schreibt er.
Und: »Ich habe in einem Aeroplan gesessen und geweint.«
Am 4. März desselben Jahres wird Nijinsky in die »Irrenheilanstalt Burghölzli« gebracht, später überwiesen in das Sanatorium am See, wo, wie es bei Joseph Roth heißt, »die Irrenwärter zärtlich waren wie Hebammen«.
*
Radetzkymarsch: Jedes halbe Jahr begibt sich der »an leichtem, sogenanntem zirkulären Irresein« leidende Fabrikant Taußig in die Schweizer Anstalt, in der »verwöhnte Irrsinnige aus reichen Häusern« die zärtliche Behandlung der Irrenwärter erfahren.
*
Wie ich damals, im Winter, dem Uferweg in der Nähe des ehemaligen Sanatoriums folgte: Dampfschwaden hingen über der Wasseroberfläche, die Straßen waren mit einer dünnen, fast unsichtbaren Schicht Eis überzogen. Abends im Schneegestöber die Rücklichter der Autos, die mit laufendem Motor am Bahnübergang standen. Ich hörte Turiya and Ramakrishna auf meinen Kopfhörern, nachts schaute ich fern.
*
Im dritten Untergeschoss der Zentralbibliothek eine Kaschnitz-Biografie aus dem Jahr 1992. Dem ersten Teil (Wälder der Kindheit) sind drei Zeilen vorangestellt:
Und rasch war die Zeit meine Zeit.
Wer von Pferden gezogen zur Welt kam
Verließ sie im Raumschiff.
Ich habe in einem Aeroplan gesessen und geweint.
S. 21: Kaschnitz, als sie noch Marie Luise von Holzing-Berstett heißt, oder vielmehr EIRAM ESIUL, läutet als Kind nach dem Kindermädchen Lulu, »das tröstend mit Zuckerwasser ins Zimmer kommt«.
S. 24: Über Das dicke Kind sagt sie zu Horst Bienek, sie sei selbst auch ein »braves, schläfriges und viel essendes Kind« gewesen, »aber eben eines mit vielen Ängsten und eines, das bei jeder Gelegenheit zu heulen anfing«.
Kein Hinweis auf einen Besuch der Gärten des Sanatoriums.
*
Sieben oder acht Jahre vermutlich bevor der Sohn des Psychiaters, beleuchtet von den Feuerwerken, die sich in der Luft zu immer neuen, hellen Formationen ausbreiten, die flackernden Kerzen durch den Garten trägt, wird am 14. Januar 1921 die Patientin, der Binswanger den Namen »Ellen West« verleihen wird, in die Kuranstalt Bellevue in Kreuzlingen aufgenommen.
Und in den Fenstern, schreibt Kaschnitz, standen die Patienten und klatschten.
Und die Irrenwärter waren zärtlich wie Hebammen.
Im Herbst vor ihrer Ankunft am südlichen Ufer des Bodensees, am 21. Oktober 1920, schreibt West in ihr Tagebuch: »Von Zeit zu Zeit fallen mir neue Indizienbeweise ein: z.B. Wenn ich in einem leeren Hotelzimmer ankomme, möchte ich zuerst etwas essen.«
*
Deutschlandreise. Mannheim, Köln, Münster. Blauer Himmel über Westfalen. Die Bäume vor Recklinghausen sind groß und stehen dicht an den Gleisen, die Unterseite ihrer Blätter leuchtet silbern im warmen Oktoberlicht.
In der Nacht zuvor, als ich gegen ein Uhr noch einmal aus dem Haus gelaufen bin, plötzlich Hunderte von Fledermäusen, die unablässig um die Flutlichter des leeren Letzigrund-Stadions kreisen. Immer wieder schießen einzelne Tiere aus dem Scheinwerferlicht in die Dunkelheit hinaus und tief über mich hinweg. Ich lege den Kopf in den Nacken, habe das weiße Fell ihrer Bäuche in aller Deutlichkeit vor Augen. Vor der Lion Bar ein roter Lamborghini Aventador mit geöffneten Scherentüren.
Und gleich habe ich diese Tiere, auch das Auto, wieder als Zeichen genommen, als Hinweis auf C.: Als handelte es sich um Trägerinnen einer Botschaft, die ich lange Zeit erwartet hatte (J’ai faim. / Je t’aime.). Obwohl er, C., zu dieser Zeit ziemlich sicher nichts ahnend auf dem Bett lag und Persian Surgery Dervishes hörte.
Als ich im leeren Hotelzimmer ankomme, bin ich hungrig. Durch das offene Fenster das Rauschen der Fahrzeuge, die in zweihundert Metern Entfernung über die deutsche Bundesautobahn durch das Münsterland und auf die Ostsee oder auf Leverkusen, das Dreieck Vulkaneifel und den Saarkohlenwald zurasen.
Die großen Schatten der Pferde, die durch die Parklandschaft laufen.
Irgendwann, spät, das aufleuchtende Display des Telefons (RoamingInfo).
Frühmorgens irre ich auf der Suche nach dem Ausgang mit nassem Haar durch die dunklen Flure des Hotels. Das dringende Verlangen, immer von C. zu sprechen, alle Sätze insgeheim von C. handeln zu lassen, auch dann z.B., als die Rezeptionistin mich fragt, ob ich etwas aus der Minibar genommen habe. Im Bus zum Bahnhof Frauen mit großen Körben, als gingen sie alle in die Pilze.
*
Als ich ihn, C., zum ersten Mal sah: Wir hielten uns im Trolleybus an den Stangen über unseren Köpfen fest.
Später einmal, als ich über die Rolltreppen im Letzipark ging.
Wie sich schon damals, in jedem dieser Augenblicke, dieses schockierende Licht über alles gebreitet hat, jenes Licht, das die Erscheinung umkleidet, das Licht, dem die blinde Pilgerin sich in einem Pinienwäldchen zusammen mit Tausenden entgegenwirft, ganz außer sich: ein Eklat.
*
Diese blöde Verwandlung der Welt in ein Pinienwäldchen. Das zwar sehr schön ist.
*
Kaffee mit Erika, meiner Nachbarin aus dem zweiten Stock. Sie hat früher in der Kantine auf dem Gelände der Zahnradfabrik Maag gearbeitet, die dann in den Neunzigerjahren geschlossen wurde.
Während wir sprechen, marschiere ich schon wieder heimlich davon, auf direktem Weg in den erwähnten Wald hinein.
Erika mit ihren schönen kleinen Kreolen, die von weitem noch zwischen den Baumstämmen hindurchfunkeln.
Alle Vögel sind schon da.
*
Und alles glänzt und strahlt und ist ein einziges großes Versprechen:
Ich lagere auf Betten aus Moos, mit aufgesperrten Augen betrachte ich alles: Er (C.) liegt in allen Dingen, und deshalb liebe ich alle Dinge so sehr.
Und noch nie habe ich einen Wald gesehen, der so irrsinnig hell beleuchtet ist, sage ich zu den Freunden: Seit eineinhalb Jahren habe ich ja überhaupt kein Auge mehr zugemacht.
Tagelang lümmle ich im Schatten der Bäume herum oder erklimme Plateau um Plateau, und bevor ich den höchsten Punkt erreiche, sehe ich ganz aufgekratzt gerade noch, wie eine Gruppe von Vögeln in V-Formation durch das Zentrum der Sonne fliegt.
Die Höhepunkte, die bei Lady Chatterley ja crisis heißen.
Stimmt schon, dass ich auch viel weine in diesem Wald, sage ich zu den Freunden, die ihre Skepsis zum Ausdruck bringen. Bin oft hungrig und müde und allein, vor allem habe ich in einem Moment der Ekstase meine Stifte verlegt.
*
Deborah Levy in ihrer Antwort auf George Orwells »Why I Write«: »The night before, when I had walked into the forest at midnight, that was what I really wanted to do. I was lost because I had missed the turning to the hotel, but I think I wanted to get lost to see what happened next.«
*
Plötzlich wieder an den Wald in EIRAM ESIULs Erzählung Das dicke Kind gedacht, an das Kind mit seinen kühlen, hellen Augen, das an einem Winternachmittag auf einmal die Wohnung der Erzählerin betritt.
Es isst die Brote, die die Frau zuvor für sich selbst zubereitet hat: Wie eine Raupe, heißt es, verspeist es alles, was sie ihm widerwillig aufträgt, und die Geräusche, die es dabei verursacht, wecken in der Frau, die das Kind mit Argwohn betrachtet, Ärger und auch Verzweiflung, ja düstere Gefühle.
Später bricht es beim Eislaufen ein, das Kind, und steht bis zur Hüfte im eisigen Wasser, dort, wo eben noch seine Schwester ihre vollendeten Bahnen gezogen hat. Und während die Erzählerin, die auf dem vereisten Steg steht, noch zweifelt, ob es dem dicken Kind gelingen wird, sich selbst aus dem Wasser zu ziehen, sieht sie, dass etwas mit seinem Gesicht geschieht: Umgeben vom dunklen Wasser scheint es plötzlich alles Leben der Welt zu trinken, trinken zu wollen, und es beginnt, seinen schweren Körper mühsam aus dem Wasser zu hieven,
»ein schreckliches Ringen um Befreiung und Verwandlung, wie das Aufbrechen einer Schale oder eines Gespinstes«,
und der See an diesem Tag ist noch immer von schwarzen Wäldern umgeben, so wie ihn die Erzählerin auf dem Steg in ihrer Kindheit kannte.
*
Bereits als Kind, teilt der Ehemann der Patientin EW dem behandelnden Psychiater, LUDWIG BINSWANGER (Kreuzlingen), mit, habe seine Frau es »interessant« gefunden, »tödlich zu verunglücken, z.B. beim Schlittschuhlaufen einzubrechen«.
Auch, notiert Binswanger in seiner Fallstudie, sei sie ein eigensinniges, ein heftiges Kind gewesen. »Einmal habe man ihr ein Vogelnest gezeigt; sie habe aber mit Bestimmtheit erklärt, das sei kein Vogelnest, und sich durch nichts davon abbringen lassen.« Sie wünscht sich, ein Knabe zu sein, sie reitet fahrlässig, küsst scharlachkranke Kinder, sie stellt sich »nach einem warmen Bade nackt auf den Balkon«, steigt »mit 39 Grad Fieber bei Ostwind vorn auf die Straßenbahn«.
»Um das Urteil der Welt kümmert sie sich nirgends«, schreibt Binswanger in ihre Lebens- und Krankheitsgeschichte. Umgekehrt bemerkt sie in ihrem 18. Lebensjahr im Tagebuch, »wie der Herr Graf während des Sprechens sein Feinbrot langsam in der Hand zerdrückt hat«, diese Beiläufigkeit des Reichtums und der Verschwendung, während ihr die Gestalt einer Hungrigen erscheint, die draußen in der Kälte steht.
Mit zwanzig reist sie nach Übersee: Aufenthalt auf jenem Kontinent, den sie mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern als Kind verließ, als die Familie nach Europa emigrierte. »Sie ißt und trinkt mit Vergnügen«, hält Binswanger fest. »Dies ist die letzte Zeit, in der sie harmlos essen kann. Sie verlobt sich jetzt mit einem romantischen Überseer, läßt die Verlobung aber auf Wunsch des Vaters zurückgehen. Auf der Rückreise hält sie sich in Sizilien auf, schreibt hier an einer Schrift ›Über den Beruf der Frau‹, liebt das Leben (laut Tagebuch) leidenschaftlich, die Pulse hämmern bis in die Fingerspitzen …«
*
Kurz vor halb neun erreicht das Schiff die Hafeneinfahrt von Messina. Vor uns, hoch aufgerichtet in der Morgensonne, eine goldene Madonna, die uns ihre rechte Hand segnend entgegenstreckt. Die Madonna della Lettera, sagt der Deutsche, der einen großen Teil der vergangenen Nacht mit seinem Border Collie auf Deck verbrachte und nun mit einem Becher Kaffee aus dem Innern des Schiffs an die Reling zurückkehrt, Madonna des Briefes, die die Stadt im Jahr zweiundvierzig schriftlich segnete. Die Italiener! Er lässt seinen Arm über die vor uns liegende Landschaft schweifen. Überhaupt die Katholiken mit ihrer Verehrung der Mutter Gottes.
Von weitem sehe ich die Freundinnen im Schatten des Terminals stehen, K. mit verschränkten Armen, S. an die Außenwand des Gebäudes gelehnt. Ich sehe ihnen die Zeit an, die sie bereits auf der Insel verbracht haben. Beiläufig unterhalten sie sich, während sie warten, denn alles, was sie umgibt, haben sie bereits gesehen: schlafende Tiere, tote Tiere, einlaufende Schiffe, faulende Gemüsereste, Wasser, das aus Plastikeimern zur Reinigung über den unebenen Platz gegossen wird, in schwarzen Rinnsalen in die Risse und Löcher im Asphalt fließt und dort im Laufe des Tages langsam verdunstet.
Wir folgen einer engen, mit großen Steinen gepflasterten Straße. Die Besitzerin der Pension, sagt K., Beatrice, eine Frau um die sechzig, sitzt den ganzen lieben Tag lang an einem großen Tisch vor ihrem Haus, auf dem Schoß das eine oder andere Enkelkind, neben ihr ihre Tochter, die sich auf Stellensuche befindet, oder der Schwiegersohn, ein langhaariger Franzose aus Toulouse, von dem sich die Tochter längst getrennt hat, dem aber die Sympathien seiner Schwiegermutter in der Hauptsache gelten. Er trägt kurze Hosen und albert mit seiner Tochter herum oder streicht den weiblichen Gästen im Vorbeigehen mit dem Zeigefinger über den Nacken. Es ist unmöglich, die Pension zu betreten oder zu verlassen, ohne von Beatrice an diesen Tisch kommandiert zu werden, um zumindest einen Espresso zu trinken, den Beatrices Tochter jeweils widerwillig aufsetzt. Die Enkelkinder mit ihren staubigen Händen und Füßen und ihrem langen französischen Haar wälzen sich einem auf den Schoß, sie besteigen einen, wie sie auch Mauern oder Hügel besteigen, und fahren den Gästen der Pension über die Gesichter, als wären sie blind, blinde Kinder, die versuchten, aus der Reihe der Anwesenden die ihnen bekannten Personen festzustellen. Unter den Gästen, sagt S., finden sich solche, die durchaus Gefallen finden an Beatrices strenger Form der Gastfreundschaft, einige deutsche Rucksacktouristen und ein Vulkanforscher mit seiner Freundin, die eben noch den Krater des Stromboli fotografierten und nun auf ihren Rückflug nach Turin warten, haben sich an diesem Tisch eingerichtet. Jeden Morgen nehmen sie ihre angestammten Plätze ein und plaudern, während sie gleichzeitig Feigen vierteilen, auf ihren Telefonen die Wetterprognose abfragen oder den träge herumliegenden Katzen übers Fell streichen. Für Außenstehende, sagt K., scheint ihre Verbindung mit der Familie Beatrices privaten, ja verwandtschaftlichen Charakter zu haben. Nicht zuletzt die vertrauliche, wenn nicht zudringliche Umgangsweise, die der Franzose zum Missfallen der Tochter Beatrices mit den Gästen pflegt, führt dazu, dass alle Grenzen unscharf werden.
Der Franzose, sagt S., nenne die Schwiegermutter Mamma, ebenfalls seine Ex-Frau.