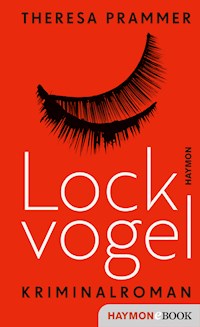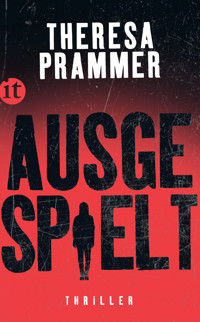11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Verlorene Erinnerungen und dunkle Geheimnisse
Zwei vermisste Frauen tauchen gleichzeitig nach drei Wochen wieder auf - eine in Berlin, die andere in Wien. Für beide scheinen nur zwei Tage vergangen zu sein. Noch merkwürdiger sind ihre exakt gleichen Erinnerungen an die Entführungen. Die Ermittler sind ratlos und holen die Erinnerungsforscherin Lea Goldberg ins Team, die zurückgezogen in Wien lebt und seit einem Fehlurteil arbeitsunfähig ist. Ein Jahr zuvor beurteilte sie einen Angeklagten falsch, der daraufhin freikam und einen Mord beging.
Die renommierte Psychiaterin Barbara Kirsch unterstützt die Ermittlungen in Berlin. Zusammen versuchen sie, die versteckten Erinnerungen der Frauen zu entwirren. Doch als die beiden Psychologinnen sich treffen, löst dies eine Katastrophe aus ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Theresa Prammer
Ausgelöscht
Thriller
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 5004.
© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildung: FinePic®, München
eISBN 978-3-458-77811-0
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Joseph
Motto
Jeder glaubt, Erinnerungen funktionieren wie ein Aufnahmegerät. Man zeichnet Informationen auf, ruft sie ab und gibt sie wieder.
Aber jahrzehntelange Arbeit in der Psychologie hat gezeigt, dass das nicht stimmt. Das Gedächtnis funktioniert ein bisschen mehr wie eine Wikipedia-Seite.
Sie können dort hingehen und den Inhalt ändern.
Aber andere können das auch.
Dr. Elizabeth Loftus, Erinnerungsforscherin
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
1.
//
Prolog
2.
//
Ein Jahr später
3.
//
Damals
4.
5.
6.
//
Damals
7.
8.
9.
//
Damals
10.
11.
12.
//
Damals
13.
14.
//
Damals
15.
16.
//
Damals
17.
18.
19.
//
Damals
20.
21.
//
Damals
22.
23.
24.
//
Damals
25.
26.
//
Damals
27.
28.
//
Damals
29.
30.
//
Damals
31.
32.
33.
//
Damals
34.
35.
36.
//
Damals
37.
38.
//
Damals
39.
40.
//
Damals
41.
42.
43.
44.
45.
46.
//
Damals
47.
48.
//
Damals
49.
50.
51.
52.
//
Epilog
. Vier Monate später
Danksagung
Informationen zum Buch
Ausgelöscht
1. // Prolog
Fünf Tage nachdem die Mordanklage gegen Jakob fallengelassen wurde, tötete er Elli.
Carl und ich waren bei der Eröffnung des Memoria-Projekts in der größten Halle der Messe Berlin. Und wir hatten keine Ahnung, was sich nur wenige Kilometer entfernt abspielte. Wussten nicht, dass Jakob Elli überwältigte. Sie in den Keller brachte. Fesselte.
Ich saß in der ersten Reihe des vollbesetzten Saals und hielt Ausschau nach Carl. Wir hatten uns heute noch nicht gesehen.
Als Leiter des Memoria-Projekts war er der erste Vortragende, nach ihm war ich dran. So nervös wie jetzt war ich selten. Nicht wegen des Vortrags. Sondern, weil ich Carl gestern Abend fast geküsst hätte.
Wir waren bei ihm zu Hause, um uns auf den Kongress vorzubereiten. Ich kannte ihn schon mehr als mein halbes Leben, doch erst seit wir zusammenarbeiteten, waren seine Tochter und er meine Ersatzfamilie geworden. Schon früher hatte es diese Momente zwischen uns gegeben. In denen ein Blick plötzlich mehr bedeutete. Passiert war nie etwas. Bis gestern. Carls Tochter hatte angerufen. Sie war bei einer Freundin, würde später kommen, und wir sollten ihr etwas vom chinesischen Lieferservice aufheben.
»Wo waren wir gerade?«, fragte Carl und legte das Handy weg. Er hatte sein Essen noch nicht angerührt. Wirkte angespannt. Das war untypisch für ihn. Ich schob den Teller gebratener Nudeln zu ihm hin.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Möchtest du Wein?«, wich er aus.
Ohne meine Antwort abzuwarten, stand er auf, holte eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank. »Wer von uns soll morgen über Jakobs psychische Verfassung reden?«, fragte er, goss ein und reichte mir das Glas.
»Keiner.«
Er wirkte überrascht.
»Du willst nichts sagen?«
»Carl, Jakob vertraut uns. Er hat vorher niemandem so sehr vertraut. Wir kennen seine Geheimnisse.« Carl setzte an, doch ich ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Und ich weiß, was du sagen willst.«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Ach ja?«
»Dass er kein Patient ist, es so viele andere gibt, für die unsere Arbeit mit ihm den Weg ebnen wird, und es darum wichtig ist, so tiefgehend wie möglich über alles zu berichten. Aber trotzdem. Er … er ist noch ein Teenager.«
Das war eine dürftige Begründung, ich erwartete, dass Carl mir etwas entgegensetzen würde. Doch er zögerte.
»Vielleicht hast du recht.«
Damit hatte ich nicht gerechnet. Er nahm sein Glas und prostete mir zu.
»Auf dich, Lea.«
»Du stimmst mir zu? Was ist los?«
»Brauche ich einen Grund?«
»Auf jeden Fall«, lachte ich. »Professor Simon braucht für alles eine Begründung«, zog ich ihn auf. Das war ein gängiger Spruch an der Uni gewesen, als ich vor etlichen Jahren seine Studentin war. Mein halber Jahrgang war damals in den gutaussehenden jungen Dozenten verliebt.
Er lächelte, nahm einen Schluck, stellte sein Glas ab.
»Lea, es gibt etwas, über das wir reden sollten. Etwas anderes.«
Sein Blick wurde weicher. Ich hielt mein Glas fest umklammert.
»Ach so?«
»Ich …«, begann er.
Er sah mich an, mein Herzschlag beschleunigte sich. Plötzlich hob er die Hand, beugte sich zu mir und streichelte sanft über die Narbe auf meiner Wange. Jede unserer Berührungen war bis jetzt rein freundschaftlich gewesen. Zumindest hatten wir beide immer so getan, was manchmal ein wenig absurd gewirkt hatte. Eine zärtliche Umarmung, die in einem Schulterklopfen endete. Ein Kuss auf die Wange, der fast die Lippen streifte. In diesem Moment wurden alle meine Vorsätze, die uns betrafen und die ich mir seit Jahren in der Theorie festgelegt hatte, unwichtig. Die Arbeit mit Jakob hatte mich verändert. Uns verändert.
Ich stellte das Glas ab, griff nach Carls Hand. Wir sahen uns an und wäre in dem Moment nicht das Aufsperren der Tür zu hören gewesen, hätte ich ihn geküsst.
Nach der Unterbrechung hatte ich mich rasch verabschiedet.
Eine dunkelhaarige Frau mittleren Alters in einem schicken Kostüm trat nun mit großer Geste zu Carl, führte ihn zu einer Gruppe von Anzugträgern, die etwas abseits standen. Carl schüttelte ein paar Hände. Er wirkte entspannt. Ganz anders als gestern Abend. Das Licht im Saal wurde gedimmt, das Podium erstrahlte im Scheinwerferlicht, und Carl betrat unter Applaus die Bühne. Auf der Videowand hinter ihm erschien Jakobs überlebensgroßes Gesicht.
»Guten Abend. Wie geht es Ihnen?«, sagte Carl in das Mikrophon.
Ein paar Stimmen aus dem Publikum riefen »gut«.
»Diesem jungen Mann, den Sie hier hinter mir sehen – sein Name ist Jakob –, geht es seit fünf Tagen auch wieder gut. Er ist der Anlass für diese Konferenz. Unsere Arbeit als Psychologen, die falsche Erinnerungen erforschen, hat durch das mediale Interesse an ihm Aufschwung bekommen. Was für mein Team und mich im besten Fall enorme Forschungsgelder und Zuschüsse bedeutet.«
Einige Lacher waren zu hören. Carl hatte das Publikum schon auf seine Seite gezogen.
Hinter mir ertönte das »Pling« einer ankommenden SMS.
»Wahrscheinlich wissen die meisten von Ihnen, dass Jakob wegen Mordes angeklagt war. Er soll einen Mann in der aufgelassenen Beelitz-Heilstätte getötet haben. Es gab dafür keine Beweise, nur Indizien«, fuhr Carl mit gesenkter Stimme fort. »Trotzdem war er für Justiz und Öffentlichkeit nicht nur der perfekte Täter. Es schien auch keinerlei Zweifel an seiner Schuld zu geben. Denn Jakob hatte gestanden. Und nicht nur das. Der Junge hatte Erinnerungen an den Mord. Er erinnerte sich an einen Mord, den er nie begangen hatte.«
Raunen ging durchs Publikum. Erneut ein »Pling«.
»Ja, Jakob ist unschuldig. Doch wie war das möglich? Wie konnte er sich an etwas erinnern, dass so nie passiert war? Und vor allem – wie sollten wir das beweisen?«
Ein »Pling« in den Reihen hinter mir. Dann noch eines. Und ein weiteres. Immer mehr. »Pling-pling-pling-pling …«
»Es scheint, jemand von Ihnen hat sein Handy …«, begann Carl. Die dunkelhaarige Frau, die ihn in Empfang genommen hatte, rannte über die Bühne. Sie war leichenblass. Sie fasste ihn am Arm, flüsterte ihm etwas ins Ohr und zog ihn aus dem Scheinwerferlicht.
Mein Handy vibrierte in der Tasche.
Eine Nachricht. Ohne Absender.
Es war ein Foto. Jakob. Und eine weitere Person im Hintergrund. Gefesselt und geknebelt. Mit aufgerissenen Augen starrte sie in die Kamera.
»O Gott, wer ist das?«, fragte jemand neben mir.
Wie aus der Ferne hörte ich meine erstickte Stimme.
»Carls Tochter Elli.«
Dann rannte ich los.
2. // Ein Jahr später
Als Kommissar David Friedrichs um halb sechs Uhr morgens anrief, dachte ich, er hätte sich verwählt. Ich stand mit der Kaffeetasse in der Küche und starrte teilnahmslos auf ein Video, das auf meinem Laptop lief. Eine junge hübsche Frau verrenkte sich in Yogaposen. Eine von Ellis Freundinnen hatte den Link auf Instagram geteilt. Es hatte etwas gleichzeitig Schmerzhaftes und Tröstendes, dass das Leben für sie weiterging – ohne Elli.
»David?«, meldete ich mich.
»Hallo, Lea. Tut mir leid, dass ich so früh anrufe.«
Seine Stimme klang anders als sonst. Oberflächlich wirkte sie ruhig, doch darunter schwang ein leichtes Beben.
»Kein Problem, ich bin wach. Aber …«
»Ich weiß, du arbeitest im Moment nicht. Ich brauche dich trotzdem. Kannst du herkommen? Jetzt gleich.«
»Was ist los?«
Er schluckte. »Das kann ich nicht am Telefon sagen, ich schicke dir einen Wagen. Es hat mit Berlin zu tun.«
Berlin. Ich wusste nicht, was er genau meinte. Schließlich hatte ich lange in Berlin gelebt und gearbeitet – bis zur Katastrophe letztes Jahr. Doch die Nennung der Stadt reichte, um mein Angstmonster zu triggern. Mein Herz fing an zu rasen, meine Muskeln verkrampften sich. Obwohl ich wusste, dass ich hier in meiner Küche in Sicherheit war, machte sich mein Körper bereit zur Flucht.
»In Ordnung, ich komme.«
Ich griff in die Medikamentenschublade, spülte die letzte Tablette im Blister mit Kaffee hinunter, schlüpfte in die erstbesten Jeans, T-Shirt und Sneaker, nahm die Lederjacke und wartete vor dem Haus auf den Streifenwagen. So, wie ich es bis vor einem Monat unzählige Male gemacht hatte. Mit dem Unterschied, dass ich mich damals noch geweigert hatte, ein angstlösendes Medikament einzunehmen. Jetzt konnte ich es kaum erwarten, bis es wirkte. Was allerdings sicher mindestens eine Stunde dauern würde.
Je näher der Streifenwagen dem Bundeskriminalamt kam, desto mehr jagte mein Puls in die Höhe. Vor der Landespolizeidirektion – einem riesigen Klotzbau aus den siebziger Jahren mit dem Charme einer Turnhalle – stieg ich aus. Meine Beine zitterten, und ich versuchte, ruhig zu atmen. Was mir nicht gelang. Eine typische Reaktion bei PTBS – der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich hatte genug Patienten mit der gleichen Diagnose behandelt. Seit einem Monat konnte ich deswegen nicht mehr als Leiterin der psychologischen Opfer-Betreuung arbeiten, dabei hatte ich den Job kaum ein Jahr. Offiziell wurde es »Bildungskarenz« genannt, mit offenem Zeitpunkt, wann ich zurückkehren würde. Man wollte mir keine Steine in den Weg legen. Wofür ich dankbar war, ich hatte die Arbeit gemocht. Sie war, mit dem Umzug von Berlin zurück in meine Heimatstadt Wien, mein Neubeginn.
Die neue Wohnung im achten Bezirk, umgeben von hippen kleinen Lokalen, Restaurants und Geschäften, war größer als die in Berlin. Das kulturelle Leben hier genauso vielfältig. Und es wimmelte von Touristen. Wien hatte sich verändert, es war eine Großstadt geworden. Vielleicht hatte ich deshalb das Gefühl, meine Rückkehr sei keine überhastete Flucht, sondern die richtige Entscheidung.
Doch nach ein paar Wochen hatte es wieder begonnen. Wie aus dem Nichts hatte mein Körper angefangen, verrückt zu spielen. Die Panikattacken kamen plötzlich und ohne bestimmten Auslöser. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dazu die Alpträume, aus denen ich von meinen eigenen Schreien nach Elli und Carl geweckt wurde. Anfangs hatte ich versucht, damit umzugehen. Auch wenn es mir nicht gefiel, waren es doch nachvollziehbare Reaktionen, es würde besser werden. Was nicht passierte. Im Gegenteil. Und da war noch etwas anderes. Dieses schleichende Gefühl, als würde ich mir fremd werden. Rational wusste ich, es handelte sich um die nächste Phase. Die Dissoziation – die Abspaltung der eigenen Emotionen. So lassen sich zu schmerzhafte Erfahrungen wirkungsvoll ausblenden. Eine Art Schutzmechanismus der Psyche. Wie ein Wächter lässt sie nur zu, was sie verkraften kann.
In Berlin hatte ich mit Patienten gearbeitet, die mit unerwarteten Todesfällen, Gewaltverbrechen, Missbrauch, Vergewaltigungen oder Unfällen nicht fertig wurden. Häufig waren es auch Kündigungen oder Trennungen. Wie wichtig und bedeutend mir die Einordnungen der PTBS-Phasen vorgekommen waren.
Lea Goldberg erkennt das und das. Oh, wie klug und brillant.
Seit diese Diagnosen mich selbst betrafen, waren sie zu dem geworden, was sie eigentlich sind – seelenlose Worte zur Etikettierung, warum man nicht mehr funktionierte. Denn so fühlte ich mich.
Vom Verstand her war mir klar, dass die alten Wunden aus meiner Kindheit durch das schreckliche Unglück in Berlin aufgerissen worden waren. Doch ich war nicht darauf gefasst gewesen, auf welcher emotionalen Achterbahn ich mich im gefühlten Blindflug bewegte.
Um ruhiger zu werden, hielt ich das Gesicht in das orangefarbene Licht der Morgensonne, die sich in den Fenstern spiegelte. Ich konzentrierte mich auf den bittersüßen Nachgeschmack des Kaffees. Spürte die Wärme auf der Haut und die leichte Brise. Hörte auf die Motorengeräusche der vorbeifahrenden Autos. Es würde ein schöner Junitag werden. Egal, was mich gleich bei Friedrichs erwartete.
Ich nahm einen tiefen Atemzug und betrat das Gebäude. Die beiden Polizeibeamten am Eingang winkten mich durch die Drehtür, ohne meinen Ausweis zu verlangen. Sie tuschelten. Wahrscheinlich erkannten sie mich. Was weniger mit mir zu tun hatte, als mit der großen Narbe in X-Form, die sich über meine komplette linke Gesichtshälfte zog. Die Erinnerung an einen Autounfall, den ich als Zwölfjährige hatte.
»Zweiter Stock, Frau Goldberg. Sie werden erwartet.« Ich nickte ihnen zu, sie senkten sofort die Blicke. Ich bin daran gewöhnt. Wie ein Stempel markiert mich diese Narbe. Ich registriere sie nur an den schlechten Tagen, wenn ich in den Spiegel sehe.
David Friedrichs stand vor einem der Gangfenster. In einem dunkelblauen Slimfit-Anzug, die dunklen Haare wie immer perfekt gegelt.
Wie üblich wurde er von seinem leicht nervösen Assistenten Hoffmann postiert. Im Gegensatz zu dem hochgewachsenen schlanken Friedrichs hatte er eine Glatze und einen Schmerbauch. Ich habe selten einen ohne den anderen angetroffen. Zumindest innerhalb dieses Gebäudes.
Hoffmann und ich lächelten einander aus der Entfernung zu, während Friedrichs mir grußlos entgegeneilte. Er deutete auf die Unterlagen, die er unter den Arm geklemmt hatte und dann auf eine offenstehende Tür am Ende des Gangs.
»Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Bitte da rein.«
Er sprach so sanft und ruhig, als würde er in einer schummrigen Bar einen Cocktail bestellen.
Vor meiner Auszeit hatte ich bei einigen Fällen mit ihm zusammengearbeitet und war mit seiner Vorgehensweise vertraut geworden. Je schwieriger sich ein Fall darstellte, desto ruhiger wurde Friedrichs. Als könnte er den Schrecken dadurch kontrollieren.
»Hoffmann, bringst du bitte Kaffee in die zwei«, rief er seinem Assistenten zu.
Wir betraten das kleine Verhörzimmer, das intern nur »Beichtstuhl« genannt wurde, weil darin gerade mal zwei Stühle Platz hatten.
»Ich bin seit 3 Uhr hier und habe in fünfzehn Minuten eine Pressekonferenz«, sagte er und gähnte. »Es war eine verrückte Nacht. Guten Morgen, übrigens.« Er lächelte, aber es erreichte seine Augen nicht. Er schloss die Tür.
Es war heiß und stickig in dem fensterlosen Raum. Trotzdem zitterte ich, mir war kalt, und ich nahm rasch Platz.
»Es wird nicht lange dauern«, sagte er beschwichtigend.
Ich schlug die Beine übereinander, verschränkte meine Finger so, dass ich unauffällig den Daumennagel in das weiche Fleisch der anderen Hand bohren konnte.
»Kein Problem, ich habe Zeit.«
Er blieb stehen, musterte mich, als würde er mir meine Schlaflosigkeit ansehen.
»Du wirst gleich verstehen, warum ich dich hergebeten habe, Lea.« Es klang nach einer Entschuldigung.
Unter vier Augen waren wir per du. Seit Friedrichs mich zwei Mal in eine italienische Weinbar, in der Nähe des Kommissariats, eingeladen hatte.
Die erste Einladung, das wurde mir nach dem ersten Glas Wein klar, hatte er nur ausgesprochen, um mir »auf den Zahn zu fühlen«, ob ich für den Job nach der Sache in Berlin bereits belastbar genug war. Als ich ihn darauf ansprach, gab er es offen zu. Da wusste ich, dass wir gut zusammenarbeiten würden. Es wurde ein angenehmer Abend. Wir unterhielten uns über alte Filme, Lieblingsbücher und die besten Restaurants in der Innenstadt. Er erzählte mir von seinen drei Kindern und ich ihm von meiner Arbeit in Berlin, die ich zurückgelassen hatte, um dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Das dachte ich damals zumindest.
Beim Abschied sagte er, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue, und ich glaubte ihm.
Der Grund seiner zweiten Einladung hatte mich überrascht. Es war vor einem Monat, nachdem unsere Fälle bereits abgeschlossen waren. Ich nahm an, er wollte nett sein oder mich zur Rückkehr in den Job überreden. Erst während des Gesprächs wurde mir klar, er kannte nur den offiziellen Grund, warum ich aufgehört hatte.
Friedrichs Bitte um dieses Treffen war rein persönlich. Er befand sich in einer Ehekrise, und seine Frau drängte ihn zu einer Paartherapie, für die ihm aber die Zeit fehlte. Und nun drohte sie mit Scheidung. Deswegen bat er mich um Rat. Als ich fragte, warum ausgerechnet mich, er habe doch immer wieder mit Psychologen zu tun, antwortete er, weil er mir vertraue. Er habe das Gefühl, dass ich ihn nicht wegen seiner Macken verurteile.
Ich weiß nicht, was an diesem Abend sonst noch anders war – aber er fing an zu reden, zuerst waren es nur Rechtfertigungen. »Verbrechen halten sich nun mal nicht an Bürozeiten oder Wochenenden«, verteidigte er sich. Ein paar Fragen reichten, um herauszufinden, dass er bereits jahrelang zu viel arbeitete und immer versprach, sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen. Was er nie einlöste.
Und ja, eigentlich müsse er es besser wissen, schon seine erste Ehe, aus der er einen Sohn habe, sei deshalb gescheitert.
Jedes Beziehungsproblem führt letztendlich auch auf uns selbst zurück. Als ich ihm das sagte, reagierte er erstaunt. Ob ihm der Job einen Vorwand zur Flucht vor seiner Familie und der Nähe zu ihr lieferte? Wieso ihn die Reaktion seiner Frau überraschte, wenn es schon in der ersten Ehe die gleichen Probleme gegeben hatte? Wie es ihm ging, wenn er sich schwach und verletzlich fühlte? Ob er das Gefühl hatte, sich seiner Frau von dieser Seite zeigen zu können? Und dann stellte ich die Lieblingsfrage aller Therapeuten – ob ihn diese Situationen an etwas aus seiner Kindheit erinnerte?
Der souveräne Friedrichs, der Schwerverbrecher und Mörder zur Strecke brachte, stammelte herum, bekam glasige Augen und stürzte den Wein hinunter. Dann verschwand er auf die Toilette.
Als er zurückkam, erwähnte er das Thema mit keinem weiteren Wort. Ich beließ es dabei. Manche Dinge brauchen Zeit.
Er knüpfte an das Gespräch unseres ersten Treffens an. Wollte mehr über die Erinnerungsforschungen wissen, an denen ich mit Carl in Berlin gearbeitet hatte. Nach seinem dritten Glas Wein waren wir plötzlich beim Du.
Beim Abschied war ich erstaunlich nüchtern und er ein wenig beschwipst. Er bedankte sich, machte einen Witz. Verdrängung ist ein probates Mittel, wenn man sich dem Kern eines Problems nähert. Aber Augen lügen selten. Ganz besonders nicht nach drei Gläsern Chianti. Ich weiß, wie schwer es fällt, über Gefühle zu sprechen, die die Fassade zum Einsturz bringen könnten.
»Manchmal ist das, was unter der Oberfläche liegt, zu schmerzvoll, um es auszusprechen«, sagte ich. »Dann findet man entweder einen Weg, wie es doch gelingt. Oder man findet eine Ausrede.«
Komisch, warum mir das gerade jetzt einfiel. Vielleicht, weil es in Wahrheit genauso auf mich zutraf.
Friedrichs nahm nun mir gegenüber Platz und reichte mir die Mappe. Dabei sah er mir in die Augen, wie man jemanden ansieht, dem man gleich schlechte Nachrichten übermittelt.
3. // Damals
Die Leiche des Jungen hängt von der Zimmerdecke.
Das Mädchen steht im Türrahmen, rührt sich nicht, starrt ihn an. Ihre Hand liegt auf der Klinke, als wäre sie festgefroren.
Normalerweise darf sie nicht ohne sein »Herein« die Tür öffnen. Aber heute Morgen hat er zu ihr gesagt: »Ich muss zu Hause bleiben, ich bin krank.« Darum hat sie die Tür geöffnet, als er nicht auf ihr Klopfen reagierte.
Ichbinkrankichbinkrankichbinkrank.
Seine Worte wandern durch ihren Kopf, als wären sie ein Echo.
Einen kurzen Moment ist sie überzeugt, sie hat sich im Haus geirrt. Den Schlüssel in ein falsches Türschloss gesteckt. Sie muss einen falschen Flur entlanggelaufen sein, der zufällig aussieht wie der, den sie ihr Leben lang kennt. Da hängt ein fremder Junge. Das kann nicht ihr Bruder sein.
Der Wind pfeift vor dem Fenster. Staubkörnchen tanzen im Licht.
Sie tritt einen Schritt näher, ohne die Klinke loszulassen. Es stinkt nach einer Mischung aus Sportsocken, vergammelten Chips und Klebstoff. Ihr Blick geht hoch, zu dem Haken in der Zimmerdecke, um den ein rot-weiß gestreiftes Springseil mit hellen Holzgriffen gewickelt ist. Straff gespannt führt es zu seinem Hals, wo es im Rollkragen des dunkelgrauen Pullovers verschwindet. Einige Zentimeter unter seinen Füßen liegt der umgekippte Holzstuhl. Der gehört nicht hierher. Er steht sonst in der Küche. Das kann nicht sein. Sie hat sich doch im Haus geirrt. Alles fängt an, sich zu drehen. Sie senkt den Kopf. Ihr hellblauer Anorak glitzert voller Wasserperlen von geschmolzenen Schneeflocken. Unter ihren Stiefeln hat sich eine Pfütze gebildet. Das ist kein Schnee. Sie hat sich vollgepinkelt.
Auf dem Heimweg hat sie sich so beeilt. Wegen der weißen Wunderlandschaft, in die sich die Stadt in den letzten Stunden verwandelt hat. Der erste Schnee.
Gestern Abend, als die Eltern bei einer Party und sie allein waren und bei Tiefkühlpizzen – sie Thunfisch, er Salami – seit Ewigkeiten wieder einmal gemeinsam ferngesehen haben, hat ihr Bruder noch gesagt, sie würden diesen Winter rodeln gehen. Wie früher. Wäre der kleine Hügel in der Nähe erst beschneit. Und sie war glücklich. Obwohl seine Freundlichkeit nichts mehr war, auf das sie sich verlassen konnte. In einem Moment war er nett. Im nächsten ignorierte er sie. Scheiß Pubertät.
Sie schließt die Augen. Presst Lider und Lippen ganz fest zusammen, bis es wehtut.
Wenn sie jetzt die Augen öffnet, wird dieses Bild verschwunden sein. Wie ein Alptraum, aus dem man nur erwachen muss.
Sie blinzelt. Ganz verschwommen hängt er noch immer da. Ihr Herz hämmert gegen die Rippen. In ihrem Kopf passiert irgendwas. Als würde er nicht mehr funktionieren. Da ist nur schwarze Leere. Stirbt sie jetzt? Sie reißt die Augen auf, keucht, will nach Hilfe schreien.
Was ist das?
Sein Mundwinkel zuckt. Da, wieder. Und wieder. Er blinzelt.
»Verdammt. Ich dachte, es wäre Mama. Ich wollte sie erschrecken. Nicht dich.«
Er spricht.
Er lebt.
Sie kann wieder atmen. Ihre Knie fühlen sich an, als wären sie aus Gummi. Sie lässt die Türklinke los und fällt hin. Wie eine Marionette ohne Fäden.
Der Schulrucksack rutscht ihr herunter, geht auf, Stifte und Hefte liegen verstreut. Mit einem Schwall erbricht sie den Apfel, den sie in der großen Pause gegessen hat.
»Jetzt kotzt du mir auch noch ins Zimmer. Igitt. Wieso bist du überhaupt schon da?«
Sie schluchzt, bringt kein Wort heraus.
»Hey, beruhig dich. Es ist doch nur ein Scherz. Wie der Typ in diesem Film, Harold und Maude. Ich habe mir auch so eine Vorrichtung gebaut. Sieht ganz schön echt aus, nicht wahr?«
Sie hebt den Blick, aber er schaut sie nicht an. Ihm wird immer schlecht, wenn sich jemand übergibt. Er hält es nicht mal aus, wenn er es im Fernsehen sieht.
»Komm, jetzt hör auf zu heulen. Hey, wollen wir nachher rodeln gehen?«
Sie zwingt sich, zu nicken.
»Gut. Aber nur, wenn du nicht mehr weinst. Und wisch die Kotze weg. Ich will Mama erschrecken, wenn sie heimkommt. Das ist einfach zu cool. Jetzt sag doch, bin ich genial oder bin ich genial?«
Sein Lachen erfüllt das Zimmer. Es wird lauter, er lacht und lacht. So wie damals, als er eine Packung Brausepulver in eine Colaflasche gesteckt und der braune Schaum wie ein Vulkan die Tapete im Wohnzimmer versaut hat. Damals hat sie mitgelacht. Bis ihr Vater nach Hause kam und brüllte.
Jetzt will sie auch brüllen. Ihren Bruder fragen, ob er noch ganz dicht ist?
Ihm sagen, er soll sofort da runterkommen. Dass er niemanden erschrecken darf. Es nicht lustig ist, sondern einfach nur völlig idiotisch.
Je lauter er lacht, desto wütender wird sie auf ihn. Dieses Arschloch, dafür wird sie ihm nachher eine reinhauen. Und es ist ihr egal, dass er viel größer und stärker ist, sie wird zuschlagen. Fest.
Sie zieht sich die Mütze vom Kopf. Ihre Hände zittern. Obwohl sie schwitzt, ist ihr eiskalt. Sie keucht.
»Jetzt mach nicht so ein Drama. Ich habe doch gesagt, es ist ein Witz.«
Sie versucht, ihm zu antworten, aber es kommt nur ein unverständliches Brabbeln heraus. Ihre eigene Stimme klingt fremd. Und alt. Viel älter als die einer Zwölfjährigen. Plötzlich ist sie müde. Nur ein bisschen die Augen zumachen. Sie sinkt auf die Knie und lässt sich zur Seite fallen.
Du bist so ein Arschloch. Scheiß auf dieses blöde Rodeln.
Das will sie sagen. Er hat es verdient. Doch sie kann nicht. Die Worte bleiben formlos im Hals stecken. Als hätte sie vergessen, wie man spricht. Endlich sieht er sie an. Er lächelt. Und ihre Wut verpufft.
»Es tut mir echt leid. Sorry. Ich habe dich lieb.«
Das hat er noch nie, nie, nie gesagt. Er dreht den Kopf wieder weg. Lässt ihn hängen. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie muss aufstehen. Ihn zwingen, endlich runterzukommen. Ihre Mutter anrufen. Aber sie kann nicht, ihr Körper fühlt sich noch immer an wie einzementiert. Bevor sie schreien kann, wird sie von der Dunkelheit verschluckt.
4.
»Das hier muss unter uns bleiben.«
Ich wartete, ob Friedrichs es weiter ausführen würde, doch er sagte nichts. Also nickte ich.
»Eine Vermisste, Katja Meissner, ist gestern Abend aufgetaucht.«
»Vermisst seit wann?«
»Seit drei Wochen. Sie wurde zuletzt im Kongressbad im sechzehnten Bezirk gesehen. Meissner ist Krankenschwester. Nach ihrer Schicht geht sie jeden Dienstag und Donnerstag schwimmen, entweder dorthin oder bei Schlechtwetter ins Stadthallenbad. Nachdem sie in der Umkleide war, verlor sich ihre Spur.«
Panik ergriff mich. Der verdammte Angstlöser wirkte noch nicht.
»Was hat das mit Berlin zu tun?«
»Erst mal nichts.« Er wich mir aus. »Ihr Handtuch und ein paar persönliche Gegenstände haben wir auf der Wiese gefunden, ihre Kleidung und ihre Tasche mit dem Handy waren im Spind. Sie ist zwischen achtzehn und neunzehn Uhr verschwunden. Das Bad war zu dieser Zeit gut besucht, aber keiner hat etwas gehört oder gesehen, was ungewöhnlich gewesen wäre. Wir konnten keine Anzeichen für Fremdverschulden entdecken. Sie war gelegentlich depressiv, laut ihrem Partner besonders in letzter Zeit.«
»Eine echte Depression oder nur eine depressive Verstimmung?«
Friedrichs zuckte mit den Achseln.
»Sie hat sich häufiger über den Job beschwert, war reizbar, hat sich wohl immer wieder mal zurückgezogen und wollte nicht darüber reden.«
»Wie alt ist sie?«
»Anfang dreißig.«
»War sie irgendwo in Behandlung?«
»Nicht, dass wir wüssten.«
»Und als sie verschwunden ist …«
»Wurde der Sache natürlich nachgegangen. Aber es hat in die Richtung gedeutet, als wäre ihr alles zu viel geworden und sie einfach abgehauen wäre. Am Nachmittag jenes Tags hatte sie zudem Streit mit einer Kollegin …«
»Wer hat sie vermisst gemeldet?«
»Ihr Freund. Fitnesstrainer. Sie sind erst seit einem halbem Jahr ein Paar, leben in getrennten Wohnungen. Gestern Abend, kurz nach zwanzig Uhr, ist Katja Meissner wieder aufgetaucht. Genau da, wo sie zum letzten Mal gesehen wurde. Im Kongressbad. Sie wurde beim Kontrollgang vor der Schließung entdeckt. Sie muss das Bad betreten haben, als die anderen Badegäste bereits weg waren.«
»Hat sie gesagt, was passiert ist?«
Er nickte. »Ja, aber da gibt es einige Ungereimtheiten. Sie sagt, sie könne sich nicht erinnern, wie sie dorthin gekommen sei, und sie sei in einem abgedunkelten Raum eingesperrt gewesen. Und in ihrer Erinnerung sind keine drei Wochen vergangen. Sie ist überzeugt, nur zwei Nächte fort gewesen zu sein. Vielleicht wurden ihr irgendwelche Substanzen verabreicht, aber der Bluttest war negativ.«
»Es könnte eine partielle Amnesie sein, ausgelöst durch ein Trauma«, murmelte ich. »Ist sie verletzt? Irgendwelche Anzeichen für Misshandlung?«
»Nichts. Auch keinerlei Hautabschürfungen, die sie hätte, wenn sie gefesselt gewesen wäre. Aber – und das ist das eigentlich Erstaunliche – sie ist überzeugt, vergewaltigt worden zu sein. Weder die allgemeinmedizinische noch die gynäkologische Untersuchung haben etwas ergeben. Keine Verletzungen, keine Spuren, kein Sperma, nichts. Auf ihrer Kleidung wurden unterschiedliche DNA-Spuren gefunden, laut erster Einschätzung aus der Forensik leider unbrauchbar. Die Sachen sind neu, wurden nach der Menge der Spuren oft anprobiert, wahrscheinlich stammen sie direkt aus der Filiale einer Modekette. Dem gehen wir noch nach.«
Ich blätterte weiter, da war ein verschwommenes Foto einer dunkelhaarigen Frau, die ein Gebäude betrat.
»Das ist die letzte Aufnahme vor ihrem Verschwinden. Im Eingang des Schwimmbads«, sagte Friedrichs.
Es gab zwei weitere Porträtfotos, eines aus dem Krankenhaus in weißer Schwestern-Uniform, das andere ein lachendes Selfie mit einem See im Hintergrund, in dem sich die Sonne spiegelte. Sie war hübsch, hatte lange braune Haare. Mandelförmige Augen. So volle Lippen, als wären sie gemalt. Dunkler Teint. Ich hatte ein vertrautes Gefühl. Als würde ich sie kennen.
Es klopfte an der Tür. Hoffmann balancierte ein Tablett mit zwei vollen Kaffeetassen, Milchkännchen und Zucker. Friedrichs stand auf, reichte mir eine Tasse und goss einen Schluck Milch hinein. Er hatte sich gemerkt, wie ich meinen Kaffee trank.
»Wo arbeitet sie?«, fragte ich, als wir wieder allein waren, und wärmte meine Hände an der Tasse.
»Allgemeines Krankenhaus, Orthopädie.«
»Und ihr Freund?«
»Wasserdichtes Alibi. Er hat den ganzen Nachmittag und Abend in einem Fitnesscenter Trainerstunden gegeben. Wir haben ihn auch sonst überprüft. Keine Auffälligkeiten.«
»Wie oft wurde Meissner seit ihrem Auftauchen befragt?«
Friedrichs rollte mit den Augen.
»Sicher fünf, sechs Mal. Anfangs war gar nicht klar, wer sie ist. Dann habe ich in der Nacht jemanden vom psychologischen Notdienst herbestellt, aber da wusste ich noch nicht …« Er sah mich an, nahm einen Schluck aus seiner Tasse. Es war offensichtlich, dass er etwas zurückhielt.
»Was denn?«
»Meissner erinnert sich nur in Bruchstücken. Sie weiß nicht, wie sie vom Kongressbad weg- und wieder hingekommen ist. Aber manches scheint langsam zurückzukehren«, fuhr er mit ruhiger Stimme fort. »Vor einer Stunde hat sie plötzlich von einer jungen Frau erzählt. Im Nebenraum. Die sie nicht sehen konnte. Nur hören. Durch einen Lüftungsschacht oder Kamin haben sie sich unterhalten.« Er sah mir tief in die Augen. »Das ist der Grund, warum ich davon ausgehe, dass es sich um eine Entführung handelt.«
»Wieso? Was hat sie gehört?«
Er räusperte sich, sah mich einen Moment zu lange an.
»Sie sagt, sie habe Elli Simon gehört … Elli, die Tochter von Carl Simon.«
Eine Stimme in meinem Innern flüsterte, dass es nicht wahr sei. Niemand konnte das Mädchen gehört haben.
Elli Simon war tot. Ich hatte sie sterben sehen.
5.
»Diese junge Frau in dem Nebenraum habe gesagt, ihr Name sei Elli Simon«, sprach Friedrichs weiter. »Ihr Vater sei Carl Simon, ein berühmter Psychiater. Doch er glaube, sie sei tot. Darum suche er nicht nach ihr. Und …« Seine Stimme klang weit entfernt, »dass sie bereits seit einem Jahr dort eingesperrt sei.«
Ich sah auf das Foto. Das diffuse Gefühl von Vertrautheit, das es in mir ausgelöst hatte. Jetzt verstand ich, warum. Diese Frau erinnerte mich an Elli. Mir rutschte die Tasse aus der Hand. Das Porzellan klirrte auf den Fliesen. Kaffeespritzer flogen durch die Luft.
»Scheiße«, fluchte Friedrichs. Er nahm ein Taschentuch, reichte es mir und deutete auf mein T-Shirt, wo sich ein großer dunkler Fleck auf dem weißen Stoff ausbreitete.
»Ich bin nicht im Detail vertraut, was sich in Berlin zugetragen hat. Die Unterlagen dazu sind zu umfassend und, wie gesagt, ich habe das mit Elli Simon erst vor einer Stunde erfahren«, fuhr er fort.
Das Thema war während unseres ersten Barbesuchs aufgekommen, aber in dem Fall war ich es gewesen, die abgelenkt hatte.
»Es gibt gleich eine Pressekonferenz. Wir werden Meissners Verschwinden als mögliche Entführung neu aufrollen, vielleicht lassen sich so Zeugen finden. Darum muss ich wissen, besteht auch nur eine winzige Chance, dass es sich bei dieser jungen Frau, von der sie gesprochen hat, wirklich um Simons Tochter handeln kann?«
»Nein.«
Ich hatte es zu laut gesagt, als hätte ich keine Kontrolle über meine Stimme. Ich gab ihm sein Taschentuch zurück, der Fleck war unverändert. Er berührte meine Hand.
»Ich weiß nur ein paar Details … von dem, was bei der Eröffnungsrede des Memoria-Projekts vor einem Jahr passiert ist«, sagte er sanft, ohne mich aus den Augen zu lassen.
Memoria. Sofort war dieses Bild wieder da. Wie Carl unter tosendem Applaus auf das Podium getreten war. Mit leicht wippenden Schritten, als liefe im Hintergrund Swingmusik, die nur er hören konnte. Ich saß in der ersten Reihe, lächelte ihn an, mit einer Mischung aus Stolz und Erleichterung. Auf der Leinwand hinter ihm Jakobs Foto.
Selten war mir die Arbeit mit einem Patienten so nahe gegangen wie bei diesem fünfzehnjährigen Jungen. Jakob Becker überraschte mich immer wieder. Er war klug, nachdenklich, und sein Humor war erstaunlich, wenn man bedachte, was er erlebt hatte.
Dieser Junge war durch die Hölle gegangen. Und das nicht erst, seit er wegen Mordes fälschlicherweise angeklagt worden war.
Als Carl mich um Hilfe bat und mir seine Akte gab, dachte ich, dieser Junge sei das Paradebeispiel eines übersehenen misshandelten Kindes. Das alle Institutionen, angefangen von der Schule über Ärzte bei notwendigen Untersuchungen, allein gelassen hatten. Wenn einer schweigt, tut es der Nächste auch.
Es verschlug mir den Atem, als ich zum ersten Mal Jakobs nackten Rücken sah. Carl hatte ihm ein Shirt seines Lieblingsfußballspielers Messi zur Sitzung gebracht. Normalerweise machte Carl seinen Patienten keine Geschenke, aber auch er konnte sich seiner Zuneigung zu dem Jungen nicht entziehen. Jakob wollte das Shirt sofort anziehen, drehte sich weg und schlüpfte aus dem grauen Hemd. Sein Rücken war voller vernarbter Striemen. In allen Größen und Schattierungen, von Dunkelrosa bis Hellbraun. Kaum ein Stückchen intakte Haut. Wir wussten aus den Polizeiberichten, dass sein Vater – ein Mann, der sich in der Nachbarschaft engagierte und im persönlichen Umkreis geachtet war – ihn jahrelang in dem kleinen, schalldicht gemachten Schlafzimmer misshandelt hatte. Aber es war ein Unterschied, davon in einem Bericht zu lesen oder die Relikte auf seiner Haut zu sehen. Tausende Narben, so unwirklich, als würde man ein abstraktes Gemälde betrachten. Unter dem Vorwand, ich müsse zur Toilette, hatte ich das Zimmer verlassen. Mir waren die Tränen gekommen. Dieser Junge war nicht nur das Opfer seines gewalttätigen Vaters. Er war das Opfer eines fehlgeschlagenen Systems. Dachte ich damals.
»Lea, alles okay?«, fragte Friedrichs erneut.
Mir war schlecht – ich hatte nichts gegessen, dazu der Angstlöser, der zweite Kaffee. Wieder sah ich auf Meissners Foto. War es Einbildung, dass ich Elli in ihr wiedererkannte? Eine leicht erklärbare Wahrnehmungsverzerrung? Passten nicht viele, unzählige Milliarden von Frauen in diese Typ-Kategorie? Hätte Friedrichs Ellis Namen nicht erwähnt, hätte ich dann einen Zusammenhang hergestellt? Ich atmete durch, die Klammer um meine Brust löste sich, ich wurde ruhig. Als wäre in mir ein Schalter umgelegt, aber ich wusste, es war nur die Wirkung der Tablette.
»Mit wem auch immer sie gesprochen hat, es war nicht Elli«, sagte ich.
Friedrichs beugte sich vor. »Warum sagt sie es dann? Ich habe die Berichte aus Berlin schon angefordert, aber das dauert. Darum wollte ich dich fragen … dieser Junge, Jakob Becker … er lebt nicht mehr?«
Ich nickte. »Ja, er ist tot, sie sind beide tot. Jakob hat sich und Elli umgebracht.«
»Ich habe aber bis jetzt nichts darüber gefunden, dass ihre Leiche identifiziert wurde.«
»Es gab keine Leiche. Nur DNA, die nach der Explosion sichergestellt wurde. Ich war vor dem Haus, als es passiert ist. Ich habe Elli gehört …«
»Du warst dort?« Er sah mich erschrocken an, ein Riss in seiner glatten Fassade. »Das wusste ich nicht.«
Ich wendete den Blick ab. Wieder die Bilder in meinem Kopf. Das Foto aus dem Heizungskeller. Elli an einen der Gartenstühle gefesselt, Augen und Mund weit aufgerissen, das Gesicht tränennass. Darunter ein Satz von Jakob:
Es ist deine Schuld.
Friedrichs setzte an, etwas zu sagen, da klopfte es, und Hoffmann steckte den Kopf zur Tür herein.
»Drei Minuten bis zur Pressekonferenz, Chef.«
»Bin gleich da.«
Friedrichs stand auf, nahm die Akte wieder an sich.
»Danke, dass du gekommen bist. Wenn es noch etwas gibt, melde ich mich bei dir.«
Er nickte mir zu und drehte sich um. Plötzlich fühlte ich mich so klar wie schon lange nicht mehr. Es musste einen plausiblen Grund geben, warum diese Frau Elli erwähnt hatte. Ich stand so schnell auf, dass ich schwankte.
»Ich muss mit ihr sprechen, David.«
»Mit wem?«, fragte er entgeistert.
»Meissner. Lass mich mit ihr sprechen.«
»Lea, das geht nicht.«
Ich verstellte ihm die Tür. »Bitte. Lass mich mit ihr sprechen. Nur kurz.«
Er seufzte, sah mich mitfühlend an.
»Ich verstehe, wie wichtig dir das ist«, sagte er leise. »Und wären die Dinge anders, würde ich dich sofort hinzuziehen. Aber du bist nicht im Dienst und …« Ich wartete, ob er »psychisch nicht belastbar« sagen würde. Sein Blick wurde weich. »Ich würde es gern, aber ich kann das nicht verantworten. Tut mir leid.«
Dieses drängende Gefühl wurde noch stärker. Ich musste klären, wieso diese Frau Elli erwähnt hatte, und ich wusste, dass ich es konnte.
»Ihr braucht mehr Informationen. Das heißt, Meissner soll sich entweder erinnern, oder das alles stellt sich als psychotische Episode heraus, richtig?«
Sein Nicken war zögerlich.
»Genau das ist eines meiner Fachgebiete, das weißt du. Lass mich mit ihr reden«, sagte ich ruhig und eindringlich. Er wollte widersprechen, doch ich ließ ihn nicht zu Wort kommen. »David, mir ist klar, es ist ein Risiko. Aber wenn es funktioniert – und sollte sie etwas wissen, wird es das –, dann bist du einen großen Schritt weiter. Es ist eine Ausnahme, nennen wir es beratende Tätigkeit, was weiß ich …«
Es klopfte erneut. »Eine Minute, Chef. Sie müssen jetzt …«, sagte Hoffmann.
Ich fixierte Friedrichs, formte stumm: »Vertrau mir.«
Er schürzte die Lippen.
Und schließlich nickte er: »Du hast fünfzehn Minuten mit ihr.«
6. //Damals
Im Schlaf ruft sie nach ihrem Bruder. Es ist immer wieder der gleiche Traum in unterschiedlichen Szenarien – sie muss ihn warnen. Vor der Lawine, dem Feuer, dem bösen Mann. Sie ruft nach ihm, doch er hört sie nicht. Niemals. Als wären sie durch eine undurchdringliche Glasscheibe getrennt. Sie muss Hilfe holen. Aber sie kommt nicht vom Fleck. Ihre Füße stecken fest, in Schlamm, Sand, Beton. Sie kann sich nicht bewegen. Steht da und muss dabei zuschauen, wie das Unvermeidbare geschieht.
Wenn sie aufwacht, rast ihr Herz, und das Nachthemd klebt schweißnass am Körper. Dann liegt sie still und rührt sich nicht. Lauscht, ob sie Schritte von ihrer Mutter hört, die kommt, um nach ihr zu sehen. Und ist erleichtert, wenn die Schritte ausbleiben. Nach solchen Nächten ist sie so müde, dass sie während des Unterrichts einschläft.
In den ersten paar Wochen nach seinem Tod wird ihr viel Verständnis entgegengebracht. Tröstendes Schulterklopfen von Lehrerinnen, mitfühlende Blicke, geteilte Pausenbrote. Doch dann – plötzlich nichts mehr. Als gäbe es ein Ablaufdatum für den Schmerz und die Trauer, das man einzuhalten hätte. Ihre Mutter wird kontaktiert, ihr wird nahegelegt, dass eine Therapie hilfreich wäre. Was nicht infrage kommt, das weiß sie. Probleme bleiben in der Familie, dort gehören sie hin.
Eine Psychologin kommt ihretwegen in die Schule. Die sie mit zuckersüßer Stimme fragt, ob sie sich über den Tod des Bruders unterhalten möchten. Natürlich will sie nicht. Denn dann müsste sie die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist ihr Geheimnis.
Mit ihrem Vater hat sie kaum noch Kontakt, er ist ausgezogen. Die Eltern werden sich scheiden lassen. Auch dafür ist sie verantwortlich.
Eines Nachts liegt sie wieder wach im Bett und starrt in die Dunkelheit. Es ist nun ein Jahr vergangen. Sie kann nicht so weitermachen. Sie will das alles nicht mehr. Diese Blicke in der Schule, die nicht mehr mitleidig sind, sondern sie ansehen, als wäre sie durchgedreht. Sie hat keine Freunde mehr. Niemand lädt sie auf eine Party ein oder verabredet sich mit ihr nach dem Unterricht. Die Pausen verbringt sie allein.
Sie muss etwas ändern. Nein, nicht etwas. Sie muss sich ändern. Wieder zu ihrer früheren Version werden. Und selbst wenn sie es vorspielt, ist das egal. Sie weiß, wie das geht. Das hat sie früher schon oft getan.
Es ist erstaunlich, wie leicht ihr das fällt.
Sie funktioniert in der Schule, sie funktioniert zu Hause, sie unterdrückt alles, was sie traurig oder wütend oder hilflos macht, und schlüpft in die Rolle.
Für die anderen ist sie wieder die, die sie vorher war.
Für sie selbst ist sie das nicht.
Aber das macht nichts.
Sie hat einen Weg gefunden, erwachsen zu werden.
7.
Unsere Erinnerungen stellen wir im Normalfall nie infrage. Die emotionalen Kerben des Erlebten tragen wir in uns. Sie formen uns, unsere Persönlichkeit. Selbst dann beeinflussen sie noch unser Handeln, wenn wir sie längst vergessen haben. Egal, ob es gute oder schlechte sind – Erinnerungen prägen. Und dabei ist es völlig unwichtig, ob sich alles genau so ereignet hat, wie wir das glauben. Denn der Kern ist wahr.
Doch es gibt auch andere Erinnerungen. Solche, die nie passiert sind. Scheinerinnerungen, falsche Erinnerungen, und sie entstehen aus vielen Gründen. Manchmal auch einfach deswegen, weil das traumatisierte Gehirn Unsicherheiten nicht aushält. Instinktiv knüpft es aus losen Zusammenhängen ein passendes, reales Geschehen.
Kein Mensch ist dagegen immun. Und kein Mensch kann bei sich selbst eine falsche von einer echten Erinnerung unterscheiden. Es ist ein Trick des Gehirns, der selbst Lügendetektoren falsch ausschlagen und die Wissenschaft recht ratlos forschen lässt.
Jakob hatte so eine falsche Erinnerung – an einen Mord, den man ihm angelastet und den er nie begangen hatte. Bevor er dann wirklich zu Ellis Mörder wurde.
Dank der Tablette war ich vollkommen ruhig, als ich die Tür zu dem Raum öffnete, in den man die angeblich entführte Katja Meissner gebracht hatte. Das ist das Hinterhältige an diesen Angstlösern – sie vermitteln das Gefühl, als hätte man diese Angst nie empfunden. Nicht nur deshalb machen sie hochgradig abhängig. Denn kaum lässt die Wirkung nach, wird es schlimmer als vorher. Ich hatte selbst genug beruflich erfolgreiche und angesehene Patienten in Therapie, die für einen Entzug in die Klinik mussten. Weswegen ich mich so lange dagegen gesträubt hatte, Benzodiazepine einzunehmen. Bis mir keine andere Wahl geblieben war.
Katja Meissner lag mit geschlossenen Augen auf der Couch, eine graue Decke bis unter das Kinn gezogen. Es war nicht auszumachen, ob sie schlief oder sich ausruhte. Die schummrige Lampe auf dem Schreibtisch in der Ecke war die einzige Lichtquelle. Ein süßlicher Geruch stieg mir in die Nase. Auf dem Tisch lag ein geöffnetes Päckchen Schokoladenkekse, daneben stand eine halbvolle Flasche Wasser.
Ich betrachtete sie. Ihr langes dunkles Haar glänzte und sah aus, als wäre es in kunstvollen Wellen um das Gesicht drapiert worden. Aus der Entfernung schien es, als schimmerte es am Ansatz heller, aber vielleicht war das auch nur der Lichteinfall. Ihr herzförmiger Mund war leicht geöffnet, die Wangen leuchteten rosig.
War das Rouge auf ihren Wangen? Wahrscheinlich.
Sie war auch sonst geschminkt. Die langen Wimpern waren schwarz getuscht, dazu Eyeliner und perlmuttfarbener Lidschatten. Sie sah nicht aus wie eine Frau, die drei Wochen lang in einer Kammer eingesperrt war. Oder hatte sie sich nach ihrer Rückkehr geschminkt?
Ihre Fingernägel waren sauber, in eine runde Form gefeilt und mit durchsichtigem Lack überzogen.
Obwohl mir noch immer übel war, fing mein Magen an, laut zu knurren.
Sie fuhr mit einem Ruck hoch und starrte mich an.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
Ihre Stimme klang erstickt vor Panik.
Ich schaltete das Licht an, damit sie mich sehen konnte. Im Hellen gab sie ein völlig anderes Bild ab. Das Make-up wirkte grotesk in diesem angstverzerrten Gesicht. Es war zu viel und unsauber aufgetragen.
Sie strampelte sich von der Decke frei. Sie trug ein schwarzes geripptes Tank-Top und dunkle Jeans. Ihre Arme waren muskulös und durchtrainiert. Athletisch.
Mit zitternden Händen strich sie sich die Haare nach hinten, streckte den Oberkörper durch.
Ich wartete einen Moment, dann ging ich auf sie zu und reichte ihr die Hand.
»Ich bin Lea Goldberg. Psychologin.«
Sie schreckte zurück.
»Noch eine? Ich habe vorhin schon mit wem gesprochen.«
Ihre Augen funkelten verwirrt, ihr Händedruck war so schlaff, als würde ich einen ausgestopften Handschuh schütteln. Auf der Innenseite ihres Handgelenks bemerkte ich ein Tattoo. Es sah aus wie ein Y. Sie folgte meinem Blick, zog sofort die Hand weg und verschränkte die Arme.
»Was wollen Sie?«, blaffte sie.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Normalerweise würde ich nicht so vorgehen, auf Abstand bleiben. Aber damit sie ihre abwehrende Haltung aufgab, musste ich eine Verbindung zu ihr aufbauen. Sie antwortete nicht, wendete den Blick ab. Ich wusste, dass ihre defensive Haltung nicht mir persönlich galt. Nur weil sie sich auf einer Polizeistation befand, bedeutete das nicht, dass sie sich in Sicherheit fühlte und Kontrolle über die Situation hatte.
Ich wartete ab, blieb stehen. Schließlich rutschte sie ans andere Ende der Couch und zog die Beine an. Ich nahm das als Einwilligung und setzte mich.
»Wie geht es Ihnen?«
Sie gab einen Laut von sich, der wohl ein höhnisches Lachen sein sollte, legte den Kopf in den Nacken und sah zur Decke. Ihr Blick war abwesend, die Augen wanderten. Als würde sie zu Wolken im Himmel sehen statt auf schmutzig weiße Abdeckplatten.
»Ich habe deinen Bericht gelesen. Wenn das okay ist, lassen wir die Förmlichkeiten. Brauchst du irgendwas?«
Sie schien gar nicht zu registrieren, dass ich zum Du gewechselt hatte, schüttelte nur den Kopf. Normalerweise dutzte ich meine Patienten nicht, aber wir waren im gleichen Alter, und wir hatten wahrscheinlich nur noch zehn Minuten.
»Ich habe bereits alles gesagt, was ich weiß«, sagte sie knapp.
»Ja, ich weiß.« Ich bemühte mich, mit ruhiger Stimme zu sprechen. »Aber ich möchte mich trotzdem gern mit dir unterhalten. Nur fünf Minuten. Dann lasse ich dich in Ruhe.« Sie schnaufte genervt. Ich wartete ab, dann endlich ein halbherziges Nicken. Mir war klar, dass sie nicht mit Elli gesprochen hatte. Die Frage, die ich mir stellte, war: Wieso glaubte sie das? Vielleicht hatte sie ihr Foto in einer Zeitschrift oder Zeitung gesehen? Jemand hatte mit ihr über Elli geredet?
Ich versuchte, sie mir neben Elli vorzustellen, aber es gelang mir nicht. Als würde sich etwas in mir dagegen sperren.