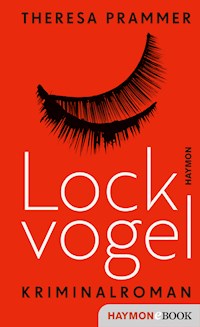Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lorenz und Brehm
- Sprache: Deutsch
Nur 20 Sekunden Mut … um endlich die Wahrheit zu sagen. Aber was, wenn die noch hässlicher ist als die Lüge? Verliebt, verlobt, … verschwunden: ein neuer Fall für Toni und Brehm Während der Sommerferien arbeitet die Schauspielschülerin Toni Lorenz mit Privatdetektiv Edgar Brehm. Doch die Beschattung vermeintlich untreuer Ehegatten müssen die beiden jäh unterbrechen, als sie eine dringende Nachricht erreicht: Ein junger Mann ist verschwunden. Und der Anruf kommt von einer Person aus Edgars Vergangenheit, die er eigentlich liebend gerne vergessen wollte. Doch das Vorhaben, sich aus der Sache rauszuhalten, geht so gar nicht auf, als auch noch eine junge Frau vermisst wird. Die beiden Fälle hängen zusammen – und bald schon merken Toni und Edgar, dass es ganz schön schwierig wird, alle Beziehungswirren, die die Vermissten und ihre Familien verbinden, im Blick zu behalten. Was genau ist zwischen den Vermissten vorgefallen, und warum wusste niemand von ihrem Treffen? Die Mutter des jungen Mannes ist schwanger und will bald heiraten – warum wirkt ihr Verlobter so wenig bemüht, bei den Ermittlungen zu helfen? Und was sieht die höchst esoterische Mutter der vermissten Anna Sophie in ihren Tarotkarten? Von wegen rosa Brille und heile Welt – was verbirgt sich unter der Oberfläche? Wenn zumindest die Privatleben von Toni und Edgar super unkompliziert wären, aber nix da: Neben ihren Ermittlungen versucht Toni auch noch einen Sommerkurs an der Schauspielschule zu absolvieren. Blöd nur, dass ihr Dozent ein junger Filmstar ist (und sie ziemlich ablenkt). Toni hat wirklich schon genug miserable Erfahrungen mit Männern gemacht und versucht, vorsichtig zu bleiben – so gut das eben geht … Auch Edgar fühlt sich im Gefühlschaos zwischen Verflossenem und neuem Freund alles andere als wohl. Als dann auch noch ein Toter in der Donau auftaucht, wächst der Druck auf Toni und Edgar, Ermittlungsfortschritte zu machen. Können Familie und Freunde der Vermissten bei der Aufklärung helfen? Wollen sie das überhaupt – oder wird Toni und Edgar nur ein Zerrbild der Wahrheit gezeigt? Ein Ermittlerteam zum Mitfiebern, eine Großstadt zum Angreifen: mit Theresa Prammer auf Verbrecherjagd in Wien Edgar Brehm, ehemaliger Kommissar und jetzt Privatdetektiv, verschlossen und mürrisch, aber mit einem riesigen Herz, und Toni Lorenz, Schauspielschülerin am Konservatorium in Wien, offen, mutig und mit ihrem persönlichen Rucksack voller negativer Erfahrungen beladen: ein Ermittlerteam, das ungleicher nicht sein könnte. Und dabei doch so gut zusammenpasst. Wenn Toni und Edgar an einem Fall arbeiten, gönnt uns Theresa Prammer keine Atempause: auf Theaterbühnen und Filmsets, auf den Straßen Wiens, von der Donau bis in den Prater lösen die beiden Fälle, die unter die Haut gehen. Emotional, aufwühlend und mitreißend bis zum letzten Wort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theresa Prammer
Schattenriss
Kriminalroman
Für Joseph und die Schauspielakademie Neulengbach – ihr rockt!
Das Vertrauen der Unschuldigen ist des Lügners mächtigstes Werkzeug.
Stephen King
Zweifle an der Sonne Klarheit, zweifle an der Sterne Licht. Zweifle, ob lügen kann die Wahrheit, nur an meiner Liebe nicht.
William Shakespeare
Prolog
Mit sieben Jahren hatte sie gelernt, dass es Wahrheiten gab, die man besser für sich behielt.
Damals war es der nette ältere Schulwart mit den dunklen Knopfaugen und den rosigen Wangen, der immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen hatte. Auch, als er sie in den Heizungskeller der Schule mitnahm. Um ihr etwas zu zeigen, das ein Geheimnis sein sollte.
Er hatte sich das falsche Kind dafür ausgesucht, sie war klug genug, um zu wissen, dass er so etwas nicht tun durfte. Als sie von dem Vorfall erzählte, gab es einen großen Tumult. Der Schulwart beteuerte seine Unschuld, niemals würde er sich an einem Kind vergehen, schließlich arbeitete er schon jahrelang in dem Beruf. Das sei alles nur ihre lebhafte Fantasie.
Immer wieder wurde sie von allen möglichen Leuten befragt. Ihre Mutter weinte viel. Ob wegen ihr oder wegen der Unannehmlichkeiten, war ihr nicht klar. Ihr Vater war ständig genervt. Er sah sie anders an als früher. Vielleicht dachte auch er, dass sie sich das alles ausgedacht hatte. Der Schulwart wurde letztendlich doch gekündigt, ihre Lehrerin gab ihr ab dem Zeitpunkt schlechte Noten und nutzte jede Gelegenheit, um sie vor der Klasse bloßzustellen – damals wusste noch niemand, dass die Frau eine Affäre mit dem Schulwart hatte.
Zehn Jahre waren seit diesem Nachmittag im Heizungskeller vergangen, in denen ihre schulische Karriere eher zweifelhaft verlaufen war, die Eltern sich hatten scheiden lassen und sie mit einer gewaltigen Portion Skepsis durchs Leben ging. Mit der Zeit hatte sie eine Fähigkeit entwickelt, ganz von selbst und so selbstverständlich, als wäre ihr an einer Hand ein sechster Finger gewachsen.
Sie hatte angefangen zu lügen. Die Wahrheit brachte zu oft Probleme. Es fiel ihr leicht. Sie wusste nicht, ob sie einfach ein Talent dafür hatte. Sie konnte so viel und unbeschwert lügen, dass sie sich manchmal fragte, ob vielleicht eine spezielle Veränderung in ihrem Gehirn eingesetzt hatte. Eine Art Angebot und Nachfrage der Evolution.
„Wollen wir nochmal?“, fragte der achtzehnjährige Junge neben ihr. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen, er grinste sie an.
Sie verzog die Mundwinkel und schüttelte den Kopf. „Ich würd voll gern, Julian, echt. Aber ich kann nicht. Ich muss nach Hause. Meine Mutter killt mich sonst“, log sie. Kein Wort davon, dass ihr Herz im dreifachen Tempo klopfte, ihr schlecht und so schwindlig war, dass der Boden unter den Füßen schwankte.
„Bitte. Nur noch einmal. Du hast doch Ferien.“ Er sah sie mit seinen großen Augen an und deutete zum Kassenhäuschen der Loopingbahn, vor dem sich seit ihrer Fahrt wieder eine kleine Schlange gebildet hatte. Für sie war es ab dem ersten Looping der reinste Horror gewesen. Dieses Gefühl, gleichzeitig zu fallen, kopfüber zu hängen und völlig ausgeliefert zu sein, hatte sie in Panik versetzt. Was sie sich nicht hatte anmerken lassen.
„Ich zahl auch wieder“, sagte er und holte weitere hundert Euro aus der Hosentasche. Es war seine Idee gewesen, in den Prater zu gehen. Was sie süß fand, denn normalerweise wollten die Jungen etwas ganz anderes. Nicht mal in der Geisterbahn hatte er die Hand um sie gelegt oder versucht, ihr unter den kurzen Rock zu fassen. Wie oft hatte sie sich gewünscht, mit jemandem wie ihm auszugehen. Julian hatte sie schon früher, als sie jünger waren, nach ihrer Meinung gefragt. Sich mit ihr über alles Mögliche unterhalten. So wie jetzt. Er hatte noch nie zu der Art von Burschen gehört, die ihr gierig auf den Busen starrten. Er interessierte sich für sie. Und sie mochte ihn. Schon lange. Was ihr ein bisschen peinlich war, darum hatte sie auch abgelehnt, als er sie vor drei Wochen das erste Mal nach einem Date gefragt hatte. Aber er war hartnäckig geblieben. Das war nur eine der Eigenschaften, die sie an ihm schätzte. Davon wusste niemand. Und wenn es nach ihr ging, sollte auch keiner davon erfahren. Denn Julian war nicht wie die anderen.
Er war ernst, verschlossen, sehr dünn, trug meistens Sakkos, was für einen Achtzehnjährigen recht schräg war. Es wirkte bei ihm nicht im Mindesten cool, sondern ein bisschen, als würde er angestrengt versuchen, sich älter zu machen.
Sie hatte bereits früher mitbekommen, wie manche über ihn redeten, „voll strange“ und „cringe“ waren die netteren Kommentare.
Heute trug er kein Sakko, sondern ein Hemd und Sneakers. Sein Vorschlag mit dem Prater hatte sie erstaunt. Diese Vorliebe für schnelle Fahrten hatte er früher, als sie jünger waren, nie erwähnt. Das hätte sie ihm nicht zugetraut. Er war also doch überraschend normal.
Gleichzeitig verunsicherte sie seine Zurückhaltung, was sie betraf. Vielleicht hatte sie seine Erwartungen nicht erfüllt? Und er stand einfach nicht auf sie?
„Ich muss los, Julian.“
„Bitte geh nicht.“ Er fasste nach ihrer Hand, hielt sie in seiner. Sein Blick wurde ernst. „Ich … Anna-Sophie, ich mag dich. Schon immer. Und …“ Jemand rempelte ihn an, er reagierte kurz erschrocken. „Können wir irgendwo anders reden?“, fragte er.
Sie bemühte sich, nicht zu zeigen, wie sie sich freute, und nickte. Er führte sie aus dem Abschnitt mit den Fahrgeschäften des Praters hinaus. Wortlos entfernten sie sich von dem Trubel, gingen in die begrünte Hauptallee. Um 22 Uhr war es hier, bis auf ein paar vereinzelte HardcoreJogger und Betrunkene, menschenleer. Obwohl sie schon mit einigen Jungen geschlafen hatte – was nicht so aufregend war, wie sie erwartet hatte –, fühlte sie sich in seiner Gegenwart seltsam nervös. Auf eine gute Art.
Er senkte den Kopf, scharrte mit dem Schuh im Kies und vergrub die Hände in den Hosentaschen.
„Ich mag diesen Platz. Nicht weit entfernt ist die Wirtschaftsuni. Ab Herbst werde ich zwei Studien gleichzeitig belegen. Am liebsten würde ich noch ein drittes dazunehmen, aber das geht nur in Ausnahmefällen.“
Sie musste grinsen. Er war der einzige Achtzehnjährige, der so etwas sagte, ohne lächerlich oder angeberisch zu wirken.
„Das wolltest du mir sagen?“
„Ähm, nein, also …“, druckste er herum, „… es ist etwas anderes.“ Er sah sie mit einem tiefen Blick an, strich ihr sanft mit dem Daumen eine Haarsträhne aus dem Gesicht und lächelte sie an. Für einen Moment wurde alles unwichtig. Ihre nervende Mutter, deren ganzer esoterischer Klimbim, das Gefühl, nie gut genug zu sein, die Schule. Da war eine Verbindung zwischen ihnen, die sie noch nie bei jemandem empfunden hatte.
Ohne nachzudenken, stellte sie sich auf die Zehenspitzen und drückte ihre Lippen auf seine. Ihr Kuss blieb unerwidert. Er öffnete weder die Lippen, noch spitzte er sie. Sie löste sich wieder von ihm. Seinen Blick konnte sie nicht deuten. Julian sah aus, als wäre er … ja, was? Erschrocken? Angeekelt? Normalerweise wollten die Jungen mehr.
So eine Reaktion wie von ihm hatte sie noch nie erlebt.
Oh Gott, wie peinlich.
„Was?“, fragte sie laut.
Er sah sie verdattert an. So ein Mist. Das war’s, den Abend konnten sie beenden. Sie wollte sich umdrehen, da zog er sie zurück. Er nahm ihr Gesicht in seine Hände und küsste sie.
Das war ein anderer Kuss als alle, die sie jemals erlebt hatte. Keine drängende Zunge, die sich in ihren Mund schob. Es war ein liebevoller, erwachsener, leidenschaftlicher und wunderbar zärtlicher Kuss. Als wäre wirklich sie gemeint. Ihre Knie wurden weich. Noch nie war sie so geküsst worden.
„Wow“, entkam es ihr, als sich ihre Lippen lösten.
„Wow“, sagte er, nahm sie in seine Arme, wiegte sie hin und her.
Sie vergrub ihr Gesicht in seiner schmalen Brust. Wie gut er roch. Sie konnte sich gar nicht erinnern, wann sie sich das letzte Mal in ihrem Leben so sicher und geborgen gefühlt hatte. Es musste lange her sein.
Sie hob den Kopf und lächelte ihn an. „Wollen wir zurück in den Prater?“, fragte sie. „Ich wäre jetzt bereit für die nächste Runde auf der Loopingbahn.“ „Echt?“ Er grinste übers ganze Gesicht.
„Ja, echt“, sagte sie. Und diesmal war es die Wahrheit.
Es wurde nicht nur die Loopingbahn. Sie fuhren auch Break Dance, Ketten-Karussell, Autodrom und mit einer Achterbahn im Liegen, in der man nebeneinander mit dem Kopf voran wie Superman die Schienen entlang geschossen wurde. Sie hielt seine Hand umklammert, schrie aus vollem Hals und hatte gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß. Als wäre da in ihr eine Tür aufgegangen, von der sie gar nicht gewusst hatte, dass sie da war.
„Hey, hast du Hunger?“, fragte er, nachdem sie beim Dosenwerfen einen kleinen Teddybären gewonnen hatten.
„Und wie.“ Die Zeit war nur so verflogen.
Sie aßen Langos und Pommes. Und er kaufte zwei Cola. Dann setzten sie sich auf eine Bank vor dem Blumenrad, er holte einen Schaumbecher für sich und für sie Zuckerwatte.
„Puh, ich platze gleich.“ Sie lachte und rieb sich den Bauch.
„Na, und ich erst.“
Ihr war aufgefallen, dass er sich manchmal umsah. Ganz plötzlich. Seine Gesichtszüge wurden dann angespannt. Als hätte er Angst.
„Vorhin, als wir aus dem Autodrom gekommen sind, war da was?“, fragte sie und zog mit den Lippen an der Zuckerwatte.
„Was meinst du?“
Bevor sie antworten konnte, läutete ihr Handy. Sie fischte es aus der Jackentasche und sah „Mama“ am Display. Dann erstarb der Klingelton.
17 Anrufe in Abwesenheit. Scheiße. Es war hier so laut, dass sie nichts gehört hatte. Und schon läutete das Handy erneut.
„Ich bin gleich wieder da“, sagte sie und drückte ihm die Zuckerwatte in die Hand. Sie musste irgendwohin, wo es leise war und sie die Musik aus den Fahrgeschäften nicht verraten würde. Ihre Mutter würde sonst ausflippen.
Der Weg zurück in die Hauptallee war von hier zu weit. Nicht abzuheben war keine Option. Denn dann stünde ihre Mutter bei ihrer besten Freundin Sarah, bei der sie angeblich den Abend mit Netflix und in Pyjamas verbrachte, auf der Matte. Sarah gehörte zu den wenigen Menschen, zu denen sie ehrlich war. Na gut, vielleicht auch nicht immer. Von ihrem Treffen mit Julian hatte sie nichts gesagt. Sarah glaubte, es wäre irgendein Date mit irgendeinem Typen. Aber sonst war sie ehrlicher zu ihr als zu allen anderen.
Warum zum Teufel rief ihre Mutter überhaupt um halb zwölf in der Nacht an? Wahrscheinlich hatte sie wieder irgendwelche schlechten Karten gelegt oder eine ungünstige Sonne-Mond-Sterne-Konstellation entdeckt. Sie spielte jedes Mal mit, tat, als würde sie auch an dieses Zeug glauben. Alles, was ihr Freiheit verschaffte, war ihr recht.
Sie schlug Haken durch die Menschenmenge, doch mit jedem Meter, den sie zurücklegte, wurde die Umgebung nur noch lauter. Über die Lautsprecher wurde Usher von Lizzo übertönt, dazwischen „Die nächste Fahrt – wer traut sich“ und „Kommen Sie, kommen Sie …“-Ansagen.
Das Handy verstummte, nur um im nächsten Moment erneut zu klingeln.
In Gedanken überschlug sie, was schlimmer wäre – nicht ranzugehen oder zuzugeben, dass sie im Prater war um diese Uhrzeit. Da sah sie zwischen zwei Schießbuden den Eingang zu den öffentlichen Toiletten.
Vielleicht würde der Lärm dort drinnen sogar als Netflix-Filmgeräusche durchgehen. Sie schlüpfte hinein. Ein Drehkreuz hielt sie auf. 50 Cent, um die Schranke zu passieren. Erneut erstarb das Handy, nur um im nächsten Augenblick wie verrückt wieder zu läuten. Sie konnte die Hysterie aus dem Klingelton förmlich heraushören. Mit einem raschen Blick vergewisserte sie sich, dass es hier kein Personal gab. Dann schlüpfte sie unter der Schranke durch, stürmte in die erste freie Kabine.
„Mama, sorry, ich …“
„Oh Gott. Wo bist du?“
„Aber du weißt doch, ich bin …“
„Wo bist du?“ Das hörte sich nach mehr als ungünstigen Tarot-Karten an.
„Ich … was ist denn los?“
„Anna-Sophie, sag mir, wo du bist!“
„Bei Sarah …“
„Lüg mich nicht an. Sarah wurde ins Krankenhaus gebracht.“
„Was? Warum? Was ist passiert?“ Ihr Herz fing an, noch viel schneller zu schlagen als vorhin in der Loopingbahn.
„Bitte, ich bin dir nicht böse. Sag mir nur, wo du bist und ob du dasselbe genommen hast wie Sarah!“
„Ich … was genommen?“
„Drogen.“
„Was für Drogen? Warte, Sarah, sie hat …“
„Hast du dasselbe genommen wie sie?“ Ihre Mutter klang völlig hysterisch.
„Nein. Nein, Mama, ich schwöre, ich hab nix genommen.“
„Sag mir die Wahrheit.“
„Das ist die Wahrheit. Was hat sie genommen?“
„Das weiß ich nicht. Sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Wo bist du?“
Tränen stiegen ihr in die Augen, ihre Stimme versagte.
So eine Scheiße.
„WO BIST DU, ANNA-SOPHIE?“
„Im Prater.“ „Mit wem?“
„Mit einem Jungen.“
„Komm sofort nach Hause.“
„Aber …“
„Hast du Geld für ein Taxi?“
„Ich … ja, ich hab 50 Euro.“
„Ist der Junge bei dir?“
„Ja.“
„Dann gib ihn mir.“
„Das geht nicht, ich bin am Klo.“
„Wie heißt er?“
„Peter“, log sie, weil so der letzte Junge hieß, mit dem sie ausgegangen war.
„Wie noch?“
Panisch sah sie sich um. Ihr Hirn war wie leergefegt. Auf der Toilettentür war ein Aufkleber mit der Nummer des 24-Stunden-Frauennotrufs mit dem Slogan „Halt! Zu mir!“.
„Peter Zumir“, sagte sie, ohne darüber nachzudenken. „Woher kennst du ihn?“
„Aus der Schule“, log sie weiter.
„Sag Peter, er soll dich zum Praterstern bringen. Dort stehen Taxis.“
„Mama, wo haben sie Sarah hingebracht?“
Ein Seufzen. „Ins allgemeine Krankenhaus.“
„Weißt du, was für Drogen es waren?“
„Nein.“
„Sie wird wieder gesund, oder? Es ist nicht schlimm?“ Kurzes Schweigen ihrer Mutter.
So eine Scheiße, was hatte Sarah getan? Tränen liefen ihr über die Wangen.
„Komm nach Hause.“
„Aber …“
„Wir werden für Sarah chanten.“
Am liebsten hätte sie losgebrüllt, dass dieses Chanten völlig blöd war. Wie die Pendel, die Tarotkarten, das Aus-der-Hand-Lesen und der ganze Mist. Einfach alles. Doch sie sagte nichts und versprach, nach Hause zu kommen. Ihr Hals fühlte sich wie zugeschnürt an. Instinktiv strich sie mit den Fingern über das selbstgeknüpfte rote Freundschaftsarmband am Handgelenk, das Sarah ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie schluckten doch nie irgendwelches Zeug, seit dieser Party letztes Jahr. Ein Mädchen aus der Nebenklasse hatte nach einer angeblich harmlosen Ecstasypille einen Hirnschaden erlitten. Sie würde ihr Leben lang schwerstbehindert bleiben, konnte weder ihren Namen sagen, geschweige denn jemals wieder etwas ohne Hilfe tun. Sarah traf sich seit einiger Zeit mit diesem Typen, der bereits studierte. Vielleicht hatte der ihr was gegeben, ohne dass ihr klar war, was sie da nahm? Sie musste zu ihr. Sofort.
Ihre Hände zitterten, sie konnte kaum die Klotür entriegeln. Vor dem Drehkreuz, unter dem sie durchgeschlüpft war, stand ein großer Glatzkopf in einer schwarzen Security-Uniform und verstellte ihr den Weg. Wortlos deutete er in die obere Ecke beim Eingang. Eine Kamera.
Sie wollte sich an ihm vorbeidrücken, er schüttelte den Kopf.
„Das macht 50 Euro. Steht da. Kannst nicht lesen?“
Bei widerrechtlichem Betreten ohne Abgabe der 50 Cent Reinigungsgebühr sind 50 Euro zu bezahlen.
„Ich brauch das Geld für ein Taxi. Meine Freundin … sie ist im Krankenhaus“, sagte sie.
„Ja, klar. Und ich bin der Scheich von Brunei und mach das hier nur zum Spaß, damit mir nicht fad wird.“
Wortlos holte sie den Geldschein aus der Jeans. Er nahm ihn, tippte etwas in eine kleine Registrierkasse und reichte ihr den Beleg, den das Gerät ausspuckte.
Sie brauchte Geld für ein Taxi. Ihre Mutter rief erneut an. Sie ließ das Handy läuten. Es hatte ein wenig zu regnen begonnen, sie rannte zurück zu der Bank, auf der Julian auf sie warten sollte. Statt ihm saß dort eine Familie mit zwei Kindern, die sich Regenponchos anzogen. Sie rief ihn an. Er musste sein Handy abgedreht haben, es ging sofort die Mobilbox ran. Auch beim zweiten Mal. Mist. Wo war er hin?
War er ihr gefolgt? Sie lief zurück zu den Toiletten, wählte dabei immer wieder seine Nummer, landete aber jedes Mal in der Mobilbox. Während der Regen stärker wurde, strömten immer mehr Menschen zum Praterstern.
Sie wollte wieder zum Blumenrad, da sah sie ihn in der Menge vor sich. Er ging zielstrebig in die andere Richtung, wahrscheinlich suchte er sie. Es war zu laut, er hörte nicht, wie sie nach ihm rief. Es sah aus, als wollte er in die Hauptallee. Vielleicht dachte er, sie wäre dorthin zurückgegangen?
Sie rannte ihm nach. Eine Horde Betrunkener kam ihr entgegen und versperrte ihr den Weg. Als sie vorüber waren, hatte sie ihn aus den Augen verloren.
Sie lief in die Allee, in die er sie vorhin geführt hatte.
„Julian?“
Keine Spur von ihm. Ein gigantischer Blitz erleuchtete die Dunkelheit für den Bruchteil einer Sekunde. In der
Ferne sah sie eine Bewegung bei den Bäumen. Es blitzte nochmal. Jemand in einem hellen Hemd war dort verschwunden. War er das?
„Julian?“, schrie sie, so laut sie konnte.
Regentropfen prasselten herab. Sie rannte in die Richtung, in der sie meinte, Julian gesehen zu haben. Da waren nicht nur Bäume, es war ein Seitenweg. Kaum von der Allee einzusehen, verdeckt von Büschen und Bäumen. Und so dunkel, dass man fast nichts sehen konnte.
„Julian?“
Keine Antwort. Sie ging ein paar Schritte ins Dickicht, hielt inne. Rief wieder seinen Namen. Nur der Regen auf den Blättern war zu hören. War er es gar nicht gewesen? Sie nahm ihr Handy heraus, schaltete die Taschenlampe ein. Keine Spur von Julian. Sie drehte sich um, wollte kehrtmachen und zurück zur Allee. Da packte sie jemand am Arm. Ihr Schrei erstickte in ihrer Lunge. Sie blinzelte.
Es dauerte einen Moment, bis sie das Gesicht erkannte.
Das war Julian. Er starrte sie erschrocken an.
„Mach das Licht aus“, zischte er.
„Meine beste Freundin ist im Krankenhaus. Ich muss zu ihr.“
„Psst. Sei leise.“
„Wieso, was ist los?“
„Psst.“
Er war ganz anders als vorhin.
„Ich brauch Geld für ein Taxi“, sagte sie.
Ohne Vorwarnung stieß er sie weg. Sie taumelte, stolperte über eine Wurzel, fiel hin. „Was soll das?“
„Hau ab“, fauchte er.
„Aber …“
„Hau sofort ab. Verschwinde.“
„Julian …“
Da packte er sie, zog sie hoch. Sie dachte, er wollte sie schlagen, doch er schob sie Richtung Hauptallee. Mit einem Ruck stieß er sie von sich. Dafür, dass er so dünn war, war er erstaunlich kräftig. Sie strauchelte wieder, fing sich im letzten Moment.
„Es tut mir so leid, Anna-Sophie“, hörte sie ihn noch sagen. Als sie sich umdrehte, war er in der Dunkelheit verschwunden.
Was war das? Wieso tat es ihm leid, und dann benahm er sich wie das größte Arschloch? War er noch ganz dicht?
Sie rannte los, ihre Tränen vermischten sich mit den Regentropfen. Immer mehr Menschen gingen zur U-Bahn, sie bewegte sich eilig durch die Menge, bis sie am Praterstern war. Sie musste ihre Mutter anrufen, wollte ihr Handy aus der Jeans holen. Es war nicht da. Sie hatte es noch gehabt, bevor sie hingefallen war. Auch das Freundschaftsarmband von Sarah war weg. Es musste abgerissen sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ein Wimmern kam aus ihrer Kehle, aber hier war es so laut, dass niemand es registrierte.
Wie ferngesteuert rannte Anna-Sophie zurück. Zum Glück fand sie sofort den schmalen Waldweg, in den sie Julian gefolgt war. Hier musste ihr Handy sein.
Von Julian war nichts mehr zu sehen. Sie kniete sich auf den durchnässten Waldboden und tastete nach ihrem Handy. Da war es nicht. War es beim Sturz weiter weggeschleudert worden, ins Unterholz? Wenn sie nur mehr sehen könnte.
Einen Moment lang hatte sie das Gefühl, in der Dunkelheit vor ihr würde sich etwas bewegen. Ein schwarzer Schatten.
„Julian? Bist du das?“
Keine Antwort. Sie blinzelte, strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht. Wahrscheinlich spielte ihr die Angst einen Streich. Sie brauchte endlich ihr verfluchtes Handy. Hinter ihr knackste es im Unterholz. Sie wollte sich umdrehen, da hörte sie aus der Dunkelheit den Klingelton ihres Telefons. Im nächsten Moment bekam sie keine Luft mehr. Sie wurde zu Boden gedrückt, ein durchdringender Schmerz bohrte sich in ihren Rücken. Etwas hatte sich so blitzschnell um ihren Hals gezogen, dass sie nicht schreien konnte. In ihrem Kopf kreischte sie „Mama“. Im nächsten Moment verlor sie das Bewusstsein.
Miriam Schill hielt den Rosenquarz fest umklammert, während sie erneut auf die Kurzwahltaste ihres Handys drückte. Ihre Tochter Anna-Sophie war noch immer nicht zu Hause. Und sie ging auch noch immer nicht an ihr Handy. Seit sie sie zum letzten Mal erreicht hatte, war bereits eine Stunde vergangen und es regnete in Strömen. Die Tropfen prasselten an die Fensterscheiben, Donner war zu hören. Ein richtig heftiges Sommergewitter mitten in der Nacht. Und ihre Tochter war da draußen. Vielleicht hatte sie wegen des Unwetters kein Taxi bekommen? Oder sie hatte sich untergestellt, um zu warten, bis der Regen aufhörte?
Miriam war besorgt, dann wieder wütend, bis die Sorge erneut die Oberhand gewann. Jetzt verstand sie auch die Tarot-Karte, die sie heute Morgen gezogen hatte – der Narr. Sie hatte gedacht, es würde bedeuten, sie solle ihr Leben mit mehr spielerischer Freude bereichern. Aber das Universum hatte ihr eine völlig andere Botschaft vermitteln wollen.
Sie war hier der Narr. Wie dumm sie war, sich von Anna-Sophie hinters Licht führen zu lassen. Im Prater war ihre Tochter statt bei ihrer Freundin. Mit einem Jungen namens Peter Zumir. Hatte sie diesen Namen schon mal erwähnt? Nein, daran würde sie sich erinnern.
Das würde ein Nachspiel haben. Wenn ihre Tochter nur erstmal sicher in ihrem Bett lag.
Weitere 15 Minuten verstrichen. Keine Anna-Sophie. Kein Rückruf. Bereits zwei Mal hatte sie bei Sarahs Mutter nachgefragt, weil sie dachte, vielleicht wäre Anna-Sophie direkt ins Krankenhaus gefahren. Aber ihre Tochter war weder aufgetaucht, noch hatte sie sich bei ihnen gemeldet.
Sarah ging es besser, sie schlief. Es schien zum Glück nur ein Kreislaufkollaps gewesen zu sein. Keine Drogen, nur zu viel Alkohol auf nüchternen Magen. Dieses Mädchen war zu dünn, kein Wunder. Man würde sie zur Sicherheit die Nacht über im Krankenhaus behalten. Falls Anna-Sophie käme oder Sarah aufwachte, versprach Sarahs Mutter, sich sofort zu melden. Doch Miriam Schills Handy blieb stumm.
Wieder und wieder rief sie bei ihrer Tochter an. Zuerst hatte es wenigstens noch durchgeläutet, jetzt landete sie direkt in der Mobilbox.
Die paar Mitschülerinnen, von denen sie die Handynummer hatte, rief sie trotz später Uhrzeit an. Kaum eine meldete sich, es war schließlich bereits halb eins. Und falls doch, reagierten sie nicht besorgt, als Miriam den Grund für die späte Störung erklärte, sondern ungehalten. Genervt. Das überraschte Miriam und kränkte sie gleichzeitig. Sie hatte immer gedacht, ihre Tochter wäre beliebt.
Miriam konnte nicht still sitzen, sie tigerte durch die Wohnung. Sollte sie ihren Exmann, Anna-Sophies Vater, anrufen? Seit Miriam sich nicht mehr um das geteilte Sorgerecht kümmern musste, hatten sie keinen Kontakt. Sie nahm ihr Handy. Erst da fiel es ihr ein. In einem Wutanfall vor ein paar Wochen hatte sie seine Nummer aus ihren Kontakten gelöscht. Weil er ihr ein Familienfoto geschickt hatte – mit seiner blutjungen Freundin und dem ein Jahr alten Baby in dieser neuen, schicken Wohnung mit Balkon. Unabsichtlich. Sofort danach kam ein „Sorry, wollte es Anna-Sophie senden“. So ein Schwachsinn. Hielt er sie für so dumm, ihm das zu glauben?
Wenn sie ihn erreichen wollte, müsste sie ihre ExSchwiegermutter anrufen. Nein, da würde sie lieber selbst in den Prater fahren und nach ihrer Tochter suchen. Was aber auch völlig verrückt war, vielleicht war sie schon längst nicht mehr dort. Und wenn sie die Polizei rief?
Sie könnte ja die Sim-Karte aus dem Handy nehmen, dann wäre ihr Anruf wieder anonym. Aber das war in dem Fall idiotisch, weil es um ihre Tochter ging. Nein, sie müsste sich zu erkennen geben. Ihr ganzer Körper verkrampfte sich bei dem Gedanken. Der Polizei war nicht zu trauen. Die würden sich wahrscheinlich wieder über sie lustig machen. Wie schon so oft. Aber was konnte man auch von einer Institution erwarten, die ihr Hauptgebäude am Schottenring auf einem Friedhof voller ungeborgener Leichen errichtet hatte?
Sie versuchte zu chanten, die Engel herbeizurufen, damit sie ihre Tochter beschützten.
Dann hatte sie eine Idee: die Tarotkarten. Das war es. Schon heute Morgen hatten sie ihr einen Hinweis gegeben. Miriam setzte sich an den Küchentisch, mischte durch und fächerte mit gekonnter Handbewegung die Karten vor sich auf. Sie schloss die Augen. Auf die Karten und die Sterne konnte sie immer vertrauen. Das waren die Wegweiser ihres Lebens. Sie atmete ein paar Mal tief durch, dachte an ihre Tochter und zog mit der linken Hand eine Karte.
Der Mond. Er stand dafür, dass nichts so war, wie es schien. Das stimmte, aber half ihr nicht weiter. Sie mischte erneut.
Die Hohepriesterin.
Sie stand für Verbundenheit und Intuition. Auch das gab ihr keine Antwort. Ein drittes Mal würde sie noch ziehen.
Die Liebenden.
In ihrem Inneren machte es „klick“, als würde ein Schloss einrasten. Eine Erkenntnis, mit der auch die beiden anderen Karten Sinn ergaben. Nichts war, wie es schien, Anna-Sophie hatte nicht nur irgendeinen Jungen getroffen, sie war verliebt in ihn. Das sagte ihr die Intuition, denn sie war mit ihrer Tochter innerlich schon immer mehr verbunden als andere Mütter. Und Anna-Sophie war nicht aufgetaucht, weil sie die Nacht mit dem Jungen verbrachte.
Wie auf Kommando läutete ihr Handy.
„Hallo Miriam, Sarah ist wach“, meldete sich Sarahs Mutter. „Ich hab das Handy auf laut gestellt.“
„Hallo.“ Sarahs Stimme klang schwach und dünn. Trotzdem konnte Miriam den Widerwillen heraushören.
„Hat Anna-Sophie sich bei dir gemeldet?“, fragte sie das Mädchen.
„Nein.“
Das hatte nichts zu bedeuten, es war lediglich eine Bestätigung, wie verliebt Anna-Sophie war.
„Wie geht es dir?“, erkundigte sich Miriam.
„Geht so.“ Ein Seufzen war zu hören.
Miriam verkniff sich den Kommentar, der ihr auf der Zunge lag. Hoffentlich war Sarah dieser Krankenhausaufenthalt Lehre genug.
„Kannst du Anna-Sophie sagen, sie soll mich anrufen, wenn sie heimkommt?“, bat Sarah. „Sie geht nicht an ihr Handy.“
„Ich weiß. Sie ist bei Peter“, sagte Miriam und bemühte sich um einen verschwörerischen Tonfall.
„Welcher Peter?“
„Der Peter, in den sie verliebt ist.“
„Aha.“
„Kannst du mir seine Telefonnummer geben?“
„Nein.“
Irgendwas an diesem „Nein“ irritierte Miriam. Es klang ängstlich. Wollte Sarah ihn schützen?
„Warum nicht?“
Keine Antwort. Nur ein Wispern war zu hören, es klang nach Sarahs Mutter. Irgendwas wie „Jetzt red schon“.
„Ich kenne diesen Peter nicht“, sagte Sarah. „Und ich glaube nicht, dass Anna-Sophie in ihn verliebt ist. Sie hat ihn doch heute zum ersten Mal getroffen.“
„Aber … woher kennen sie sich?“ Wieder keine Antwort.
„Bitte, Sarah, woher kennen sie sich?“
„Ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, über Tinder“, sagte Sarah leise.
„Tinder?“
Das konnte nicht sein. Tinder. Dafür war ihre Tochter doch noch viel zu jung. Das bedeutete, dieser Peter war ein Fremder. Irgendjemand.
In Miriams Ohren rauschte es. Sie hatte das Gefühl zu fallen. Die Küche fing an, sich zu drehen.
Ein Donnerschlag krachte so laut, dass die Fensterscheiben erzitterten, ein Blitz erhellte das Zimmer. Miriam zuckte zusammen, sie bekam kaum Luft.
„Miriam? Bist du noch dran?“, fragte Sarah.
Sie konnte nicht mehr antworten und legte auf.
Ihre Finger zitterten so sehr, dass sie drei Anläufe brauchte, um die Nummer des Polizeinotrufs zu wählen.
1.
„Ich stech dich ab, du verdammtes Schwein.“
Edgar Brehm war überrumpelt, als er von hinten gepackt, in den Hauseingang gezogen und mit dem Gesicht gegen die Wand des Stiegenhauses gedrückt wurde. Im ersten Moment registrierte er das kalte Metall an seinem Hals nicht. Bis vor ein paar Sekunden hatte er sich in der belebten Naglergasse im ersten Bezirk befunden und einen vermeintlich untreuen Ehemann beschattet.
„Edgar? Edgar … was ist los?“, hörte er Tonis Stimme aus dem Handy, das er noch immer ans Ohr gepresst hielt. Sie hatten plötzlich ihr Zielobjekt aus den Augen verloren. Weswegen er Toni zum U-Bahn-Eingang Herrengasse geschickt hatte, während er selbst Richtung Hotel Orient weiterging. Wiens berühmtestes Stundenhotel war eine Querstraße von hier entfernt. Der Hotspot für stilvolles Fremdgehen. Was für ein Klischee.
Edgar wollte Toni antworten, dass sie wegbleiben sollte, doch der Angreifer schlug ihm das Telefon aus der Hand. Er schrie ihn weiter an, klang wie ein gequältes Tier.
Edgar war nicht nur ehemaliger Polizeibeamter, seit mehr als 20 Jahren arbeitete er als Privatdetektiv. Es gab so gut wie nichts, das er in seinem Beruf noch nicht erlebt hatte. Aber Toni war seine Assistentin und erst Anfang 20, eine Schauspielschülerin, die er seit ein paar Wochen beschäftigte. Er hatte ihren Exfreund aufgespürt – leider ohne die beachtliche Summe, die er Toni abgenommen hatte. Im Gegenzug hatte sie ihm als Lockvogel bei der Aufklärung eines Falls in der Filmbranche geholfen.
Seit Edgars Detektei vor ein paar Wochen deshalb in den Medien gewesen war, flogen die Aufträge nur so he- rein. Als hätte ganz Wien in diesem heißen August nichts anderes zu tun, als Ehebrüche zu begehen. Wofür die vielen Online-Seitensprungportale verantwortlich waren, die wie Pilze aus dem Boden schossen. Früher musste man erst jemanden kennenlernen, der interessiert war, bevor der Entschluss folgte, sich auf eine Affäre einzulassen. Heutzutage war es umgekehrt. Die eigene Entscheidung, fremdzugehen, war der Auslöser. Dann fehlten nur noch ein paar Klicks, bis der passende Gegenpart gefunden war.
Edgar hatte eine gespaltene Einstellung zum Internet – es war Fluch und Segen zugleich und schien die besten wie auch die schlechtesten Seiten der Menschen zum Vorschein zu bringen. Auf jeden Fall war es für den Aufschwung seiner Detektei verantwortlich.
Aber nicht nur deswegen hatte er Toni engagiert. Nach seinen Herzproblemen vor ein paar Monaten war er noch längst nicht wieder auf der Höhe. Nichts Besorgniserregendes, wenn man ihn fragte. Zu viel Stress, Übergewicht, Unsportlichkeit, die Heilige Dreifaltigkeit des Älterwerdens. Was die Ärzte, um die er gerne einen großen Bogen machte, nicht so entspannt sahen.
Deshalb – und weil Toni ihre Aufgabe nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut gemacht hatte und ohnehin in gravierenden Geldnöten war – hatte er ihr diesen Sommerjob angeboten. Das war der offizielle Grund.
Inoffiziell mochte er die junge Frau mit den kurzen schwarzen Haaren und den großen grünen Augen. Ihre Unbedarftheit erinnerte ihn an eine frühere Version von sich selbst, bevor das Leben ihn mit einer großen Portion Vorsicht und Misstrauen ausgestattet hatte. Toni war ihm in der kurzen Zeit, die sie einander kannten, ans Herz gewachsen.
Darum war alles, an das er in diesem Moment denken konnte, dass sie wegbleiben musste. Wer auch immer dieser Wahnsinnige war, Toni sollte ihm nicht begegnen. Aus der engen Naglergasse fiel ein wenig Licht in das Treppenhaus, aber nicht genug, um die vorbeiströmenden Touristen auf das aufmerksam zu machen, was hier vor sich ging. „Toni, komm nicht her“, rief Edgar Richtung Handy am Boden, weiter kam er nicht. Der Fuß seines Angreifers kickte sein Telefon in den dunklen Flur. Ein Fuß, der in einem dunkelbraunen, glänzenden Lederschuh steckte. Wahrscheinlich Maßschuhe, auf jeden Fall auf den ersten Blick teuer.
Wer in aller Welt war das?
Edgar wollte sich umdrehen, die Klinge wurde stärker an seinen Hals gepresst. Ihm brach der Schweiß aus. In seinen Ohren begann es zu dröhnen. Nein, nicht jetzt. Nicht schon wieder.
„Hören Sie, Sie können mein Geld, meine Brieftasche und mein Handy haben. Wir können das friedlich …“, begann er ruhig.
„Halts Maul.“ Es klang nach einem Schluchzen. „Seit wann geht das bereits?“
„Das ist sicher eine Verwechs…“
Edgars Handy klingelte in der Entfernung. Er flehte innerlich, dass es nicht Toni war, die nach ihm suchte. Er musste diesen Wahnsinnigen beruhigen, bevor sie ihn fand. „Ich will wissen, seit wann?“, heulte der Mann auf.
„Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Seit wann was?“
„Verarsch mich nicht.“
„Wenn Sie mich loslassen, verspreche ich Ihnen, mich nicht zu wehren. Wir werden uns einfach unterhalten.
Okay?“
„Du hältst mich wohl für sehr blöd.“
Wieder klingelte Edgars Handy im dunklen Hausflur.
„Das ist sie sicher“, sagte der Mann.
„Wer?“
„Meine Frau.“
„Wer ist Ihre Frau?“
„Meine Frau ist die, die dich anruft und fragt, wo du bleibst.“
„Ich kenne Ihre Frau nicht …“
Ein Laut, der wie ein jaulender Hund klang, war zu hören.
„Muss ich dir erst wehtun, damit du es zugibst?“
„Bitte, mir geht es nicht gut“, versuchte Edgar den Mann zu besänftigen.
Es war die Wahrheit, auch, wenn er das mehr aus Taktik erwähnte.
„Dir soll es auch nicht gut gehen. Seit wann vögelst du meine Frau?“
„Das ist eine Verwechslung, und wenn Sie mich loslassen, werden wir alles klären.“
Statt einer Antwort spürte Edgar, wie das Messer an seinem Hals zu zittern begann. Dieser Mann handelte im Affekt. Was Edgar kein bisschen beruhigend fand. Das machte ihn noch unberechenbarer.
„Wie heißt Ihre Frau?“, fragte er.
„Spiel nicht den Unschuldigen.“
„Ich spiele nichts.“ Pfft-pfft-zisch – Edgars Herzschlag fühlte sich plötzlich an wie ein verstopftes Abflussrohr.
„Hören Sie …“, keuchte er. „Ich bin Privatdetektiv und …“ „Seit wann du meine Frau vögelst, will ich wissen.“ Dieser Irre hörte ihm gar nicht zu.
„Ich kenne weder Ihre Frau, noch hätte ich irgendwelche Ambitionen, mit ihr …“
„DU SOLLST NICHT LÜGEN.“
Das Messer wurde stärker an seinen Hals gedrückt. Sein Handy klingelte erneut.
„Edgar?“, hörte er im nächsten Moment seinen Namen aus der Gasse. Das war Toni. Sie suchte ihn und dank des läutenden Handys würde sie ihn gleich entdecken.
„SAG MIR DIE WAHRHEIT“, brüllte der Mann.
„Das ist … die Wahrheit. Lassen Sie mich los.“
Der Kerl dachte nicht daran, im Gegenteil. Wieder hörte er Toni rufen. Sie war nahe.
„SEIT WANN VÖGELST DU MEINE FRAU?“
„Ich bin Privatdetektiv, sehen Sie in meiner Brieftasche nach, mein Name ist Edgar Brehm. Wie heißen Sie?“, versuchte er es wieder.
„DAS IST MIR SCHEISSEGAL, WAS DU BIST UND WIE DU HEISST. MEINE FRAU WIRST DU NICHT
MEHR VÖGELN.“
„DAS WILL ICH AUCH NICHT.“
„Lügner.“
„Ihre Frau interessiert mich nicht.“
„LÜGNER.“
„ICH BIN KEIN LÜGNER. ICH BIN SCHWUL.“
Das wirkte. Edgar spürte, wie sich der Griff des Mannes lockerte. Blitzschnell beugte er sich zur Seite, fasste nach hinten und versuchte, den Unterarm seines Angreifers zu packen. Im nächsten Moment spürte er einen scharfen Schmerz in seiner Hand. Er hatte danebengegriffen. Das Messer fiel klirrend zu Boden. Reflexartig stieß er es mit dem Fuß weg und ging in die Knie. Es war ein Schweizer Klapptaschenmesser. Die Mini-Ausgabe. An einem Schlüsselbund. Ein Schlüsselanhänger.
„Scheiße, was …“
Das kam von Toni. Sie stand in der offenen Haustür, die Augen weit aufgerissen. Als sie ihn an der Mauer kauernd entdeckte, stürzte sie auf ihn zu.
„Geht’s dir gut?“
Sie drückte auf das Ganglicht, und Edgar öffnete seine Hand. Lediglich ein roter Strich war auf der Handfläche zu sehen, wie eine markierte Lebenslinie.
„Alles gut“, sagte er heiser.
„Herr Hagenbauer, sind Sie irre?“, hörte er Toni fragen.
Erst da sah Edgar hoch. Vor ihm stand zitternd und verheult ihr Zielobjekt, Erwin Hagenbauer, 38 Jahre alt, Halbglatze, als technischer Projektkoordinator bei einem Telekommunikationsunternehmen tätig. Seine Frau, eine
Eventmanagerin, die ihren Mann des Ehebruchs verdächtigte, hatte Edgar engagiert. Hagenbauer hatte etwas von einem verschreckten Vogel, wie er ruckartig den Kopf von Toni zu Edgar und wieder zu Toni drehte.
„Woher … Sie kennen meinen Namen?“
„Ja, und Sie haben soeben den Detektiv verletzt, den Ihre Frau angeheuert hat“, fauchte Toni.
Edgar fluchte innerlich. Das war gegen die Ethik seiner Arbeit, sie hätte das dem Mann nie sagen dürfen.
Hagenbauer trat einen Schritt zurück, schnappte nach Luft.
„Sie sind … meine Frau hat was?“
„Einen Detektiv angeheuert, weil Sie fremdgehen.“ So wütend hatte Edgar Toni noch nie erlebt. Sie baute sich vor Hagenbauer auf, und obwohl sie zwei Köpfe kleiner war als er, zuckte der Mann vor ihr zurück. „Ich rufe die Polizei.“
Edgar wollte Toni aufhalten. Das würde ihm nur Schwierigkeiten bringen, denn Toni hatte gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung von Edgar und Hagenbauers Frau verstoßen. Mit strenger Miene funkelte Toni weiter Hagenbauer an, während sie langsam ihr Handy aus der Jeans fischte. Oder bluffte sie? Es machte fast den Anschein. Sie hielt das Telefon drohend vor sich, während sie Hagenbauer nicht aus den Augen ließ, als wartete sie auf ein Geständnis. Sie erstaunte Edgar immer wieder.
Er rappelte sich hoch, seine Knie fühlten sich ein wenig weich an. Sonst ging es ihm gut.
„Ich betrüge meine Frau nicht. Ich dachte, sie betrügt mich. Mit dem da.“ Hagenbauer deutete auf Edgar.
„Wie kommen Sie auf diese absurde Idee?“, fragte Toni.
Der Mann wischte sich über die Stirn, seine Hand zitterte. „Weil ich seit einiger Zeit das Gefühl habe, meine Frau verheimlicht mir was. Und man liest doch so viel, wie einfach das geworden ist, durch diese ganzen Apps. Darum war ich in den letzten drei Tagen nicht in der Firma, sondern … ich bin ihr gefolgt. Und da hab ich ihn entdeckt.“ Er deutete wieder auf Edgar. „Immer in der Nähe meiner Frau.“
Toni verdrehte die Augen. „Das ist unmöglich. Wir verfolgen Sie seit drei Tagen. Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben bemerkt, dass Sie beobachtet werden, und deshalb …“
„Wo ist Ihre Frau jetzt?“, unterbrach Edgar. „In dem französischen Bistro gleich nebenan.“ „Im Le Bol?“, fragte Toni.
„Ich weiß den Namen nicht.“ Er sah wieder zu Edgar. „Ich dachte, Sie wollen zu ihr und dann weiter mit ihr ins Hotel Orient“, sagte er kleinlaut.
„Toni, bitte sieh nach“, sagte Edgar.
Sie nickte und drückte sich an Hagenbauer vorbei, der sofort zur Seite sprang.
Edgar strich den Staub von den Hosenbeinen. Er fühlte sich wackelig. Das Ganglicht erlosch, keiner von ihnen betätigte es erneut. Das schwache Dämmerlicht vom Eingang reichte.
„Sie werden mir das wahrscheinlich nicht glauben. Aber es tut mir wirklich sehr leid“, sagte Hagenbauer. „Ich wollte Ihnen nicht … meine Frau denkt echt, ich hätte eine Affäre?“
„Ja. Hat sie recht?“
„Um Gottes willen. Meine Frau ist mir anstrengend genug. Ich meine, ich wollte sagen … wie kommt sie da- rauf, dass ich Zeit für eine Zweite hätte?“
„Also haben Sie jetzt eine oder nicht?“
„Nein, ich habe keine Affäre.“
„Wenn das stimmt, dann heißt das, wir haben Sie die letzten drei Tage dabei beschattet, wie Sie Ihre Frau beschattet haben.“
Edgars Handy läutete erneut aus dem Hausflur.
„Ich hole es Ihnen“, sagte Hagenbauer. Das schlechte
Gewissen war dem Mann anzusehen, als er Edgar sein Telefon reichte. Eine unterdrückte Nummer. Edgar drückte auf den Annahmeknopf und sah, wie Frau Hagenbauer mit Toni im Hauseingang erschien.
„Martin … was machst du da?“, fragte Frau Hagenbauer.
Ihr Mann brach in Tränen aus. Den zornigen Blick von Toni schienen beide nicht zu bemerken.
Edgar dachte noch, dass dieser Fall einen Platz in den absurdesten Anekdoten seines Detektivlebens bekommen sollte, als er sich am Telefon meldete. Eine Geschichte, die er auf Partys erzählen könnte. Wenn er auf Partys gehen würde.
„Brehm.“
„Hallo Edgar“, sagte eine männliche, leicht rauchige Stimme mit samtenem Unterton. Edgar brauchte einen Moment – sein Herz fing wieder an, außer Takt zu schlagen.
Er wusste, wer das war.
Obwohl es fast schon 20 Jahre her war, würde er diese Stimme immer erkennen.
2.
Toni stand etwas abseits des Ehepaars Hagenbauer und wartete, während Edgar im dunklen Hausflur leise telefonierte. Sie verfluchte alles an diesem Tag.
Und das nicht erst seit jetzt.
Sie war völlig übermüdet aufgewacht. Seit vier Uhr hatte sie sich schlaflos im Bett gewälzt und war erst kurz vor dem Läuten des Weckers wieder eingeschlafen. Dann hatte die Kaffeemaschine nicht funktioniert. Und keine saubere Wäsche war mehr da und sie musste den Schmutzwäscheberg durchwühlen. Gerade heute. Dass dieser Irre Edgar angegriffen hatte, war wie die Kirsche auf der Torte der Unerfreulichkeiten.
Sie mochte Edgar, oft hatte sie dieses unbestimmte Gefühl, als würden sie einander lange kennen. Und es war definitiv der spannendste und abwechslungsreichste Sommerjob, den sie jemals gehabt hatte. Was es allerdings mit ihrer ohnehin von Liebeskummer angeschlagenen Seele anstellen würde, Ehepartner beim Fremdgehen zu überführen, damit hatte sie nicht gerechnet. Als würde jeder neue Fall ihre Wut und Verzweiflung wegen dem, was Felix getan hatte – sie mehr als ein Jahr zu belügen und zu bestehlen –, auf irrationale Weise anfeuern.
„Oh Gott, ist das unangenehm“, murmelte Frau Hagenbauer immer wieder, während ihr Mann mit ihr flüsterte. Toni verstand nur Wortfetzen. Er hatte aufgehört zu weinen, und es klang, als würden sie über diverse Geldsummen verhandeln. Die beiden wirkten in Tonis Augen eher wie zwei Kollegen, die einander misstrauten, nicht wie ein Ehepaar. Aber vielleicht projizierte sie auch nur ihr eigenes verworrenes Gefühlsleben auf die Szene.
Endlich beendete Edgar das Telefonat. Toni erschrak, als er zu ihnen zurückkam, er war furchtbar blass. Seine Stirn glänzte verschwitzt, und als er sich über die Oberlippe strich, zitterte seine Hand. Sie warf Herrn Hagenbauer einen vernichtenden Blick zu.
„Das tut mir alles schrecklich leid. Wenn Sie von einer Anzeige absehen, werden wir uns finanziell erkenntlich zeigen“, sagte Frau Hagenbauer.
„Sehr erkenntlich“, sagte ihr Mann und nickte.
Toni wusste von Edgars Missverhältnis zur Polizei. Auch davon, dass es ehemalige Kollegen gab, die nur da- rauf warteten, ihm eines auszuwischen. Aber sie mussten trotzdem etwas tun. Mit den Lippen formte sie stumm „Fernanda“ in Edgars Richtung. Sie war nicht nur Polizistin und eine von Edgars engsten Freundinnen, ihre Dienststelle, die Landespolizeiinspektion am Schottenring, lag lediglich zehn Minuten entfernt. Edgar schüttelte leicht den Kopf.
„Die Rechnungssumme bleibt unverändert. Ich maile Ihnen die Abrechnung“, sagte er zu den Hagenbauers. „Tun Sie sich bitte einen Gefallen und begeben Sie sich so rasch wie möglich in Paartherapie.“
„Aber wir brauchen doch keine Paartherapie“, sagte Frau Hagenbauer.
Ihr Mann bedeutete ihr, ruhig zu sein.
„Ja, das werden wir“, sagte er rasch. „Vielen Dank.“
Das Ehepaar bedankte sich überschwänglich und schüttelte zuerst Edgar und dann Toni die Hand, bevor sie fluchtartig den Hausflur verließen.
„Wirklich? Du lässt den einfach so davonkommen?“, fragte Toni.
Edgar sah sie nicht an. Er wirkte irritiert.
Wahrscheinlich steckte ihm der Schreck von eben in den Knochen. Toni versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie sich um Edgar sorgte. Er war nicht gerade gut darin, auf seinen Gesundheitszustand aufzupassen. Wenn es nach ihr ging, hätte sie ihm längst ein
Sportprogramm aufgehalst und ihm gesünderes und vor allem regelmäßiges Essen verordnet. Außerdem schien er nicht viel zu schlafen. Nicht selten kam es vor, dass er ihr mitten in der Nacht E-Mails schickte. Die sie deshalb las, weil sie auch nicht schlafen konnte.
Sie hoffte, für Edgars durchwachte Nächte war Vincent Blum verantwortlich. Der junge und leider nicht besonders erfolgreiche Schauspieler, der nebenbei als Fitnesstrainer arbeitete, war verliebt in Edgar. Ein paar Mal hatte sie Vincent im Hintergrund gehört, wenn sie am Wochenende mit Edgar telefoniert hatte. Doch wenn sie Edgar darauf ansprach, schien seine Begeisterung sich in Grenzen zu halten. Vincent war deutlich jünger als er, seine dunkle Hautfarbe und der durchtrainierte Körper verliehen ihm das Aussehen eines Models. Das Einzige, was nicht zu seiner perfekten Erscheinung passte, war seine Stimme. Bei einer Schilddrüsenoperation waren seine Stimmbänder geschädigt worden, weswegen er in erstaunlich hoher Tonlage sprach. Was ihm als Schauspieler immer wieder Absagen einbrachte. Modelaufträge lehnte er ab – anscheinend bekam er davon aber eine ganze Menge.
Nach ein paar Gläsern Chianti hatte Edgar Toni anvertraut, Vincents Alter und seine objektive Schönheit waren dafür verantwortlich, dass er den jungen Mann auf Abstand hielt. In ihren Augen war das absolut lächerlich.
Ja, es stimmte, er war viel älter als Vincent. Und es konnte sein, dass er vielleicht ein paar Kilo zu viel wog. Das größere Problem war allerdings seine Unsportlichkeit, er kam außer Atem, wenn sie ein Stockwerk hochstiegen. Aber das alles spielte in Wahrheit keine Rolle. Denn Edgar war einfach umwerfend. Seine freundliche, ruhige Art, die das Gefühl von Sicherheit vermittelte, sein Charisma, durch das er alle Blicke auf sich zog, wenn er einen Raum betrat. Sein trockener Humor, den Toni liebte. Und er war groß, nein, riesig. Seit einiger Zeit trug er einen Dreitagebart, der ihm unglaublich gut stand. Er passt zu seinem dichten silbernen Haar und den erstaunlich blauen Augen in dem markanten Gesicht. Jenen blauen Augen, die nun vor sich hinstarrten.
„Geht es dir gut, Edgar? Hast du heute schon was gegessen?“
Eine lächerliche Frage, wenn man bedachte, dass er gerade bedroht worden war.
Edgar hob den Kopf, lächelte leicht und nickte. „Ja.
Das ist es nicht.“
„Was ist es dann?“
Er zögerte. Automatisch griff sie in ihren Rucksack und reichte ihm ihre Wasserflasche.
„Danke.“ Er seufzte, nahm einen Schluck und lehnte sich gegen die Wand. „Der Anruf eben, das war ein neuer Fall. Ganz in der Nähe, Taborstraße, aber …“
„Wenn ich mitkommen soll, ich hab noch Zeit. Ich hab sowieso angenommen, wir sind länger mit diesem Irren beschäftigt. Das war schon verrückt. Was für absurde Sachen Menschen manchmal angeblich aus Liebe machen.“
Sie trank einen Schluck und stopfte die Wasserflasche wieder in ihren Rucksack. Edgar sah sie nachdenklich an.
„Was ist los, Edgar? Du hast doch was?“
Sein Räuspern hallte im Stiegenhaus. Er schien zu zögern, doch dann sagte er: „Lass uns erst mal ein Taxi nehmen und schauen, ob wir den Fall übernehmen.“
„Ein Taxi in die Taborstraße? Die ist doch ganz in der
Nähe.“
„Aber … na gut. Okay.“
„Worum geht es denn?“
„Ein Achtzehnjähriger ist gestern nicht nach Hause gekommen und wir sollen ihn finden.“
Toni hatte das Gefühl, dass Edgar etwas für sich behielt. Vielleicht ging es um was Illegales? Wie spannend, sie freute sich richtig. Das war eine nette Abwechslung zu all den Ehebrüchen.
Die Hitze hüllte sie ein, als sie aus dem kühlen Treppenhaus auf die Naglergasse traten. Das Gewusel der Touristen hatte zugenommen, sie bogen ab auf die Tuchlauben. Stimmengewirr und Lachen aus dem Gastgarten des Fabios schwappte durch die kurze Fußgängerzone. Sehnsüchtig sah Toni zu dem Eissalon, den sie passierten. Jetzt eine Kugel Nougat- und Erdbeercreme-Eis! Sie hatte so gut wie immer Hunger, was alle in ihrem Umfeld mit Erstaunen zur Kenntnis nahmen. Den Satz „Wo isst du das alles hin?“ hörte sie fast täglich.
„Wann musst du in der Schauspielschule sein?“, fragte Edgar.
„Ich hab noch mehr als zwei Stunden Zeit.“ Wie sie es sagte, hörte es sich nach einem Ultimatum an.
„Du klingst nicht begeistert.“
Sie wichen einer Reisegruppe aus, die ihrem Guide Richtung Ankeruhr hinterhertrottete.
„Bin ich auch nicht.“
„Warum? Ich dachte, du freust dich darüber, das ist doch eine Chance?“
Toni seufzte. Die Schmitz – der Drachen von Schulleiterin – hatte sie vor einer Woche angerufen. Im Konservatorium gab es für den dritten Jahrgang einen Sommerkurs. Eine Teilnehmerin hatte sich das Bein gebrochen und war ausgefallen. Laut Schmitz war es eine Ehre, dass Toni als Ersatz ausgewählt worden war. Obwohl sie erst in den zweiten Jahrgang kam. Niemand anderes als der berühmte Tim Ravinger, der vor sechs Jahren seinen Abschluss am Konservatorium gemacht hatte und mittlerweile einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands war, leitete ihn. Toni hatte Ravinger in ein paar Filmen, zwei NetflixSerien und bei einem Gastspiel der Wiener Festwochen als Cyrano de Bergerac gesehen. Die Rollen waren komplett unterschiedlich. Und er in jeder davon brillant. Egal, ob im Theater mit großer Nase, auf Netflix als Serienmörder mit gespaltener Persönlichkeit oder im historischen Film als Sohn der Haushälterin einer reichen Familie, der sich unstandesgemäß in die Tochter des Hauses verliebte. Er schlüpfte in jede Figur, als wäre er ein Teil von ihr und die Rolle sei nur für ihn geschrieben worden. Kein Wunder, dass er so viele Auszeichnungen bekommen hatte.
Auf Tonis Frage, wieso die Wahl ausgerechnet auf sie und nicht auf jemand anderen gefallen war, hatte die Schmitz nicht geantwortet. Und genau da lag das Pro- blem. Die Schmitz hatte Toni bereits im ersten Jahr an der Schauspielschule das Leben schwer gemacht. Die Schulleiterin war strenger zu Toni als zu allen anderen.
„Vielleicht versucht die Schmitz auf diese Art, mich loszuwerden“, sagte Toni.
„Wie meinst du das?“
Sie überquerten die Brücke über den Donaukanal, wichen Radfahrern aus, die mit rasantem Tempo vorbeizischten.
„Na ja, mit Ravingers Hilfe. Ich weiß auch nicht, es klingt wahrscheinlich paranoid …“
„Ein wenig.“
„Aber du kennst die Schmitz nicht“, verteidigte sie sich. „Ich hab rausgefunden, dass sie die Lehrerin vom Ravinger war. Bei einer Preisverleihung hat er ihr in seiner Rede gedankt. Die beiden waren ein Herz und eine Seele.“
„Woher weißt du das?“
„Ich hab mir die Rede auf YouTube angesehen. Sie hat ihn sicher für diesen Sommerkurs geholt, wieso wäre er sonst da? Der dreht doch die ganze Zeit. Und dann will sie ausgerechnet mich als Ersatz für die ausgefallene Teilnehmerin? Wo sie letztes Jahr versucht hat, mich rauszuwerfen? Dass sie es nicht geschafft hat, war ein Glücksfall, mehr nicht.“
Edgar blieb stehen, sah Toni an und nickte bedächtig.
„Ich verstehe. Aber du besuchst den Kurs trotzdem.“
„Klar. Wenn die Schmitz mich loswerden will, dann schafft sie das früher oder später ohnehin.“ Sie klang couragierter, als sie sich fühlte. „Mit etwas Glück lern ich wenigstens noch was vom Ravinger.“
Dass ihr dieser Sommerkurs einen gewaltigen Strich durch ihre Planungen machte, erwähnte sie nicht.
Toni hatte erst gestern ihr Budget überschlagen. Seit Felix das gesamte Ersparte, das sie für ihre Oma verwaltete, für seine Spielschulden abgezweigt hatte, konnte sie die Wohnungsmiete in der Seniorenresidenz für ihre Oma bald nicht mehr zahlen. Das Honorar, das sie von Edgar bekam, war mehr als großzügig. Trotzdem reichte es nicht. Ihre Oma war schon in eine viel kleinere Wohnungseinheit umgezogen, was Toni furchtbar bedauerte. Ein weiterer Nebenjob ging sich nicht aus neben der Schauspielschule, deshalb hatte sie sich entschlossen, aus ihrer Wohnung eine WG zu machen. Dazu musste sie eine, vielleicht sogar zwei Mitbewohnerinnen finden. Was sie im Moment ein wenig überforderte, sie hatte bis jetzt nur mit ihrer Oma und dann mit Felix zusammengelebt. Zwei Menschen, die sie von ganzem Herzen liebte, beziehungsweise in Felix’ Fall: geliebt hatte.
Aber wie wäre das Zusammenleben mit jemandem völlig Fremden? Welche Zimmer sollte sie freigeben, welches für sich behalten? Wie viel Miete durfte sie verlangen? Und vor allem, wie würde sie es nach Felix schaffen, wieder jemandem vorbehaltlos zu vertrauen?
Vielleicht war sie einfach heillos naiv und dafür prädestiniert, in solche Fallen zu tappen. Oder es war umgekehrt, sie vertraute einfach niemandem mehr und würde sich dann in ihrer eigenen Wohnung wie eine Fremde fühlen. Natürlich war Toni klar, dass dieses Gedankenkarussell in erster Linie ihrer Angst vor einer erneuten Enttäuschung entsprang. Aber auch wenn sie das rational wusste, emotional fühlte es sich sehr real an.
Edgar deutete zu der Eingangstür des Altbaus hinter sich.
„Gut. Wir sind da.“
Er schien einen Augenblick zu warten. Dann drückte er auf die Gegensprechanlage. Ein kurzes Surren, doch er reagierte nicht.
„Was ist los?“, fragte Toni.
Er sah sie an. In den letzten Wochen hatte Toni Edgar ziemlich gut kennengelernt. Kein Wunder, so viel Zeit, wie sie zusammen verbrachten. Aber nun war etwas an ihm, das sie erstaunte.
Denn zum ersten Mal wirkte es, als wäre Edgar nervös.
I.
Ich kenne deine Geheimnisse. Ich kenne sie alle. Und ich bin froh, dass ich sie kenne. Willstdu wissen, warum?
Als ich klein war, habe ich immer gedacht, die Welt ist gerecht. Ich dachte, die Guten werden belohnt und die Bösen bekommen ihre gerechte Strafe.
Was für ein Schwachsinn!
In Wahrheit ist das einzige Gesetz: Fressen oder gefressen werden. Das gilt immer. Für alles.
Es gilt auch für dich.
Vielleicht werden deine Geheimnisse ans Licht kommen. Vielleicht wird sich alles ändern. Es kommt darauf an, wie du dich verhältst.
Du merkst es nicht, aber ich beobachte dich. Und verstecke mich dabei hinter meiner Fassade, wie ich es immer schon getan habe. Ich warte ab.
Jeder verteidigt seine eigene Maske.
Weißt du eigentlich, dass hier niemand einen Scheiß da‑ rauf gibt, wer du wirklich bist? Weder die Frau mit den langen grauen Haaren. Noch das Mädchen mit den schiefen Zähnen, der Mann mit dieser hässlichen Krankenkassenbrille. Sie sehen dich, doch sie sehen nichts.
Am liebsten möchte ich ihnen allen deine Geheimnisse erzählen. Sie ihnen ins Ohr flüstern und dabei zusehen, wie die Farbe aus ihren Gesichtern weicht.
Aber das tue ich nicht. Denn ich bin kein schlechter Mensch. Gott ist mein Zeuge.
3.
Edgar zuckte zusammen, als er den schlanken Mann um die 40 sah, der die Wohnungstür im zweiten Stock öffnete. Er war so angespannt, es brauchte einen Moment, bis er begriff: Das war nicht Ralph. Wie merkwürdig, Ralphs Stimme hatte er am Telefon sofort erkannt, aber er hatte keine Vorstellung, wie er jetzt aussah.
Der Mann trug eine Brille mit Goldrand, ein hellblaues Hemd unter einem schmal geschnittenen dunklen Sakko, er hatte einen gestutzten Vollbart und brünette kurze Haare. Er wirkte angespannt, bemühte sich aber um ein Lächeln. Es war absurd, wie erleichtert Edgar für einen kurzen Moment war, nicht von Ralph in Empfang genommen zu werden. Als würde das irgendeinen Unterschied machen.
Seine Bereitschaft, Ralphs Bitte sofort nachzukommen, hatte ihn selbst überrumpelt. Es war ein Reflex gewesen.
Am liebsten hätte er am Weg her Ralph zurückgerufen und gesagt, es tut mir leid, ich kann den Jungen doch nicht suchen. Aber wenn das die Wahrheit war, wieso stand er dann hier?
„Herr Brehm?“, fragte der Mann und legte die Stirn in Falten.
Edgar nickte und deutete auf Toni. „Das ist meine Mitarbeiterin, Frau Lorenz.“
„Gustav Hammer, ich bin der Verlobte von Kirsten. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Bitte hier entlang.“
Er führte sie durch einen schmalen Flur, an dessen Wänden viele gerahmte Fotos hingen. Auf den meisten war eine hübsche blonde Frau mit einem Jungen. Sie lachten in die Kamera oder alberten herum. Vom Flur konnte man in die Küche sehen, sauber und aufgeräumt.
Am Ende des Flurs lag das Wohnzimmer. Edgar machte sich darauf gefasst, gleich Ralph zu begegnen. Doch niemand war da.
„Bitte nehmen Sie Platz“, sagte der Mann. „Ich hole Kirsten, sie hat sich kurz hingelegt. Wollen Sie einen Kaffee?“
„Ja, gerne“, antwortete Toni, Edgar schüttelte den Kopf.
Der Mann nickte, drehte sich um und verschwand in den Flur, eine Tür, die geöffnet und geschlossen wurde, war zu hören. Dann war es ruhig.
Und erst da fiel Edgar auf, dass Ralph nichts davon gesagt hatte, dass er hier war. Er hatte Edgar nur um seine Hilfe gebeten und diese Adresse genannt. Sonst nichts. Und da Edgar nicht annahm, dass Ralph sich gemeinsam mit der Frau hingelegt hatte, wurde er augenblicklich entspannt. Natürlich war Ralph nicht hier.
Es wäre auch ein zu absurdes Aufeinandertreffen gewesen, wenn man bedachte, unter welchen Umständen sie sich das letzte Mal gesehen hatten.
Er schaute sich um, jetzt aufmerksam. Der Raum war hell und freundlich, viele Grünpflanzen, ein vollgestopfter Bücherschrank, zwei weiße Kommoden, ein kleiner Esstisch mit vier Stühlen, eine hellgrüne Couch mit bunten Polstern. An der Wand ein großer, in Gold gerahmter Druck von Van Goghs Caféterrasse am Abend. Edgar liebte dieses Bild. Obwohl es häufig als Poster verramscht wurde, hatte es nichts von seinem Charme verloren. Er trat einen Schritt näher. Nein, das war kein Druck. Jemand hatte das Gemälde kopiert. Und das ziemlich gut. Er nahm seine Lesebrille und begutachtete das Bild genauer. An einem der ersten Kaffeehaustische waren die Schemen zweier Personen, sie saßen am Tisch, gesichtslos, einander zugewandt. Edgar kannte das Bild gut, er war sich sicher, diese zwei waren nicht im Original. In der unteren Ecke standen die Initialen.
„Wer ist das, J. K.?“, fragte Toni. Sie war neben ihn getreten.
Eine laute Frauenstimme war vom Flur zu hören. Was sie sagte, war nicht zu verstehen, es klang ungehalten.
Wieder öffnete und schloss sich eine Tür, der Mann kam zurück. Er verzog den Mund und hob entschuldigend die Schultern.
„Kirsten ist sofort da. Was wollte ich gleich? Ach ja, der Kaffee.“
„Ich nehme doch einen, wenn es keine Umstände macht“, sagte Edgar. Wie es aussah, würde es länger dauern.
„Natürlich.“
Hammer verschwand, Geschirrgeklapper war über den Flur zu hören.
„Du gehst einfach, wenn es zu lange dauert“, sagte Edgar zu Toni. Sie war zur Kommode getreten, auf der die Gipsskulptur einer bunt bemalten Eule Briefe beschwerte, und bedeutete ihm, rüberzukommen. Die Eule sah aus, als hätte sie ein Kind gemacht.
Kirsten und Julian König war auf einem Briefkopf zu lesen.
„Julian König“, sagte Toni, „J. K. – sind das die Initialen auf dem Bild?“
„Ja. Mein Sohn Julian hat es gemalt“, sagte eine Frauenstimme hinter ihnen. Sie hatten niemanden hereinkommen gehört und drehten sich gleichzeitig um. „Ich bin Kirsten König.“
Edgar wollte antworten, aber er schaffte es nicht. Er starrte auf den Mann neben Kirsten König. Schlagartig fing sein Herz an, wie wild zu schlagen. Wie aus weiter Ferne hörte er Toni: „Wow, das ist ein tolles Bild. Hat er die Eule auch gemacht?“
„Ja, da war er noch klein.“
Ralph hatte sich auf den ersten Blick kaum verändert.
Er war schlank, aber nicht mehr ganz so dünn wie früher. Und er trug denselben Haarschnitt, nur waren seine hellbraunen Haare mittlerweile mit etlichen grauen Strähnen durchzogen. Ein paar Falten mehr, doch noch immer dieses ausdrucksstarke, vertraute Gesicht mit den Grübchen und den erstaunlichsten Augen, die Edgar je gesehen hatte. Ohne Zweifel, Ralph gehörte zu den Männern, denen das fortschreitende Alter nichts anzuhaben schien. Als steckte da ein junger Mann in der Hülle eines älteren. Was auf Edgar nicht zutraf – er war in genau der Hülle, in die er gehörte.
Ralph war in Schwarz gekleidet, Hemd, Sakko, Hose, trotz der sommerlichen Temperatur. Als wäre er in Trauer.
„Hallo Edgar.“
Ralph löste sich von der Frau, kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Sein Lächeln war gleichzeitig wehmütig und herzlich, so dass Edgar nicht anders konnte, als ebenfalls zu lächeln. Ein nachdrücklicher Händedruck, wie bei ihrer ersten Begegnung, der Edgar für einen Augenblick vergessen ließ, dass sie aus beruflichen Gründen hier waren.
Ralph ließ seine Hand los, senkte den Blick und rückte geschäftig die Stühle zurecht. Ob er sich auch erinnerte?
Oder war ihm die Begegnung mit Edgar unangenehm?
„Wo ist Gustav?“, fragte Ralph.
„Er macht Kaffee“, sagte Edgar.
„Ich helfe ihm.“ Kirsten König verließ den Raum.
Im nächsten Moment war ihr Schluchzen aus der Küche zu hören und murmelnde tröstende Worte von Gustav Hammer.
Ralph hob entschuldigend die Schultern. Er wollte etwas sagen, da klirrte es hinter Edgars Rücken.
„Oh nein“, hörte er Toni und wandte sich um. Toni starrte erschrocken auf die zerbrochene Eulen-Skulptur am Parkettboden. „Entschuldigung, ich wollte das nicht“, sagte sie mit bebender Stimme.
Ralph eilte zu ihr und beide bückten sich, um die Scherben aufzuheben.
„Was …?“ Keiner hatte bemerkt, dass Kirsten König aus der Küche zurückgekommen war. Tränen stiegen ihr in die Augen, als sie erkannte, was zu Bruch gegangen war.
„Es tut mir unendlich leid, Kirsten. Das ist meine Schuld“, sagte Ralph rasch, bevor Toni auch nur den Mund öffnen konnte. „Mir ist die Eule runtergefallen, ich wollte sie mir ansehen. Bitte verzeih. Kann man sie kleben?“
Edgars Knie wurden weich. Ralph nahm die Schuld auf sich. Obwohl er Toni nicht einmal kannte. Nur, um sie zu schützen. Er hatte sich nicht geändert. Dieser Mann war wie Licht und Schatten – die besten und schlechtesten Seiten vereinte er in sich.
„Wie gesagt, es geht um Julian, Kirstens Sohn“, eröffnete Ralph das Gespräch, als alle Platz genommen hatten. Er dankte, dass sie so kurzfristig Zeit hatten, und schob ein paar bemühte Floskeln wie „wahrscheinlich nur schwierige Phase“ und „verwirrendes Erwachsenwerden“ ein. Dabei sah er Toni an und vermied den Blick zu Edgar.
Kirsten König hielt etwas umklammert in der Hand.
Edgar konnte nicht erkennen, was es war.
Edgar wusste nicht, wieso, doch trotz seiner Anteilnahme wirkte Ralph unbeteiligt und distanziert. Als wäre er eine Art Moderator. War Ralph der Anwalt der Frau? Hatte er letztendlich seinen Job als Hotelmanager an den Nagel gehängt? Vielleicht sogar Jus studiert? Der Gedanke gefiel Edgar. Ralph hatte immer den Wunsch gehabt, sich beruflich zu verändern.
Er bemühte sich, seine Aufmerksamkeit auf Kirsten König zu lenken. Sie war schlank und hatte eine athletische Figur. Durch ihre fließenden Bewegungen wirkte sie gleichzeitig kraftvoll und elegant. Er schätzte sie auf Anfang 40. Blonde Haare, die zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden waren, aufrechte Haltung, ein zarter Duft nach Parfum. Eine silberne Halskette mit einem Herzanhänger, perlmuttfarben manikürte Nägel. Man sah ihr an, dass sie Wert auf ihre Erscheinung legte.
„Julian ist gestern nicht nach Hause gekommen“, sagte Ralph. „Er ist niemand, der so etwas macht. Julian hat gerade erst die Matura mit Auszeichnung bestanden. Er ist ein unglaublich lieber junger Mann und sehr gewissenhaft.“
„Ja, das ist er.“ Kirsten König lächelte traurig, öffnete ihren Griff und schob ein Passfoto über den Tisch.
„Darf ich?“, fragte Edgar.
Sie nickte kaum merklich.
Der Mann auf dem Foto hatte ein schmales Gesicht, ebenmäßige Gesichtszüge, hohe Wangenknochen und einen ernsten Blick.
„Er ist wirklich erst 18?“, fragte Edgar.