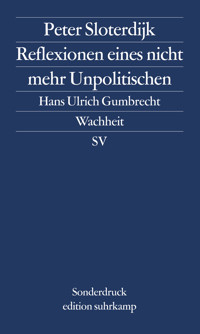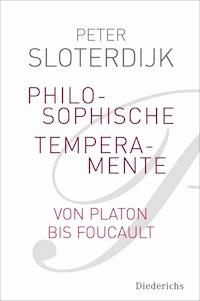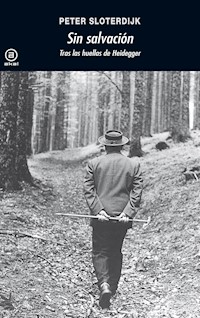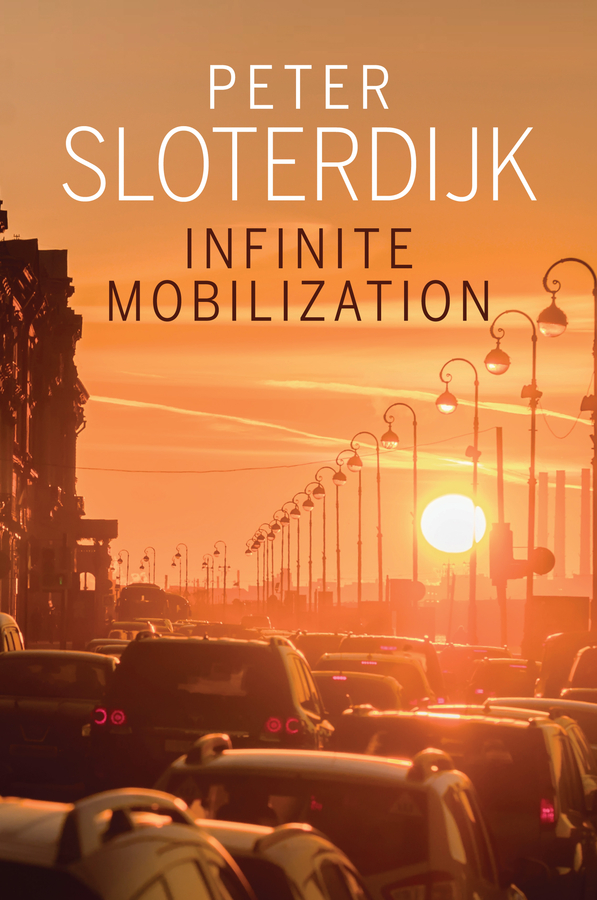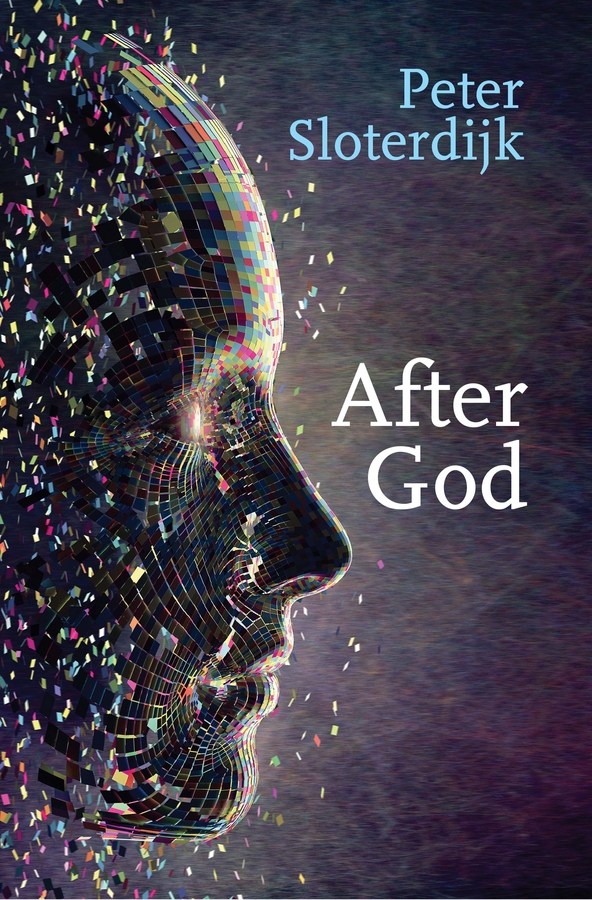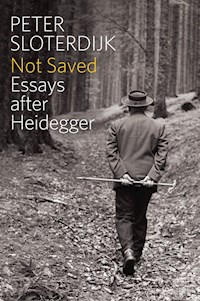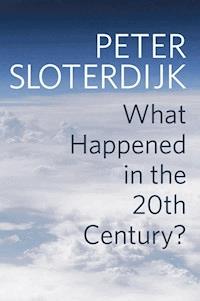11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die hier versammelten mehr als fünfzig Interviews aus fast dreißig Jahren bilden den Kern des Sloterdijk'schen Denkens. Seine Dialoge in und mit der Öffentlichkeit handeln vom Doping und der »doxa«, von Gott und der Welt, vom Design und dem Dogma. Hier ist nachzulesen, wie Peter Sloterdijk die philosophische Tradition und deren neueste Strömungen beurteilt, welche Diagnosen er dem Zeitgeist stellt, wie alltägliche Phänomene durch eine überraschende Perspektivierung einen völlig neuen Sinn erhalten. Für alle Leser, die Peter Sloterdijk kennen oder kennenlernen wollen, bieten diese Dialoge eine ebenso aufschlussreiche wie überraschende und zugleich amüsante Lektüre der geistigen und politischen Ereignisse der letzten drei Jahrzehnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
In den hier versammelten mehr als fünfzig Interviews aus fast dreißig Jahren wird das Sloterdijksche Denken in Gesprächform unmittelbar nachvollziehbar. Seine Dialoge in und mit der Öffentlichkeit handeln vom Doping und der doxa, von Gott und der Welt, vom Design und dem Dogma. Hier ist nachzulesen, wie Peter Sloterdijk die philosophische Tradition und deren neueste Strömungen beurteilt, welche Diagnosen er dem Zeitgeist stellt, wie alltägliche Phänomene durch eine überraschende Perspektivierung einen völlig neuen Sinn erhalten.
»Sloterdijk lesen heißt, unerschlossene Wissensgebiete und brach liegende Denkregionen zu erkunden.«
Dirk Pilz, Frankfurter Rundschau
Peter Sloterdijk, geboren 1947, ist Professor für Ästhetik und Philosophie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und deren Rektor.
Zuletzt erschienen im Suhrkamp Verlag: Zeilen und Tage (st 4485), Die schrecklichen Kinder der Neuzeit (2014) und
Peter Sloterdijk
AusgewählteÜbertreibungen
Gespräche und Interviews1993-2012
Herausgegeben von
Bernhard Klein
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4564
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlagfoto: Peter Rigaud/laif
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-74540-3
Inhalt
Statt eines Vorworts
Der Halbmondmensch
Warum sind Menschen Medien?
Weltfremdheit und Zeitdiagnose
Rollender Uterus
Wirf den Seelenklempner raus!
Philosophische Umstimmung
Wir fahren immer auf dem Maternity Drive
Arbeit am Ungesagten der Kultur
Über Reichtum und Selbstachtung
Lernen ist Vorfreude auf sich selbst
Von Postboten und eingestürzten Türmen
Den Kopf heben: Über Räume der Verwöhnung und das Driften in der Zeit
Gute Theorie lamentiert nicht
Es gibt keine Individuen
Verwirrte geben Verwirrung weiter
Deutsche wollen müssen: Theorie zum Jahresende
Komparatisten des Glücks
Bild und Anblick. Versuch über atmosphärisches Sehen
Das heilige Feuer der Unzufriedenheit.
Ein Team von Hermaphroditen
Unter einem helleren Himmel
Ein Freund der Mühe: Der Leser
Also sprach Sloterdijk
Väter weg von Puff und Kneipe
Die Athletik des Sterbens
Erfülle deine Genießerpflicht!
Auch ein Gott kann uns nicht retten
Ein Stecker für höhere Energien
Die Verpfändung der Luft: Zur Finanzkrise
Gibt es einen Ausweg aus der Krise der abendländischen Kultur?
Schicksalsfragen: Ein Roman vom Denken
Der Mensch in der Wiederholung
Im Hintergrund das Murmeln Babylons
Gespräche und Interviews
Statt eines Vorworts
Bernhard Klein im Gespräch mit Peter SloterdijkKarlsruhe, 17. 12. 2012
KLEIN: Herr Sloterdijk, nach längeren Recherchen habe ich eine Auswahl Ihrer Interviews aus den letzten zwei Jahrzehnten zusammengestellt, eine enge Selektion aus einer nahezu unüberschaubaren Fülle, dennoch ein voluminöser Band. Mir ist bewußt, daß Interviews nur einen kleinen Teil Ihrer publizistischen Tätigkeit bilden – hier ist die Redewendung von der Spitze des Eisberges wirklich am Platz. Sie blicken auf eine Liste von mehr als 40 Buch-Veröffentlichungen zurück. Darüber hinaus ist eine große Zahl von Aufsätzen aus Ihrer Feder in unterschiedlichsten Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden verstreut. Sie sind seit zwanzig Jahren tätig auf Lehrstühlen in Karlsruhe und Wien – die österreichische Funktion haben Sie vor nicht allzu langer Zeit niedergelegt. Daneben hatten Sie eine Agenda als Redner bei allen möglichen Anlässen, sie nehmen an einer Vielzahl von Konferenzen, Tagungen und Symposien teil. Sie hielten Lesungen aus neuen Büchern, Sie gaben Seminare, Festvorträge, Dinner Speeches. Sie führten Interviews in vielen Medien und waren mehr als zehn Jahre lang Moderator einer eigenen Fernsehsendung. Man sagt im allgemeinen »weniger ist mehr« – wie kommt es, daß bei Ihnen mehr mehr ist? Ist Ihre geradezu verzweifelte Schaffenskraft nicht auch Ausdruck einer Ohnmacht angesichts der Stummheit der Bibliothek, wie sie jeder Schriftsteller empfindet?
SLOTERDIJK: Mir scheint, die richtige Antwort auf die Frage nach den Triebfedern meiner Arbeit würde weniger ein Motiv als eine innere Verfassung offenlegen. Wenn ich auf die Jahre zurückschaue, aus denen die Auswahl dieser Gespräche genommen ist, dann ist mein erster Eindruck von mir selbst: Wehrlosigkeit, beziehungsweise Verführbarkeit. Auf mich kann man das Klischee von der endogen überschäumenden Produktivität des geborenen Autors jedenfalls nicht anwenden, ebensowenig wie das Modell der engagierten Literatur. Was man für Produktivität hält, ist in meinem Fall meistens nur die Unfähigkeit, mich gegen Vorschläge zu wehren. Eine gewisse Übernachgiebigkeit steht am Anfang. Sie ist letztlich schuld an dem ständigen Übergang von Passivität in Produktion. Allerdings wäre dieser Zustand ohne Übermut nicht zu halten gewesen. Wenn ich mich auf eine zusätzliche Aufgabe einließ, war ich offenkundig bereit, zu sagen: Das geht noch. Natürlich habe ich dabei mit der Erschöpfung Bekanntschaft geschlossen, doch stärker war ein unglaublich leichtsinniges Vertrauen auf regenerative Kräfte. Das ist im übrigen der einzig nennenswerte Unterschied zwischen früher und jetzt: Ich mache seit einer Weile die Erfahrung, wie die Regeneration sich Zeit läßt.
KLEIN: Entführen Sie uns in die Werkstatt Ihrer Kreativität. Können Sie Ihre Arbeitstechnik beschreiben und die Organisation Ihrer Bibliothek erklären. Wie erinnern Sie sich?
SLOTERDIJK: Kein Mensch kann wissen, wie sein Gedächtnis arbeitet. Ich weiß nur, daß ich ein gut aufgeräumtes inneres Archiv haben muß, selbst wenn es für Dritte als Durcheinander erschiene. Mein Archivar findet ziemlich regelmäßig Zugang zu den wichtigeren »files«, er ist ein Mitarbeiter, der mich nie enttäuscht hat. In guten Momenten holt er Dokumente hervor, von denen ich gar nicht wußte, daß sie zitierreif abgelegt sind. Er entdeckt manchmal unbewußt fast fertig geschriebene Stücke, die ich nur noch kopieren muß.
KLEIN: Inwiefern wird Ihr publizistischer Elan durch Ihre Sprachlichkeit potenziert?
SLOTERDIJK: Nun ja, Sprache wird generell als Medium der Verständigung aufgefaßt – eine Annahme, die von Schriftstellern nicht ohne weiteres akzeptiert werden dürfte. Eine kritische Minderheit sieht in der Sprache den Anfang aller Mißverständnisse. Wittgenstein meinte sogar, philosophische Probleme entstünden, wenn die Sprache feiert – was »feiern« bedeutet, wollte uns der Autor jedoch nicht verraten. Heißt es Nonsens treiben? Scheinprobleme wälzen, Überschüsse in die Luft pulvern? Jedenfalls spielte er mit der Vorstellung, man könne es genausogut bleiben lassen, die deflationäre Tendenz ist manifest. Wenn ich das lese, sehe ich einen zerknitterten Pedell ins Zimmer treten, der dem Unfug der Jungen ein Ende machen möchte. Mir kommen Anweisungen solcher Art beengend vor. Man weiß gar nicht, was noch alles möglich wird, wenn man sich aufs Feiern einläßt. Lieber halte ich es mit Wittgensteins Landsmann Egon Friedell, wenn er statuiert: Kultur ist Reichtum an Problemen. Man darf an allem sparen wollen, an den Problemen nicht.
KLEIN: Von Ihren Interviews habe ich in diversen Zeitungsarchiven und im Internet bisher ungefähr dreihundert ermitteln können. Wenn wir hier davon etwas mehr als dreißig ausgewählte Stücke präsentieren, ergibt das tatsächlich nur den über Wasser sichtbaren Teil, um beim Eisberg-Bild zu bleiben. Welche Rolle spielen die Interviews in Ihrer publizistischen Tätigkeit? Dienen sie dazu, die »Geschäftsführung des eigenen Namens« zu betreiben, wie Sie das selbst einmal formuliert haben.
SLOTERDIJK: Sehen Sie, es gab Autoren von hoher Reputation, die nie Interviews gegeben haben, und solche, die es selten taten und tun. Daneben andere, die sorglos Interviewvorschläge akzeptieren. Ich würde mich dem letzteren Typ zurechnen. Daß dabei Namens-Management betrieben wird, ist ein Nebenaspekt, den man in Kauf nimmt. An den meisten Gesprächen müßte der Leser merken, daß ich nach spätestens einer Minute dergleichen vergesse, sollte ich zuvor daran gedacht haben. Das Interview ist eine literarische Produktionsform unter anderen, ich verstehe es als eine Untergattung des Essays. Ich habe es häufig praktiziert, nachdem ich mich nach einigem Sträuben mit der Rolle des public intellectual abgefunden hatte, die sich aus dem Erfolg meiner ersten Veröffentlichungen ergab. Wie man leicht erkennt, bin ich ein behauptungsfroher Formulierer, und wenn ich mich erst einmal in den Redestrom gestürzt habe, sind Sorgen um Wirkung inexistent. Die werden nur in der Phase der Nacharbeit akut, ich bin empfindlich gegen mißglückte Wendungen.
KLEIN: Insofern sind Ihre Interviews auch keine eins zu eins »live«-Veröffentlichung. Sie werden immer von Ihnen durchgesehen.
SLOTERDIJK: Sagen wir, sie sind eine Mischform aus Improvisation und redigierter Arbeit. Wobei der redaktionelle Anteil manchmal nicht über die eine oder andere Retusche hinausreicht, in anderen Fällen geht er bis zu einer kompletten Neufassung.
KLEIN: Aus dem jungen, scheuen Sloterdijk, den man in älteren Aufzeichnungen sehen kann, wird mit den Jahren ein Star. Auf mich wirkt er wie ein Koloss der Ausdrucksgewalt, mündlich und schriftlich. Diese Schaffenskraft, so kommt mir vor, mit normalen Maßstäben ist sie nicht zu erklären. Ein Rätsel bleibt, wie Sie das bewältigt haben.
SLOTERDIJK: Daß durch mich eine Menge hindurchgegangen ist, soviel kann ich zugeben. Hin und wieder habe ich Freude an dem starken Durchzug, keineswegs immer. Mein Grundgefühl ist wie bemerkt nicht das von übertriebener Produktivität, sondern das von Empfänglichkeit für Evidenz aus allen Richtungen, was ich eben Wehrlosigkeit nannte. In der Entstehungsphase gefallen mir auch meistens die Dinge, die ich mache, ich verliere sie aber schnell aus dem Blick. Es mag seltsam klingen, Erfolgsgefühl kommt nur kurz und selten auf, sollte auch ein größeres Werk zustande gekommen sein. Ich kann solche Regungen entweder nicht entwickeln oder nicht festhalten. Vor mir liegt immer wieder das leere Blatt, das beweist, es ist noch nichts geleistet. Ich fahre also die Antennen aus und fange mit dem Neuen an. So absurd es klingt, ich habe mich meistens im Verdacht, nicht genug zu tun. Das zeigt wohl, daß ich nicht mit Rückblicks-Intelligenz ausgestattet bin. Ich sehe meine Vergangenheit nicht, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als in Bewegung zu bleiben. Vielleicht wäre das die nächste Lektion: Verlangsamung und Rückkehr in den Augenblick. Aber ich mißtraue noch solchen Suggestionen und schimpfe sie Pensionärsgedanken.
KLEIN: Es heißt, Sie hätten in jüngeren Jahren in einer Wohngemeinschaft gelebt. Wie schafften Sie es, mitten im Chaos kreativ zu sein? Viele würden sagen, in einem solchen Umfeld könnte ich nie etwas zu Papier bringen!
SLOTERDIJK: In der Münchener Wohngemeinschaft war ich nicht als Interner, aber als besuchendes Mitglied auf täglicher Basis. Was mir schon damals an mir selber auffiel, war die Fähigkeit, durch nichts aus der Bahn geworfen zu werden. Ich hatte immer ein intensives Beziehungsleben, ich war mit Frauen und Freunden eng liiert, wir waren viel aus und oft unterwegs. Seit zwanzig Jahren dominiert bei mir die Lebensform Familie, das ist auch keine reine Solitüde. Sehr gut erinnere ich mich an die Zeit, als ein wirbeliges Kleinkind durch mein Arbeitszimmer stürmte. Es amüsierte mich, ich konnte nicht gestört werden. Heute kommt mir das seltsam vor, da die Irritierbarkeit zugenommen hat. Auch durch das Telefon war ich nicht zu stören, ebensowenig durch Handwerker und Zeugen Jehovas. Ich sah in allem Anregung, nicht Unterbrechung. Ein wundertätiger Aberglaube war am Werk: Was auch immer kommt, verwandelt sich auf der Stelle in einen Teil der Produktion. In jener mittleren Phase lebte ich wie unter einer Schutzhülle, ich war meiner Themen sicher oder die Themen waren sich meiner sicher. Ich war durch nichts aus der Spur zu bringen.
KLEIN: Wenn man »Wehrlosigkeit« hört, könnte man auch an Müdigkeit und Aufgeben denken. Diese Option haben Sie offensichtlich ständig durch die Kreativität des Schreibens aus dem Weg geräumt.
SLOTERDIJK: Alte Arbeitstiere wissen, selbst Müdigkeit kann zu einer Antriebsenergie werden, sofern sie die Regeneration auslöst. Sobald man sich nur einmal richtig ausgeruht hat, sagen wir mal einen ganzen Tag lang, fühlt es sich an, als hätte man Schwung geholt für drei neue Leben. Früher habe ich den Unterschied zwischen Regeneration und Urlaub betont. Letzterer war in meiner Sicht illegitim, es durfte ihn nach meiner Ansicht gar nicht geben. Hochmütig ausgedrückt: Urlaub braucht man nur vom falschen Leben. In diesem Punkt denke ich heute anders, ich gebe die Berechtigung des Urlaubs allmählich zu.
KLEIN: Lassen Sie mich noch einmal zu Ihren Interviews zurückkommen. Aus aktuellem Anlaß steht der Suhrkamp Verlag, dem Sie seit Ihrem ersten Buch vor dreißig Jahren angehören, in den Schlagzeilen. Es gab bei Suhrkamp eine Zeit, da wäre es seinen Autoren ein Gräuel gewesen, in einem Springer-Blatt zu publizieren. Sie aber publizieren praktisch in jedem Medium, das auf Sie zukommt, fast wahllos, möchte man meinen, einmal sogar in der Bild-Zeitung und im Playboy. Wie beurteilen Sie sich selbst in diesen Zusammenhängen? Der Suhrkamp-Autor, wie hat er sich verändert seit jenen Jahren, in denen es undenkbar war, in Zeitungen der Springer-Presse Interviews zu geben?
SLOTERDIJK: Eines ist sicher, den typischen Suhrkamp-Autor gibt es heute nicht mehr, falls er je existierte. Schon früher waren es sehr idiosynkratische Charaktere, die unter demselben Dach zusammenkamen. Was sollten Bloch und Beckett miteinander gemeinsam gehabt haben? Oder Hesse und Luhmann? Die Diversität hat inzwischen eher noch zugenommen. Einige wenige Kollegen sind allerdings weiter Suhrkamp-Autoren im Sinn der sechziger oder siebziger Jahre geblieben, sie verkörpern mildere Positionen des Zu-Spätmarxismus. Daß auch sie Kinder des Zeitgeists sind, sieht man daran, wie sie fast unmerklich vom Thema Utopie aufs Thema Gerechtigkeit umgestellt haben – darin leben Reste der Frankfurter Ziviltheologie nach. Dagegen sind viele neue Temperamente im Spektrum aufgetaucht, auf der literarischen wie auf der wissenschaftlichen Seite. Der Erfolg meines ersten Buchs 1983 war ein Signal dafür, daß die Musik künftig auch anderswo spielt. Warum nicht in bisherigen Tabu-Medien? Für die überlieferten Aversionen habe ich mich mit der Zeit immer weniger interessiert. Ich bin Gesprächspartnern aus den politisch heterogensten Medien ohne ideologiekritische Hintergedanken und wenn möglich auf Augenhöhe begegnet, ausgenommen die Presse der neo-nationalistischen Tendenz – hier kam dann doch die Prägung durch das Herkunftsmilieu zum Tragen. Vielleicht hätte ich auch diese Hemmung ablegen und gelegentliche Hausbesuche bei den rechtsaußen verirrten Seelen machen sollen.
KLEIN: Viele von diesen Gesprächen knüpfen an Ihren jeweils aktuellen Publikationen an, andere gehen von Themen aus, die zur gegebenen Zeit in der Luft lagen. Haben Sie Gespräche in Erinnerung, die sich besonders einprägt haben?
SLOTERDIJK: Die meisten in unserem Band dokumentierten Gespräche und Interviews liegen so weit zurück, daß ich mich an die Situationen, in denen sie geführt wurden, nicht erinnern kann, bestenfalls diffus. Sehr lebhaft sind mir die Umstände gegenwärtig, unter denen das breit angelegte Doppel-Gespräch mit dem Leiter des Deutschen Literaturarchivs, Ulrich Raulff, über das Motiv »Schicksal« stattgefunden hat – vor etwa zwei Jahren, das erste hier in Karlsruhe, das zweite in Marbach, wo Raulff mir als Hausherr und als Hüter seiner Schätze gegenübersaß. Das waren Momente puren intellektuellen Glücks. In solchen Augenblicken begreift man deutlicher als sonst, was Literatur sein kann, auch als gesprochenes Wort. Sie ist eine syntaktische Glückstechnik. Mit der nicht-alltäglichen Zusammenfügung von zwei, drei Wörtern beginnt die Levitation.
KLEIN: Das vorliegende Buch ist ein Florilegium von pointierten Formulierungen. Man hat den Eindruck, für Sie ist der Dialog auch immer ein Metalog. In dem kommen und gehen viele Stimmen. Der äußeren Form nach sind die Interviews Zwiegespräche, doch kommt es mir vor, als fühlten Sie sich im Gespräch mit mehreren Partnern am wohlsten.
SLOTERDIJK: Ich erlebe schon das Zwiegespräch als Polylog, das heißt als Gespräch mit vielen. Der gute Interviewpartner bringt ja außer seiner eigenen Stimme in der Regel alle möglichen anderen Stimmen mit. Er ist schon selber eine akkordische Subjektivität. Die erzeugt beim Befragten unweigerlich Resonanzen. Wenn etwas existiert, was mir überhaupt nicht liegt, so ist es Phrasen-Austausch im Verlautbarungston.
KLEIN: Es gibt in diesem Buch garantiert keine Stelle, von der man sagen könnte, es würden Phrasen verlautbart.
SLOTERDIJK: Vielleicht kann ich Ihnen erklären, woher meine Abneigung gegen die Phrase kommt. Seit jeher leide ich unter einer kindlichen Furcht vor Langeweile. Am langweiligsten schien mir seit jeher das Reden in fertigen Sätzen, wie man sie auf dem akademischen Diskursmarkt hört, um von den Preß-Spanplatten vom politischen Baumarkt zu schweigen. Damit wir uns nicht mißverstehen, ich kenne eine gute Langeweile, die beruhigt und integriert. Man kann sich ihr anvertrauen wie einer alten Erzieherin – ich denke an die subtile Langeweile einer Landschaft, die befreiende Langeweile des Meeres, die erhabene Langeweile des Gebirges und manchmal die geduldfördernde Langeweile großer Erzählliteratur. Eine bösartige Langeweile geht von der zudringlichen Borniertheit stolzer Phrasenbesitzer aus, sie ist wirklich so tödlich wie ihr nachgesagt wird. Ich weiß nicht, ob Sie solche Situationen kennen: Man wechselt ein paar Worte mit einem Menschen, der dir nicht einmal a priori unsympathisch sein muß. Nach drei, vier ausgetauschten Sätzen fühlst du dich lebensmüde. Es ist, als ob die vitale Batterie binnen Sekunden entleert worden wäre, und du weißt nicht warum. Vor dieser Art von Langeweile schrecke ich zurück wie vor Tod und Teufel, sie ist ein pathologischer Zustand, in dem die Freude am Gespräch, am Meinungsausdruck, am Etwas-sehen-und-sagen-Können, ja am Leben überhaupt verloren geht. Das Symptom der schlimmen Langeweile ist der Sprachzusammenbruch. Mit einem Mal wollen die Wörter nicht mehr in der richtigen Reihenfolge herauskommen, du schaffst gerade noch ein Nomen, aber das Verbum folgt nicht mehr, ein fürchterliches Gefühl von Nichts-mehr-sagen-Wollen greift um sich – was man auf keinen Fall mit dem guten Zustand des freien Nichts-zu-sagen-Habens verwechseln darf. Ich nähere mich manchmal diesem gefährlichen Punkt, wenn ich merke, daß ein Gesprächspartner völlig ausgelaugte Fragen aus dem Koffer holt, Fragen, die ihrem Wesen nach Verdummungsangebote sind. Deren Subtext lautet immer: Komm endlich mit ins Elend! Unter großen Anstrengungen habe ich gelernt, solchen Attacken auszuweichen, indem ich die Frage umformuliere, bis ich wieder Lust habe, auf sie zu reagieren.
KLEIN: Es gibt also Fragen, die den Befragten wie Vampire aussaugen?
SLOTERDIJK: Es gibt solche Fragen und solche Fragende. In theosophischen Kreisen nannte man negativ geladene Leute dieser Art prana suckers, Lebensatemvampire. Manchmal ist die mentale Erschöpfung der Fragesteller von Anfang an deutlich. Im besten Fall versuche ich dann, wie ein Animateur zu antworten oder wie der Notarzt.
KLEIN: Ich bin absolut sicher, daß es in diesem Buch kein Gespräch gibt, in dem Sie den Notarzt spielen mußten, und an Sprachzusammenbruch wird niemand denken, der diese Stücke liest. Hingegen frage ich mich, ob nicht hin und wieder beim Gegenüber eine Art Respekt, um nicht Ehrfurcht zu sagen, zu spüren ist.
SLOTERDIJK: Wenn das je der Fall war, wäre es falsch gewesen, dabei stehenzubleiben. Gespräche vor der Öffentlichkeit sind eine Sportart, bei der es nicht darum geht, zu gewinnen, sondern auf höherer Ebene unentschieden zu spielen. In jedem besseren Frage-Antwort-Fluß erinnern sich die Gesprächspartner gegenseitig an ihre intelligenteren Möglichkeiten. Man entdeckt die Freude, navigationsfähig zu sein in einem Problemraum.
KLEIN: Ich möchte noch einmal auf den Enthusiasmus zu sprechen kommen, den man in Ihren Äußerungen oft wahrnimmt, ob man ihn nun jugendlich nennt oder nicht. Die Explosion Ihres Ausdruckstriebs setzte nach Ihrem Indienaufenthalt im Frühjahr 1980 ein. Kann es sein, daß damals, nach Indien, eine gleichsam archaische vorsprachliche Begeisterung mit den späteren akademischen Prägungen zusammenkam? Wahrscheinlich ist Ihnen diese Frage schon öfter gestellt worden. Ich finde es faszinierend, daß es danach für Sie kein Zurück mehr zu geben schien. Mit einem Mal war nur der Weg zur Produktivität noch offen.
SLOTERDIJK: Sagen wir eher der Weg zur praktischen Prüfung eines Vorgefühls. Mir war bis dahin wohl latent bewußt, daß ich wie hinter vorgehaltener Hand lebte. Nach 1980 war es soweit, daß ich anfangen konnte, mich weiter vorzuwagen. Damals habe ich meinen Ton gefunden, falls man das so unbedarft ausdrücken kann. Es war, als hätte ich das Instrument entdeckt, auf dem ich meine Art von Musik machen sollte. Das Instrument wurde gestimmt in dem Moment, als ich begriff, worin meine Chance besteht.
KLEIN: Das möchte man natürlich näher erklärt haben.
SLOTERDIJK: Lassen Sie mich's versuchen. 1947 geboren, blieb ich ein von der Vaterseite her so gut wie völlig ungeprägter junger Mann. Zur rechten Zeit sah ich ein, ich sollte mich zu einer Art von Selbstbevaterung entschließen. Was Bemutterung ist, vorgefunden oder gewählt, und wie man sie allmählich zurückläßt, das wußte ich schon ziemlich gut. Was Bevaterung bedeutet, wußte ich nicht. Ich mußte mir meine Väter oder Instruktoren zusammensuchen, dazu war es nötig, sich in der Welt umzusehen. Väter sind Vorbilder, nicht wahr, die man aufsucht, um etwas zum Überwinden zu haben, irgendwann später? So machte ich mich am Leitfaden der Bewunderung auf den Weg. Niemand, der etwas zu sagen hatte, war vor meiner Bewunderung sicher – auch nicht vor meiner Enttäuschung. Der Durchbruch kam, als ich verstand, daß ich mir selber die Welt erzählen sollte. In meinem Fall konnte das nur dadurch geschehen, daß ich mich selber an die Hand nahm – als Lehrer und Schüler in einer Person. Irgendwie gelang es mir, mich in einen größeren und einen kleineren Part zu verdoppeln. Also habe ich mich selber an die Hand genommen und mir die Welt und das Leben erklärt. Offensichtlich hat das vielen Beobachtern eingeleuchtet, die gerne mitlasen, was ich mir zu sagen hatte. Sie amüsierten sich wohl darüber, wie ich dem Junior zuliebe in die Rolle des alten Weisen schlüpfte. Ich denke noch immer, dieses Vorgehen war nicht die schlechteste Zugangsweise zur philosophischen Sphäre. Sie empfahl sich in meinem Fall besonders, sie entsprach der Lage eines jungen Menschen, der wie so viele aus seiner Generation mit dem Gefühl starker kultureller Unsicherheit aufgewachsen war.
KLEIN: Was trieb Sie nach der Dissertation bei den Hamburger Professoren gen Osten? Was haben Sie von Bhagwan Shree Rajneesh bzw. Osho gelernt? Warum sind Sie damals nach Indien gegangen und nicht an der Universität geblieben?
SLOTERDIJK: Das ist eine längere Geschichte, ich kann den Ablauf nur kurz andeuten. Ich bekam um 1974 zeitweilig eine Vertretungsassistentenstelle an der Hamburger Universität angeboten, ich akzeptierte und übersiedelte. Das folgende Jahr in Hamburg wurde für mich eine sehr fruchtbare Zeit, ein Wendejahr in meinem Leben. Die damalige Nähe zu Klaus Briegleb, dem Ordinarius für neuere deutsche Literatur, war für mich ein Glücksfall, ich kannte ihn aus München, er war in meinen Augen, und nicht nur in meinen, der herausragende Literaturwissenschaftler des Landes und in den Hamburger Jahren auf der Höhe seiner Kunst. Und genauso glücklich war die Konstellation mit den älteren Kommilitonen, ein intellektueller Spiralnebel mit enormen Ladungen, auch gruppenerotisch nicht uninteressant. Was die Universität anging, wußte ich von da an, das ist nicht mein Maulwurfshügel. Als mein Vertrag auslief, bin ich nach München zurückgegangen. Anschließend begannen die wilderen Gruppenjahre: Wohngemeinschaft, Psychotherapie, Meditationsgruppen, Neue Linke, Neuer Mensch. Ständig spukten solche Motive durch den Raum. Man glaubte damals an die Theorie wie an eine messianische Kraft. Die Zeit zwischen 1974 und 1980 wurde die Experimentierphase meines Lebens. Die Dissertation war geschrieben, viele Möglichkeiten standen offen, das einzige, was ich eindeutig wußte, war, daß ich in die Universität nicht zurückgehe. Sollte es ein Leiden an der Unbestimmtheit geben, so war es mir damals unbekannt. Ich empfand die Freiheit, noch einige Orientierungsjahre vor mir zu haben, als beflügelnde Nichtfestlegung.
KLEIN: Das erklärt aber nicht, wie es es kam, daß Sie den Weg nach Indien einschlugen.
SLOTERDIJK: Die Indienreise war seit den Tagen des seligen Hermann Hesse im spirituellen Curriculum des Westens diskret vorgezeichnet. Auch wenn man Marx und Lenin und Marcuse gelesen hatte, die Morgenlandfahrt fehlte. Eines Tages war sie fällig, in ihr kam alles zusammen, was damals zählte, der therapeutische Aufbruch, der spirituelle Aufbruch, der Counter-Culture-Aufbruch, außerdem stand über dem Unternehmen das Epochenthema »freie Liebe« wie eine Leuchtreklame am Times Square. Man hätte ein Idiot sein müssen, es nicht zu probieren. Überdies traf man in Indien halb Frankfurt wieder, und halb München. Meine besten Adorno-Kolloquien erlebte ich am Rand des Ashrams von Poona. Es begann eine unvorstellbar intensive Zeit, weil man in Indien nur Menschen begegnete, die auf ihre Weise mutig waren, offensiv, konfrontativ, freigiebig mit Gefühlen, Beobachtungen und Berührungen. Heute wird das Klima vor allem vom Bedürfnis nach Absicherung definiert, das kannte man seinerzeit nicht. Natürlich waren damals alle verrückt, das kann man im Rückblick nüchtern feststellen, doch daß sie mutig waren bis zum Exzeß, muß man ihnen lassen. Nach Indien zu gehen zu den Bedingungen jener Jahre, das war wirklich ein Sprung, ein Bruch mit der Hintergrundkultur.
KLEIN: Wenn man alte Videos einlegt, in denen die Augen von Osho dich anblicken, dann schwingt noch heute eine Dimension jenseits der europäischen Akademia mit. Wie kam es, daß dieser Guru zu der damaligen Zeit eine so große Rolle spielte?
SLOTERDIJK: Inzwischen spielt er für mich keine Rolle mehr, eine distanzierte Dankbarkeit abgerechnet. Man muß bedenken, ich gehöre zu denen, die aus dem Osten zurückgekommen sind, um hier zu bleiben. Verändert war ich wohl, aber nicht verindert. Im Gegenteil, ich wurde seither erst ganz bewußt zum Europäer. Die Impulse von dort habe ich in mein Leben eingebaut, diskret. Sie sind jetzt nur noch in verwandelter Gestalt präsent, als leise Schwingungskomponenten.
KLEIN: Sie leben seitdem »unter einem helleren Himmel«?
SLOTERDIJK: So habe ich das wohl einmal ausgedrückt. Nach der Rückkehr aus Indien habe ich eine Privatmeteorologie entwickelt. Ich fühlte mich vom Wetterbericht für Mitteleuropa nicht mehr persönlich betroffen.
KLEIN: Könnten Sie denn erklären, wie man in die Region unter dem helleren Himmel gelangt? Gibt es eine Wegbeschreibung für Menschen, die in Krisen stecken und auf der Suche sind nach inneren Kräften?
SLOTERDIJK: Ich will jetzt keinen Besinnungsaufsatz über die Verschränkung von Individuum und Gesellschaft schreiben, es dürfte aber evident sein, daß die Aufhellung des Weltgefühls mit einer Veränderung des Modus von Vergesellschaftung zu tun hat. Arthur Koestler hat am Ende des Zweiten Weltkriegs einen luziden Essay veröffentlicht, »Der Yogi oder der Kommissar«, in dem er die beiden basalen Antworten des 20. Jahrhunderts auf das Weltelend einander typologisch gegenüberstellte, die Antwort des Yogi, der den Weg nach innen wählt, ohne nach äußeren Voraussetzungen zu fragen, und die Antwort des Kommissars, der nie müde wird, die These zu wiederholen, erst müßten die sozialen Strukturen völlig verändert sein, ehe man an die Emanzipation der Einzelnen denken könne. Gegen Ende der siebziger Jahre, als die sozialrevolutionären Illusionen des Jahrzehnts davor Schiffbruch erlitten hatten, stand eine Lücke offen, die für die Yogi-Option neue Spielräume bot. Daran können sich die meisten heutigen Zeitgenossen nicht mehr erinnern. Wir erleben gegenwärtig wieder eine Ära der Kommissare, obschon nicht mehr solcher vom Schlag der Kommunisten, die Koestler vor Augen hatte. Die jetzigen Akteure des Sozialdemokratismus sind überzeugt, alle Übel des Lebens seien durch die Ausweitung der Staatszone zu kurieren. Der Absolutismus des Sozialen sickert wieder bis in die kleinsten Ritzen. Mit der klassisch indischen Weltauffassung ist der Kommissars-Ansatz nicht kompatibel. Dort neigt man zu der Ansicht, daß zwar jedes Individuum das Potential zu einer Revolution in sich trägt, jedoch zu einer Revolution in der ersten Person. Mit dieser unverzollten Instruktion im Gepäck bin ich aus Indien nach Europa zurückgekehrt, ich habe sie nie ganz aufgegeben. So war der Konflikt mit den Kommissaren hier vorprogrammiert. Der verlief aufs Ganze gesehen ziemlich kurios, vielleicht auch, weil ich nicht als phänotypischer Yogi das Wort ergriff, weltabgewandt, idealistisch und esoterisch, sondern sehr von dieser Welt, doch mit einem anderen Weltbegriff. Seit dreißig Jahren steht der Gegensatz mehr oder weniger unaufgeklärt im Raum. Hin und wieder kam es zu Zusammenrottungen von neuen Kommissaren gegen einzelne meiner Interventionen – denken Sie an die seltsam mißratene Debatte vor zwei Jahren über die demokratische Neudefinition von Steuern aus dem Geist der Gabe. Der Vorgang war in gewisser Weise komisch. Da hat eine große Koalition aus Kommissaren einen Gedanken, der offensichtlich vom Yogi-Pol kam, niedergeknüppelt. Die Leute verstehen noch immer nicht, daß es mehr als einen Fortschritt gibt, mehr als eine Revolution, mehr als eine Anthropologie.
KLEIN: Wie wirkt es sich menschlich für Sie aus, wenn Ihnen neben mancher Kritik auch viel Bewunderung entgegenkommt? Was macht das mit Ihnen, alle die Projektionen Ihrer Leser und Fans zu tragen?
SLOTERDIJK: Ich sage jetzt etwas sehr Seltsames: Zuspruch von außen empfinde ich oft gar nicht. Ich fürchte, ich bin, was Applaus angeht, seelenblind. Es ist mir nicht entgangen, daß manche Leser meine Arbeit schätzen, sowenig mir entgangen ist, daß es Versuche gegeben hat, sie zu entwerten. Den Beifall habe ich nicht überhört, aber er bringt mich nicht aus der Fassung, nur selten haben einzelne Leserstimmen mich tiefer berührt.
KLEIN: Das klingt für mich sehr paradox. Sie nehmen ja zugleich in Anspruch, auf äußere Reize sehr empfindlich zu reagieren.
SLOTERDIJK: Vielleicht sollte ich das etwas näher erklären. Ich spreche jetzt von der öffentlichen Wirkung von Büchern. Sehen Sie, bevor eine neue Arbeit die Werkstatt verläßt, muß ich sie erst einmal mir selber abnehmen. In diesem Moment bin ich mein Publikum, als solches will ich überzeugt werden. Meine Zustimmung ist nicht umsonst zu haben. In dem Augenblick, in dem ich etwas aus der Hand gebe, muß ich auch eine Vorstellung davon besitzen, auf welcher Stelle der Wertskala die Sache steht. Wenn es der Autor nicht weiß, wer sollte es sonst wissen? Ich glaube nicht an das Klischee vom somnambulisch vor sich hin produzierenden Verfasser, der wie ein reiner Tor am Schreibtisch Werke in die Welt setzt und erst durch die aufgeregte Reaktion der anderen erfährt, daß sie etwas taugen. Viele Künstler verstecken sich heutzutage hinter solchen Ich-weiß-nicht-Spielchen, indem sie so tun, als könne das hohe Publikum allein das Urteil über den Wert eines Werkes fällen. Ich denke, die Selbstbeurteilung des Autors, wenn er diesen Namen verdient, trifft meistens die Sache genausogut wie das Leserurteil, oft besser. Vielleicht muß man einen Rabatt für die übliche Selbstüberschätzung abziehen, danach erhalten wir einen realistischen Wert.
KLEIN: Das hieße, exzessive Selbstüberschätzung tritt gar nicht erst auf, wo die Urteilskraft nach innen ausreichend entwickelt ist. Dann wird man vom Urteil der Mitwelt auch nicht allzusehr überrascht. Doch dieses Über-den-Tellerrand-des-eigenen-Werkes-schauen-Können scheint eine Kunst zu sein, die nicht jedem gegeben ist.
SLOTERDIJK: Sagen wir so: Veröffentlichen heißt sich selber etwas durchgehen lassen. Das setzt ein internes Urteil über das hinreichend Gelungen-Sein eines Gebildes voraus. Ein solches Urteil fällt nicht, weil man im Rausch blinder Selbstliebe alles Eigene herrlich findet, im Gegenteil. Eher befindet man sich in einer starken Anspannung des Selbstzweifels, nur wenig darf die Schranke passieren. Kommt es zu dem Schluß, daß es so stehenbleiben kann, dann hat die Vorzensur ihre Arbeit getan. Das schließt nicht aus, daß andere Leute mit anderen Maßstäben zu anderen Wertungen gelangen. Der Autor ist eigentlich nur der, der »fertig« sagt. Alles übrige können die anderen auch, allein der Autor ist derjenige, der die Arbeit an einer Sache abbricht. Wann es soweit ist, bestimmt eine intime Evidenz.
KLEIN: Ihr Stil ist barock und nicht selten fulminant, hierin kommen Bewunderer und Kritiker überein. Inwiefern spielt Klarheit eine Rolle in Ihrer Auffassung von philosophischer Prosa?
SLOTERDIJK: In dieser Angelegenheit ist mein Urteil befangen. Ich selber empfinde meine Sachen als durchweg klar. Ich arbeite häufig mit Abkürzungen und Übertreibungen, technisch gesprochen mit Ellipsen und Hyperbeln, zwei Stilmitteln, deren Nützlichkeit für die Verdeutlichung von Gedanken man nicht abstreiten kann. Von manchen Kollegen wurde mir ein zu reichlicher Gebrauch von Metaphern vorgeworfen, worauf ich antworte, daß Begriff und Metapher keine Gegensätze sein müssen, oft stellen Metaphern Begriffe in einem höheren Zustand dar. Natürlich gibt es Theoretiker, die in einer anderen Rationalitätskultur sozialisiert wurden und mit einer assoziativeren Sprache nicht zurechtkommen. Sie sind gewöhnt, darüber zu diskutieren, ob eine Aussage wie: »alle Junggesellen sind unverheiratete Männer« als analytisches Urteil gelten darf. Bei meinen Sprüngen und Hopsasas bleiben sie mißtrauisch und neigen dazu, »Gedankendichtung!« zu rufen oder »Metaphernspuckerei!«.
KLEIN: Meinen Sie, daß das Live-Denken im Gegensatz zum redigierten Denken höher zu bewerten wäre, weil es schwieriger ist?
SLOTERDIJK: Schwieriger nicht unbedingt, doch seltener. »Live« ist ein Begriff aus der Übertragungstechnik, die uns Teilnahme an entfernten Ereignissen erlaubt. In der Regel ist man ja nicht dabei, wenn irgendwo gedacht wird. Und meistens ist es lange her, daß Denken stattfand. Wenn man Glück hat, gibt es Aufzeichnungen davon, die man viele Jahre später nachlesen darf.
KLEIN: Das Wort »nachlesen« bringt mich jetzt zu einer wesentlichen Frage. Ich habe den Eindruck, für Ihr Werk beginnt seit einer Weile die Phase der Aufarbeitung, noch zögernd, doch in Ansätzen erkennbar. Ihr in Buchform publiziertes Œuvre macht bisher nur den kleineren Teil Ihrer Arbeiten sichtbar. Die vorliegende Interviewsammlung gibt eine erste, extrem selektive Andeutung von dem, was Sie im Tagesgeschäft der Zeitkritik nebenbei produziert haben. Was Ihre Vorträge und Aufsätze betrifft, die im letzten Vierteljahrhundert entstanden, gibt es meines Wissens noch keinen Editionsplan, er müßte eine Reihe umfangreicher Bände vorsehen. Der Löwenanteil Ihres unbekannten Werks entfällt aber, soweit ich sehe, auf Ihre akademischen Vorträge, von denen nur die Hörer eine Vorstellung haben, die dabei waren. Da liegen vermutlich große Schätze an Live-Denken verborgen. Was haben Sie damit vor?
SLOTERDIJK: Zwanzig Jahre lang habe ich an der Akademie der Bildenden Künste in Wien ohne Wiederholungen zu vielen Themen vorgetragen, die Tonbänder davon müßten in diversen privaten und hochschuleigenen Archiven herumliegen. Auch die öffentlichen Veranstaltungen in Karlsruhe sowie die dortigen Seminare sind zum großen Teil dokumentiert, aber nicht erschlossen. Nur ein einzelner kompletter Vortrag, die Schlußvorlesung des Zyklus über das klassische griechische Theater im Saal der Landesbibliothek von Karlsruhe, ist 1999 als Hörbuch bei supposé erschienen – eine Deutung des sophokleischen Dramas unter dem Titel »Ödipus oder Das zweite Orakel«. An dem Stück kann man so ungefähr ablesen, wie es zuging, wenn ich am Live-Pol frei agieren konnte. Es gab vor längerer Zeit auch einmal eine Audio-Kassette aus dem Auer-Verlag mit sechs Mitschnitten von Vorträgen, aber denen lagen, soweit ich mich erinnere, fertige Manuskripte zugrunde. Ich schätze, es liegen an die 1500 Stunden mündlicher Rede in den Archiven. Bedauerlicherweise hat der Suhrkamp Verlag sich nicht dazu entschließen können, die Betreuung der Dokumente zu übernehmen. Dafür hat es beim Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe einen ersten Anlauf gegeben, die Sachen zusammenzutragen und zu archivieren. Man hat ein Gutteil der Dokumente digitalisiert und durchgehört, um sie zu indexieren, in der Absicht, anhand der notierten Schlüsselworte zu entscheiden, welche Stücke sich für eine Transkription eignen. Ich vermute, daß man das meiste ohne Bedauern vergessen darf, aber manches wäre es vielleicht wert, hervorgeholt zu werden. Im Moment sieht es so aus, als könnte man damit in den nächsten Jahren vorankommen. Es gab übrigens zu der damaligen Zeit in Wien und in Karlsruhe ein treues Publikum, teils aus der Hochschule, teils aus der Stadtöffentlichkeit, das mir durch seine Anwesenheit die Illusion erlaubte, nicht ganz in den Wind zu sprechen. Leider war ich nie in der Lage von Meister Eckart, wenn er behauptete, er sei des Gottes so voll gewesen, daß er dem Opferstock gepredigt hätte, wären keine Hörer da gewesen. Ich saß gern einem Publikum gegenüber und ließ mich durch seine Anwesenheit inspirieren.
KLEIN: Nicht zu vergessen, das Philosophische Quartett ist noch in den Archiven des ZDF verfügbar.
SLOTERDIJK: Wenn ich richtig zähle, haben wir in zehneinhalb Jahren 63 Sendungen zustande gebracht. Die Auftritte in der eigenen Fernsehsendung bilden eine Sonderkategorie, die mit meiner übrigen Arbeit praktisch nichts zu tun hat. In den Quartetten habe ich mich immer sehr zurückgenommen, bis auf ein paar Ausnahmen, wo ich ein wenig heftiger fabulierte. Ansonsten war ich meistens der verhaltene Moderator, der seine Hauptsorge darin sieht, den Gästen einen optimalen Rahmen anzubieten. Es war Glanzlosigkeit als Leistung, wenn man so will, das hatte auch einen Reiz.
KLEIN: Wenn ich jetzt noch kurz Kant aus der »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« zitieren darf: »Diese Herablassung zu Volksbegriffen ist allerdings sehr rühmlich, wenn die Erhebung zu den Prinzipien der reinen Vernunft zuvor geschehen und zur völligen Befriedigung erreicht ist, und das würde heißen, die Lehre der Sitten zuvor auf Metaphysik gründen, ihr aber, wenn sie fest steht, nachher durch Popularität Eingang verschaffen.« Konnten Sie sich bei Ihrer Arbeit als öffentlicher Intellektueller mit dieser Aussage identifizieren?
SLOTERDIJK: Ich werde den Eindruck nicht los, daß Kant sich hier viel schlichter stellt, als er wirklich dachte. Er gibt vor zu glauben, die Philosophie sei eine resultative Wissenschaft, die bei letzten Einsichten Halt macht. Die dürfte man dann natürlich ohne Scheu popularisieren. Aber so liegen die Dinge nicht. Ich nehme an, wüßten die Philosophen irgend etwas Relevantes mit völliger Sicherheit, es wäre inzwischen durchgesickert. Seit Kant hatten die Denker zwei Jahrhunderte Zeit, sich einig zu werden, sie wurden uneiniger denn je. Das Modell der Ex-cathedra-Popularisierung metaphysisch gesicherter Doktrinen läßt sich auf die geistige Situation der Gegenwart nicht anwenden. Kein Mensch weiß mehr, was allgemein zwingende »metaphysische Grundlagen« sein könnten. Die Theoretiker sind sich nicht einmal einig, ob das Wort »Grund« ein sinnvoller Ausdruck ist. Das ganze Geschäft des »Grundlegens« ist problematisch geworden, man hat den Eindruck, jeder Grundleger dreht sich im eigenen Kreis. Im übrigen ist an dem symptomatischen Metaphernfehler in der von Ihnen zitierten Bemerkung Kants abzulesen, daß er selber unschlüssig war, in welcher Gegend die sogenannten Prinzipien zu suchen wären: Zuerst soll man sich zu ihnen »erheben«, zwei Zeilen später findet man dieselben Prinzipien wieder ganz unten als den sicheren Boden, auf dem die populäre Lehre »fest stehen« soll. Die Debatte über das »Gründen« läuft seit einiger Zeit leer. Mir scheint, am besten wurde sie resümiert durch den Le Corbusier zugeschriebenen Ausspruch: »Die Grundlage ist das Fundament der Basis.«
KLEIN: Aber was ist es dann, was ein Philosoph mit der breiteren Öffentlichkeit noch teilen könnte?
SLOTERDIJK: Ich neige dazu, die Philosophie nicht als spezialisiertes Fach, sondern als Modus des Bearbeitens von Themen aufzufassen. Wer more philosophico denkt, stellt positives Wissen vor den Hintergrund von Nicht-Wissen und in den Kontext von allgemeinen Sorgen. Dabei entsteht ein Pendeln zwischen Affirmationen und skeptischen Momenten. Wenn man das längere Zeit betreibt, kann man sich davon überzeugen, daß wir in unserem Gedankenaustausch viel mehr das Nicht-Wissen gemeinsam haben als das effektive Wissen. Dieser Modus des Denkens läßt sich von den nicht-professionellen Teilnehmern solcher Übungen mit der Zeit übernehmen. Dabei lernt man Trittsicherheit in unsicherem Gelände. Für ein solches modal philosophisches Verhalten stehen viele Wege offen. Es kann auch künftig ein größeres Publikum berühren, während es unrealistisch wäre zu erwarten, daß die Philosophie als akademisches Fach aus ihrer Klausur noch einmal herauskommt. Es gibt glücklicherweise eine Reihe von gut etablierten Disziplinen wie die Anthropologie, die Linguistik, die Ethnologie, die Psychologie, die Systemik, neuerdings auch die Neurologie und vor allem die Kulturtheorie, die von der Logik ihrer Gegenstände her mehr oder weniger philosophie-nahe arbeiten oder arbeiten könnten. Ihre Akteure wissen ziemlich genau, was sie können und wo die Grenzen ihrer Kunst liegen. An diesen Befunden kann man anknüpfen. In den genannten Fächern sind die Archive gefüllt mit Erkenntnissen, die sich zu einer nach-skeptischen Darstellung vor dem Publikum eignen. Ich tue seit längerem nichts anderes mehr.
Der Halbmondmensch
Im Gespräch mit Elke Dauk[1]
DAUK: Herr Sloterdijk, die Kritik der zynischen Vernunft wirkte vor zehn Jahren wie ein ungeheurer Appell. Wie erklären Sie sich diese außergewöhnliche Wirkung?
SLOTERDIJK: Das Buch war kein Appell, es war eine Performance. Es hat das, wovon es gesprochen hat, auf seinen eigenen Seiten zelebriert. Es war, es ist, es bleibt ein sehr fröhliches Buch, ungewöhnlich angreiferisch an einer Stelle, wo man es nicht erwartet. Die Kritik liegt in der Tonart. Es ist angesichts seines Sujets erstaunlich lustig; es enthält eine Art von Phänomenologie aller Witze, die über den Menschen überhaupt gemacht werden können in den neun Hauptfeldern von Witzigkeit, die in dem zweiten Band durchbuchstabiert sind.
Und vor allem, es hat dazu beigetragen, die Verschwörung der Verdrossenheit, die linke Larmoyanz im Jahr '83 aufzusprengen. Die Kritik der zynischen Vernunft war der Versuch, die Über-Ich-Katastrophe der europäischen Kultur in einer phänomenologisch breiten Studie zu rekonstruieren, eine Über-Ich-Katastrophe, die damit einsetzt, daß unerreichbar hohe Ideale an die Menschen herangetragen werden. Schon in der Antike beginnt der Prozeß der Über-Ich-Aufrichtung, in dessen Abbruchphase wir heute leben. Was heute europäische Menschen als universales Gefühl von Demoralisierung erleben bis in die kleinsten Verästelungen politischer Unkorrektheit hinein, die den Zeitgeist so sehr bestimmen, sind Fernwirkungen eines Idealisierungsprozesses, der in der griechischen Philosophie und später mit der christlichen Tugendlehre eingesetzt hat und der zu einer Destruktionsgeschichte sondergleichen hat führen müssen.
DAUK: Inwiefern war denn die Kritik der zynischen Vernunft eine Kritik der Aufklärung?
SLOTERDIJK: Es ist nicht Kritik an der Aufklärung, sondern eine Weiterführung der Aufklärung in eine selbstreflexive Stufe; es ist Aufklärung über die Aufklärung, Reflexion über Grenzen, die in einem ersten Versuch notwendigerweise auftreten, die bei einem zweiten Versuch erkannt werden und die bei einem dritten Versuch bereits Berücksichtigung finden. Dritter Versuch ist Gesellschaftsbildung nach den schlechten Erfahrungen, die die Gesellschaft mit ihren eigenen Naivitäten gemacht hat. Die Kunst, Menschen in großen Gemeinschaften zum Zusammenleben zu überreden, ist nach wie vor nicht gelernt. Ob sie auf dem Wege der klassischen, der in der Antike zuerst entwickelten Idealismen und Opferkonzeptionen überhaupt gelingen kann, ist so fraglich geworden, daß man mit neuen Versuchen rechnen muß.
DAUK: War es nicht auch der Versuch, die zerstörerische Vernunft in einem Gegenmodell aufzuheben, das Kynismus und Diogenes repräsentieren?
SLOTERDIJK: Es geht nicht um die Aufhebung von zerstörerischen Elementen. Es geht darum, daß ich den Kynismus hervorgehoben habe als eine Art existentialistische Revolte, die bereits in der Antike gegen die Stadt und gegen den Staat, also gegen die beiden repressiven Großformen, gegen die »politischen Monstren« des Altertums sich formuliert hat. An diesem Modell können sich Menschen bis auf den heutigen Tag orientieren, wenn sie begreifen, daß der Mensch erst einmal ins Leben gerufen sein muß, bevor der Staat ihn verwenden kann. Die moderne Erziehung, die moderne Aufklärung, das moderne Staatswesen setzen den Menschen immer schon als gegeben voraus und denken nicht darüber nach, wie er geboren wird, wie er sich selbst erzeugt. Der alte Kynismus war in meinen Augen ein Versuch, vielleicht mit ungeeigneten Mitteln, eine Sphäre zu verteidigen, in der der Mensch nicht zu schnell an den Staat ausgeliefert wird, nicht zu schnell Agent der großen Strukturen wird. Er wollte an eine Lebensform erinnern, die damals mit dem Begriff Selbstbehauptung verknüpft wurde, eine Lebensform, in der der Mensch erst einmal entsteht und nicht schon vernutzt und auf Mission gebracht wird.
DAUK: Wollten Sie damit die Gesellschaftstheorie zu einer Lebenskunst, genauer einer Erotik hin überschreiten?
SLOTERDIJK: Es ist nicht nur Gesellschaftstheorie, was ich treibe, es ist ein existenzphilosophischer Ansatz, der von sich her die gesellschaftliche Welt beobachtet als eine vielfach gebrochene Landschaft von Obsessionen. Das Buch ist ein Befreiungsmanifest, es führt ein Stück der deutschen Philosophie fort, soweit sie Emanzipationsphilosophie war. Es hat wahrscheinlich deshalb auch in Deutschland seinen größten Erfolg gehabt, weil es ein deutsches Sprachspiel auf einem avancierten Stand der Möglichkeiten neu gespielt hat.
DAUK: Sie haben damals am Beispiel der Atombombe das Subjekt als reinen Selbst- und Weltvernichtungswillen charakterisiert. Gilt diese Analyse auch heute noch?
SLOTERDIJK: Im Prinzip ja. Nur, die gesellschaftlichen Stellungen haben sich sehr stark verschoben. Wir haben jetzt diesen paranoiden Zweikampf nicht mehr vor Augen, der in der Zeit des Kalten Krieges zwei exemplarische politische Megazentren gegeneinanderstellte. Heute geht es nicht mehr so sehr darum, solche Subjekte zu entwaffnen oder über sich zu belehren, das natürlich auch, sondern darum, sie so zu reformieren und zu informieren, daß sie mit ihrer eigenen Größe, mit ihrem eigenen Gewaltpotential und ihrer eigenen Paranoia leben können. Es geht, so paradox das klingen mag, nicht darum, diese Großsubjekte zu zertrümmern, sondern darum, ihnen bei einem erfolgreichen Funktionieren zu helfen. Erfolgreich bedeutet hier: jenseits der Selbstzerstörung.
DAUK: Ist der kynisch-zynische Impuls noch der Motor Ihres Denkens?
SLOTERDIJK: Kynisch-zynische Impulse führen nicht zum Denken, sie führen zu einer Abschwörung an Zumutungen. Denkmotoren liegen nicht auf der Ebene von kynisch und zynischen Impulsen, weil diese etwas mit defensiven Bewegungen zu tun haben, defensiven Regungen. Der zynische Impuls ist die Ablehnung, die der Mächtige empfindet, wenn man von ihm verlangt, er soll sich vor der Moral oder vor einer Norm kleinmachen. Dazu fühlt er sich zu stark und wird zynisch. Und der kynische Impuls ist die Abwehr, die die Vitalität der »armen Hunde« hervorbringt, wenn man von ihnen verlangt, sie sollen sich an Normen halten, die für andere geschaffen waren. Die sind auf ihre Weise auch zu kräftig, um sich kastrieren zu lassen durch einen Normativismus, der sie vereinnahmen möchte für eine Art von Gesellschaftsspiel, bei dem sie vorher nicht gefragt wurden, ob sie es mitmachen wollen. Es ist eine Art individualistischer Résistance in beiden Fällen, die an den Grenzen des Moralismus operiert, einmal von oben, einmal von unten. Für sie gibt es seit dem Beginn der Städte und Reiche Dokumente aus den verschiedenen Weltkulturen. Man kann beobachten, daß diese Art von Résistance, diese Abschwörung an das Reichsethos, von oben wie von unten, seit etwa zweieinhalbtausend Jahren sich meldet, und das vor allem im westlichen Bereich, wo es immer eine besondere Lizenz gegeben hat für veristische Widerstände, das heißt also, wo das Wahrheitsorakel auch in einem frechen, einem immoralistischen Ton besser funktioniert hat als, sagen wir mal, in China oder anderswo, wo der politische Zwang, schön zu reden und die Sachen zu sagen, die »sich gehören«, viel lückenloser funktioniert. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Denkmotoren liegen bei mir und, wie ich glaube, bei den meisten Philosophen in einem tieferen Feld. Es sind nicht Widerstände, sondern es sind Rätsel, die zu denken geben. Wenn man ein großes Nein in sich trägt, das führt einen bis in die Therapie, wenn's hochkommt. Aber wenn man ein Rätsel in sich hat, dann kommt man entweder in die Kunst oder in die Philosophie. Ich sehe meine Arbeit am Schnittpunkt dieser Felder.
DAUK: Sie haben sich in den letzten Jahren mit der Gnosis beschäftigt. Während der Kyniker auf einem erfüllten Leben beharrte, sucht der Anhänger der Gnosis umgekehrt die Weltflucht. Ist das nicht ein Weg vom »Leben als Wagnis« zum »Leben als Trauerarbeit«?
SLOTERDIJK: Im Gegenteil. Ich bin heute viel optimistischer als in dem Buch Kritik der zynischen Vernunft, denn das Buch sprach damals nur die Sprache einer Protestheiterkeit. Man kann den Krieg erklären, und man kann die Ferien erklären, und das Buch hat die Ferien erklärt. Und zwar in einer polemischen Absicht gegen eine Gesellschaft, die den Krieg und die Sorge erklärt hatte. Ich sehe heute andere Horizonte und denke von einem anderen Zentrum her, das mehr durchgeklärt ist und über die Gründe seiner Heiterkeit andere Informationen hat. Die Gründe der Heiterkeit haben sich gegenüber der Kritik der zynischen Vernunft viel tiefer verlegt. Daher arbeite ich nicht mehr an einer Theorie des Protests, sondern an einer Fundamentaltheorie des abwesenden Menschen. Das heißt, ich entwickle mit anthropologischen Argumenten die These, daß Menschen sowieso der Welt in einem hohen Maße abgekehrt sind und daß sie immer auch im Modus der Nichtanwesenheit, im Modus des Nichtwissens, in einer nächtlichen Weltbeziehung existieren. Daher sehe ich keine Gründe, zumindest von der Anthropologie her, die Zwangsvereinnahmung der Individuen zugunsten einer Totalität namens »Wirklichkeit« fortzuschreiben. Das machen ja die heutigen Medien, soweit sie immer noch mit ihrer Sorgenagitation fortfahren, indem sie Menschen ständig überschütten mit unbekömmlichen Nachrichten, aus einem gewissen informatischen Sadismus, in dem es heißt: »Wir haben den Mist aufgenommen, um ihn weiterzugeben, denn ihr seid die wahren Adressaten.« Jeder versucht, Medium zu sein und nicht Filter. Filter und Endabnehmer sind immer die anderen. Ich glaube, man kann zeigen, daß Menschen nie Endabnehmer von Unglück sein müssen. Aus ihrer eigenen Beschaffenheit heraus sind sie wie Halbmonde auch nur mit der Hälfte der Welt zugewandt und gehören zur Hälfte einem andern Prinzip, das nicht erreichbar ist von dieser Sorgenagitation.
DAUK: Ist das Verhältnis von Ich und Welt das Grundthema Ihrer Arbeiten?
SLOTERDIJK: Das Verhältnis von Mensch und Welt ist das Thema der Philosophie seit zweieinhalbtausend Jahren, nur daß in der klassischen Metaphysik noch ein drittes Element mit gedacht wird, das heute keine gute Presse hat. Aber das metaphysische Dreieck, in dem das Denken über die großen Fragen routiniert wurde, das Dreieck aus Gott, Mensch und Seele, besteht in einer Rumpfform nach wie vor. Andernfalls wird es durch einen Monismus der Welt, also durch die Absolutsetzung der Welt, ersetzt, wobei man den Versuch macht, den Menschen nur als eine Funktion der Welt darzustellen, als eine lokale Funktion des Kosmos oder als eine lokale Funktion der Gesellschaft. Womit wir wieder in die alte Misere zurückrutschen, weil wir dann jedes einzelne Individuum aufhetzen, als Symptom einer an sich selber verzweifelnden Gesellschaft zu existieren. Man hat gute Gründe, diese Zumutung zurückzuweisen. Ich beginne, eine ganz andere Anthropologie vorzutragen, in der die Automatik der Zuordnung von Mensch und Welt gekündigt wird. Der Mensch gehört nicht so zur Welt wie der Daumen zur Hand. Er steht auch mit dem Rücken zur Welt – als ein Kind der Nacht oder des freien Nichts.
DAUK: Haben Sie sich mit der Gnosis beschäftigt, weil diese Sekte den Widerstand gegen die »Weltagenten« praktiziert hat?
SLOTERDIJK: Die Gnosis ist für mich ein Übungsfeld gewesen, auf dem man die a-kosmische Dimension, die von der Welt abgewandte Komponente der menschlichen Psyche, studieren kann. Es war ein grenzgängerisches Projekt, zwischen Religionsphilosophie und Anthropologie. Die Resultate liegen jetzt vor, zum einen in dieser großen Sammlung von Dokumenten unter dem Titel Weltrevolution der Seele, einer fast tausendseitigen Dokumentation, die belegt, wie Menschen der westlichen Tradition ihre Abmeldung – wie soll ich's nennen? – beim Einwohnermeldeamt des Kosmos hinterlegt haben. Auf der anderen Ebene als nicht dokumentarisches, sondern diskursiv durchgeschriebenes Resultat erscheint jetzt ein Buch mit dem Titel Weltfremdheit, in dem obige These systematisch entfaltet wird, im Blick auf die Musik, im Blick auf den Schlaf, im Blick auf die Drogen, auf die Religionen, auf den Todestrieb, auf die Selbsterfahrung, auf meditative Phänomene und vieles andere, wo jedesmal zu zeigen ist, daß wir mit einer primitiven face à face-Beziehung zwischen »Mensch und Welt« nicht weiterkommen. Daß wir den Menschen nur richtig beschreiben, wenn wir zeigen, daß er oder sie im spitzen Winkel zur Wirklichkeit lebt und mal da ist und mal nicht und meistens nicht.
DAUK: In welcher Beziehung steht die »Weltfremdheit« zu Ihrer These, daß die Hominisation, die Menschwerdung selbst, die Katastrophe schlechthin ist?
SLOTERDIJK: Das sage ich nicht auf eigene Rechnung, sondern ich nehme eine These auf, die vor etwa 2000 Jahren im Umfeld eines dissidenten Judentums, in einer selbstkritischen Phase jüdischer Genesistheologie aufgekommen ist und die seither von Menschen unseres Kulturkreises nicht wieder vergessen wurde. Das Flüstergerücht besagt, daß es einen ungeschickten Schöpfer gab und daß diese Erde noch nicht die Bestleistung des Jenseits darstellt, auf jeden Fall nicht das Optimum, und daß die katholische Grundentscheidung, Gott zu retten, indem man den Menschen belastet, nicht die einzige mögliche Art von Lastenverteilung ist, die auf diesem Feld sinnvoll wäre. Man könnte auch Gott belasten und damit die Wahrheit retten, indem wir die Schöpfung als zweitbeste ansehen, vielleicht sogar als eine mißlungene oder eine, die mit einem immanenten Hang zum Mißlingen ausgestattet ist. Das ist ein ganz anderer Denkansatz, und der schlägt durch in die Anthropologie und macht negative Anthropologien möglich, das heißt Lehren von der Abwesenheit des Menschen von der Welt, als eine Art Theorie der Nacht und des Schlafes, der Absenz. Sobald das ausführlich genug formuliert ist, wird man sehen, daß der Mensch so insgesamt besser beschrieben werden kann als in den positivistischen Anthropologien.
DAUK: Ist die Nachtseite des Menschen nicht nur die halbe Wahrheit?
SLOTERDIJK: Sie ist die vergessene Hälfte der Wahrheit. Es kommt jetzt darauf an, die Erkenntnisse der Anthropologie so weiterzudenken, daß wir im Kontinuum der westlichen Lernprozesse bleiben und trotzdem einem taoistischen Weisen, einem indischen Sadhu und einem verzückten Chassid auf Augenhöhe Rede und Antwort stehen.
[1] Dieses Gespräch zwischen Peter Sloterdijk und Elke Dauk erschien unter dem Titel »Der Halbmondmensch« in der Frankfurter Rundschau (29. September 1993, S. ZB 2).Elke Dauk ist Suhrkamp-Autorin von Der Griff nach den Sternen. Suche nach Lebensformen im Abendland (Insel Verlag 1998).
Warum sind Menschen Medien?
Im Gespräch mit Jürgen Werner[1]
WERNER: Üblicherweise verstehen wir unter Medien Apparate, die Bilder und Töne übermitteln. Sie hingegen vertreten die These, daß Menschen Medien seien. Warum?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!