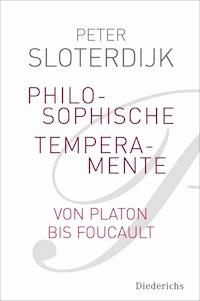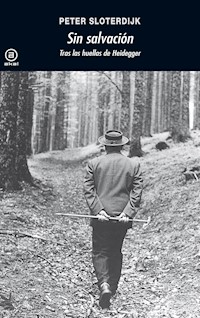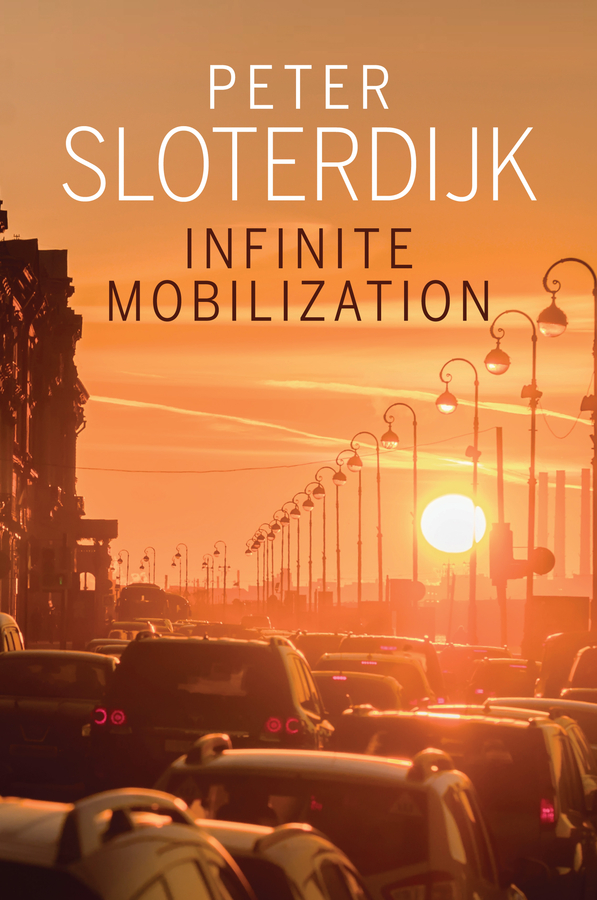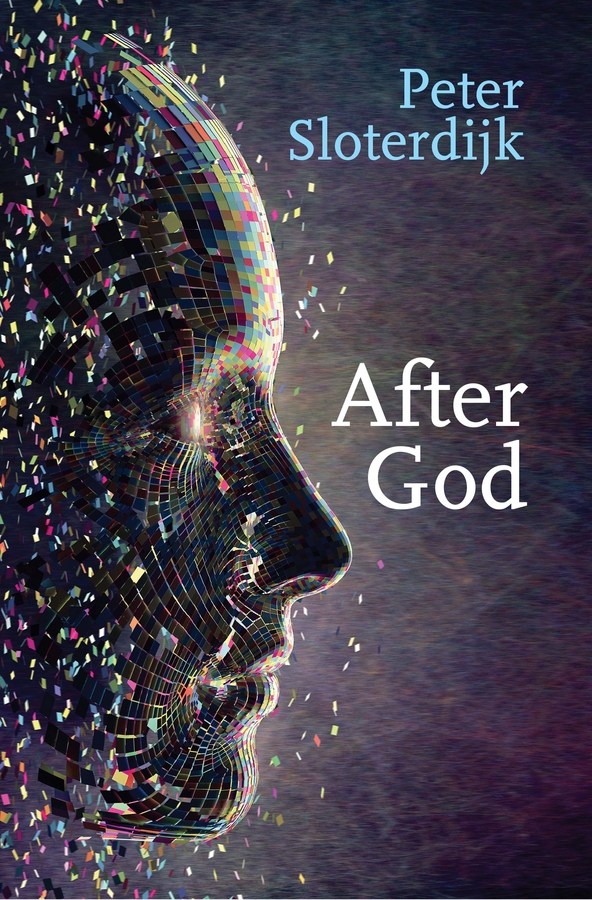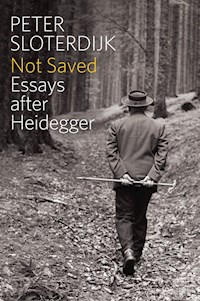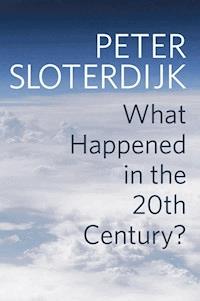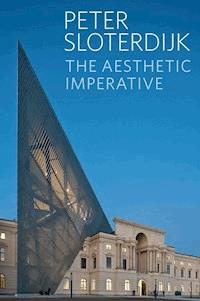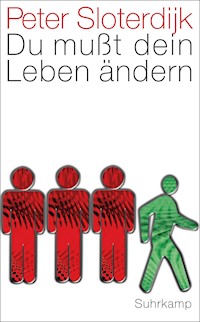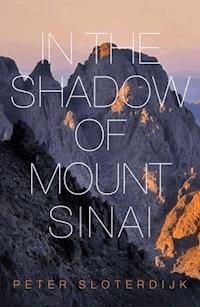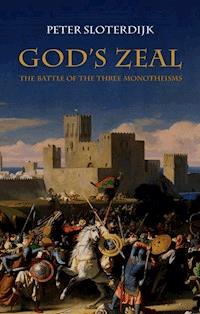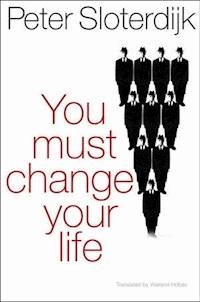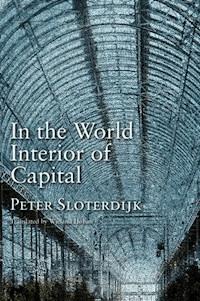27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Datierte Notizen
- Sprache: Deutsch
Nach längerer (Bedenk-)Zeit hat sich Peter Sloterdijk dem Unabwendbaren gebeugt. Wer Zeilen und Tage, das von Kritik wie Lesern zum Hype gemachte Vorgänger-Buch, veröffentlicht, kann sich Forderungen nach einer Fortsetzung ebenso wenig entziehen wie den Lockungen der buchlangen Transformation, Privates als Öffentliches auszuweisen und umgekehrt. »Zeilen und Tage vereint in einer grandiosen Mischung Gesellschaftsroman und Gesellschaftsanalyse für unsere Zeit.« Und, weiteres Beispiel: »Muss man das lesen? Unbedingt.«
Dabei erfährt man: »Heutzutage rückt jeder, der lesen und schreiben kann, mit seinem Befund über die kranke ›Gesellschaft der Gegenwart‹ heraus. Die ›Gesellschaft‹ wird so zu dem meist-überdiagnostizierten Patienten. Wäre ich ›die Gesellschaft‹, ich wüßte nicht, woran zu leiden ich mir aussuchen würde.«
Peter Sloterdijk steht tagtäglich Sinn und Zweck des tagtäglichen Mitnotierens der Zeit und der Leute vor Augen und erklärt sich in gewohnt ironischer Weise: »Wozu? Wahrscheinlich lebe ich unter dem Auge eines transzendenten Beobachters, der von mir keine besonders hohe Meinung hat. Mein innerer Beobachter ist kein Publizist.« Folglich unterscheiden sich seine Notizen von denen der Blogger und netz-öffentlichen Tagebuchschreiber durch analytische Präzision, Wortmächtigkeit, Sprachbewusstsein, Gelehrtheit, Aphorismen, Humor, lyrischen Tonfall …
Wenn also Goethe Neue Lieder, wie Heine und Rilke Neue Gedichte veröffentlicht, dann kann Peter Sloterdijk Neue Zeilen und Tage publizieren. Sie begründen, im Kontrast zu Sudelbüchern, Skizzenbüchern, Ideensammlungen, ein eigenes Genre mit Namen: Archivierung des gelebten und reflektierten Tages.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Sloterdijk
Neue Zeilen und Tage
Notizen 2011-2013
Suhrkamp Verlag
In Erinnerung an René Gude
Surabaya, 2. März 1957 – Amsterdam, 13. März 2015
Weggefährte Freund Lehrer Philosoph
Inhalt
Vorbemerkung
Erstes Buch. Augenblicksgötter
Heft 111
9. Mai 2011 – 10. Juni 2011
Heft 112
10. Juni 2011 – 9. August 2011
Heft 113
9. August 2011 – 30. Oktober 2011
Heft 114
30. Oktober 2011 – 10. Mai 2012
Heft 115
10. Mai 2012 – 26. August 2012
Zweites Buch. Momente der Entewigung
Heft 116
27. August 2012 – 12. November 2012
Heft 117
13. November 2012 – 13. Januar 2013
Heft 118
13. Januar 2013 – 15. März 2013
Heft 119
16. März 2013 – 20. Juni 2013
Heft 120
20. Juni 2013 – 23. September 2013
Vorbemerkung
Befragte man die Verfasser von Notizheften oder Journals, warum sie sich regelmäßig, oft sogar täglich der Mühe unterziehen, Spuren ihres erlebten, geträumten oder versäumten Lebens aufzuzeichnen, so müßten die meisten, falls sie sich für die Strategie der aufrichtigen Antwort entschieden, zugeben: aus Gewohnheit.
Eine solche Replik für Koketterie zu halten wäre nicht klug. Motivation ist eine knappe Ressource, daher bringt es Gewinn, wenn man, wo Motive fehlen, auf Gewohnheiten zurückgreifen kann. Das Schreiben von Notizen, hat man es jahrelang praktiziert, wird zu einem Habitus, der sein Warum absorbiert. Man tut es, weil man es getan hat. Es ist eines von den tausend Gesichtern des übenden Lebens.
Fragt man, aus welchem Grund ein Verfasser seine Aufzeichnungen später wieder zur Hand nimmt, meldet sich das Motiv-Problem in akuter Form zurück. Mit dem Hinweis auf eine Gewohnheit ist die Neubefassung nicht zu erledigen. Das Schreiben mag zur Gewohnheitssache werden, das Verhältnis zum Geschrieben-Haben bleibt problematisch. Wer Notizen macht, wird irgendwann entdecken, daß alles, was er vorbringt, vom Moment der Niederschrift an gegen ihn verwendet werden kann. Darum wagt man sich auch nach mehreren Jahren an die Wiederbegegnung mit den blau-schwarzen Spuren auf liniertem Papier nie ohne Verlegenheit heran. Alles vermag Teil einer Anklage zu werden oder Schriftsatz der Verteidigung. Warum den Blick zurück riskieren?
Um Spekulationen abzukürzen, stellt der Verfasser und Redakteur der nachfolgenden Notizen fest, daß ihm seit einer Weile eine veränderte Empfindung vom Ablauf der Zeit zu schaffen macht. Es kommt ihm immer öfter so vor, als habe sich am Monatsende der Monat ins Unwirkliche verflüchtigt. Nicht viel besser ergeht es an Silvester dem abgelaufenen Jahr. Um nicht zu reden vom einzelnen Tag, der nur selten noch eine erinnerungstaugliche Kontur hinterläßt.
Auch wenn man dem Befund zustimmt, das alles entspreche der geriatrischen Normalität und gehöre zu den Mitgiften der conditio humana, wird man vielleicht Verständnis für die Reaktion des Opfers solcher Empfindungen aufbringen. Ist es unnormal, wenn aus ihnen der Wunsch entsteht, dem Zug der Zeit zum Verfließen in der Leere einen Widerstand entgegenzusetzen? Das Festhalten hat bei Buddhisten und Psychotherapeuten keinen guten Ruf, es wäre aber sinnlos, abzustreiten, daß das Folgende auf dieser Geste beruht. Es ist nicht zu verkennen, der Autor ergreift im Streit zwischen Bewahrung und Verflüchtigung für die Bewahrung Partei.
Damit das kein inhaltsloser Anspruch bleibt, sind frühere Notizen von Nutzen, auch wenn sie das Risiko mit sich bringen, im Rückblick anmaßend oder belanglos zu erscheinen. Sie liefern immerhin Indizien des Dagewesenseins in der verlorenen Zeit. Wer spricht vom Wiederfinden? Es genügt, von der Zeile auf den Tag zu schließen. Zur Ironie des Älterwerdens gehört, daß man sich fragt, wieviel Vergangenheit einem noch bleibt.
Im übrigen trifft auch auf die Neuen Zeilen und Tage zu, was der Verfasser im Vorwort zu Zeilen und Tage, Notizen 2008-2011 (vor sechs Jahren erschienen), bemerkt hatte: daß es sich nicht um ein Tagebuch im eigentlichen Sinn des Worts handelt (es wäre sonst erzählerischer und indiskreter), geschweige denn um ein journal intime (es wäre sonst melancholischer und bösartiger). Es ist aber auch kein »Denk-Tagebuch« und kein »Arbeitsjournal« (es wäre sonst mehr von literarischen Plänen die Rede, von der Entropie der zeitgenössischen Philosophie, von der Korruption der humanities). Auf dem richtigen Weg dürfte sein, wer eine Affinität zu Paul Valérys Cahiers vermutet – nur daß hier die Notizen in natürlicher Unordnung chronologisch aufeinanderfolgen, ohne thematische Gruppierung. Der Sache am nächsten käme, wer sich bei der Lektüre der vorliegenden Seiten an den Begriff der »intellektuellen Komödie« erinnert, mit dem der französische Dichter seine Erwartungen an eine künftige Literatur umschrieb.
Es wäre unnötig schwerfällig, hier zu erläutern, warum das erste Buch der neuen Notizen mit dem Titel »Augenblicksgötter« überschrieben ist, während das zweite die etwas dunkle Überschrift »Momente der Entewigung« trägt. Da das Buch klugen Lesern in die Hände fällt, werden sie nicht lange brauchen, des Rätsels Lösung zu finden.
Wenn wir gehen, werden wir das Gefühl haben, wir hätten unsere Kindheit in der Antike verbracht, unsere mittleren Jahre in einem Mittelalter, das man die Moderne nannte, und unsere älteren Tage in einer monströsen Zeit, für die wir noch keinen Namen haben.
Zeilen und Tage, Notizen 2008-2011, S. 639
Erstes Buch
Augenblicksgötter
Heft 111
9. Mai 2011 – 10. Juni 2011
9. Mai, Karlsruhe
Erinnerung an die vergangene Woche in Girona: Aus Katalonien bringe ich die Erkenntnis mit, warum die netten Menschen unsere Feinde sind: Zu schwach, um zu gestehen, daß sie es nicht wissen, antworten sie, nach einer Adresse in der Stadt gefragt, spontan, charmant und halluzinatorisch. Sie geben sich, als würden sie dich am liebsten begleiten, müßten sie nicht leider gerade in eine andere Richtung gehen. Als überzeugende Einheimischen-Darsteller schicken sie den entzückten Touristen mit autohypnotischem Elan in den April, und dies nicht nur einmal oder zweimal. Wenn du das Unglück hast, nacheinander auf fünf strahlende Katalanen zu stoßen, kann es dir passieren, daß du durch ihre freihändigen Antworten auf die gleiche Frage in fünf Richtungen gewiesen wirst, jedesmal mit warmen Blicken und herzlichen Empfehlungen.
Iberische Unkultur: sechs Personen bei Tisch, drei separate Gespräche, vokal expansiv, insistent unmanierlich, vom Sinn für Sitte und Situation verlassen; beunruhigend, wie schnell man selber ein Teil der Entgleisung wird.
Der Rechtsgrundsatz vim vi repellere licet ist seit altrömischen Tagen förmlich in Kraft, implizit jedoch schon sehr viel früher. Seine klassische Form fand er im Codex Justinianus, wo expressis verbis statuiert wurde, daß gewaltsam Angreifende mit Gewalt »zurückgedrängt« werden dürfen, sei es nur defensiv, sei es unter Inkaufnahme fataler Schädigung der angreifenden Seite. Der »außergesetzliche Notstand« »rechtfertigt« Verbrechen gegen Verbrecher, Unrecht gegen Unrechtstäter, Enthemmung gegen Enthemmte, indem er die defensiven Taten anders benennt und bewertet als die offensiven.
Daß man beim Geschäft des »Zurückdrängens« (repellere) auf ein Gebiet verwirrender Ähnlichkeiten und abgründiger Ambivalenzen gerät, geht aus der Natur der Dinge hervor. Der effektive Anfang einer Sequenz von Angriff und Gegenwehr läßt sich oft nicht deutlich fassen. So evident er klingen mag, verrät der alte Grundsatz nicht, wie tief dem Notwehrrecht ein Zug zur Überdehnung innewohnt. Das licet – Lizenz als Verbum – sagt wenig über die Grenzen der wehrenden Gewalt. Aus legitimer Verteidigung will oft Vorbeugung werden, aus Vorbeugung antizipierte Vergeltung. Von US-Polizisten weiß man, sie löschen in vermeintlich loyaler Ausübung ihres Diensts Jahr für Jahr Hunderte Leben aus, weil sie inmitten eines übernervösen Klimas existieren, in dem die Differenz zwischen sachlicher Ermittlung und präventiver Erschießung sich nicht klar genug definieren läßt.
Inzwischen exportieren die Amerikaner ihre Labilität in rechtsempfindlichen Fragen auf die weltpolitische Bühne. Für sie ist es von der Notwehr zur Rache offensichtlich nur ein Schritt. Hätte man, in Analogie zu Pearl Harbor, der US-Bevölkerung nach dem 11. September zureichende Gründe vorgegaukelt, Hunderttausende von Saudis auszulöschen, da die Täter in ethnischer Sicht sich überwiegend aus diesen Gebieten rekrutierten, dazu jede Menge Iraker, von denen man leicht hätte suggerieren können, sie müßten mit der fatalen Episode etwas zu tun gehabt haben: so wäre dem Rache-Reflex kurzfristig Genüge geleistet worden. Die meisten Amerikaner würden trotzdem das Gefühl nicht losgeworden sein, für effektive Notwehr sei es zu spät, für Vergeltung hingegen keine Opferzahl hoch genug.
In psychopolitischer Sicht ergeben sich daraus Konsequenzen von kaum ermeßbaren Dimensionen: Weil wirksame Notwehr in der Regel nicht möglich ist (nach Terrorakten ohnedies nicht), während Vergeltung unweigerlich suspekt bleibt (zumindest in der vom Christentum erfaßten Hemisphäre, wo die Frage nach der korrekten Haltung der »anderen Wange« keine überzeugende Antwort gefunden hat), bündeln sich die Energien in den Gesten der Vorbeugung. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wird der Zeitgeist mit aller Macht von security-Motiven getrieben, und zwar durchwegs zuungunsten des Freiheitstrebens, das früher, zumal von den sechziger Jahren an, die zivilisatorische Tendenz vorgegeben hatte. An der Basis der illiberalen Entwicklungen in der Gegenwart findet man die Illusion, die Notwehr lasse sich in die Zukunft projizieren.
Beruf: Resilienz-Berater
11. Mai, Karlsruhe
In der Jüdischen Allgemeinen versucht sich ein Autor namens Alan Dershowitz, seines Zeichens Jura-Professor an der Harvard-Universität, in moralischen Randgängen mit akrobatischen Einlagen. »Alle rechtschaffenen Menschen«, sagt er, »begrüßen die Tötung Osama Bin Ladens.« Er fügt hinzu: Die gezielte Tötung sei ein »wirksames, legales und moralisches Instrument« im »Krieg gegen den Terror«. Die Äußerung liest sich wie eine professorale Parallelaktion zu den muskulösen Jubel-Szenen auf den Straßen New Yorks, als die Nachricht von Bin Ladens Auslöschung verbreitet wurde.
Man muß wohl Advokat und in der Attitüde des Plädierens bis zum Stadium der Voll-Automatisierung geübt sein, um in einem so kurzen Satz vier kapitale Fehlurteile zusammendrängen zu können. Weder ist die Wirksamkeit der gezielten Tötung zweifelsfrei erwiesen (sie könnte das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung hervorrufen), noch kann im geringsten davon die Rede sein, daß sie unstrittig »legal«, geschweige denn, daß sie allgemein »moralisch« akzeptabel wäre. Hier sieht man einen Rechtsgelehrten sich mit feuerfester Selbstgewißheit als Experte haltlosen Behauptens betätigen.
Sein Mandant ist fürs erste kein anderer als die vermutete öffentliche Meinung seines Landes. Im unterstellten Interesse des phantom public tritt der US-weit renommierte Anwalt als Lobredner der irregulären Tötung an die Barriere und gibt der nachträglich gewaltwehrenden Gewalttat den rechtswissenschaftlichen Segen. Tatsächlich wurde die Liquidierung Bin Ladens in den Vereinigten Staaten von vielen mit Genugtuung wahrgenommen, obgleich der 11. September fast zehn Jahre zurückliegt. Zahllose Amerikaner dürften die Vorgänge in der Nacht von Abbottabad als Richtigstellung einer offenen Rechnung empfunden haben. Vergegenwärtigt man sich, wie viele Angelegenheiten nach Ablauf einer solchen Frist dazu neigen, ins So-gut-wie-nie-Gewesene zu entschwinden – zumal in der Ära der chronischen Auslöschung von Neuigkeiten durch Neuigkeiten –, läßt sich begreifen, daß hier ein gestocktes kollektives Psychodrama bewußt in seinen letzten Akt getrieben wurde. Kein Amerikaner hätte vor dem 11. September einen Cent in die Erhaltung der Twin Towers investiert. Die Gebäude, schlicht quadratisch im Geist einer verflachten Bauhaus-Architektur aufragend, standen ohne besondere Bedeutung an dem Ort, an den man sie hingestellt hatte. Sie begnügten sich bis zum 10. September damit, ein quasi ornamentaler Bestandteil einer überbekannten Stadtsilhouette zu sein. Nach ihrer Zerstörung wuchsen sie zu einem Wir-Symbol empor, viel höher als das Original-Gebäude. Es übermittelte unzähligen Bürgern zwischen Atlantik und Pazifik den Impuls, sich als einsturzgefährdete Größen aufzufassen. Amerikaner mögen ja mit vielem zurechtkommen, nur nicht mit dem Gedanken, angreifbar zu sein, und dies individuell wie kollektiv. Daher die für gebildete Europäer unbegreifliche Unabschaffbarkeit des Anspruchs auf private Bewaffnung sowie die scheinbar pathologische Unaustilgbarkeit des Willens, über den größten Militärapparat der Welt zu verfügen. Solange Nationen als virtuelle oder aktuelle Kränkungsgemeinschaften konstruiert sind, bleibt das Motiv der Rache-Justiz unauslöschlich. Das Ressentiment ist, wie das Unbewußte, zeitlos.
Offenbar nahm kaum jemand Anstoß daran, daß der re-aktualisierte Prozeß »Vereinigte Staaten versus Bin Laden« Aspekte einer Treibjagd aufwies. Mehr noch trug er die Züge eines Bandenüberfalls auf einen Unbewaffneten. Was zeigt: Durch den ausgedehnten Aufenthalt im Klima des Terrors und durch die Gewöhnung an die prekären Prozeduren seiner Bekämpfung sind die letzten Spurenelemente von kriegerischem Ethos aus dem soldatischen Metier eliminiert worden. Vom klassischen Krieg bleibt nichts übrig außer dem Motiv, dem Feind ein Höchstmaß an Schaden zuzufügen, gleichgültig mit welchen Mitteln.
Schon wenige Tage nach dem Einsturz der Türme im Herbst 2001 war absehbar geworden, daß das Drama von New York in einer riesenhaften Selbstvergiftung der angegriffenen Seite enden würde. Das hartnäckige ideologische Relikt des 11. September, die Phrase vom »Krieg gegen den Terror«, erweist sich als die unheilvollste Attrappe, die in der politischen Rhetorik der vergangenen Jahrzehnte montiert wurde. Sie bildet den vierten Irrtum in Dershowitz’ dubioser Wortergreifung. Der Phrase ist es zuzuschreiben, wenn Todesurteile (außerhalb des erklärten Kriegs, doch gegen Einzelpersonen) künftig nicht mehr von Gerichten verkündet, sondern im Weißen Haus, im Pentagon oder in anderen politischen Willenszentren unter dem Schutz der Geheimhaltung gefällt werden. Exekutiert werden sie von Militär-Mitarbeitern, die nicht mehr wissen können, ob sie als Soldaten, als Henker, als Auftragsmörder oder als Bestattungsunternehmer fungieren.
Von unvergeßlicher Kläglichkeit bleiben die Bilder, die den US-Präsidenten Barack Obama im Situation Room des Weißen Hauses zeigen, von wo aus er, umgeben von einem Stab ko-ignoranter Beobachter, die Vorgänge in Pakistan wie eine Tele-Show verfolgte. Er kauerte auf seinem Stuhl in der rechten hinteren Ecke, einem College Boy ähnlich, der gespannt auf einen Freistoß wartet. Im Vordergrund machte Joe Biden sich breit, der notorische Vize mit dem leeren Gesicht, in situ apathisch, ohne eigene Meinung. Er stellte ein Trägheitsphänomen dar, das besser durch eine Gewichtsangabe als durch die Aufzählung seiner Überzeugungen zu charakterisieren gewesen wäre. Hillary Clinton zeigte als einzige im Raum eine humane Regung, indem sie sich mit der Hand den Mund zuhielt, als wollte sie in der Runde von einverstandenen Fern-Tötern darauf verzichten, die Empfindungsweise einer Minderheit auszudrücken.
Die in der gezielten Tötung enthaltene moralische Konfusion war – um einen Rückblick zu versuchen – vor allem durch den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad ins Dasein gesetzt worden. Nach dem Schwarzen September in München 1972 hatte er seitens Golda Meirs, damals der ersten Frau im Staat Israel, den Auftrag erhalten, die überlebenden Attentäter mitsamt ihren Hintermännern zu liquidieren. Frau Meir trägt ein gut Teil der Verantwortung dafür, wenn die Todesstrafe aus der Sphäre des Rechts ins Register der geheimdienstlichen »Operation« übersetzbar wurde. Die von ihr lancierte Unternehmung, die den so populären wie kitschigen Titel »Zorn Gottes« trug, erstreckte sich über zwanzig Jahre. Zu ihrem Ergebnis gehörten Dutzende von außerlegalen Tötungen, darunter die Auslöschung von Unbeteiligten. Im übrigen war Golda Meirs Initiative keine Improvisation. Sie knüpfte an der Logik früherer Mossad-Operationen an, für welche die gezielte Tötung – in diskreten Proportionen, versteht sich – von den fünfziger Jahren an zum Werkzeug des Metiers gehört. Meir war seit ihrer Funktion als Außenministerin (1956-1965) mit solchen Verfahren vertraut und einverstanden.
Im aktuellen Kontext kann kein Zweifel daran bestehen, daß Dershowitz von Golda Meirs Vergeltungs-Logik inspiriert ist. Es müssen Jahrzehnte der Enthemmung vorangegangen sein, bis ein Jurist seines Kalibers einen so korrupten Satz von sich geben konnte wie den, die gezielte Tötung sei ein »wirksames, legales und moralisches Instrument« im Umgang mit Feinden der USA. Auch Perversionen sind die Töchter monströser Zeiten.
Kennte man nicht auch zahlreiche Beispiele für intakte Juristenvernunft, wäre angesichts von Äußerungen wie denen aus Dershowitz’ Feder zu sagen: Die Rechtswissenschaft denkt nicht.
Für den Ideenhistoriker stellen sich weitere Verknüpfungen her. Die gezielte Tötung Einzelner oder bestimmter Gruppen bildet den Inbegriff der »Maßnahme«, mit der das althergebrachte Notwehrrecht auf gesetzlich nicht eingrenzbare und standardisierbare Situationen antwortet. Die »Maßnahme« gehört zum Arsenal des Kriegsdenkens, von dem sich zeigen läßt, wie es seit 1914 und mehr noch nach 1917 die Vernunft der Europäer deformierte. Sie überschreitet die Grenzen der Notwehr und wird zum vorausgreifenden bellizistischen Akt. Die kriegerische Handlung eines Staatswesens gegen Einzelpersonen erfüllt nicht nur den Tatbestand einer Rache, die sich selbst recht gibt, sie schreitet, der eigenen Logik folgend, bis zur präventiven Ermordung voran.
In Brechts Theaterstück Die Maßnahme (1930) kann man das Eindringen der kriegerischen Dimension in die politisch-moralisch-literarische Sphäre exemplarisch verfolgen. In ihm wird die Allgemeinmoral ausdrücklich der kämpferischen Partei-Raison untergeordnet, wie es dem Geist der Ära zwischen den Weltkriegen entsprach. Im Falle Brechts macht die Enthemmung einen doppelt korrupten Eindruck, da die Verkehrung im Modus des »Lehrstücks« vorgeführt wird. Ausgerechnet auf der deutschen Theaterbühne, nach Schiller als eine »moralische Anstalt« entworfen, wurde die für die Arbeiterklasse denkwürdige Lektion doziert, wer eine bessere Welt erstrebt, muß töten können. Die Maßnahme geriet zu einem Lehrstück für die Korruption der Literatur.
Wenn es je die »Zerstörung der Vernunft« gegeben hat, über die sich Lukács in seinem verworrenen Buch aus dem Jahr 1954 zum bürgerlichen Irrationalismus um 1900 beschwerte, dann wäre sie vor allem bewirkt worden durch das Umschlagen des besonnenen Denkens in die bellizistische, dezisionistische, jedem Normgedanken fremde Maßnahmen-Rationalität. Für die sind keine allgemeingültigen Gesetze mehr akzeptabel: Was ihr nötig scheint, sind gewaltsichere Reaktionen auf unvorhergesehene Situationen. Überflüssig zu betonen, warum eine solche Logik für das revolutionäre Lager mehr Attraktivität besaß als für die »bürgerliche« Sphäre (die erst dank der security-Doktrin lernte, als erste loszuschlagen). Welcher »Revolutionär« sympathisiert nicht mit den nichtlinearen Prozessen?
Der junge Lukács hatte, nach seiner Konversion zum Marxismus, in seinen Äußerungen über eine vorgebliche »zweite Ethik« (ausgehend von Dostojewkijs Raskolnikow) die Lizenz zum Töten für die noble Sache unterstützt. Dem Guten, das den Lauf der Geschichte ändern möchte, muß schlechthin alles erlaubt sein. Unverzeihliches kann verzeihlich werden. Die »zweite Ethik« setzt das fünfte Gebot, die Achse des jüdischen und christlichen Kanons, nicht nur beiseite, sie kehrt es um. Nach ihr heißt es unmißverständlich: Du sollst, wenn nötig, töten, töten, töten. Wenn im allgemeinen das Töten böse ist, handelt es sich für diesmal um ein gutes Böses. Wer verstehen möchte, warum im 20. Jahrhundert der politische Moralismus mehr Opfer forderte als der politische Biologismus, sollte auf das gute Böse achten, das seinen Agenten die Pflicht zur Auslöschung des Feindes einflüstert. Solange du der Tötungshemmung unterliegst, bleibst du ein kleinbürgerlicher Philister, unfähig, einer großen Sache zu dienen.
Damit sind wir wieder nahe bei Dershowitz und seiner schamlos inklusiven These, alle rechtschaffenen Menschen begrüßten die Liquidierung Bin Ladens. Was seinem Plädoyer mitsamt seiner falschen Umarmung der »Rechtschaffenen« in die Quere kommt, ist eine vernehmbare Minorität respektabler Rechtsgelehrter, Politologen und Publizisten, die meinen, man hätte Bin Laden, um der Intaktheit unserer Rechtsbegriffe willen, nach Den Haag überstellen und ihm dort den Prozeß machen müssen. Naturgemäß hätte ein solches Verfahren hohe Kosten verursacht. Es hätte Protest, Aufruhr, womöglich lokalen Krieg hervorgerufen. Diese Ausgaben zu scheuen stand der westlichen Zivilisation, nach Lage der Dinge, nicht zu. Wenn es je eine Sache gab, die es durchzufechten galt, dann wäre es diese gewesen.
Was tun unsere amerikanischen Freunde? Sie töten fürs erste rasch mal aufs Geratewohl, um ein Ventil für die Stimmung im Lande zu öffnen. Dann führen sie Amok-Krieg in einem Teil der Welt, in dem sie wenig zu suchen hatten. Nach ihrem hastigen Rückzug von der Interventionszone hinterlassen sie ein Trümmerfeld, in dem ein endloser Terror aufblüht. Schließlich, als sich kaum jemand noch für die Sache echauffierte, spüren sie per Zufall den Mann auf, von dem es hieß, er habe den Masterplan für den 11. September entworfen. Man hätte ihn ohne zusätzlichen Aufwand festnehmen können, vorausgesetzt, der Heldenmut des Kommandos, das auf dem Territorium eines fremden Landes eine Tötung ausführte, hätte auch für eine Verhaftung ausgereicht.
Nun erst wird evident, welche Perversion sich durch das Denken in kriegerischen Kategorien bis in die Spitze des Weißen Hauses durchgesetzt hat. Barack Obama, um das Nötigste zu sagen, war zu schwach, um sein Amt dem Geist der Verfassung gemäß auszuüben. Er entzog sich dem Mandat, als Präsident eines Rechtsstaats zu handeln, und entschied sich dafür, bloß als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu agieren. Nur so konnte er die Liquidierung dem Prozeß vorziehen. Er hat die historische Option, den Vorgang auf eine höhere Ebene zu heben, in voller Kenntnis der Risiken ausgeschlagen. Er hat befürwortet, Morde mit Gegenmorden zu beantworten. Man möchte denen, die ihn trotz allem bewundern, nicht unnötig weh tun. Er war ein Berufener, zu den Erwählten zählt er nicht. Sein Einsatzbefehl für die Spezialtruppe von Abbottabad beweist erneut: Geschichte wird weder von großen Männern gemacht noch von sozialen Strukturen, sondern von banalen Fehlern.
Ein offener Prozeß gegen Bin Laden und seine Ideen hätte die muslimische Weltszene gezwungen, Farbe zu bekennen. Wahrscheinlich war es ebendas, was man um jeden Preis vermeiden wollte. Man versäumte willentlich den Moment, in dem der clash of civilisations kein Gerede von Politikprofessoren mehr gewesen wäre, sondern ein historisches Mandat. Moralisch kleingesinnt, zivilisatorisch perspektivelos, vom Rachegift erfüllt und ohne den Mut zu einer weltethischen Konfession, hat die westliche Koalition den islamisierenden Staaten zwischen Marokko und Indonesien den unentbehrlichen Zusammenstoß der Kulturen erspart. Man hat ihnen zugestanden, sich in diplomatische Formularien zu absentieren. Die Ergebnisse hat man vor Augen: Der vermiedene Konflikt ist der verlorene.
Was Dershowitz vorbringt, ist die »zweite Ethik« in amerikanischer Deklination. Der moralische Kopfstand hat sich als Staatsraison durchgesetzt. Warum es schwerlich anders hätte kommen können, läßt sich allerdings aus der imperialen Grammatik herleiten. Der Vormacht ist es nicht erlaubt, Provokationen von seiten schwächerer Aggressoren zu ignorieren. Um der Behauptung ihres Ranges willen ist sie dazu verurteilt, ihre rückschlagbereite Haltung in Permanenz zu demonstrieren. Für sie besteht eine ständige Pflicht zur Intervention – anders ausgedrückt: Sie lebt unter dem kategorischen Müdigkeitsverbot.
Entscheidend ist freilich etwas anderes: Die strategischen Zentren der USA haben errechnet, die gezielte Tötung sei die unendlich viel billigere Alternative zum kräfteraubenden Massiv-Krieg mit einem verfeindeten Gegenüber. Damit ändert sich die Sprache, die den Krieg »erklärt«, von Grund auf. Der Terrorismus-Vorwurf an Einzelne und kleine Gruppen ist nichts anderes als ein ökonomisch günstiger Ersatz für die Kriegserklärung an ein gerüstetes, national formatiertes politisches Feind-Kollektiv. Er ermöglicht es, unliebsame Einzelne zu Feinden im vollwertigen Sinn des militärischen und völkerrechtlich statuierten Feindbegriffs zu stempeln. Daraufhin kann man sie nach kriegsrechtlichen Kriterien auslöschen, ohne eine teure Massenmobilisierung in Gang setzen zu müssen – und ohne chronischer Kriegsverbrechen bezichtigt zu werden.
Als Joseph Nye 1990 den Begriff soft power lancierte, um zu begründen, warum die Attraktivität der US-Kultur für die übrige Welt auch nach dem absehbaren Abbau ihrer ökonomischen und militärischen Dominanz weiterwirken werde, konnte er nicht ahnen, daß der spätere scheinbare Soft-Politiker Barack Obama einen folgenschweren Schritt zur Entzauberung des amerikanischen Musters in Gang setzen würde. Seither steuert der Zeitgeist im Sturzflug auf die Verhäßlichung der USA zu – um für den Augenblick von der Verzwergung Europas nicht zu reden.
Dank einer kurzen Netz-Recherche läßt sich in Erfahrung bringen, Alan Dershowitz sei ein Mitwirkender in der Kamarilla von Anwälten gewesen, die 1995 den Freispruch in dem Skandal-Prozeß von O. J. Simpson bewerkstelligten. Das Arbeitsgebiet der professionalisierten Lüge beschränkt sich also nicht auf die Liaison von Terror-Polemik und Security-Gerede. Es paßt vollkommen ins Bild, wenn Dershowitz später die Behauptung vorbrachte, dem Simpson-Prozeß komme letztlich keine tiefere Bedeutung zu. Auch hier redet er als Fälscher pro domo. Solche Leute bewegen sich in einer Art von phallischem Koma, bei dem sich oft genug wiederholte Lügen in stabile Zustände verwandeln.
Ernsthafte Fach-Kollegen halten dagegen, mit dem Simpson-Prozeß sei ein rechtsgeschichtlicher und sozialpsychologischer Einschnitt im moralischen Ökosystem der USA erfolgt. Das Drama berührte die nationalen habits of the heart. Manche meinen, durch die Affaire ging die Demoralisierung der Vereinigten Staaten ins kritische Stadium über. Was tun, wenn die Verdrehung der Grundbegriffe zum status quo gerät?
Im Rechtswesen wie im Kriegswesen: Kopfstand der Moral.
Kontemplation versus Operation. Die Gipfel reden nicht miteinander.
12. Mai, München
Auf dem achtzackigen Stern des britischen Knight Grand Cross of the Order of the British Empire (seit 1917 verliehen) stehen die Worte, auf die es in der Imperiosophie ankommt: For God and the Empire. In ihren hohen Zeiten verstand sich die damals einzige Weltmacht darauf, die Quintessenz ihres Handelns zu formulieren.
Die Form des Ordens spricht für sich: Als Mittelding zwischen Stern und Sonne verkörpert er das Programm der Machtausübung durch Strahlung. Das Empire brauchte das soft-power-Prinzip noch nicht verbal zu fassen, es machte dieses im Design einer seiner höchsten Auszeichnungen sichtbar. Lord Weidenfeld trägt jetzt auch diese Ehrenlast neben seinen übrigen Dekorationen. Er akzeptiert sie ohne Zweifel mit der Ironie des weisen alten Mannes, dem nicht entgangen ist, wie beide Größen, Gott und das Reich der Briten, sich binnen eines Jahrhunderts zu Gegenständen der matten Satire gewandelt haben.
Nach dem BMW-Forum in der gläsernen Halle am Mittleren Ring. Warum strömen die Menschen in solchen Zahlen zu Veranstaltungen dieser Art? Den ganzen Abend lang hören sie keinen einzigen Satz, den sie nicht ebensogut im Wirtschaftsteil der verdächtigen Medien lesen könnten. Und doch harren sie aus, als ob sie in der Liste der Podiumsteilnehmer eine Chance vermuteten, etwas zu vernehmen, was die Blätter nicht bieten. Sie schauen nach oben, als ob es die Laurentius-Nacht wäre, wenn so viele Meteoriten die Erdlaufbahn kreuzen. Nun, alter Knochen, tauche in die Erdatmosphäre ein und hinterlasse eine Lichtspur.
13. Mai, München Amsterdam
Am Security Check am Münchener Flughafen steht in der Reihe vor mir ein alter Mann (Vorsicht: wahrscheinlich gleichaltrig!), mit dem Gesicht eines resignierten Kindes. Er führt mit auffälliger Dienstbereitschaft die Gesten der sekuritären Unterwürfigkeit aus: den Paß bereithalten, das Ticket vorweisen, den Gürtel ausziehen und um das Recht bitten, durch das elektronische Tor gehen zu dürfen.
Als wir die Überprüfungszone durchquert haben, bemerke ich, der Alte besitzt einen kanadischen Paß. Ob er selber als junger Studienrat aus Deutschland emigriert war? Oder hatten seine Eltern sich für die Flucht entschieden?
Ein Philosoph, der etwas taugt, müßte immer etwas von einem Kinderbuch-Autor an sich haben.
Freund Assheuer veröffentlicht in der Zeit einen Artikel über die soeben eröffnete Marbacher Ausstellung zum Thema »Schicksal«. Zu ihr gehören die Gespräche, die ich mit Ulrich Raulff im Vorfeld des Ereignisses geführt hatte, eines in Marbach, eines in Karlsruhe: Schicksal. Ein Roman vom Denken, beide im Marbacher Magazin, das die Ausstellung begleitet, in extenso abgedruckt. Die Grundidee der Ausstellung: siebenmal sieben mit Fatum aufgeladene Objekte der jüngeren Geistesgeschichte in zahlenmagischen Konstellationen zusammenzubringen, das hieß den Zauberkreis eng ziehen.
In einer der sieben Vitrinen sah man meine Ausgabe von Sein und Zeit mitsamt den Anstreichungen, die vor Jahrzehnten entstanden waren, neben den Leseexemplaren des gleichen Buchs von Blumenberg, Adorno, Koselleck, Martin Walser, Botho Strauß, Celan, Jaspers und Heidegger selbst: eine Anzahl an Heidegger-Lektüren, erratisch zusammengehörig, unter einer Glasplatte versammelt. Der angereiste Journalist sollte auf der Stelle erfaßt haben, welches Zeichengewebe da ausgebreitet wurde. Zeit-Leser sollten hiervon besser nichts erfahren. Wer möchte die Totschweigearbeit sonst machen?
Dank Hegel wissen wir, das »Leben des Geistes« ist das vom Tod gedopte Leben. Der Gedanke ist geeignet, das Lebensfußvolk abzuschrecken. Es will ja alles, nur kein Doping durch die Aussicht auf das Nicht-Sein. Das Publikum verlangt pures Leben, so vegetativ wie möglich, so animalisch wie denkbar. Der Saalredner ruft: Wollt ihr die totale Pflanze? Wollt ihr das totale Tier? Wollt ihr sie beide totaler und radikaler als alles, was man sich bisher vorstellen konnte? Es vergeht keine Sekunde, da steigt der Bejahungsschrei der Menge bis an die Wolken.
Im Sea Palace in der Hafenzone vis-à-vis der Centraal Station. Früher den Gerüchten zufolge Drehpunkt der lokalen Kokain-Mafia, heute ein Vorposten legaler asiatischer Effizienz. Eigentlich sind die Niederlande schon eine westchinesische Provinz. Während die Einheimischen sich ihren europatypischen Bequemlichkeiten hingeben, sorgen hochmotivierte Leute aus dem Osten, lächelnd und mit schnellen Schritten, für die unauffällige Übernahme der Geschäfte.
Nachmittags mit René und Babs auf dem Hausboot dem Bahnhof gegenüber. Wir reden über die geplante Sommerexkursion in den Schwarzwald und die Evasion nach Korsika im September. Am Horizont zeigen sich bessere Zeiten, wer weiß für wie lange.
14. Mai, Leusden
lischny tschelowek: »der überflüssige Mensch«, ein Archetypus der russischen Literatur im 19. Jahrhundert (englisch: unnecessary people). Wie ich auf den Begriff komme? Weil ein lokaler Journalist keine Ahnung von der Existenz des Ausdrucks zu besitzen schien. Er meinte, ich spräche von den Arbeitslosen unserer Tage. Die möge man besser nicht beleidigen. Ein Minimum an Lese-Erfahrung hätte dem Frager gezeigt, warum die Figur des überflüssigen Menschen für die Mehrzahl der russischen Klassiker unentbehrlich war. Sie alle beteiligten sich an der Phänomenologie des verstimmten Daseins. Die Leidenden fanden den Zustand der Welt auch damals naturgemäß entsetzlich, aber sie waren zu müde, irgend etwas zu tun, wodurch das unleidliche Ganze um einen Hauch besser geworden wäre.
Wer wissen möchte, wie es sich anfühlt, wenn die Existenz der Essenz vorhergeht, muß Russen fragen, die »vor der Revolution« gelebt haben. Im Französischen hieß »vor der Revolution« existieren, Talleyrand zufolge, noch etwas von der Süße des Lebens wissen können. Auf russisch bedeutet es, mit Tschechow und anderen: eintauchen in diese seltsame Sinnlosigkeit des überprivilegierten Daseins. Das Reich der gähnenden jungen Frauen reichte bis zum Ural. Russkaja skuka: Hätte Rußland damals etwas zu exportieren gehabt, es wäre die Langeweile gewesen.
Daß es dabei nicht bleiben konnte, zeigte die russische Oktoberrevolution. Diese hatte auch eine weibliche Seite: In Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk (1934) sagt die frustrierte junge Ehefrau zu ihrem Liebhaber, während er sie begattet: »Stoß mich, bis die Ikonen von der Wand fallen.«
Sartre meinte, aus dem Vorrang der Existenz vor der Essenz lasse sich die Nötigung herleiten, dem eigenen Dasein durch Wahl und Entwurf Sinn zu geben. Dem widersprach im voraus die petersburgische und moskowitische Melancholie. Sie zeigte, wie das Herumhängen in der entleerten Zeit das Ende der Geschichte mit sich bringt. Nicht nur der Tod ist die Unmöglichkeit, ein Projekt zu haben, wie Levinas dachte, die russische Müdigkeit tut es auch. Zeit meint da die Spanne zwischen dem Leeren der Wodkaflasche und dem Begräbnis.
Im Wald von Leusden, nahe an dem Gelände von Renés Schule der wijsbegeerte, ein Rauschen, auf das der Schwarzwald eifersüchtig sein könnte. So ähnlich klingen die Weiden am Alt-Rhein in der Nähe meines Rastplatzes, wo die Schwäne brüten.
In der agrarischen Welt ist der Mensch ein pleuriertes Lebewesen. Mit dem Kopf in die Erde eingepflanzt, verzweigen sich seine Füße zu einer Trauerkrone, die in der Luft schwankt, indes sein Kopf ein unterirdisches Wurzelwerk ausbildet. Es denkt in den Wurzeln, in den Fußwipfeln spielt der Sturm. Was Wunder, wenn ein solches Geschöpf davon träumt, die verkehrte Welt vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Die sprechenden Wesen sind von Natur aus zur Akrobatik bestimmt. Sie rollen in den bunten Wagen des Zirkus »Logos« übers Land. Haben sie genug geübt, fügen sie Sätze in Sätze in Sätze.
15. Mai, Leusden
Aus dem Perlentaucher erfährt man, Žižek habe dieser Tage in Berlin einen Vortrag gehalten, in dem er auf Frank Rudas Buch Hegels Pöbel Bezug nahm. Der Pöbel-Begriff des Philosophen ist unkonventionell, weil er nicht nur die unfreiwillig verwahrlosten Armen umfaßt. Er nimmt auch die mutwillig haltlosen Reichen aufs Korn. Pöbel ist, was von innen her kein Verhältnis zum Gesetz, zum Allgemeinen, zu Geist und Staatswesen besitzt.
Ruda irrt, wenn er meint, die Existenz des Pöbels dementiere den Hegelschen Versuch der Systembildung. Er übersieht, daß es eine völlig aufgeräumte »Gesellschaft« nirgendwo geben kann – es sei denn am Totensonntag des Lebens. Kein »System« muß alles erfassen. Es spricht nicht gegen die Idee des Rechts- und Vernunftstaats, wenn man zugibt, daß auch in ihm Behinderte, Obdachlose, Arbeitsunwillige, Autisten, Anarchisten, Spieler und Hooligans sich aufhalten, daneben auch Gewalttäter und reisende Einbrecherbanden, die undurchdringliche Dialekte sprechen. Der unordentliche Überschuß delegitimiert die Anstrengung des »Bestehenden«, sich in seinem Bestand zu festigen, keineswegs, seiner chronischen Labilität ungeachtet. Im übrigen: War nicht die ältere Kritische Theorie eine einzige Unternehmung, dem sogenannten Bestehenden die Rechtsgrundlage zu entziehen? Und ist nicht das »Bestehen« die eigentliche Tätigkeit jedes nicht-gescheiterten Staats?
Wie gut kann man sich die aufmerksamen Gesichter der rebellisch disponierten klugen jungen Leute vorstellen, die in Berlin den Kapriolen von Žižek zuhören. Ob sie besser dran sind, als wir es vor über 40 Jahren waren, wenn wir Adornos Umweg-Künsten zu folgen versuchten? Adornos Hermetik und Slavojs Assoziationen haben gemeinsam, daß sie in manchen von den Besten unter den Jungen die Illusion wecken, die Wahrheit warte auf sie wie eine nackte Göttin am Ende des Labyrinths. Sie wissen noch nicht, am Ausgang der Irrwege steht das hilflose gute Herz, das begriffen haben wird, daß es oft nicht kann, wie es möchte.
Goethe: »Wer nicht verzweif’len kann, der muß nicht leben.«
16. Mai, Amsterdam
Auf der Fähre von der Centraal Station zum Ij-Plein. In den Gesichtern mancher holländischer junger Frauen liegt ein Leuchten, das sich mit den herkömmlichen biologischen Konzepten unmöglich erklären läßt. Ob nicht ein offener Brief an Darwin am Platz wäre?
»Verehrter Sir Charles,
Sie dürfen versichert sein, daß niemand den Scharfsinn Ihres Werks mehr bewundert als der Verfasser dieser Zeilen. Aber, ich bitte Sie, sehen Sie diesen hellen Geschöpfen aufmerksam ins Gesicht. Sie werden zugeben, die Evolution, wie wir sie bisher dank Ihrer Konzepte nachvollzogen haben, reicht nicht hin, um das Mehr an Licht und Liebreiz in den Zügen solcher Wesen zu begreifen. Es sind nicht allein die sexuellen Merkmale, seien sie primär oder sekundär, die uns zu Handlungen geneigt machen, um den Weg von der Sympathie zur Fortpflanzung zu ebnen. Mir scheint, es gibt tertiäre Größen, in denen sich der tiefere Grund des Hingerissenseins verbirgt. Daß diese Wesen leuchten können, beweist mir, es sind noch andere Motive im Spiel. Im Interesse der schönen Mädchen an Bord und aus dem Bekenntnis zu meiner Freude an ihrem Anblick muß ich Ihrer Theorie, verehrter Sir Charles, teilweise untreu werden. Naturgemäß schrecke ich vor theologischen Aussagen zurück. Diese dürften jedenfalls nicht auf der Höhe einer amtlichen Dogmatik liegen. Es wäre genug, von den Augenblicksgöttern und vom Schwirren der Nymphen über den Quellen zu reden.
Ich fürchte, Sir Charles, das ist nicht der richtige Moment, diese Überlegungen auszuführen. Die Fähre legt an. Die jungen Dinger schwingen sich auf ihre Räder. In weniger als einer Minute sind sie in der Nordstadt verschwunden. Ich weiß nicht, wohin die flüchtigen Wesen sich zerstreuen; erst recht weiß ich nicht, woran sie glauben. Doch bin ich sicher, Glauben und Leuchten sind miteinander verwandt. Jede Sprache wäre willkommen, die erlaubt zu sagen, es gebe Raum nach oben.
In aufrichtiger Bewunderung
Ihr …«
Vom Hausboot aus beobachtet. Ein fliegender Schwan landet auf dem breiten Fluß. Bevor er sich damit abfindet, ein wassergetragenes Wesen zu sein, läuft er flügelschlagend fünfzig, sechzig, siebzig Meter auf der Flut, dann erst akzeptiert er das graugrüne Element als sein aktuelles Milieu. Wie rührend es ist, zu sehen, daß er die Lage nicht sofort gutheißt. Schon schwimmend breitet er noch einmal seine Flügel aus, wie um sich zu vergewissern, sie würden ihm ihre antigrave Energie später nicht versagen. Dann senkt er den Kopf, er pickt ins Wasser. Jetzt läßt er sich darauf ein, für eine Weile als Bewohner des flüssigen Elements zu existieren.
Lese von Malcolm Gladwell einen Artikel aus dem Jahr 2004, zuerst erschienen im New Yorker unter dem Titel The Picture Problem. Er entwickelt darin eine glänzende Analogie zwischen Kriegsphotographie und Mammographie – eine Exkursion in die Abgründe der artifiziellen Sichtbarkeit. In Brüsten und in Nachtaufnahmen feindlicher Städte im Mittleren Osten meint man nicht selten zu erkennen, was es gar nicht gibt. Krebszellen und Waffenlager. Man interveniert hier wie dort, ohne im Realen zu finden, was den Mystifikationen des bildgebenden Mediums entspricht.
An Dominique Strauss-Kahns New Yorker Affaire zeigt sich, woran Männer mit Machtambitionen in heutigen Tagen am leichtesten scheitern. Figuren seines Zuschnitts möchten bis zum Beweis durch das Gegenteil nicht einsehen, wie weit die Parallelen zwischen Virilität und Dummheit reichen. Seit Jahren lebt der Mann in den Vereinigten Staaten und hat noch immer nicht begriffen, unter welchen Spielregeln die lokalen Sexualverhältnisse sich ergeben. Aus seinen beruflichen Realitäten sollte er damit vertraut sein, daß hier alles, worauf es ankommt, transaktional, förmlich, schriftlich, teuer und langsam vor sich geht. Kaum betritt er seine Suite, soll mit einem Mal alles schnell, informell und umsonst sein.
17. Mai, Amsterdam
Nachdem Jean-Pierre Wils den Satz »Das Wunderbare ist das Lächeln des Unmöglichen« an den Anfang seiner Befragungen zu Du mußt dein Leben ändern gestellt hatte, konnte das Podiumsgespräch nicht mehr mißlingen. Vom ersten Moment an war alles im Raum, was mit den Leitbegriffen des Buchs zu tun hat: Vertikalspannung, Allgemeine Akrobatik, Vorsprung durch Übung, Leichtwerden des Unwahrscheinlichen.
Wie schön sind Vormittage ohne Pflichten in einer fremden Stadt. Aus der Presse verschafft man sich einen Überblick über die Aktualitäten. Ist auch das meiste unerfreulich, die Übersicht als solche heitert auf. Du sammelst Signale aus der multikorrupten Szene, die sich die »freie Welt« nennt. Du darfst viel erfahren und mußt nichts ändern. Wie sympathisch ist der Liberalismus, solange er nicht mehr ist als der Pluralismus der Immoralismen.
Im Grünen Amsterdamer der letzten Woche versucht sich ein Journalist, Koen Haegens, nicht ohne Sympathie, an einem Resümee meiner Position. Es könnte sein, daß er den Punkt getroffen hat. Er deklariert, Sloterdijk sei ein »linker, rechter, elitärer sozialdemokratischer Liberaler mit … originellen Ideen«.
Für das Philosophische Quartett vom 19. Juni hatte Peer Steinbrück vor einigen Monaten zugesagt. Inzwischen war es ihm in den Sinn gekommen, sich für die SPD als Kanzlerkandidat aufstellen zu lassen. Vom selben Augenblick an wollte der Mann kein intellektuelles Risiko mehr eingehen. Er widerrief seine Teilnahme an der Sendung einen Monat ante eventum. Aus seiner Sicht mag die Entscheidung so etwas wie politische Reserve ausdrücken, aus meiner Wahrnehmung und der der übrigen Betroffenen ist sie ein Zeichen von eitler Illoyalität. Obschon Steinbrück gegen Angela Merkel, die Große Mutter der Entpolitisierung, nicht den Hauch einer Chance haben wird, entschied er sich dafür, die einzige Fernsehsendung zu meiden, in der ihm sein bestes Talent, seine Redefreiheit, hätte nützlich werden können.
18. Mai, Amsterdam
Treffe am späten Vormittag in einem TV-Studio Wim Brands, dem hierzulande nachgesagt wird, er sei der Mann, der das holländische Kulturfernsehen überragt. Extrem gutaussehend, schlagfertig, gebildet, ganz Zuvorkommen und Resonanz. Und Lyrik schreibt er auch. Er rechnet unter die Geschöpfe, die man pränatal hätte kennen sollen, bevor man entschied, sich männlich oder weiblich zu inkarnieren. Von den günstigen Gerüchten, die ihm vorauslaufen, scheint jedes zutreffend.
Im übrigen hat das niederländische Kulturfernsehen längst vor der Anglophonie kapituliert, wir produzieren die zwanzigminütige Sendung auf englisch. Daß sie dem Buch (Du mußt dein Leben ändern auf holländisch) vage nützen kann, ist plausibel, zumal sie zweimal ausgestrahlt wird, zuerst am kommenden Sonntag und am folgenden Samstag noch einmal, so daß sie mit circa 500.000 Zuschauern praktisch das gesamte niederländische Bildungspublikum erreicht. Es wäre naiv, von der Streuung der publicity auf Verkaufszahlen zu schließen. Heute dient die Kritik meist nur noch der abstrakten Präsenz eines Titels. Eine Rezension, zumal die lobende, führt den Leser nicht zum Buch hin, eher macht sie die Lektüre überflüssig.
Mittags wieder im Sea Palace, allein. Diesmal mit Malcolm Gladwells Essay Something Borrowed, ebenfalls aus dem Jahr 2004, erschienen im New Yorker. Das wird vermutlich auf lange Zeit das Klügste darstellen, was man zu den Themen Plagiat und geistiges Eigentum lesen kann, geschrieben von einem beiläufig Bestohlenen, der sich aus gegebenem Anlaß klarmachte, was für eine Ehre es bedeuten kann, wenn ein paar Sätze aus der eigenen Feder im Kunstwerk eines anderen wiederkehren.
Am Abend mit Babs und René in einem exzellenten Design-Restaurant in Amsterdam-Noord. Leichtsinnig probiere ich danach eine von Renés Opioid-Kapseln aus, mit ambivalenten Folgen. Kaum im Hotelzimmer angekommen, tritt ein heftiger Schweißausbruch auf, das Wasser strömt gießbachartig vom Kopf über die Schultern. Schuld hieran war vermutlich die Wechselwirkung der Kapsel mit der Havanna, die ich mir am Nachmittag bei Hajenius am Rokin besorgt hatte. Der Spuk geht nach einer Viertelstunde vorüber.
19. Mai, Nijmegen, Wien
Mit der Promotionszeremonie in der südholländischen Stadt endet die von Presseterminen und Auftritten überladene Woche. Auch diesmal (wie im Jahr zuvor in Warwick) wird der Laureatus zum Zeugen dessen, was geschehen kann, wenn eine Universität sich noch als zeremonienfähige Größe ernst nimmt. Doch mag man von invented traditions so viel träumen, wie man will, für ein entzeremonialisiertes Subjekt wie den deutschen homo academicus ist eine überzeugte Rückkehr zu den Riten nicht mehr möglich.
Was für ein Bild: Am dies natalis der Universität, die ihren 88. Gründungstag feiert, zieht die gesamte Professorenschaft in Togen aus schwarzem Samt und viereckigen weichen Baretten in die Fest-Aula ein, indes das wartende Publikum sich von den Plätzen erhoben hat. Bei uns wäre eine solche Demonstration von esprit de corps in keiner Institution mehr anzutreffen, nicht einmal beim Bundesverfassungsgericht, bei dem es immerhin noch einen partiellen Kostümzwang gibt, noch weniger bei der Bundeswehr, die über ihren Status als altgewordene Improvisation nicht mehr hinauskommt.
Ganz perplex ist der Gast, wenn er erlebt, wie der rector magnificus die Sitzung mit einem Gebet auf lateinisch eröffnet. Nach zwei längeren Reden repräsentativen Charakters, die eine mit bildungspolitischem Tenor, die andere zu einem rechtsphilosophischen Thema in akademischem Prunk-Niederländisch, folgt schließlich die Ehrenzeremonie, bei der man mir als Zeichen der neuen Würde eine hellrote Capa umlegt, über der vom Fundus ausgeliehenen schwarzen Robe.
Einen Höhepunkt eigener Art fügte Hans Sars nach dem Ablauf der Feier hinzu, als er uns in seinem Büro auf dem Germanisten-Korridor Einblicke gab in Briefe von Paul Celan an seine holländische Geliebte aus den Jahren 1949 und 1950. Kaum zu fassen, daß das Original-Typoskript der Todesfuge sich hier befindet, und du darfst sagen, du habest es autoptisch gesehen.
Am Abend Ursula angerufen und Grüße aufs Band gesprochen.
Um den Verdruß über die Verspätung des Flugs von Düsseldorf nach Wien zu dämpfen, blättere ich in einem Artikel aus der Werkausgabe von Ortega y Gasset, von der ich zufällig einen Band mitgenommen hatte. An einer Stelle entwickelt der Verfasser die Idee, Leben sei das ständige Geschehen der Lebensrettung. Er nimmt den Grundgedanken der Allgemeinen Immunologie vorweg, ohne den Ausdruck zu nennen und zu kennen.
Wahrscheinlich war es in demselben Aufsatz – oder einem benachbarten Stück –, wo ich Ortegas These zum realen Ursprung der athenischen Demokratie entdeckte: Demokratie, so erfährt man hier, war die taktische Antwort des Themistokles auf die Frage, woher man die 14.000 Ruderer nehmen sollte, die nötig waren, um die gegen die Perser gebaute athenisch-griechische Flotte zu bemannen.
Das anti-persische Immunsystem der Stadt Athen war nur durch ein »demokratisches« Regime auf die Beine zu stellen. Die Adligen, auf Reiterangriffe und Schwertkämpfe an Land spezialisiert, und die Bauern, die die Phalangen bildeten, wären niemals imstande gewesen, die Stadt gegen die orientalische maritime Übermacht zu verteidigen. Folglich ist die athenische Demokratie ein Nebenprodukt der Verlegenheit, einen Seekrieg gewinnen zu müssen. Wer von Salamis nicht reden will, soll von der demokratischen Verfassung des Gemeinwesens schweigen. Die angebliche Herrschaft des Volks beginnt auf den Ruderbänken der athenischen Kriegsflotte. Sie trägt der Klasse der Tagelöhner und Handlanger einen politischen Status ein. Der kann nur so lange gültig bleiben, wie die Erinnerung wachgehalten wird, wonach demokratische Rechte als legitimer Preis für erfüllte Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen verliehen werden. Von den zweihundert Triremen, die später auf dem athenischen See-Reich patrouillierten, trugen manche so blumige Namen wie »Demokratie« und »Freie Rede«.
In Wien angekommen, macht sich das Ausmaß der Verausgabungen während der letzten Wochen bemerkbar. Erschöpfung will gelernt sein. Man muß die Seele langsam dimmen. Es wäre ein Fehler, zu Bett zu gehen, ohne ein Minimum an Ankunftsritualen zu beachten. Da ergab sich die Wahl zwischen zwei alten Whiskys, beide in dem Glasschrank, den Luigi Blau für die Bibliothek entworfen hatte.
Auch am Abend liest man mails, nicht um Neues zu erfahren, sondern um sich von der Welt zu verabschieden. Das Wetter von morgen wäre zu konsultieren.
20. Mai, Wien
Malcolm Gladwell demonstriert in seinem Essay über die geheimdienstliche Intelligenz, wieso diese in der Regel außerstande ist, vorliegende disparate Daten zu einer sinnvollen Geschichte zusammenzusetzen. Connecting the Dots (2003), ebenfalls im New Yorker publiziert, bietet eine hyperkluge Studie zur Epistemologie der Secret Services. Deren Gebrechen besteht darin, vorhandene Erkenntnisse zu stark zu fragmentarisieren. Ist wieder einmal etwas Schreckliches passiert, pflegt man den Geheimdienstleuten vorzuwerfen, sie hätten alles gewußt, was nötig gewesen wäre, um es zu verhindern. Das trifft in vielen Fällen zu, doch begreift man üblicherweise nicht, daß es solchen Einrichtungen strukturell an Synthesefähigkeit mangelt. Um die Erfolgsquote zu heben, müßte man den Ermittlern einen Drehbuchschreiber außer Dienst zur Seite stellen oder einen Romancier in Schaffenspause.
Die Affaire Strauss-Kahn nimmt mit jedem Tag bizarrere Züge an. Längst hat der Unrechts- und Verletzungsgehalt der öffentlichen Bloßstellung eines Manns mit dubiosen Manieren in den Medien der ganzen Welt ein Vielfaches dessen überstiegen, was der Übeltäter seinem Opfer angetan haben könnte.
Die asymmetrische Kriegführung hat das Rechtswesen erreicht. Nimmt man an, es habe zwischen DSK und der schwarzen Chambermaid des New Yorker Sofitel tatsächlich eine sexuelle Transaktion gegeben – vielleicht ein Akt von nicht allzu spontanem Oralsex, wahrscheinlich durch ein Trinkgeld vermittelt –, so liegt in dem Vorgang nichts, was die Aufmerksamkeit Dritter auf sich ziehen sollte.
Wenig später mußten die Eingeweihten begriffen haben, was für einen Fisch sie an der Angel hatten. Eine eifrige junge Staatsanwaltschaft tat das übrige. Man hat nicht jeden Tag die Gelegenheit, den möglichen Präsidenten eines Landes zu verhaften, das seit 50 Jahren an der Führungsrolle der USA in der Nato herummäkelt – und dies nur wenige Minuten vor seinem Abflug in die Unbelangbarkeit.
Die DSK-Affaire ist mediologisch als Musterfall zu studieren, ja, sie ist soziologisch unbezahlbar, weil sie, wie seinerzeit der O. J.- Simpson-Prozeß, alle Zutaten zu einem Skandal hors catégorie enthält.
Im überdimensionierten Skandal wird das Gewebe der Differenzen offengelegt, aus denen moderne Gesellschaften gemacht sind. Wir haben die Rassendifferenz: weißer Täter, schwarzes Opfer; wir haben die Klassendifferenz: Millionär versus armes Mädchen; wir haben die Geschlechterdifferenz: aggressiver Mann versus duldende Frau; wir haben die Statusdifferenz: Welt-Promi gegen Underdog; wir haben die Glamour-Differenz: der gutaussehende jüdisch-französische Charismatiker gegen die schlichte dunkelhäutige Frau, der man kaum zu nahe tritt mit der Vermutung, ihre Vorzüge würden erst auf den zweiten Blick wahrnehmbar. Daß DSK einer solchen Frau einen sexuellen Gefallen entlocken wollte, ist nur endokrinologisch zu deuten. Er muß von einer Episode kurz davor noch so stimuliert gewesen sein, daß ihm am folgenden Tag jede beliebige weibliche Erscheinung als erneuerte Einladung vorkam.
Jeder Beobachter der Vorgänge hat zuzugeben, daß der eigentliche Skandal im Modus der Skandalisierung liegt. In der blühenden Affaire wird die von den Jakobinern erprobte und von der Tscheka perfektionierte In-eins-Setzung von Anklage und Verurteilung erneut vollzogen. Die bürgerliche Öffentlichkeit hat sich das Muster zu eigen gemacht, und keine von den Qualitätszeitungen schert aus.
»Bürger Strauss-Kahn, stehen Sie auf! Das Gericht redet zu Ihnen. Sie begreifen doch endlich, warum Öffentlichkeit und Gericht eins sind? Es spricht Sie schuldig aufgrund der unleugbaren Tatsache, daß Anklage gegen Sie erhoben werden konnte.
Das Gericht sieht es als seine Pflicht an, Sie darauf hinzuweisen, daß Ihre Hinrichtung bereits erfolgt ist. Wenn es Sie im Folgenden auf freien Fuß setzt, so unter der Bedingung, daß Sie das Reglement für die lebenden Toten respektieren. Sie haben alles zu unterlassen, was den Verdacht nähren könnte, Sie wünschten, unter die Lebenden zurückzukehren.«
21. Mai, Wien
Vormittagsmystik. Seit das helle Nachbarhaus renoviert ist, leuchtet die Bibliothek im reflektierten Licht.
Aus Le Monde des livres erfahre ich, was bei den 5. Assises du roman in Lyon besprochen wurde. Es existieren immer noch Gründe, den Roman als Welt-Sonde ernst zu nehmen, selbst wenn 98 Prozent der Produkte dieses Genres besser eingestampft würden, bevor ein Leser auch nur eine Minute seiner Lebenszeit mit ihnen verliert.
Einen immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse gibt es nicht, außer im Kindertheater und der iranischen Metaphysik (die im 20. Jahrhundert unter ideologischem Incognito zahllose europäische Intellektuelle beirrt hat).
Der erwachsene Geist kennt den Einsatz für eine unvollkommene Sache. Mein ferner Freund Finkielkraut schreibt diese Idee einem fast unbekannten Autor namens Paul-Louis Landsberg zu. Nach ihm geht es im verantwortlichen Leben darum, mit Leib und Seele für Dinge einzutreten, die sich nicht vervollkommnen lassen.
Was soll man aber über den lieben alten Stéphane Hessel sagen? Er setzt die nicht ungefährliche Illusion in die Welt, wonach die Empörung die Muse der progressiven Politik sei. In Wahrheit ist sie die Muse der Vergröberung. Schon Bakunin hat sie vergeblich beschworen. Wer sie nicht unter Kontrolle bringt, tut leicht den Schritt in die Verdummung. Die wartet auf jede Gelegenheit, gegen die schwarze Bestie der »Zustände« ins Feld zu ziehen. Von der Empörung zur Unbelehrbarkeit ist es nur ein Schritt.
In der Neuen Zürcher Zeitung findet sich ein Artikel des Heidelberger Indologen Axel Michaels über einen aktuellen Yoga-Streit in den USA. Ausgelöst wurde er durch den suspekten Trainer Bikram Choudhury, der sich seine »26-Asanas-Power-Sequenz« patentieren lassen will, als ob unter heutigen Bedingungen alte Kulturtechniken privatisiert werden könnten. Der Clou des bikramisierten Yoga soll sein, daß die Übungen in überhitzten Räumen ausgeführt werden – und daß der profit- und sexsüchtige Meister jeden verklagt, der etwas davon nachahmt, ohne zu zahlen.
Bei Michaels erfährt man, förmliche Anleitungen zum Hatha-Yoga gebe es in Indien erst seit dem 14. Jahrhundert. Das übrige ist Konstruktion und späte interkulturelle Synthese. (Vgl. Mark Singleton, The Yoga Body. The Origine of Modern Posture Practice. Oxford University Press 2010.) Was wir für ur-uralt halten, wurde in der Regel gestern konfektioniert und liegt jetzt in den Vitrinen der Antike-Läden als Fund aus der Archaik.
22. Mai, Wien, Karlsruhe
Heutzutage rückt jeder, der lesen und schreiben kann, mit seinem Befund über die kranke »Gesellschaft der Gegenwart« heraus. Die »Gesellschaft« wird so zu dem meistüberdiagnostizierten Patienten. Wäre ich »die Gesellschaft«, ich wüßte nicht, woran zu leiden ich mir aussuchen würde.
Rückblick. Gestern im Goldlicht an der Donau unterwegs, vom Mittag überflutet, jedes einzelne Blatt an den Sträuchern strahlt wie von einer evangelischen Mission erfüllt. Auch wir haben einen leuchtenden Pfad, einen geteerten Weg am Strom.
Beklemmender Traum aus dem Nachmittagsschlaf. Ich bin als Mitglied einer Gruppenreisegesellschaft in Japan. Man trifft in einem Landhotel ein. Meine Mitreisenden halten Luftmatratzen in Händen, die man ihnen zum Schlafen anbietet. Sie begeben sich in ihre Schlafnischen von der Größe eines Sarges. Ich protestiere. Mit mir kann man so etwas nicht machen! Die Austeilung der Matratzen geschieht in einer Atmosphäre von Unruhe, hilflosem Widerspruch, beklemmender Gefangenschaft. Als ob es nichts Schlimmeres gäbe als das Zusammensein-Müssen mit einer Reisegruppe, die sich alles gefallen läßt.
Wolf Wondratschek gestern zum Aperitiv getroffen. Wie unter Freunden üblich, die sich länger nicht gesehen haben, tastet sich das Gespräch über ein Durcheinander von Themen: sein neues Buch, Das Geschenk, das zu Recht viel Beifall fand und seine Autoren-Imago veränderte; die Strauss-Kahn-Affaire und die unauslöschbare Präpotenz erfolgreicher Männer; das Phänomen des Knock-out außerhalb des Box-Rings; die Babylon-Oper, deren Libretto heranwächst; das Motiv des schlafenden Mädchens in der Kunst.
Gott gerät in den Medien unter Druck, seit man nicht umhinkommt, ihn als alleinerziehenden Vater des Menschengeschlechts aufzufassen. In dieser Position wurde er zu jemandem, an den man auch »nicht glauben« konnte. Der Unglaube betrifft nicht so sehr seine Existenz, sondern stützt sich auf den Eindruck, daß er in seiner Rolle nicht überzeugt.
Wondratschek meint, die Welt der Opernliebhaber warte auf etwas wie eine neue Zauberflöte.
Büchermensch, hör zu: Hast du denn je das Buch entdeckt, das dich so absorbierte, bis Buch und Außen eins wurden? Könntest du selbst es schreiben?
Sicher, du hast sieben Jahre im Venusberg des Wissens verbracht, um Sphären zu verfassen, die vielleicht den letzten Versuch darstellen, das absolute Buch zu liefern, oder fast. Daß niemand es so verstanden hat, ist wahrscheinlich ein weiterer Beweis seiner Unmöglichkeit.
Der Weltuntergang in einer absorbierenden Theorie findet nicht statt. Was folgt daraus? Du wirst wie bisher am Rand deiner Bibliothek leben und zusehen, wie die Bestände wachsen. Viel klüger wirst du nicht werden. Was bisher gesagt werden konnte, ist gesagt, zumeist von anderen. Hast du ein wenig Glück, wird dich die Muse der Nuance noch hin und wieder küssen. Die Summe episodischer Verzauberungen ergibt keinen Glauben.
Das Bayerische Fernsehen bringt vor Mitternacht Bilder des jungen Bob Dylan. Daneben werden aktuellere Aufnahmen präsentiert, die den 1941 Geborenen in seinem jetzigen, wie mir schien, weniger vorteilhaften Zustand zeigen. Vor allem die frühen Dokumente machen etwas deutlich, was von Anfang an zu hören und zu sehen war. Dylan lebte für wenige Jahre in einem Zustand der Gnade. Er war nicht weniger als ein begabter Junge, der lichte Momente hatte, aber mehr auch nicht. Schon damals produzierte er mit seiner quengeligen Stimme und seinem beschränkten Tonumfang eine Menge unbedeutendes Zeug, das immer sehr ähnlich klang. Sein trashiger Sound sickerte einer Generation ins Ohr. Er popularisierte eine Musik, die nicht unbedingt sein müßte. Durch ihre Redundanz prägte sie die kollektive Stimmung. Mit Dylan wurde das Singen, ohne es zu können, zur Klanggestalt einer Ära. Das intensive Nicht-Können erwies sich mehr und mehr als ein Können eigener Art. Man gewöhnte sich daran und war irgendwann davon überzeugt, es habe von Anfang an so und nicht anders sein sollen.
Da ließ sich nicht vermeiden, daß nach einer Weile die Sentimentalen auf den Plan traten und aus den wenigen hellen Augenblicken von gestern eine große Sache für heute machen wollten. Es ist schon richtig, Hard Rain bleibt die akustische Ikone einer versunkenen Zeit.
Es ist leicht, ein wenig genial zu sein, wenn man zwanzig ist oder dreiundzwanzig. Es käme darauf an, es mit siebzig zu sein, in einem Alter, in dem Dylan einige Mühe hat, nicht als Kopist seiner selbst zu erscheinen. Er wirkt heute ein wenig wie eine Lagerhalle, in der alle Arten von kunstähnlichen Produkten aufbewahrt werden. In dem gleichen Film trat eine grauhaarige Lady auf, von der es hieß, sie sei Joan Baez. Ihr Habitus glich dem der Direktorin eines Immobilienfonds. Die Gentrifizierung macht vor dem Folksong von einst nicht halt.
23. Mai, Paris
Die Affaire DSK ist in aller Munde. Der am häufigsten zu hörende Satz lautet: »Er tut mir nicht leid.«
Bericht von den Lebensbedingungen in Singapur. Jeden Augenblick kann es einem geschehen, daß ein Kontrolleur in der Wohnung steht, um den Wasserstand in deinen Vasen und Blumentöpfen zu prüfen. Da sich Moskitos darin vermehren könnten, ist stehendes Wasser auch in den eigenen vier Wänden verboten.
24. Mai, Paris
Im 7. Stock des Unesco-Gebäudes an der Place de Fontenay mit Michel Rocard, René Passet, Sacha Goldman und anderen zur Vorbesprechung des Treffens mit einigen Spitzen von UNO und Unesco, das gleich danach im Plenarsaal stattfinden soll.
Es scheint, diesmal sorgen die Zeitumstände dafür, daß mein Referat über die Entwicklung eines politischen und meta-politischen Bewußtseins von Ko-Immunität auf globaler Basis ein aufmerksames Publikum findet, während dieselben Ideen für fast dieselben Ohren vor einem Jahr praktisch außer Hörweite geblieben waren. Die deutsche Botschafterin bei der Unesco, eine Dame mit ausgeprägtem Sinn für gesellige Informalität, versicherte im Anschluß an die Sitzung, sie wolle sich um erneute Einladungen zu Veranstaltungen des Hauses bemühen. Sie gehört zu den Frauen, bei denen man das Wort »attraktiv« verwendet, um über Mitgiften seitens der Natur nichts Näheres zu sagen.
Michel Rocard hatte sich in großer Form präsentiert. Man möchte meinen, es seien jetzt die Alten, die Frankreichs Ehre retten. Vom Auftritt Rocards abgesehen hat Sacha Goldman recht, wenn er gegen die UNO poltert, sie sei eine Mühle, die das Nichts mit Milliardenaufwand zu noch mehr Nichts zermahlt.
Das Motiv »Ko-Immunität« wartet auf seine Zeit. Mag sein, sie kommt niemals. Einiges spricht dafür, daß die Eliten den Traum der Globalisierung, die zum Zusammenleben aller mit allen führen sollte, mehr oder wenig stillschweigend aufgegeben haben. Träfe dies zu, würde das kommende Jahrhundert den Rückzügen der Mächte in regionale Egoismen gehören. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem französischen Spitzenpolitiker vor einem Jahr in Abu Dhabi, der beiläufig bemerkte, die Erdbevölkerung müsse im Lauf der kommenden Jahrhunderte auf weniger als zwei Milliarden Menschen reduziert werden. Über die Schrumpfungsverfahren wurde nicht gesprochen.
Nachts, an der Place des Abesses, hört man das Moos auf Marens Terrasse flüstern.
Das Motiv der schwarzen Sonne führt zu Baudelaire, der über seine flüchtige Schöne sagt: En elle le noir abonde … Je la comparerais à un soleil noir, si l’on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur.
Dichterliebe im französischen Ton: Wenn schon ein Vergleich gewagt werden soll, dann der mit einem schwarzes Gestirn, das Licht und Glück verströmt.
Julia Kristeva entwickelte die Metapher der schwarzen Sonne in unvorhergesehener Weise, als sie in ihrer Studie über Melancholie und Depression, erschienen in den späten achtziger Jahren, die Tatsachen der aktuellen seelenklinischen Praxis mit Baudelaires Bild des dunklen Gestirns in Zusammenhang brachte. Diese Verknüpfung gehört zu den seltenen Einsichten, die den aktuellen Weltzusammenhang, die Anklammerung von Verlassenen an Verlassene, mit einer plötzlichen Wendung erläutern.
Der postmoderne Patient ist das Subjekt, das keine Vergleiche mehr produzieren kann. Das Vermögen, zu vergleichen, ist aber die Quelle des vitalen Elans, wenn Elan die Fähigkeit meint, Älteres auf Neues zu beziehen. Was man gedankenlos Liebe nennt, folgt aus der Begabung, das Leben im Getrenntsein zu formulieren, als ob es ungetrennt wäre. Lieben und dichten sind Ausdrücke für ein und dieselbe Bewegung. Shall I compare thee to a summer’s day? Nur zu, vergleiche mich, womit du willst, solange du der Antigravitation folgst.
Im Verlassenen ist der Sinn für Dichtung erloschen. Er vegetiert im Abgrund seiner Trennung von allem, was vormals Integrität gewährte – wenn man nur wüßte, wann das war. Er ist der leere Rest eines verlorenen Ganzen. Der Nachteil, geboren zu sein, schlägt über ihm zusammen wie das Meer über dem, der nicht mehr auftaucht.
Auch die Größten sind vor solchem Versinken nicht sicher. Als Hölderlin in seinem Turm auf und ab ging, kritzelte er in Erinnerung an den Dichter, der er einmal gewesen war, die Zeilen: »April und Mai und Julius sind ferne / Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne.«
Der Versunkene hat den Glauben an die Sprache verloren. Die Sprache war das Boot, das über das Mittelmeer des Daseins trug.
25. Mai, Paris, Karlsruhe
Sorgloser Morgen an der Place des Abbesses mit Maren und ihrer Freundin Anne. Die wird das Haus hüten, während Maren übers Wochenende nach Berlin geht. Ich komme erholter zurück, als ich anreiste.
Wo die Depression zum kollektiven Schicksal wird, bietet sich die Manie als Korrektiv an. Das Geheimnis der Massenkultur besteht darin, daß sie Manien auf den Markt wirft, die jeder sich leisten kann. Daher die okkulte Koalition der Amerikosphäre mit der Muslimosphäre. Beide offerieren ihren Anhängern die Möglichkeit, Größenphantasien von der Stange zu kaufen.
26. Mai, Karlsruhe
Ob es sein könnte, daß Postulate wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit usw. nur Nebenprodukte der Freiheit des Papierhandels waren? Papier ist das meistunterschätzte Produkt der Neuzeit, subversiver als Pulver und Kanonen.
Telefongespräch mit Nicolas Truong von Le Monde über sexuellen Pantheismus und erotischen Emanationismus. Der letztere, ungefähr altersgleich mit der bürgerlichen Gesellschaft, führt zur unmerklichen Vermehrung der Sonnenkönige. Darum gibt es zahlreiche Strahlungszentren, wo niemand sie vermutete. In der Aufklärung wachsen dem Pantheismus der Mächtigen ständig neue Köpfe nach – so viele Chefs gab es noch nie, so viele Zauberstäbe, so viele Flöten, zu denen die Kobras tanzen. In diesem Zusammenhang nimmt das Wort Penetration einen mehr ontologischen als sexuellen Sinn an. Es bezeichnet die Verwandlung eines Objekts in einen von der Strahlung des Senders mitverklärten Leuchtkörper. Einverleibung durch Gewährung von Teilhabe an einem Energie-Zentrum.
27. Mai, Karlsruhe
Von Philippe Nassif ein Widmungsexemplar seines Buchs La lutte initiale: Quitter l’empire du nihilisme, Denoël 2011. Es ist sympathisch in seiner Bemühung, den Teufelskreis von Depression, Ironie und Larmoyanz zu verlassen, der die französische Theorie- und Medien-Szene seit vielen Jahren verhext. Das Unternehmen erinnert von fern an die Verlegenheiten junger deutscher Intellektueller in den frühen achtziger Jahren, als sie dem Dunstkreis der Kritischen Theorie entwuchsen. Sie merkten allmählich, daß sie außer der Ablehnung des Bestehenden nichts gelernt hatten. Sie wollten sich ins Positive umschulen. Doch wie?
Nassifs Buch, diagonal überflogen, bietet Paraphrasen von Žižeks seit mehr als einem Jahrzehnt zirkulierenden Thesen über den perversen Imperativ der Konsumkultur: «Du sollst genießen!« Man erfährt, was man wußte: Paris ist ironisch, mürrisch und begierig, die jeweils neuesten Versionen des Deklinismus zu rezipieren, dabei hochmütig wie eh und je und auf elegante Weise streitsüchtig. Von résistance darf weiter geträumt werden. Noch immer bildet die Idee des Widerstands, wogegen auch immer, den nationalen Fetisch par excellence. Am Ende wird man den Krieg gewonnen haben, weil man kapituliert hat, ohne einverstanden gewesen zu sein. Da man sich auf post-marxistischem Terrain bewegt, ist vorauszusetzen, daß weit und breit niemand mehr an ein »letztes Gefecht« glaubt. Wie wäre es dann mit einem ersten Gefecht? Als Waffenbrüder zieht der junge Autor Tschuang-Tse, Lacan, Stiegler, mich und einige andere heran.
Der parisianische Kampf-Kitsch intensivierte sich kürzlich um einige Stufen, als Paul Veyne, sonst ein Autor mit Augenmaß, auf die Idee verfiel, seinen 1984 verstorbenen Freund Michel Foucault posthum (2008) als Samurai zu portraitieren. Das leuchtete nicht wenigen als anti-depressive Pose ein. Seither laufen sie auf dem Boulevard Saint-Germain in Kriegermontur herum und führen Schläge gegen den Nihilismus der anderen.
In den Campus Bookstores der Vereinigten Staaten brachte man Produkte dieser Tendenz noch kürzlich als French Theory in Umlauf. Neuerdings zieht man den Ausdruck Fresh Theory vor.
Auf der Leinwand des Medientheaters im ZKM