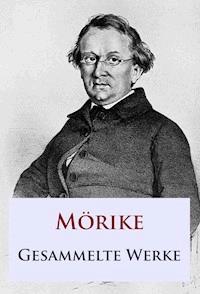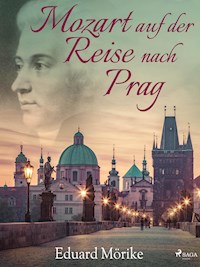Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auswahl aus den Dichtungen Eduard Mörikes Eduard Mörike - "Auswahl aus den Dichtungen Eduard Mörikes" von Eduard Mörike. Eduard Friedrich Mörike (* 8. September 1804 in Ludwigsburg, Kurfürstentum Württemberg; 4. Juni 1875 in Stuttgart, Königreich Württemberg) war ein deutscher Lyriker der Schwäbischen Schule, Erzähler und Übersetzer. Er war auch evangelischer Pastor, haderte aber bis zu seiner frühen Pensionierung stets mit diesem Brotberuf.Mörike wurde als siebtes Kind des Medizinalrates Karl Friedrich Mörike (17631817) und der Pfarrerstochter Charlotte Dorothea geb. Bayer geboren. Sein Vorfahr in vierter Generation war der Apotheker Bartholomäus Mörike (16691730) aus Havelberg.Er hatte zwölf Geschwister. Ab 1811 besuchte er die Lateinschule in Ludwigsburg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PUBLISHER NOTES:
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
LyFreedom.com
Einleitung.
Eine Auswahl aus Mörike und insbesondere eine Auswahl aus Mörikes Gedichten – ist sie gerechtfertigt, da doch der Dichter selbst bei der Sammlung seiner Gedichte so sorgfältig wählte und schied? Der Zweck unserer Ausgaben, die in erster Linie für die weitesten Kreise unseres Volkes bestimmt sind, möge es erklären, daß wir von dem Guten nur das Beste bringen, daß wir alle Übersetzungen und die meisten Gelegenheitsgedichte fortgelassen haben. Wenn sich auch in vielen irgend etwas dichterisch Schönes findet, so sind sie im Vergleich zu den anderen Gedichten doch minderwertig. Und scheint es nicht, als ob unsere Zeit mit der Fülle ihrer Erscheinungen und Forderungen, mit der ruhelosen Hast, in die uns der Kampf eines jeden Tages treibt, geradezu zu einer Auswahl drängt? Ist es nicht mehr als Zufall, daß unsere ersten lebenden Lyriker wie Liliencron, Dehmel, Falke selber eine Auswahl ihrer Gedichte veranstaltet haben? Wir sind nicht mehr die fröhlich dahinschreitenden Wanderer, die in behaglicher Muße den Fluß entlang ziehen. Wir werfen von der Höhe des Weges einen sehnenden Blick in sein liebliches Tal, steigen in der Hitze des Tages wohl zu ihm herab und erquicken uns an einem vollen Trunk, aber dann weiter, weiter! Hat er uns wohlgetan, dann denken wir des Spenders in dankbarem Gemüte, und in gesegneter Stunde kehren wir gern zu ihm zurück, um eine weit größere Strecke, wenn möglich den ganzen Weg mit ihm zu wandern. –
Eduard Friedrich Mörike wurde am 8. September 1804 in Ludwigsburg geboren, der kleinen württembergischen Residenzstadt, die uns auch Justinus Kerner, Friedrich Theodor Vischer, den Dichter von »Auch Einer«, und David Strauß, den Verfasser des »Lebens Jesu«, geschenkt hat. Der Vater, der Arzt gewesen, starb, als Eduard erst dreizehn Jahre alt war, und nun blieb der Mutter die Sorge für sieben unversorgte Kinder. Sie war eine lebhafte, heitere, phantasiebegabte Frau, und des Dichters geistiges Erbe stammte wohl zumeist von ihr. So ungern sie sich auch von ihrem Eduard trennte, so mußte sie es doch dankbar annehmen, daß sein Oheim, der Obertribunalpräsident Georgii, ihn zu sich nach Stuttgart nahm, um seine Erziehung zu leiten.
Da Mörike Theologie studieren wollte und sollte, kam er im folgenden Jahre (1818) in das Seminar zu Urach. Hier schloß er Freundschaft mit Wilhelm Hartlaub, der ihm Zeit seines Lebens aufs treuste zugetan war. Mit mancherlei Anlagen ausgerüstet, mit ausgesprochenem Talent für Zeichnen, mit tiefer Neigung für Musik verriet er auch schon hier seine poetische Begabung, und als er im Jahre 1822 in das Seminar zu Tübingen, das sogenannte »Stift«, eintrat, fand er sich bald mit dem poetisch veranlagten Ludwig Bauer zusammen, mit dem im Bunde er seinen phantastischen und poetischen Neigungen nachgehen konnte.
Von früh auf suchte der scheue, stille Knabe die Einsamkeit, fand seine tiefsten Freuden in der Natur und liebte es, sich in eine bunte, romantische Märchenwelt einzuspinnen. Nun trieben die Freunde »in einsamer Abgeschlossenheit im Walde, in einem Felsenloch, in einem verlassenen Brunnenstübchen ihr Wesen, machten den Tag zur erkünstelten Nacht, deren Dunkel eine matte Lampe erhellte, und lasen sich da Homer und Shakespeare vor. Nixen, Elfen und Geister aller Art beschworen sie mit ihrer Phantasie und träumten sich auf eine einsame Wunderinsel Orplid versetzt.«
In seiner Tübinger Studienzeit wurde Mörike von einer leidenschaftlichen Liebe zu Marie Meyer, einem abenteuernden Mädchen, ergriffen, dessen Wesen und Schicksal noch heute nicht ganz aufgehellt ist. Nach schweren inneren Kämpfen erkannte er, daß seine Liebe, die er in dem Gedichtcyklus »Peregrina« verewigt hat, auf Irrwege gegangen, und schwer krank kehrte er zur Mutter zurück. Wenn je ein Mann der liebenden, sorgenden und stützenden Hand des Weibes bedurfte, so war es Mörike, der so unerfahren in allen praktischen Dingen war, der sich so scheu von aller Welt zurückzog, daß er einmal später Geibel gestand: »Wenn Sie wüßten, welchen Entschluß schon es mich kostet, einer Gesellschaft zuliebe in einen andern Rock zu schlüpfen!« Er, der sich so sehr nach einem Heim sehnte, mußte jahrelang, nachdem er 1826 sein theologisches Examen abgelegt, von einem Orte Schwabens zum andern wandern, um als Pfarrvikar tätig zu sein. Kaum fing er an, irgendwo zu wurzeln, so mußte er sich wieder losreißen, bis er endlich 1834 die Pfarre von Cleversulzbach erhielt. Ein Jahr zuvor hatte er sein langjähriges Verlöbnis mit Luise Rau lösen müssen. Ihre Sorge um die Sicherheit ihrer Zukunft, Mißtrauen in seine Kraft und in seinen Willen hatten ein Verhältnis gelockert, das Liebe und Vertrauen geknüpft hatten. Nun bereiteten ihm die Mutter und die Schwester, die schon 1832 zu ihm gezogen waren, ein behagliches, stilles Heim, das wohl dem nicht ganz unähnlich war, das er in seinem fein humoristischen Idyll »Der Turmhahn« geschildert hat.
Es war ein schwerer Schlag für ihn, als die Mutter 1841 starb. Er ließ sie neben Schillers Mutter betten, auf deren fast vergessenem Grab er ein Kreuz hatte aufrichten lassen, und der er in seinem Gedicht »Auf das Grab von Schillers Mutter« ein Denkmal seiner Verehrung setzte.
Fortwährende Kränkeleien – so recht gesund fühlte sich Mörike nie – bestimmten ihn 1843 dazu, sein kirchliches Amt ganz aufzugeben. Hatten ihn im Anfang seiner Laufbahn oft religiöse Zweifel gequält, so hatte er sich allmählich in praktischer, ratender und helfender Tätigkeit zurechtgefunden, so daß er aus seinem Amte nicht leichten Herzens schied. Sein literarischer Ruhm war inzwischen stetig gewachsen. 1832 war sein großer Roman »Maler Nolten«, in den der Dichter manche Ereignisse seines Lebens hineingesponnen, erschienen. 1839 veröffentlichte er »Iris, eine Sammlung erzählender und dramatischer Dichtungen«, und ein Jahr früher hatte er die erste Sammlung seiner Gedichte herausgegeben. Fanden sie auch bei dem großen Publikum nur geringen Widerhall, die Kundigen wußten, was sie galten, wußten, daß ein neuer starker Dichter erstanden war. Hermann Kurz durfte scherzen, er werde ihn beschuldigen, daß er Goethes verlorene Lieder unrechtmäßigerweise an sich gebracht habe, um sich nun damit zu brüsten.
Nachdem Mörike sein Amt niedergelegt hatte, siedelte er nach kurzem Aufenthalt in Schwäbisch-Hall nach Mergentheim über. Hier entstand die »Idylle vom Bodensee«, die er 1846 veröffentlichte. 1851 ging er nach Stuttgart, wo er am Katharinenstift, einer höheren Töchterschule, eine Anstellung erhielt. In Stuttgart verheiratete er sich auch, zwei Töchter entsprossen dieser Ehe, und Mörike, der große Kinderfreund, jubelte über sein spätes Vaterglück; aber der Bund war trotzdem kein glücklicher. Die beiden Gatten standen sich innerlich zu fern, und anstatt zusammenzuwachsen, wurden sie sich immer fremder, so daß schließlich eine Trennung erfolgte.
In Stuttgart wurden auch zwei andre Kinder Mörikes geboren, seine beiden feinsten Prosadichtungen: das farbenprächtige, volkstümliche Märchen vom Stuttgarter Hutzelmännlein (1852), aus dem wir die köstliche »Historie von der schönen Lau« bringen,1 und die ergreifende Novelle »Mozart auf der Reise nach Prag« (1856). Sie mutet uns wie eine biographische Erzählung an, so wahr scheint Wesen, Charakter und Sprache des großen Komponisten getroffen; und doch ist's eigentlich auch ein Märchen, ein Märchen, wie ein Dichter sich einen Glückstag aus dem Leben eines Künstlers träumt, ein Tag, wo alle Erdenfreude ihm noch einmal hell leuchtet, kurz bevor die Lebenssonne zur Rüste geht. Von jeher hatte die Musik die tiefste Wirkung auf Mörike geübt, und was er einmal von seiner Lieblingsoper Don Juan sagt, das schlägt uns auch aus seiner Dichtung entgegen: »ein Überschwall von allem Duft, Schmerz und Schönheit«.
1 Es sei hier auf die Hessesche Gesamtausgabe von Mörikes Werken mit der vortrefflichen Einleitung von Rudolf Krauß hingewiesen.
Aus Gesundheitsrücksichten gab Mörike 1866 seine Stuttgarter Stelle auf und zog mit seiner Schwester nach Lorch. Mannigfache Auszeichnungen waren ihm inzwischen zu teil geworden. Die Tübinger Universität hatte ihn zum Ehrendoktor ernannt; der König Max von Bayern, der ihn gern in den Münchener Dichterkreis gezogen hätte, erwählte ihn zum Ritter des Maximilianordens, und die Schillerstiftung verlieh ihm eine lebenslängliche Jahrespension. Berühmte Dichter und Künstler suchten seine Freundschaft. Theodor Storm, der wesensverwandte norddeutsche Dichter, wies schon früh auf Mörikes Bedeutung hin. In seinen »Erinnerungen an Mörike« spricht er es aus, was der Dichter ihm gewesen, und in seinem Hausbuch deutscher Lyriker betont er, daß »Mörikes Gedichte in keiner Bibliothek fehlen dürften, in der unsere poetische Literatur, wenn auch nur andeutungsweise, vertreten ist«. Moriz von Schwind und Ludwig Richter schufen Bilder zu seinen Werken, und hervorragende Komponisten vertonten seine Lieder. Er hätte in Lorch, wo er die »langersehnte, absolute Ruhe und Stille« fand, einen behaglichen Lebensabend verbringen können, wenn ihn sein häusliches Unglück nicht tief gequält hätte. Ihm fehlte, was er an Schwinds Frau rühmte, »die treue, so ganz für ihn geschaffene Gefährtin«. Noch kurz vor seinem Tode rief er seine Frau zu sich und söhnte sich mit ihr aus, und am Morgen des 4. Juni 1875 endete ein Leben, das scheinbar ruhig und still verlief, das aber reich war an allem, was nur ein Menschenherz erregen und bewegen kann, an Leiden und Enttäuschungen, an schweren Kämpfen und stillen Siegen.
Mörike der Lyriker ist, wie Hebbel der Dramatiker, erst in unsern Tagen zu seinem vollen Recht gekommen. Es liegt in seinen Dichtungen nichts Hinreißendes, Leidenschaftliches, nichts Großes, Überwältigendes, das gleich auf den ersten Blick fesselt. Und doch fehlt es ihnen nicht an Größe und Leidenschaft. Nur wurzeln sie ebenso tief unter der Erde, wie sie oberhalb wachsen und grünen. Sie tragen die stille Schönheit seiner Heimat in sich: Hügel und Täler, Wald und Wiese und Fluß. Dem vorüberhastenden Blick erschließen sie nicht ihren Reiz, man muß sich darin ergehen. Aber dann findet jeder ein Stück Heimatland da, das Heimatland seiner Seele: »Ja, so haben wir's gefühlt, so haben wir's genossen! Das lag wohl immer schon so in uns, Mörike hat es nicht erfunden, hat es uns selber nur entdeckt.« Seine Dichtungen wirken so, wie er einmal in einem Brief an seinen Freund Waiblinger von dem frischen Sommerregen schreibt: »Unser Innerliches fühlt sich sonderbar geborgen und guckt wie ein Kind, das sich mit verhaltenem Jauchzen vor dem nassen Ungestüm draußen versteckt, mit hellen Augen durchs Vorhängel, bald aus jenem, bald aus diesem vergnügten Winkelchen.«
Und mit Kindesaugen sieht der Dichter in die Welt. Da ist nichts so klein, daß es, mit seinen Blicken betrachtet, nicht Wert erhielte, nichts so unscheinbar, daß es, von dem Strahl seines hellen Gemüts getroffen, nicht leuchtete und glänzte, und nichts so groß, daß er nicht damit spielen könnte. »Mörike,« sagt Fr. Strauß, »nimmt eine Handvoll Erde, drückt sie ein wenig, und alsbald fliegt ein Vögelchen davon.« Das ist die göttliche Urkraft der Phantasie, die in jedem Kinde lebendig ist und sich in jedem Dichter betätigt. Da gibt es nichts Großes und Kleines, nichts Lebendes und Totes. Da berühren sich überall Himmel und Erde, und jeder Mensch trägt das Gottesgnadentum, König zu werden, in sich. Aus dieser Märchenwelt kam Mörike nie heraus. Alles um ihn her, Stein und Pflanze und Tier, war ihm Gefährte und redete in seiner Sprache zu ihm. Weltfremd und menschenscheu, war er doch auf jedem Fleckchen grüner Erde daheim und vertraut mit allem, was Menschenherz bewegt. War es wunder, daß er Märchen dichtete? Er lebte sie ja. Märchenbildungen wie die Insel Orplid, wie der sichre Mann Suckelhorst wurden ihm so lebendig, daß sie in seiner Rede als gegenständlich vorkamen oder umherliefen.
In seinen Märchennovellen ist das Wunderbare und Alltägliche so gemischt, daß wir das eine wie das andre glauben. Daß die schöne Lau in den Blautopf verbannt ist, erscheint uns ebenso natürlich, wie daß sie lachen muß, als sie »das Enkelein mit rotgeschlafenen Backen hemdig und einen Apfel in der Hand auf einem runden Stühlchen von guter Ulmer Hafnerarbeit, grünverglaset« sitzen sah.
Manche seiner Dichtungen sind in dem wenig volkstümlichen Hexameter verfaßt, und Mörike ist oft stark von der antiken Dichtung beeinflußt, so daß er, wie Keller treffend bemerkt, uns anmutet, als ob er der Sohn des Horaz und einer feinen Schwäbin sei.
Aber trotz dieses fremden Elements lebt in Mörike so viel Naives und Volkstümliches, so viel Naturgefühl und Phantasie, so viel sonniger Humor und tiefe Lebensweisheit, daß wir getrost den Worten, die Friedrich Vischer dem Freunde am Grabe nachrief, vertrauen können: »Es gibt eine Gemeinde – und nur in der Vergleichung mit der breiten Menge ist sie klein – die sich labt und entzückt an deinen wunderbaren, hellen, seligen Träumen und die hohe Wahrheit schaut in diesen Träumen. Es gibt eine Gemeinde, die den Dichter nicht nach rednerischen Worten schätzt, die den feineren Wohllaut trinkt, der aus ursprünglichem Naturgefühl der Sprache quillt. Und sie wird wachsen, diese Gemeinde, sich erweitern zu Kreis um Kreis, Bund um Bund wird sich bilden von Einverstandenen in deinem Verständnis.«
Hamburg im Dezember 1905.
J. Loewenberg.
Dekoration
Dichtungen von Eduard Mörike
Dekoration
An einem Wintermorgen vor Sonnenaufgang.
O flaumenleichte Zeit der dunkeln Frühe!
Welch neue Welt bewegest du in mir?
Was ist's, daß ich auf einmal nun in dir
Von sanfter Wollust meines Daseins glühe?
Einem Kristall gleicht meine Seele nun,
Den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen;
Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn,
Dem Eindruck naher Wunderkräfte offen,
Die aus dem klaren Gürtel blauer Luft
Zuletzt ein Zauberwort vor meine Sinne ruft.
Bei hellen Augen glaub' ich doch zu schwanken:
Ich schließe sie, daß nicht der Traum entweiche.
Seh' ich hinab in lichte Feenreiche?
Wer hat den bunten Schwarm von Bildern und Gedanken
Zur Pforte meines Herzens hergeladen,
Die glänzend sich in diesem Busen baden,
Goldfarb'gen Fischlein gleich im Gartenteiche?
Ich höre bald der Hirtenflöten Klänge,
Wie um die Krippe jener Wundernacht,
Bald weinbekränzter Jugend Lustgesänge;
Wer hat das friedenselige Gedränge
In meine traurigen Wände hergebracht?
Und welch Gefühl entzückter Stärke,
Indem mein Sinn sich frisch zur Ferne lenkt!
Vom ersten Mark des heut'gen Tags getränkt,
Fühl' ich mir Mut zu jedem frommen Werke.
Die Seele fliegt, so weit der Himmel reicht,
Der Genius jauchzt in mir. Doch sage!
Warum wird jetzt der Blick von Wehmut feucht?
Ist's ein verloren Glück, was mich erweicht?
Ist es ein werdendes, was ich im Herzen trage?
– Hinweg, mein Geist! hier gilt kein Stillestehn:
Es ist ein Augenblick, und alles wird verwehn.
Dort, sieh! am Horizont lüpft sich der Vorhang schon.
Es träumt der Tag, nun sei die Nacht entflohn;
Die Purpurlippe, die geschlossen lag,
Haucht, halb geöffnet, süße Atemzüge:
Auf einmal blitzt das Aug', und, wie ein Gott, der Tag
Beginnt im Sprung die königlichen Flüge.
Nächtliche Fahrt.
Jüngst im Traum ward ich getragen
Über fremdes Heideland;
Vor den halbverschlossnen Wagen
Schien ein Trauerzug gespannt.
Dann durch mondbeglänzte Wälder
Ging die sonderbare Fahrt,
Bis der Anblick offner Felder
Endlich mir bekannter ward.
Wie im lustigen Gewimmel
Tanzt nun Busch und Baum vorbei!
Und ein Dorf nun – guter Himmel!
O mir ahnet, was es sei.
Sah ich doch vorzeiten gerne
Diese Häuser oft und viel,
Die am Wagen die Laterne
Streift im stummen Schattenspiel.
Ja, dort unterm Giebeldache
Schlummerst du, vergeßlich Herz!
Und daß dein Getreuer wache,
Sagt dir kein geheimer Schmerz. –
Ferne waren schon die Hütten:
Sieh! da flattert's durch den Wind.
Eine Gabe zu erbitten
Schien ein armes, holdes Kind.
Wie vom bösen Geist getrieben,
Werf' ich rasch der Bettlerin
Ein Geschenk von meiner Lieben,
Jene goldne Kette, hin.
Plötzlich scheint ein Rad gebunden,
Und der Wagen steht gebannt,
Und das schöne Mädchen unten
Hält mich schelmisch bei der Hand.
»Denkt man so damit zu schalten?
So entdeck' ich den Betrug?
Doch den Wagen festzuhalten,
War die Kette stark genug.
Willst du, daß ich dir verzeihe,
Sei erst selber wieder gut!
Oder wo ist deine Treue,
Böser Junge, falsches Blut?«
Und sie streichelt mir die Wange,
Küßt mir das erfrorne Kinn,
Steht und lächelt, weinet lange
Als die schönste Büßerin.
Doch mir bleibt der Mund verschlossen,
Und kaum weiß ich, was geschehn;
Ganz in ihren Arm gegossen,
Schien ich selig zu vergehn.
Und nun fliegt mit uns, ihr Pferde,
In die graue Welt hinein!
Unter uns vergeh' die Erde,
Und kein Morgen soll mehr sein!
Der Knabe und das Immlein.
Im Weinberg auf der Höhe
Ein Häuslein steht so windebang,
Hat weder Tür noch Fenster;
Die Weile wird ihm lang.
Und ist der Tag so schwüle,
Sind all' verstummt die Vögelein,
Summt an der Sonnenblume
Ein Immlein ganz allein.
Mein Lieb hat einen Garten,
Da steht ein hübsches Immenhaus:
Kommst du daher geflogen?
Schickt sie dich nach mir aus?
»O nein, du feiner Knabe,
Es hieß mich niemand Boten gehn;
Dies Kind weiß nichts von Lieben,
Hat dich noch kaum gesehn.
Was wüßten auch die Mädchen,
Wenn sie kaum aus der Schule sind!
Dein herzallerliebstes Schätzchen
Ist noch ein Mutterkind.
Ich bring' ihm Wachs und Honig;
Ade! – ich hab' ein ganzes Pfund.
Wie wird das Schätzchen lachen!
Ihm wässert schon der Mund.«
Ach, wolltest du ihr sagen,
Ich wüßte, was viel süßer ist:
Nichts Lieblichers auf Erden,
Als wenn man herzt und küßt!
Begegnung.
Was doch heut nacht ein Sturm gewesen,
Bis erst der Morgen sich geregt!
Wie hat der ungebetne Besen
Kamin und Gassen ausgefegt!
Da kommt ein Mädchen schon die Straßen,
Das halb verschüchtert um sich sieht;
Wie Rosen, die der Wind zerblasen,
So unstet ihr Gesichtchen glüht.
Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen,
Er will ihr voll Entzücken nahn:
Wie sehn sich freudig und verlegen
Die ungewohnten Schelme an!
Er scheint zu fragen, ob das Liebchen
Die Zöpfe schon zurecht gemacht,
Die heute nacht im offnen Stübchen
Ein Sturm in Unordnung gebracht.
Der Bursche träumt noch von den Küssen,
Die ihm das süße Kind getauscht,
Er steht, von Anmut hingerissen,
Derweil sie um die Ecke rauscht.
Der Jäger.
Drei Tage Regen fort und fort,
Kein Sonnenschein zur Stunde;
Drei Tage lang kein gutes Wort
Aus meiner Liebsten Munde!
Sie trutzt mit mir und ich mit ihr –
So hat sie's haben wollen;
Mir aber nagt's am Herzen hier,
Das Schmollen und das Grollen.
Willkommen denn, des Jägers Lust,
Gewittersturm und Regen!
Fest zugeknöpft die heiße Brust
Und jauchzend euch entgegen!
Nun sitzt sie wohl daheim und lacht
Und scherzt mit den Geschwistern;
Ich höre in des Waldes Nacht
Die alten Blätter flüstern.
Nun sitzt sie wohl und weinet laut
Im Kämmerlein in Sorgen;
Mir ist es wie dem Wilde traut,
In Finsternis geborgen.
Kein Hirsch und Rehlein überall:
Ein Schuß zum Zeitvertreibe!
Gesunder Knall und Widerhall
Erfrischt das Mark im Leibe.
Doch wie der Donner nun verhallt
In Tälern durch die Runde,
Ein plötzlich Weh mich überwallt,
Mir sinkt das Herz zu Grunde.
Sie trutzt mit mir und ich mit ihr –
So hat sie's haben wollen;
Mir aber frißt's am Herzen hier,
Das Schmollen und das Grollen.
Und auf! und nach der Liebsten Haus!
Und sie gefaßt ums Mieder! –
»Drück mir die nassen Locken aus
Und küß und hab mich wieder!«
Ein Stündlein wohl vor Tag.
Derweil ich schlafend lag,
Ein Stündlein wohl vor Tag,
Sang vor dem Fenster auf dem Baum
Ein Schwälblein mir, ich hört' es kaum –
Ein Stündlein wohl vor Tag.
»Hör an, was ich dir sag'!
Dein Schätzlein ich verklag':
Derweil ich dieses singen tu':
Herzt er ein Lieb in guter Ruh',
Ein Stündlein wohl vor Tag.«
O weh! nicht weiter sag!
O still! nichts hören mag.
Flieg ab, flieg ab von meinem Baum! –
Ach, Lieb' und Treu' ist wie ein Traum
Ein Stündlein wohl vor Tag.
Storchenbotschaft.
Des Schäfers sein Haus und das steht auf zwei Rad,
Steht hoch auf der Heiden, so frühe wie spat;
Und wenn nur ein mancher so'n Nachtquartier hätt'!
Ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett.
Und käm' ihm zur Nacht auch was Seltsames vor,
Er betet sein Sprüchel und legt sich aufs Ohr;
Ein Geistlein, ein Hexlein, so lustige Wicht',
Sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht.
Einmal doch, da ward es ihm wirklich zu bunt:
Es knopert am Laden, es winselt der Hund;
Nun ziehet mein Schäfer den Riegel – ei schau!
Da stehen zwei Störche, der Mann und die Frau.
Das Pärchen, es machet ein schön Kompliment,
Es möchte gern reden – ach, wenn es nur könnt'!
Was will mir das Ziefer? ist so was erhört?
Doch ist mir wohl fröhliche Botschaft beschert.
Ihr seid wohl dahinten zu Hause am Rhein?
Ihr habt wohl mein Mädel gebissen ins Bein?
Nun weinet das Kind und die Mutter noch mehr,
Sie wünschet den Herzallerliebsten sich her?
Und wünschet daneben die Taufe bestellt:
Ein Lämmlein, ein Würstlein, ein Beutelein Geld?
So sagt nur, ich käm' in zwei Tag' oder drei.
Und grüßt mir mein Bübel und rührt ihm den Brei!
Doch halt! warum stellt ihr zu zweien euch ein?
Es werden doch, hoff' ich, nicht Zwillinge sein? –
Da klappern die Störche im lustigsten Ton,
Sie nicken und knixen und fliegen davon.
Suschens Vogel.
Ich hatt' ein Vöglein, ach, wie fein!
Kein schöners mag wohl nimmer sein:
Hätt' auf der Brust ein Herzlein rot
Und sung und sung sich schier zu Tod.
Herzvogel mein, du Vogel schön,
Nun sollt du mit zu Markte gehn! –
Und als ich in das Städtlein kam,
Er saß auf meiner Achsel zahm.
Und als ich ging am Haus vorbei
Des Knaben, dem ich brach die Treu',
Der Knab' just aus dem Fenster sah,
Mit seinem Finger schnalzt er da:
Wie horchet gleich mein Vogel auf!
Zum Knaben fliegt er husch! hinauf.
Der koset ihn so lieb und hold;
Ich wußt' nicht, was ich machen sollt',
Und stund, im Herzen so erschreckt,
Mit Händen mein Gesichte deckt',
Und schlich davon und weinet' sehr
Ich hört' ihn rufen hinterher:
»Du falsche Maid, behüt dich Gott!
Ich hab' doch wieder mein Herzlein rot.«
In der Frühe.
Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir,
Dort gehet schon der Tag herfür
An meinem Kammerfenster.
Es wühlet mein verstörter Sinn
Noch zwischen Zweifeln her und hin
Und schaffet Nachtgespenster. –
Ängste, quäle
Dich nicht länger, meine Seele!
Freu dich! schon sind da und dorten
Morgenglocken wach geworden.
Er ist's.
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen. –
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Im Frühling.
Hier lieg' ich auf dem Frühlingshügel:
Die Wolke wird mein Flügel,
Ein Vogel fliegt mir voraus.
Ach, sag mir, alleinzige Liebe,
Wo du bleibst, daß ich bei dir bliebe!
Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus.
Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen,
Sehnend,
Sich dehnend
In Lieben und Hoffen.
Frühling, was bist du gewillt?
Wann werd' ich gestillt?
Die Wolke seh' ich wandeln und den Fluß,
Es dringt der Sonne goldner Kuß
Mir tief bis ins Geblüt hinein;
Die Augen, wunderbar berauschet,
Tun, als schliefen sie ein,
Nur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet.
Ich denke dies und denke das,
Ich sehne mich und weiß nicht recht, nach was:
Halb ist es Lust, halb ist es Klage;
Mein Herz, o sage,
Was webst du für Erinnerung
In golden grüner Zweige Dämmerung? –
Alte unnennbare Tage!
Fußreise.
Am frischgeschnittnen Wanderstab
Wenn ich in der Frühe
So durch Wälder ziehe,
Hügel auf und ab:
Dann, wie 's Vögelein im Laube
Singet und sich rührt,
Oder wie die goldne Traube
Wonnegeister spürt
In der ersten Morgensonne,
So fühlt auch mein alter, lieber
Adam Herbst- und Frühlingsfieber,
Gottbeherzte,
Nie verscherzte
Erstlings-Paradieseswonne.
Also bist du nicht so schlimm, o alter
Adam, wie die strengen Lehrer sagen:
Liebst und lobst du immer doch,
Singst und preisest immer noch,
Wie an ewig neuen Schöpfungstagen,
Deinen lieben Schöpfer und Erhalter!
Möcht' es dieser geben,
Und mein ganzes Leben
Wär' im leichten Wanderschweiße
Eine solche Morgenreise.
An eine Äolsharfe.
Angelehnt an die Efeuwand
Dieser alten Terrasse,
Du, einer luftgebornen Muse
Geheimnisvolles Saitenspiel,
Fang an,
Fange wieder an
Deine melodische Klage!
Ihr kommet, Winde, fern herüber
Ach! von des Knaben,
Der mir so lieb war,
Frisch grünendem Hügel.
Und Frühlingsblüten unterwegs streifend,
Übersättigt mit Wohlgerüchen,
Wie süß bedrängt ihr dies Herz
Und säuselt her in die Saiten,
Angezogen von wohllautender Wehmut,
Wachsend im Zug meiner Sehnsucht
Und hinsterbend wieder.
Aber auf einmal,
Wie der Wind heftiger herstößt,
Ein holder Schrei der Harfe
Wiederholt, mir zu süßem Erschrecken,
Meiner Seele plötzliche Regung,
Und hier – die volle Rose streut, geschüttelt,
All ihre Blätter vor meine Füße.
Mein Fluß.
O Fluß, mein Fluß im Morgenstrahl!
Empfange nun, empfange
Den sehnsuchtsvollen Leib einmal
Und küsse Brust und Wange! –
Er fühlt mir schon herauf die Brust,
Er kühlt mit Liebesschauerlust
Und jauchzendem Gesange.
Es schlüpft der goldne Sonnenschein
In Tropfen an mir nieder,
Die Woge wieget aus und ein
Die hingegebnen Glieder,
Die Arme hab' ich ausgespannt:
Sie kommt auf mich herzugerannt,
Sie faßt und läßt mich wieder.
Du murmelst so, mein Fluß; warum?
Du trägst seit alten Tagen
Ein seltsam Märchen mit dir um
Und mühst dich, es zu sagen;
Du eilst so sehr und läufst so sehr,
Als müßtest du im Land umher,
Man weiß nicht wen, drum fragen.
Der Himmel, blau und kinderrein,
Worin die Wellen singen,
Der Himmel ist die Seele dein:
O laß mich ihn durchdringen!
Ich tauche mich mit Geist und Sinn
Durch die vertiefte Bläue hin
Und kann sie nicht erschwingen.
Was ist so tief, so tief wie sie?
Die Liebe nur alleine.
Sie wird nicht satt und sättigt nie
Mit ihrem Wechselscheine. –
Schwill an, mein Fluß, und hebe dich,
Mit Grausen übergieße mich!
Mein Leben um das deine!
Du weisest schmeichelnd mich zurück
Zu deiner Blumenschwelle.
So trage denn allein dein Glück
Und wieg auf deiner Welle
Der Sonne Pracht, des Mondes Ruh'!
Nach tausend Irren kehrest du
Zur ew'gen Mutterquelle.
Auf der Reise.
Zwischen süßem Schmerz,
Zwischen dumpfem Wohlbehagen
Sitz' ich nächtlich in dem Reisewagen,
Lasse mich so weit von dir, mein Herz,
Weit und immer weiter tragen.
Schweigend sitz' ich und allein,
Ich wiege mich in bunten Träumen,
Das muntre Posthorn klingt darein
Es tanzt der liebe Mondenschein
Nach diesem Ton auf Quellen und auf Bäumen,
Sogar zu mir durchs enge Fensterlein.
Ich wünsche mir nun dies und das.
O könnt' ich jetzo durch ein Zauberglas
Ins Goldgewebe deines Traumes blicken!
Vielleicht dann säh' ich wieder mit Entzücken
Dich in der Laube wohlbekannt.
Ich sähe Genovefens Hand
Auf deiner Schulter traulich liegen,
Am Ende säh' ich selber mich,
Halb keck und halb bescheidentlich,
An deine holde Wange schmiegen.
Doch nein! wie dürft' ich auch nur hoffen,
Daß jetzt mein Schatten bei dir sei!
Ach, stünden deine Träume für mich offen,
Du winktest wohl auch wachend mich herbei!
Frage und Antwort.
Fragst du mich, woher die bange
Liebe mir zum Herzen kam,
Und warum ich ihr nicht lange
Schon den bittern Stachel nahm?
Sprich, warum mit Geisterschnelle
Wohl der Wind die Flügel rührt,
Und woher die süße Quelle
Die verborgnen Wasser führt!