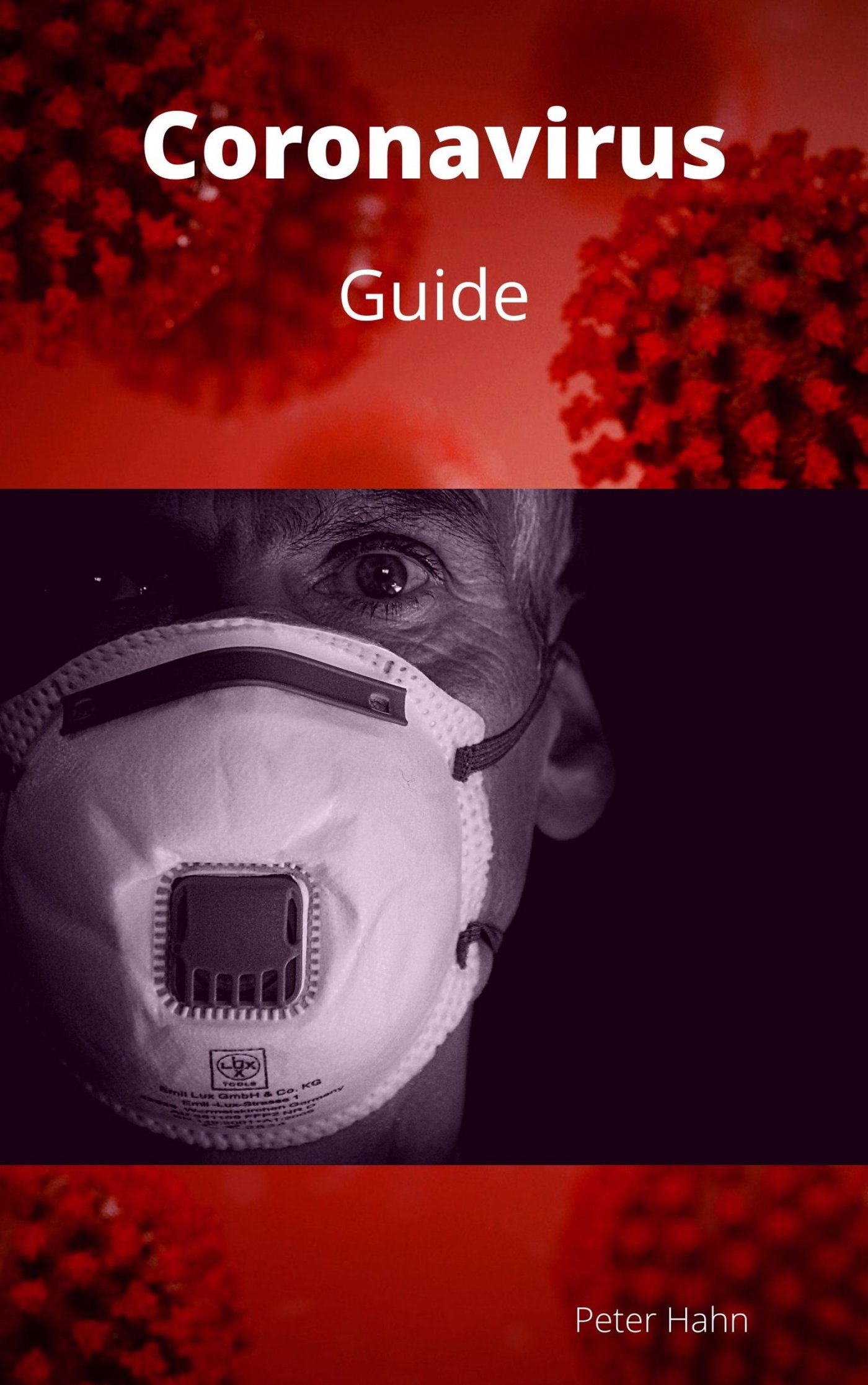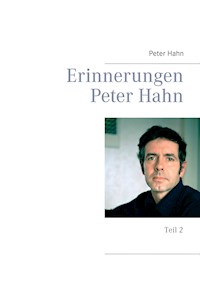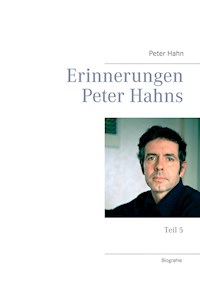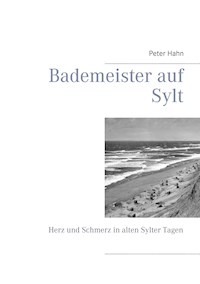
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Bademeister“ klingt etwas großspurig und vielleicht auch ein wenig anrüchig, wozu der Film Bademeister – Weiber, Saufen, Leben retten beigetragen haben mag. „Bademeister“ ist bereits im Grimmschen Wörterbuch zu finden: balneator, der die aufsicht beim baden führt, auch im schwimmen unterrichtet. Im Wenningstedter Nordseebad wurden die Rettungsschwimmer lange vor meiner Zeit bereits so genannt. Sie waren mehr als nur Rettungsschwimmer: Sie waren mit den Gegebenheiten des von ihnen bewachten Strandes zumeist seit Jahren bestens ver-traut, was in einem Nordseebad auf Sylt unbedingt nötig ist, und sie waren oben-drein von der DLRG ausgebildete Rettungsschwimmer. Sie waren Angestellte der Kurverwaltung Warum ein Büchlein über Bademeister auf Sylt? Einmal will ich die frühen Sylter Jahre ab 1948 insbesondere von Kampen und Wenningstedt beschreiben und dann eben meine Jahre am Wenningstedter Strand von 1957 bis 1965, mit den beteiligten Menschen, als vieles noch ganz anders und heute fast vergessen ist. Es war noch eine geruhsame Zeit des Briefeschreibens, ohne Handys und die Fotos wurden mit einer Rollei-Spiegelreflex-Kamera aufgenommen, die gerade einmal 12 Bilder im Format 6x6 cm fasste. Natürlich gehören neben der Beschreibung unserer Arbeit als Rettungsschwimmer auch „Herz und Schmerz“ eines Bademeisters dazu. Beides ist nicht zu trennen wie das Soma (der Körper: Die reale Welt des Strandes) und Psyche (Seele: Die Empfindungen und Gedanken). Wobei Herz und Schmerz zumindest für mich zeitlos sind. Sollte die Beschreibung des Meeres, der See mit Wind und Wetter, Tieren und Pflanzen hier zu kurz kommen, in meinem kleinen Büchlein „Das Meer, die See; Betrachtungen eines Badegastes“ sind sie recht umfassend beschrieben worden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
„Bademeister“ klingt etwas großspurig und vielleicht auch ein wenig anrüchig, wozu der Film Bademeister – Weiber, Saufen, Leben retten beigetragen haben mag. „Bademeister“ ist bereits im Grimmschen Wörterbuch zu finden: balneator, der die aufsicht beim baden führt, auch im schwimmen unterrichtet. Im Wenningstedter Nordseebad wurden die Rettungsschwimmer lange vor meiner Zeit bereits so genannt. Sie waren mehr als nur Rettungsschwimmer: Sie waren mit den Gegebenheiten des von ihnen bewachten Strandes zumeist seit Jahren bestens vertraut, was in einem Nordseebad auf Sylt unbedingt nötig ist, und sie waren obendrein von der DLRG ausgebildete Rettungsschwimmer. Sie waren Angestellte der Kurverwaltung
Warum ein Büchlein über Bademeister auf Sylt? Einmal will ich die frühen Sylter Jahre ab 1948 insbesondere von Kampen und Wenningstedt beschreiben und dann eben meine Jahre am Wenningstedter Strand von 1957 bis 1965, mit den beteiligten Menschen, als vieles noch ganz anders und heute fast vergessen ist. Es war noch eine geruhsame Zeit des Briefeschreibens, ohne Handys und die Fotos wurden mit einer Rollei-Spiegelreflex-Kamera aufgenommen, die gerade einmal 12 Bilder im Format 6×6 cm fasste.
Natürlich gehören neben der Beschreibung unserer Arbeit als Rettungsschwimmer auch „Herz und Schmerz“ eines Bademeisters dazu. Beides ist nicht zu trennen wie das Soma (der Körper: Die reale Welt des Strandes) und Psyche (Seele: Die Empfindungen und Gedanken). Wobei Herz und Schmerz zumindest für mich zeitlos sind.
Sollte die Beschreibung des Meeres, der See mit Wind und Wetter, Tieren und Pflanzen hier zu kurz kommen, in meinem kleinen Büchlein „Das Meer, die See; Betrachtungen eines Badegastes“ sind sie recht umfassend beschrieben worden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Anfänge, wieso Sylt?
Wieder Schule
Christel
Schwemer
Etwas kriegerisch Anmutendes
Wirtschaftliche Schwierigkeiten
Unser Sylter Ende
Rückkehr nach Sylt
Mittlere Reife
Sybille
Herbst 1957 auf Sylt zu Gast bei den Rettungsschwimmern
Buhnen
Sommerende 1957
Auf zum Studium nach Berlin
Jahresende 1957 auf Sylt
Bewerbung als Rettungsschwimmer
Vorbereitungen für meinen Job als Rettungsschwimmer
Bademeister auf Sylt 1958
Gisela
Barbara
Die Strandkörbe damals
Glückliche Tage mit Barbara
Wieder heftiger Wind, Werner Kroll taucht auf
Flossen statt Rettungsrolle
Musik
Nackt baden?
Meine ersten Badeunfälle
Unsere Rettungsmannschaft
Mittagspause abschaffen
Nackt baden, FKK
Brandung
„Teer“ am Strand
Fluglärm
Agneta, Bina, Elke
Andere Hilfeleistungen
Sonnenschutz
Elke
Nachtwächter und Strandkorbwäscher 1958
Hans Jamke verlässt uns
Die Nachsaison 1958
Ich verlasse Sylt nach meiner ersten Bademeistersaison
Wieder in Berlin
Ein Brief von Barbara
Weihnachten 1958 steht vor der Tür
Ein Liebespaar
Bärbel, eine zweite Christel?
Bademeister 1959
Plüschi
Traumhaftes Wetter
in Ein zweiter Schwimmerwagen wird eingeweiht
Kurze Haare für den Rest des Lebens
Nordseebad Wenningstedt feierte sein 100-jähriges Jubiläum
Verloren in der weiten See
Tanzen
Streit in der Kurverwaltung, die Strandkorbwärter
Rosi
Sylter Namen
Uwe Rehse besuchte mich
1959, ein ungewöhnlich warmer Sommer
Weiterhin Rosi
„Uns Uwe“ kehrt zu uns zurück
Mit Rosi in der Tankstelle als Taxifahrer 1959
Uwe Lödige geht auf Wanderschaft
Studienwechsel zur Mathematik
Briefe, Briefe, Briefe
Und Sybille
Jahresende 1959 in Hamburg, Hans Haider
Wieder in Berlin
Zu Besuch bei Barbara im Harz
Bademeister 1960
Ein Bruch, jedoch noch kein Beinbruch
Plüschi ist wieder da
Kurz nach Berlin
Zurück auf Sylt
Alte und neue Freunde
Barbara wieder auf Sylt
Sybille will nach Sylt kommen
Fröhliche Tage mit Uwe
Karin Brandt
Und wieder Sybille
Karin Brandts Einladung
Das Wenningstedter Leben geht weiter
In Düsseldorf bei Brandts
Wieder Sybille
Blinddarmoperation
Winter 1960/61
Ein Auto für Sybille
Sommer 1961
Hans Haider wird Rettungsschwimmer
Was macht Sybille?
Heiraten?
Versuch einer Reise zu vier Meeren
Sommer 1962
Maren
Diesmal ist Regina die Königin meines Herzen
Maren – Regina
Das Ende im Studentenwohnheim
Wieder Maren
Wohnen bei Sybille
Renate
Bademeister 1963
Rippenfellentzündung?
Astrid
Saison 1963
Schauschwimmen
Wasserski am Ellenbogen
Leben auf dem Ellenbogen 1963
Astrid verlässt Sylt
Uhlandstraße 188
Sommer 1964
Bademeister 1965
„Uns Uwe“ ?
Wie weiter?
Die alten Freunde?
Sönke
Die Anfänge, wieso Sylt?
Es begann damit, dass mein Vater Ende 1945 aus russischer Kriegsgefangenschaft entflohen, sich mit seinem Freund Walter, wie noch im Kriege verabredet, im holsteinischen Städtchen Nortorf traf, wo Walters Schwester wohnte. Dort konnten die Freunde die Vertretung einer kleinen Fabrik für Fertigsuppen übernehmen. Ich lebte zu dieser Zeit in einem ehrwürdigen, alten Internat, das in Wickersdorf hoch oben im Thüringer Wald in der damaligen sowjetischen Besatzungszone lag. Es war bereits 1906 von Gustav Wyneken als eine Schule für Koedukation und Sexualerziehung gegründet worden.
1947 konnte ich meinen Vater in den Sommerferien in Nortorf besuchen. Da mein Vater als Vertreter viel unterwegs war, hatte er mein tägliches Mittagessen bei einem wohlhabenden Bauern am Marktplatz organisiert. So saß ich dann mittags inmitten einer großen Familie am Tisch und aß weiße, ganz mehlig aussehende, herrlich duftende Kartoffeln und andere köstliche Sachen, die es in meinem Wickersdorfer Internat nicht gegeben hatte. Mein Vater nahm mich ein paar Mal in einem klapprigen Kleinlaster, der von einem sogenannten Holzvergaser angetrieben war, mit nach Hamburg, weil er dort ein paar Eimer mit Suppenpaste an den Mann bringen wollte. Der Holzvergaser war ein fast mannsgroßer eiserner Ofen, der hinter dem Führerhaus montiert war. Er wurde mit Holz befeuert, dann luftdicht verschlossen und das dem schwelenden Holz entweichende Gas trieb einen umgebauten Benzinmotor an. Man kam nur langsam voran, denn das Holz war bald verbrannt, und man musste nachheizen und dann noch warten, bis sich genug Gas gebildet hatte. Für mich zwölfjährigen Jungen waren dies kleine Abenteuer.
Ende 1947 erfuhren die beiden Männer, dass auf der Insel Sylt, in Kampen, ein Hotel in bester Lage für 6000 Reichsmark jährlich zu verpachten sei. Da der Suppenvertrieb nicht sehr lukrativ und überdies arg mühsam war, und der Name Sylt schon damals einen aufregenden Klang hatte, zögerten die beiden Freunde nicht lange und eröffneten Anfang 1948 ihr Hotel Haus Fernsicht. Es lag in der renommierten Kurhausstraße neben den noblen Hotels wie Meeresblick, Rungholt und dem Kurhaus, das die Straße zur See hin abschloss. Haus Fernsicht war bereits 1902 vom königlichen Bauaufseher Chr. Thams als „Villa Fernsicht“ erbaut worden und war nach dem Hinzufügen des großen Anbaus vorübergehend „Einziges vegetarisches Speisehaus am Platze“.
Haus Fernsicht hatte mit seinem kleinen hinteren Anbau etwa 40 Betten auf Einzel- und Doppelzimmer verteilt. Es gab zwar schon fließendes Wasser, aber nur kaltes, keine Duschen, kein Bad und Toiletten auf den Fluren. Die einzige Heizung waren zwei Kachelöfen in unseren Privatzimmern im Erdgeschoss. Keines der Häuser, auch nicht die Hotels von Kampen oder Wenningstedt, die sogenannten Norddörfer, waren an eine öffentliche Wasserver- und Entsorgung angeschlossen. Alle Häuser hatten damals eigene Tiefbrunnen und Klärgruben, mit den entsprechenden Problemen. Die Klärgruben wurden im Allgemeinen in die nicht zu ferne Umgebung entleert.
Hotel Haus Fernsicht 1948, rechts im Hintergrund das Kurhaus
Der Baum an unserem Haus war der größte in Kampen, und wir waren stolz auf ihn. Das Schönste am Hotel war jedoch das große, zweistöckige Quergebäude, das sich dem Haupthaus anschloss. Die untere Etage war Speiseraum und darüber mit einer breiten Treppe verbunden lag der herrliche Aufenthaltsraum. Hier hatte man den schönsten Blick von Sylt, was wirklich nicht übertrieben ist. Man sah nach Norden zunächst auf das ausgedehnte, (heute noch) unverbaute Heidegelände mit seinen dunkelbraunroten Farbtönen, dann weiter auf beide Meeresseiten, die Westseite mit ihrer Brandung und auf die Wattseite mit dem zumeist ruhigen Wasser. Dazwischen lag ein weitläufiges Dünengelände mit dem kleinen Leuchtturm, das sich bis an die nördliche Spitze der Insel erstreckte.
Mehrmals am Tage konnte man die Inselbahn zwischen den Dünentälern die Anhöhe von Kampen sich heraufwinden sehen, gezogen von einer kleinen, fauchenden Dampflokomotive, die mit ihren Funken hin und wieder das Dünengras entzündete. Bei dem unbeständigen Seewetter, änderten sich die Farben des Himmels und der beiden Meeresseiten ständig, was den Blick nie langweilig werden lies und heute noch lässt.
Diese Nordwestkampener Heide, wie das riesige Gebiet bis hinunter zum kleinen Leuchtturm genannt wird, stellte und stellt auch heute noch eines der schönsten Naturdenkmäler an der deutschen Nordseeküste dar und ist für das Kampener Landschaftsbild von ausschlaggebender Bedeutung. Schon in den dreißiger Jahren stellte man sicher, dass die Bebauung dieser Landschaft tatsächlich für alle Zukunft ausgeschlossen wird. Und so etwas Schönes lag buchstäblich vor unserer Hoteltür.
Da die sanitären Einrichtungen von Haus Fernsicht recht einfach waren, und da Baden und Duschen hier nicht möglich waren, fuhren unsere Väter mit uns mit der Inselbahn nach Westerland ins Warmbadehaus. Hier ließ ein Bademeister in einer Kabine mit einem Schlüssel warmes Wasser in eine Wanne, und dann hatten wir eine Weile Zeit, um uns zu waschen. Selber Wasser nachfüllen, konnten wir nicht.
Die beiden alten Freunde hatten zwar nicht die geringste Ahnung vom Führen eines Hotels, aber sie glaubten, das zu schaffen. Beide waren schon Anfang des Krieges geschieden worden und hatten die sogenannte „Personenfürsorge“ für ihre einzigen Kinder, was etwa dem heutigen Sorgerecht entspricht. Die Jungen waren gleich alt und hießen Peter. Der blonde, kräftige Peter kam aus Berlin, wo er bei seiner Mutter gelebt hatte. Ich, der andere, der dunkelhaarige Peter kam aus Thüringen, aus einem Internat. Ich durchlebte einen unglaublich großen Gegensatz zwischen den dunklen, geheimnisvollen Fichtenwäldern Thüringens und dem freien, hellen Blick bis zum Horizont auf Sylt, und dazu wehte ständig ein frischer Wind. Nach den strengen Regeln der Freien Schulgemeinde Wickersdorf schien für mich die Freiheit auf Sylt schier grenzenlos. Wir wähnten uns im Paradies. Die Bebauung war noch gering, es gab kaum Autos, und man konnte in der direkt vor dem Hause liegenden Heide, den nahen sandigen Dünen und am Strand nach Herzenslust herumtoben und Abenteuer erleben.
Die Winter auf Sylt fanden wir Kinder schöner als die Sommer. In jenen Jahren waren zur kalten Jahreszeit so gut wie keine Gäste auf der Insel. Es war einsam. Die Fenster und Türen der meisten Geschäfte, die im Winter keine Kunden erwarteten, waren mit Brettern verkleidet. So auch unsere reetgedeckte Sturmhaube in Kampen, der Sitz der damaligen Kurverwaltung. Wir konnten buchstäblich tun und lassen, was wir wollten. In einem Zimmer im oberen Teil unseres Hotels trugen wir einige Möbel und Bettdecken zusammen und bauten uns Höhlen, in denen wir uns verkriechen und ungestört spielen konnten, wenn es draußen zu kalt war. Die metallene Türklinke zu unserem Versteck hatte ich mit dem Spannung führenden Pol der Stromleitung verbunden, und darunter einen feuchten Scheuerlappen gelegt, den ich erdete. Sollte jemand es wagen, unser Zimmer betreten zu wollen, so holte er sich einen ordentlichen elektrischen Schlag. Wir hatten ein riesiges Glück, dass dabei niemand zu Schaden gekommen ist. Ab und zu kam der kleine, etwas unbedarft scheinende Friedhelm aus dem Nachbarhotel Friesenburg zu uns, und ein kleines Flüchtlingsmädchen aus der Nachbarschaft durfte auch in unsere Höhle kriechen. Wir wollten wissen, wie Mädchen so gebaut sind. Aber sie zeigte es uns nicht. Ansonsten hatten wir in Kampen kaum Freunde. Wir lagen zu abseits.
Ein paar Hundert Meter entfernt lag die höchste Stelle des etwa 30 m hohen Kampener Roten Kliffs. Auf dem Kliffrand stand ein wuchtiger, teilweise gesprengter Bunker aus dem Kriege, in dem man abenteuerlich herumklettern konnte. Es lagen da Unmengen von kleinen, runden Steinen, mit denen wir das Werfen ins Meer üben konnten. Das steile, lehmartige Kliff bot uns Kindern ausgiebige, aber auch gefährliche Möglichkeiten zum Buddeln. Der Weg zum Strand war für uns Kinder weit. Erst in etwa 600 m Entfernung, bei der Sturmhaube, gab es einen offiziellen Abgang. Um einen direkten Zugang zum Strand zu haben, planten wir, Stufen in das Kliff hinein zu graben. Wir haben das endlich auch geschafft, dabei jedoch nie bedacht, dass wir beim Klettern leicht abrutschen und in die Tiefe fallen konnten, insbesondere dann, wenn das Kliff durch Regen weich und glitschig wurde. Obendrein hatten wir noch die tolle Idee, uns in etwa 20 m Höhe eine Höhle in das Kliff hinein zu graben. Doch der harte Lehm ließ uns nur langsam vorankommen. Da hatte ich eine geniale Idee: Sprengen, wie im Bergwerk. Im Thüringer Internat hatte ich von den älteren Schülern gelernt, dass man mit Unkrautex sprengen konnte. Noch von Nortorf aus hatte ich bei einer der Fahrten mit meinem Vater nach Hamburg in einer Samenhandlung im Chilehaus mich mit einer gehörigen Portion Unkrautex versorgt. Unkrautex ist als natriumchlorathaltiges Herbizid ein starkes Oxidationsmittel. Wenn man es in Wasser löst und darin Watte, Löschpapier oder ähnlich Brennbares tränkt und danach trocknet, kann man damit sprengen. Eine Mischung mit Zucker wäre noch explosiver gewesen, aber ausreichend Zucker gab es für uns damals nicht. Wir hatten in den Dünen schon einige Sprengversuche unternommen, wobei wir unsere Ladungen in dicht verschlossenen Konservendosen untergebracht hatten.
Die Konservendosen hatten wir in der Küche unseres Hotels mit einer professionellen Maschine gebördelt, die unsere Väter angeschafft hatten, weil sie in der gästearmen Jahreszeit Dosenwurst herstellen und vertreiben wollten. Zu Sprengungen am Kliff kam es jedoch nicht, weil unsere Väter rechtzeitig dahinter kamen, was wir Bengel vorhatten und uns ordentlich verdroschen. Zum Handel mit Dosenwurst kam es übrigens auch nicht so richtig.
Obgleich unser Hotel sehr einfach ausgestattet war, hatten wir doch schon ein paar halbwegs berühmte Gäste: den Schlager- und Filmkomponisten Werner Bochmann („Der Theodor im Fußballtor“, „Heimat deine Sterne“) die Schauspieler Albert Florath und Aribert Wäscher. Richtig belegt war das Hotel jedoch nur in den Monaten Juli und August. In der Vor- und Nachsaison hatten wir nur wenige Gäste. Jedoch musste Personal in einem gewissen Mindestumfang beschäftigt werden. Aus Mangel an Bedienung mussten Peter und ich gelegentlich im Speiseraum kellnern, wobei wir lernten, zwei gefüllte Speiseteller in der linken Hand zu tragen, was wir zur höheren Bedienkunst rechneten.
Da die Reichsmark nicht viel wert war, beglichen manche Gäste ihre Rechnungen mit Naturalien, mit sogenannten Kompensationsgütern. So häuften sich in einer Abstellkammer angeschleppte Artikel wie kleine elektrische Kochplatten mit ihren in Schamotte mäanderförmig eingelegten Heizspiralen, Tüten voller Rohkaffee und andere damals rare, nützliche Dinge. Ein Gast beglich seine Rechnung sogar mit einem roten Herrenfahrrad, das zu unserer unglaublich großen Freude uns Jungen überlassen wurde. Da Bohnenkaffee zu jener Zeit eine Rarität war, rösteten unsere Väter in einer Bratpfanne hin und wieder Kaffeebohnen, und im ganzen Hause roch es herrlich nach Kaffee.
Wieder Schule
Da wir Kinder nun auch wieder zur Schule gehen mussten, wir beide aber unterschiedliche Schulen besucht hatten, schickten uns unsere Eltern nicht in die zwischen Kampen und Wenningstedt gelegene Norddörfer Schule, sondern meinten, dass wir in der „Privatunterrichtsstätte” Schwemer in Wenningstedt besser aufgehoben wären. Die Schule lag mitten in Wenningstedt in einem Eckhaus namens Villa Arethusa. Sie war mehr als Nachhilfeschule gedacht, jedoch unterrichtete man dort sämtlich Fächer einer normalen Schule. So hatten wir, je nach Schulfach, unterschiedliche Mitschüler. Es waren auch Schüler aus Westerland unter uns. Wir bewältigten unsere einsame, etwa 2,5 Kilometer lange Strecke meistens zu Fuß. Wir gingen auf Trampelpfaden an den Dünen entlang und kurz vor Wenningstedt durch die alte Segelflugschule, dort wo heute der Campingplatz liegt. Dieser Weg war für uns nicht ganz ungefährlich, denn aus irgendeinem Grunde lauerten uns zwischen den Flachbauten der Segelflugschule, in der Flüchtlinge Unterkunft gefunden hatten, manchmal ein paar Jungen auf. Wir waren für sie wohl Eindringlinge, denn sonst ging dort kein Kind von oder nach Kampen durch. Peter, der immer stärker und größer war als ich, hat uns beiden so manches Mal durch einen kleinen Kampf Respekt verschafft. War ich allein, dann legte ich den Weg gerne auf den Gleisen der Inselbahn zurück, nicht nur weil ich dort auf keine rauflustigen Jungen traf, sondern auch deshalb, weil es Spaß machte, den kleinen Zug mit seiner Dampflokomotive aus nächster Nähe zu beobachten und vielleicht vorher noch ein Geldstück auf die Schiene zu legen.
Da unsere Lehrer mehrere Fächer unterrichteten, hatten wir zwischen den Unterrichtsstunden öfter längere Pausen, und so verbrachten wir manchmal den ganzen Tag in Wenningstedt. Wenn wir dann im Winter im Dunkeln nach Hause gehen mussten, war uns manchmal ganz unheimlich zumute. Nicht nur der an den Dünen entlang huschende Lichtschein des Kampener Leuchtturms wirkte geheimnisvoll: einmal kurz, einmal lang, einmal kurz, was wir Morsefans als R deuteten; R wie Rotes Kliff. Auch die elektrischen Freileitungen in unserer Kurhausstraße, die von starkem Wind zum Schaukeln gebracht werden konnten, so dass sie aneinander schlugen und es dann blitzte und knallte, machten uns Angst und ließen uns ganz schnell nach Hause rennen.
Christel
Die für mich folgenreichste Begegnung in der Privatunterrichtsstätte Schwe mer war die mit Christel. Sie erhielt dort Nachhilfeunterricht in Englisch und saß in meiner Schülergruppe. Christel war damals zwölf Jahre alt, hatte für mich unergründlich schöne graugrüne Augen, Sommersprossen und trug lange braune Zöpfe. Christel war ein fröhliches Geschöpf, sie lachte gern und war stets zu irgendwelchen Streichen bereit. Ich, damals 13 Jahre alt, verliebte mich unsterblich in Christel. Sie war freundlich zu mir, wie zu jedermann, hatte aber sonst kein besonderes Interesse an mir. Leider. Ich schwebte ständig zwischen Himmel und Hölle. Erwischte ich beim Nachhausegehen an der sich schließenden Klassentür einen letzten Blick aus ihren bezaubernden Augen, dann war ich selig. Scherzte sie mit anderen Jungen mehr als mit mir, dann litt ich Höllenqualen.
Es waren da noch andere Mädchen, die gelegentlich Nachhilfe für ihre Schulfächer bekamen. Etwa eine etwas ältere Petra, die mit ihrem krausen Haar wie eine Negerpuppe (wie man damals sagte) aussah, war die Tochter des Inhabers eines der edelsten, unmittelbar am Strand gelegenen Hotels in Westerland. Ich traf sie Jahrzehnte später wieder, als sie die noble Gaststätte bonne auberge am Wenningstedter Dorfteich führte. Doch sie erkannte mich nicht wieder.
Dann gab es Sybille und Michael Georgi, die Kinder der seinerzeit recht bekannten Modefotografin Sonja Georgi, die in Wenningstedt in dem alten reetgedeckten Friesenhaus Deutsches Haus wohnten. Frau Georgi war schon deswegen für uns interessant, weil sie mit dem britischen Inselkommandanten Major Davis verheiratet war. Die niedliche Sybille war im gleichen Alter wie Christel. Wegen Christel und Sybille blieben Peter und ich abends öfter länger in Wenningstedt, und wir spielten auf den nahen Wiesen und an den Friesenwällen Versteck oder Kriegen. Unvergessen ist, dass wir einmal, an einem warmen Sommerabend im Dunkeln im Garten hinter einem Wall des Deutschen Hauses im Gras lagen, uns Geschichten erzählten, schäkerten und Peter Sybille küssen durfte. Das war etwas, was Peter und ich dann zuhause noch lange besprachen. Ein Mädchen küssen, wie aufregend!
Schwemer
Herr Schwemer war Lehrer in einer Privatschule in Hamburg gewesen, hatte eine seiner Schülerinnen geheiratet und war in das Haus ihrer Eltern nach Wenningstedt gezogen, wo er die bewusste Privatunterrichtsstätte eröffnete. Da er bis in die Jahre meiner Arbeit als Rettungsschwimmer auf Sylt eine wichtige Rolle für mich spielte, muss einiges über ihn berichtet werden.
Wir Schüler hassten und liebten ihn abgöttisch, beides tatsächlich gleichzeitig. Er war in Vielem unser großes Vorbild. Im Nachhinein muss ich sagen, dass er mich in meinem Werdegang nach meinen Eltern am stärksten beeinflusst hat. Nicht vorbildlich war, dass er bei uns während des Unterrichts seinen Kaffee aus dem Schnabel einer kleinen Kanne trank, die in seiner riesigen linken Hand fast verschwand. Hätten wir Schüler es gewagt, ihm zu sagen, dass wir das unschicklich fänden, dann hätte er sicherlich mit dem oft von ihm zu hörenden Zitat geantwortet: „Quod licet Iovi, non licet bovi.“ Zu Deutsch etwa: Was dem Jupiter geziemt, geziemt dem Ochsen (noch lange) nicht.“ Er rauchte auch viel während des Unterrichts, was damals allerdings als normal angesehen wurde.
Ich wurde von Herrn Schwemer in den Fremdsprachen Englisch und Latein unterrichtet, und das tat er so gründlich, dass ich heute noch – 66 Jahre später – von den meisten englischen und lateinischen unregelmäßigen Verben die Konjugationen aufsagen kann (etwa: to go, went, gone; legere, lego, legi, lectum). Er lehrte uns eine Menge Merksätze, die sich fest in unser Gedächtnis eingruben. Im Biologieunterricht etwa den Satz: „Osmose ist das Ausgleichsbestreben zweier unterschiedlich stark konzentrierter Flüssigkeiten durch eine halbdurchlässige Membran”, was ja auch ungefähr stimmt. Oder „Die dritte PSP erhält ein s“, was im Klartext bedeutet, dass im Englischen jedem Verb in der dritten Person Singular Präsenz ein s angehängt werden muss. Oder „Aus und außer, bei und binnen, mit, entgegen, gegenüber, nach und nächst, nebst, samt und seit, von, gemäß und zu, zuwider – schreibe mit dem Dativ nieder!“ Und was solcher Merksätze mehr waren. Und wehe uns, wenn wir mitten in der Nacht geweckt, das alles nicht wie aus der Pistole geschossen von uns geben konnten! (Was natürlich nur eine scherzhaft vorgetragene Forderung Schwemers war.)
Wir hörten von Schwemer auch das erste Mal in unserem Leben Ausdrücke wie alldieweil und sintemalen, zu Nutz und Frommen, mich deucht, mich dünkt, gehab dich wohl, hinfort, tunlichst, fürderhin, jüngst, heischen, hub an …; alles längst nicht mehr verwendete Ausdrücke, die uns aber gerade wegen ihres altmodischen Klanges (oder nur deswegen, weil der von uns verehrte Schwemer sie hin und wieder benutzte?) gleichsam aufgesogen und in unserem Sprachschatz aufgenommen wurden, so gründlich, dass ich sie auch heute noch gelegentlich scherzhaft benutze.
Bei unseren Aufsätzen hörte ich oft seine Kritik: „Gleiche oder ähnliche Ausdrücke in räumlicher Nähe sind zu vermeiden.“ Was man durchaus gelten lassen kann. Der Konjunktiv mit dem Wort „würde“ war Herrn Schwemer und damit auch bald uns zuwider. Dazu zitierte er aus der Bibel den Satz: „Was hülfe es dem Menschen, denn er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Schaden an seiner Seele.“ Er wollte uns damit lehren, dass Deutsch eine „würde“-lose Sprache sein sollte, also eine Sprache, in der man das Wort „würde“ tunlichst weglassen und stattdessen die starke Beugung der Verben benutzen sollte.
Herr Schwemer war bei aller Strenge auch ein lustiger Lehrer. Er zitierte, wenn ihm danach war, mitten im Unterricht lustige Reime, etwa den von den Hamburger Ameisen:
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Doch in Altona, auf der Chaussee,
Da taten ihnen die Füße weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Teil der Reise.
Diesen Vers von Ringelnatz hatten wir noch nie gehört. Auch den Ringelnatzschen Reim mit dem Suahelischnurrbarthaar, das da am Kattegatt treibt, fanden wir äußerst interessant. Unvergessen auch Verse wie dieser
Ich hab dich so lieb!
Ich würde dir ohne Bedenken
Eine Kachel aus
Meinem Ofen schenken.
Da war dann noch die Alwine, deren Name ich wegen der Ähnlichkeit mit einem der Vornamen Schwemers (Alwin) gut behalten konnte:
Alwine war meine längste Braut.
Ich grub sie ein, ich grub sie aus,
Bis sie schließlich an den weichen Teilen
Schon ganz anders und ganz flüssig war.
Ob Ringelnatz so etwas Scheußliches auch gedichtet hat? (Ja, hat er, so ähnlich) Als Peter und ich einmal in den Ferien im Kampener Dünengelände zelteten, fanden wir eines Nachmittags, als wir von einem Strandspaziergang zurückkehrten, in großen, roten Druckbuchstaben auf unserem Zeltdach die Aufschrift
GRUSZ HGAS + EVA
H. G. A. Schwemer vor seiner Veranda
Wir rätseln lange herum, wer das gemacht habe und was das bedeuten soll. Erst als die Schule wieder angefangen hatte, löste sich das Rätsel: Herr Schwemer hatte uns zusammen mit seiner Frau besuchen wollen. Und als sie uns nicht antrafen, hatten sie seine Initialen, Hans Gustav Alwin Schwemer, und den bis dahin uns unbekannten Namen seiner Frau Eva mit Lippenstift auf die Zeltwand geschrieben. Wir haben erst viel später herausgefunden, was das für eine Ehre für uns bedeutet hatte. Herr Schwemer war mit der Inselbahn nach Kampen gefahren und dann bis in die Kampener Dünen gewandert, um uns dort zu besuchen! Herr Schwemer ging normalerweise nicht den kleinsten Weg zu Fuß, wenn er es nicht musste und trieb nicht den geringsten Sport. Als er viele Jahre später ein Auto besaß und im knapp 200 m entfernten Gemeindebüro als Bürgermeister arbeitete, hat er diese kleine Strecke meines Wissens stets mit dem Auto zurückgelegt. Ein Grund mag gewesen sein, dass er auf dem Weg nicht angesprochen und aufgehalten werden wollte.
Etwas kriegerisch Anmutendes
Sylt hatte bereits im Kriege einen Militärflughafen, den die Engländer nach der Kapitulation übernahmen. In der ersten Zeit nutzten sie die Schieß- und Bombenziele der deutschen Luftwaffe auf dem Ellenbogen und im Wattenmeer, was wir auch von unserem Hotel aus gut beobachten konnten. Und über dem Meer westlich von Sylt übten die Engländer das Schießen auf fliegende Ziele. Dazu schleppte ein Flugzeug eine lange weiße Fahne mit einem aufgemalten schwarzen Punkt an einem Drahtseil hinter sich her. Winzige doppelrümpfige Düsenjäger vom Typ Vampire sollten dann den schwarzen Punkt mit ihren Bordkanonen treffen. Natürlich verfolgten wir diese Schießübungen mit starkem fachlichen Interesse. Einmal verlor ein Schleppflugzeug die Zielfahne beim Heimflug über den Dünen nördlich von Kampen. Ich hetzte den langen Weg zur Absturzstelle, wagte jedoch nicht, das lange Drahtseil und das erstaunlich grob gewebte, riesige Tuch mitzunehmen. Und es dauerte auch nicht lange, und ein englischer Jeep kam in die Dünen gefahren, und zwei Soldaten packten das verlorene Schleppziel zusammen und nahmen es mit.
Ein paar Hundert Meter hinter unserem Haus lag die höchste Erhebung der Insel, die Uwedüne, mit ihren ca. 50 Metern. Sie war benannt nach Uwe Jens Lornsen, einem Vorkämpfer für ein geeintes und unabhängiges Schleswig-Holstein. Auf ihr stand eine halb zerstörte Flugzeugabwehrkanone, eine sogenannte FlaK, an der wir herrlich spielen konnten. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn das Kriegsgerät wurde gesprengt, was wir Jungen natürlich buchstäblich hautnah miterlebten. In unserem Hotel zerbrachen dabei einige Scheiben.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten
Das Hotel warf trotz aller Mühen unserer Väter keinen Gewinn ab. Die Fabrikation von Wurstkonserven kam ebenfalls nicht recht voran. Mein Vater nahm zu unserer großen Trauer „unser“ rotes Fahrrad und fuhr mit dem Zug aufs Festland, wo er bei den Bauern Eier kaufte, die er dann an Kampener Hotels und Pensionen verkaufte. Das einzige, was dieser Geschäftsbetrieb von uns Jungen aus gesehen abwarf, waren die vielen „Knickeier“, Eier, die angeschlagen waren, und die wir kleinen Köche in leckere Eieromelettes verwandelten. Für den Rest des Lebens hätten wir jeden Rekord gebrochen, bei dem es darum ging, möglichst schnell mit einer Gabel in einem tiefen Teller Eiweiß zu festen Schaum zu schlagen. Ein anderes Geschäft meines Vaters bestand darin, bei einem Bauern im nördlichen List Teewurst, das Pfund für 2,60 Mark, zu kaufen und in Hamburg wieder zu verkaufen.
Mit den geschiedenen Müttern, die uns ab und zu auf Sylt besuchten, waren nahezu zwei Familien zu ernähren. Und da unsere Väter alles andere als Hoteliers waren, konnte das wirtschaftlich nicht lange gut gehen. Sie waren ungemein gastfreundlich, scharten gerne Freunde und Bekannte um sich und feierten fast ständig. Vor allem im Winter, wenn nichts zu tun war, waren häufig einheimische Junggesellen bei uns zu Gast, darunter auch einige Maler, denn Kampen war damals noch eine kleine Künstlerkolonie. Dabei wurde viel getrunken, Skat gespielt und erfreulicherweise auch viel gelacht. Wenn kein Geld mehr da war, dann wurde die Bezahlung der Einkäufe im Winter in den beiden Kampener Lebensmittelgeschäften Brodersen und Hansen auf die nächste Saison verschoben. Die Inhaber der Geschäfte waren entweder äußerst naiv und gutmütig, oder unsere Väter blendende Überredungskünster. Ich halte das Letztere für das Wahrscheinlichere.
Das wirtschaftliche Ende leitete sich mit der Währungsreform ein, die uns am 20. Juni 1948 ereilte. Es war fantastisch: Plötzlich gab es Apfelsinen, Pampelmusen und Bananen zu kaufen! Zur Währungsreform erhielt jeder Erwachsene zunächst nur 40 Deutsche Mark. Die wenigsten konnten damit verreisen, so dass das Hotel sich erst wieder im Juli langsam füllte. Dann aber wurde um jeden Gast gekämpft, um die im Herbst fällige Pacht noch zu erwirtschaften. Um auch noch unsere eigenen Betten vermieten zu können, haben mein Vater und ich eine Weile im Garten unseres Hotels in einem Zelt geschlafen.
Unter den wenigen Gästen war eine gewisse Frau von M. mit ihrer zwölfjährigen Tochter. Ihr Mann – damals bereits ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Ölbranche in Hamburg – hatte uns die Bezahlung der Hotelrechnung schriftlich garantiert. Frau von M. hatte mich in ihr Herz geschlossen, weil ich ihrem Sohn ähnlich sah, der beim Spielen mit einer Granate ums Leben gekommen war.
Wir badeten unter dem Kliff, damals ein einsames Stück Strand. Wir badeten nackend, was gerade wieder in Mode kam. Für mich war es das erste, unglaublich aufregende Mal, dass ein splitternacktes Mädchen sich neben mir im Sand sonnte. Gelegentlich musste Frau von M. ihre Tochter ermahnen, nicht so breitbeinig dazuliegen.
Tante Mia, wie ich diese freundliche Dame bald nennen durfte, hat mich kurz nach ihrer Abreise für ein paar Tage nach Hamburg in ihr prächtiges Anwesen an der Außenalster eingeladen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Tante Mia meine Manieren gar nicht fein fand. (Die Erziehung in den täglichen Dingen des Lebens fand erst ein paar Jahre später, Anfang der Fünfziger Jahre durch Herrn Schwemer statt) und die Wickersdorfer Internatserziehung hatte nicht viel mit der feinen Etikette der Hamburger High Society gemein. Und so habe ich später von Tante Mia kaum noch etwas gehört.
Mit großer Mühe konnten unsere Väter im Herbst 1948 die Pacht von 6000 neue Deutscher Mark doch noch aufbringen, so dass wir noch ein weiteres Jahr unser Hotel behalten durften. Jedoch das Feiern und Anschreibenlassen in der mageren Jahreszeit ging munter weiter.
März 1949 werden Peter und ich in der Friesenkapelle zu Wenningstedt konfirmiert. Wir hatten nur an einigen wenigen Stunden am Konfirmandenunterricht teilgenommen. Aber weil unsere Väter dem Pastor bei ein paar Schnäpsen gut zugeredet hatten, bestanden wir die Prüfung nach einigen wenigen leichten Fragen. Die Geschäftsleute im Ort schickten uns viele Glückwünsche und jedem von uns einen versilberten Esslöffel. Die Kaufleute hofften wohl insgeheim, dass durch diese freundliche Geste unsere Väter geneigter wären, in der kommenden Sommersaison die Schulden vom vergangenen Winter bei ihnen zu begleichen. Aber vielleicht tue ich ihnen mit dieser Annahme auch Unrecht.
Unser Sylter Ende
Als unsere Väter im Herbst 1949 die Pacht nicht mehr bezahlen konnten, musste das Hotel aufgegeben und Sylt verlassen werden. Mein Vater meldete mich im November im Schülerheim auf dem Festland im nahe gelegenen Niebüll an, bezahlte die erste monatliche Pension von etwa 35 DM und drückte mir verlegen etwas weniger als fünf Mark Taschengeld in die Hand. Da stand ich nun, mutterseelenallein, und zog in einen kleinen Schlafsaal zu mir völlig unbekannten Schülern ein. Es war mein fünfter Schulwechsel, und so hatte ich schon einige Übung. Mein finanziell ruinierter Vater fuhr weiter nach Hamburg, lieh sich von seiner geschiedenen Frau, meine Mutter, Geld für eine Fahrkarte zu seiner Schwester nach Düsseldorf, und fing dort als Hilfsarbeiter beim nächtlichen Sortieren von Paketpost an. Das war’s.
In Niebüll musste ich wieder eine reguläre Schule besuchen, die neben dem Schülerheim gelegene Friedrich-Paulsen-Schule. Der Leiter des Schülerheims, Oberstudiendirektor Dr. Meyer, der gleichzeitig mein Biologielehrer war, stufte mich eine Klasse zurück, weil ich seiner Meinung nach keine ausreichenden Biologiekenntnisse von Schwemer mitbrachte. Aber in Mathematik war ich hervorragend. Einmal schrieb ich die beste Arbeit dreier Parallelklassen.
Von Niebüll aus fuhr ich, so oft ich konnte, zur nahen Insel Sylt. Es war nicht nur die Insel, die mich hinzog, sondern vor allem Christel, die ich jedoch weiterhin nicht für mich begeistern konnte. Wenn ich zum Baden an den Strand ging, dann an den Nacktbadestrand, wie ich es von Kampen gewohnt war, so dass ich nahtlos braun wurde. Das hat dann beim allgemeinen sonnabendlichen Duschen im Keller der benachbarten Schule stets einiges Erstaunen bei den anderen Heimschülern hervorgerufen, weil das Nacktbaden damals bei vielen noch mit dem Schleier des Sündigen, sexuell Aufregenden umgeben war.
Im Sommer, wenn das Haus von Christels Mutter, Haus Daheim, belegt war, wohnten sie und Christel in den Dachkammern direkt über ihrem Obstladen im Gebäude der Kurverwaltung, wo ich Christel besuchte. Der Laden war zweigeteilt: rechts wurden Süßigkeiten und links Obst verkauft. Ich darf Christels Mutter bald Tante Ami nennen und bekomme von ihr zum Abschied stets etwas Gesundes in eine Tüte gepackt, die den Schriftzug Eßt mehr Obst trug. Diesen Mischgeruch von Süßigkeiten und Obst im Laden, dem ich in dieser Art nie wieder in meinem Leben begegnet bin, werde ich fortan nicht mehr aus der Nase verlieren. Wenn nur etwas so ähnlich riecht, dann bin ich schlagartig um Jahrzehnte zurückversetzt in diesen heimeligen Laden bei Christel und Tante Ami.
Als Christel den Film „Die Jungfrau von Orleans“ mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle sieht, schwärmt sie mir etwas von dieser jungen, schwedischen Schauspielerin vor. Ich suche mir in Niebüll ein passendes Bild aus einer Illustrierten und zeichne mit Bleistift und viel Fleiß ein großes Bild nach dem Foto von Ingrid Bergmann. Als ich Christel dieses Bild bei meinem nächsten Besuch mitbringe, freut sie sich sehr, sie strahlt mich an – und ich bin überglücklich. Aber trotz aller meiner Bemühungen, es bleibt zu meinem tiefen Leid bei dem rein platonischen Verhältnis zu Christel.
Die Umgebung des Schülerheims, die norddeutsche Landschaft, hat mich immer an mein Sylt erinnert. Der weite unverstellte Blick, die reetgedeckten Bauernhäuser, um die sich windgebeugte Baumgruppen scharen, mit dem meist grauen weiten Himmel darüber. Aber es war eben doch nicht das geliebte Sylt, zu dem es mich noch immer hinzog.
In Niebüll blieb ich bis Frühjahr 1952. Als meine Mathematikzensur mit der Zeit schlechter wurde, und ich meine nur ausreichende Lateinnote nicht mehr mit der Mathematiknote ausgleichen konnte, blieb ich Ostern 1952 sitzen. Auf Wunsch meiner Mutter verließ ich das Schülerheim und damit die Schule und zog zunächst zu ihr und ihrem dritten Mann nach Hamburg.
Da ich mir zur Familie Schwemer ein gutes Verhältnis bewahrt hatte, fuhr ich auch von Hamburg in der gästearmen Zeit öfter für ein, zwei Nächte nach Wenningstedt und konnte bei Schwemers für ein paar Mark unterkommen. Da ich dann stets mit dem letzten Zug gegen Mitternacht auf Sylt ankam, schlich ich mich nachts leise in ihr Haus und legte mich in irgendein freies Bett. Dazu muss man wissen, dass damals die meisten Häuser auf Sylt auch nachts nicht verschlossen waren.
Rückkehr nach Sylt
Im Juni 1952 heiratete mein Vater eine relativ vermögende Frau und konnte es sich leisten, mir meinen innigsten Wunsch zu erfüllen, wieder nach Sylt zurückzukehren. Da Familie Schwemer inzwischen eine Art von Kleinst-Schülerheim für Jungen mit angeschlossener Schule eröffnet hatte, zog ich bei ihnen ein. Ich wohnte nun zwar nicht in meinem Kampen, jedoch waren mir Wenningstedt und Familie Schwemer sehr vertraut, so dass ich mich auch dort bald wie zuhause fühlte. Diesmal war der einzige Lehrer Herr Schwemer. Er schien ein Genie zu sein. Er unterrichtete neben den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Latein sämtliche Schulfächer, außer Sport natürlich. Zusätzlich brachte er abends noch jungen Damen Buchführung bei.
Unsere kleine Schülergruppe aß stets mit Familie Schwemer zusammen. Und Herr Schwemer achtete immer auf gute Tischsitten: Gerade sitzen, beide Hände auf den Tisch, Ellenbogen nicht aufstützen, nicht Schmatzen, Messer und Gabel nicht nach oben strecken und nicht mit vollem Mund reden. Wehe, einer von uns Jungen pulte das Innere aus einer Wurstpelle heraus und ließ dann die Wurst mit dem schlaffen Wurstdarm für die anderen liegen! Herr Schwemer konnte dann recht ärgerlich werden. Und Gnade dem, der seinen Bissen mit einem Getränk hinunterspülte!
Auch Schwemers Haus Villa Arethusa, in dem wir wohnten, war ähnlich einfach ausgestattet wir unser Kampener Hotel. Unsere Schlafzimmer hatten keine Heizung, und unsere dünnen schweren Steppdecken waren wie die im Hotel Haus Fernsicht mit dunkelgrauer Baumwolle gefüllt. Einmal war es tagelang so kalt, dass sich an den einfach verglasten Fenstern Eisblumen bildeten, die immer dicker wurden, so dass wir mit einer Rasierklinge ein kleines Guckloch in das Eis schabten, um wenigstens ein wenig hinausgucken zu können. Sogar das Wasser im Waschbecken hatte eines Morgens eine Eisdecke. Doch wir beklagten uns nicht, wir waren froh, hier auf Sylt sein zu können. Auch das Wattenmeer war zu jener Zeit so stark zugefroren, dass einige Leute mit ihren Autos über das Eis fuhren, um die Transportkosten der Bahn über den Hindenburgdamm zu sparen.
Neben Schwemers Haus lag die kleine Drogerie Schukat, dessen Inhaber so sehr auf Umsatzsteigerung versessen war, dass er uns Jungen nahezu alles an Chemikalien besorgte, was wir eigentlich nicht haben durften. Ich hantierte wieder ein wenig mit Sprengstoffen, diesmal mit Schwarzpulver, aber es bot sich mir wenig Neues an Erfahrung, so dass ich mich bald anderen Experimenten zuwandte.
In einer Illustrierten hatten wir ein Bild gesehen, auf dem ein junger Mann einen gewaltigen Feuerball erzeugt, indem er eine brennbare Flüssigkeit in eine offene Flamme bläst. Es handelte sich hier um eine Art Mutprobe, die an irgendeiner amerikanischen Universität von den sogenannten „Freshmen“ als Aufnahmeprüfung bestanden werden musste. Das hielt ich für eine gute Idee für die Aufnahme von Neulingen in unserem kleinen Schülerheim. Wir suchten uns also einen neuen, reichlich unbedarften Schüler aus und erklärten ihm, dass auch er die Aufnahmeprüfung bestehen müsse, die wir alle hinter uns gebracht hätten. Sie bestand darin, einen Schluck Benzin gegen eine brennende Kerze zu pusten, um so einen schönen Feuerball zu erzeugen. Wir hatten schon eine Weile mit Leichtbenzin von Drogerie Schukat experimentiert, wobei einige von uns sich damit durch Einatmen in eine Art Kurznarkose hatten versetzen können. Und wir wussten, dass diese Flüssigkeit äußerst leicht entzündlich war.
Nun war ich ein durchaus verantwortungsvoller Mensch. Obgleich keiner von uns dieses Feuerspucken je mit eigenen Augen gesehen, geschweige denn selbst ausprobiert hatte, wollte ich keineswegs, dass unser etwas einfältiges Opfer sich verbrennt. Also setzten wir dem Jungen eine einigermaßen dichte Mütze auf, cremten ihm das Gesicht dick mit NIVEA ein, und ich schärfte dem Knaben ein, dass es immens wichtig sei, dass er – wenn der Feuerball sich plötzlich vor seinem Gesicht entfaltet – keinesfalls vor Schreck aufhören soll zu blasen. Ganz im Gegenteil: Er solle so lange weiter pusten, bis alles Benzin aus seinem Mund heraus sei. Dann stürbe das Feuer von selbst. Jedenfalls hatte ich mir das technisch in Gedanken so zurecht gelegt.
Also nahm der ängstlich dreinschauende Junge einen kleinen Schluck aus der Flasche mit dem Leichtbenzin, (die ich sogleich wieder sorgfältig verschloss) und pustete das Benzin-Luftgemisch gegen die brennende Kerze. All unsere Herzen blieben stehen – die Kerze erlosch. Die Kerze wieder angezündet, wieder einen kleinen Schluck genommen, ein kräftiges Pusten – die Flamme erlosch abermals. Beim dritten Versuch klappte es.
Es entfaltete sich vor dem Jungen ein riesengroßer, rotgelb lodernder Feuerball. Wir erstarrten vor Schreck und unser Neuling hörte aus Angst auf zu blasen. Die Feuerwolke kam kurzzeitig bis an sein Gesicht heran und versenkte ihm die Augenbrauen und Wimpern bis auf die Haarwurzeln. Obendrein verbrannte er sich trotz der Creme sein Gesicht ein wenig. Aber wir alle waren anschließend sehr stolz auf ihn, und er natürlich auch auf sich. Jedoch, als wir ihm dann später gestanden, dass er der erste gewesen sei, der diese Mutprobe bestehen musste, wollte er tagelang nicht mehr mit uns reden.
Wenningstedt war für uns Heimjungen bald ein vertrauter Ort. Auch hier gab es halb gesprengte Bunker, Dünen zum Toben, die Ausläufer des Roten Kliffs und einheimische Spielkameraden. Ein besonders wilder unter ihnen, von dem man munkelte, er habe als kleines Kind sein Elternhaus angesteckt, wurde mein Lieblingsfreund. Er hieß Uwe Lödige und war zwei Jahre jünger als ich. Sein Vater war früher Rettungsschwimmer gewesen. Uwe sollte für die nächsten 35 Jahre mein engster Freund auf Sylt werden. Uwe war stets zu irgendwelchen Streichen aufgelegt. Als ich einmal Gaspistolen aufgetrieben hatte, bauten Uwe und ich sie so um, dass man damit Stahlkugeln verschießen konnte. Wir ballerten damit in den Dünenbunkern herum, um treffsicherer zu werden. Als ich bei Schwemers eine Zeit lang mit einem Schulkameraden im Souterrain im unteren Bett eines Stockwerkbettes schlief, hatten wir des Nachts im Sommer offene Fenster, in die man leicht hätte einsteigen können. Zur Sicherheit hatte ich mir meine scharfgeladene Pistole über meinem Kopf an der Matratze des Bettes über mir befestigt, um bei Gefahr schnell schussbereit zu sein. Eines Nachts werde ich durch ein Geräusch geweckt und will zur Pistole langen. Es gelingt mir jedoch nicht: Eine Hand greift die meine. Ich bin zu Tode erschrocken, bis ich merke, dass es Uwe ist, der leise in das Zimmer eingestiegen ist und nun nicht erschossen werden will. Er wollte mich abholen, weil am Strand eine Menge fast nagelneuer Holzbohlen angeschwemmt worden war, die er mit mir hoch holen und der Baufirma Holst verkaufen wollte. Wir schleppten den Rest der Nacht lange Holzbohlen vom Strand, doch viel Geld brachte das Geschäft nicht, denn wir ließen uns erpressen, weil alles Angeschwemmte von Wert dem Strandvogt zu melden war, der dann über die weitere Verwendung entschied. Unser Geschäft war somit illegal.
Uwe war ein echter Naturbursche. Er war gewissermaßen zuhause am Strand, in den Dünen mit ihren Bunkern, auf der See mit ihren Fischen und Möwen. Er war ein genauer Kenner der Wellen und der Tier- und Pflanzenwelt Sylts; Es schien, als lebte er nur im Freien. Seine Kenntnisse und Fähigkeiten waren später, als er mit mir zusammen als Rettungsschwimmer arbeitete, uns allen sehr nützlich. Davon wird noch zu berichten sein. Wenn Uwe ein verletztes Tier fand, etwa eine Möwe, dann hat er sie mit nach Hause genommen und solange aufopfernd gepflegt, bis sie wieder fliegen konnte und ihn verließ. Auch Möweneier trieb Uwe auf, woher auch immer. Er verriet es uns nicht. Später sollten noch seine handwerklichen Fähigkeiten etwa als Zimmermann hinzukommen. Eine Zeit lang verdiente er sein Geld auch als Wallbauer. Diese Wälle, auch Friesenwälle genannt, bestehen aus Natursteinen mit Grassoden zwischen den Steinen und als Abdeckung des Walls. Uwe hatte in Dänemark eine Quelle aufgetan, wo er die für den Wall relativ großen raren Feldsteine bezog. Als Uwe später Familie hatte, machte er daraus ein kleines Unternehmen.
Mittlere Reife
Trotz aller Freude am Jungendasein wurde die Schulbildung nicht vernachlässigt. Da Herr Schwemer ein Privatlehrer war, hatte er keine Erlaubnis, Abschlussprüfungen durchzuführen, die staatlich anerkannt wurden. So meldete Herr Schwemer mich und meinen Freund Werner Holst im April 1953 für die Prüfung der sogenannten Mittleren Reife bei der zuständigen Kieler Schulbehörde an. Durch den unregelmäßigen Schulbesuch während der Monate vor und nach dem Kriegsende war ich mit meinen 18 Jahren ziemlich spät dran. Wir fuhren nach Kiel, wohnten in einer Jugendherberge und wurden an drei aufeinander folgenden Tagen von den Lehrern einer dortigen Schule geprüft. Ich kam durch, Werner leider nicht. Nun galt es, auf das Abitur hinzuarbeiten.
Gelegentlich besuchte mich mein Vater auf Sylt, und ich konnte – dank seiner üblichen Großzügigkeit – mit seinem Diesel-Mercedes auf der Straße am Ellenbogen, eine Privatstraße, das Fahren üben. Im März 1953 meldete ich mich in der Westerländer Fahrschule Liß