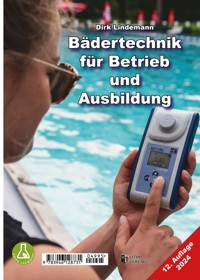
44,95 €
Mehr erfahren.
Dieser Neuauflage liegen die neusten Ausgaben der Normen, Richtlinien und Regeln zugrunde. Ebenso die Ausgabe der DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ der Teile 1-4 (2023-06). Maßgebend für die Verwendung der DIN-Normen sind die Fassungen mit neuestem Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4-10, D-10787 Berlin, erhältlich sind. Gleiches gilt für die Richtlinien für den Bäderbau, Herausgeber: Koordinierungskreis Bäder DGfdB/DSV/DSB sowie den Regeln der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der Öffentlichen Hand (BAGUV) und den Merkblättern des Technischen Ausschuss des „Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.“ sowie „Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.“, Alfredistr.32, D-45127 Essen. Ein besonderer Dank gilt Sabine Härtl, Sami Traboulsi und Dr. Gregor Golz (Witty Chemie) für ergänzende Hinweise zu Kapitel 10.6.ff, 10.9.3.7.ff und Kap 4. Flächendesinfektion ff.. Ebenso ein großer Dank an Daniel Ackermann von der Bäderfachschule e.V. für die Überarbeitung und Anpassung an die aktuelle DIN Norm des Kapitel 8 Wasserbeschaffenheit in Schwimm- und Badebecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1
2
3
Dirk Lindemann
Dipl.-Ing. OStR i.R.
Bädertechnik
für
Betrieb und Ausbildung
12. überarbeitete Auflage Herbst 2024
Dieser Neuauflage liegen die neusten Ausgaben der Normen, Richtlini-en und Regeln zugrunde. Ebenso die Ausgabe der DIN 19643 „Aufbe-reitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ der Teile 1-4 (2023-06).
Maßgebend für die Verwendung der DIN-Normen sind die Fassungen mit neuestem Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burg-grafenstr. 4-10, D-10787 Berlin, erhältlich sind. Gleiches gilt für die Richtlinien für den Bäderbau, Herausgeber: Koordinierungskreis Bäder DGfdB/DSV/DSB sowie den Regeln der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der Öffentlichen Hand (BAGUV) und den Merkblättern des Technischen Ausschuss des „Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.“ sowie „Deutsche Gesellschaft für das Badewe-sen e.V.“, Alfredistr.32, D-45127 Essen.
Ein besonderer Dank gilt Sabine Härtl, Sami Traboulsi und Dr. Gre-gor Golz (Witty Chemie) für ergänzende Hinweise zu Kapitel 10.6.ff, 10.9.3.7.ff und Kap 4. Flächendesinfektion ff..
Ebenso ein großer Dank an Daniel Ackermann von der Bäderfachschu-le e.V. für die Überarbeitung und Anpasung an die aktuelle DIN Norm des Kapitel 8 Wasserbeschaffenheit in Schwimm- und Badebecken.
4
In eigener Sache:
Ursprünglich firmierte der Verlag unter der Bezeichnung K&L Verlag - Thomas Lindemann ansässig in 67346 Speyer und wurde im Dezember 2003 in Litho-Verlag e.K. umbenannt. Zum 1.1.2004 übernahm der Verlag alle Buchrechte an den B. Lindemann-Unterrichtsmedien, Schwetzingen. Seit Februar 2006 ist der Verlag in 34466 Wolfhagen ansässig.
© Litho-Verlag e.K., Wolfhagen
www.litho-verlag.de • www.badeliteratur.de
Mittelstrasse 4, 34466 Wolfhagen
Tel: 05692-9960682 • Fax: 05692-9960683
Alle Rechte vorbehalten
Druck: Silber Druck GmbH & Co. KG, Lohfelden
12. Auflage Nov. 2024
Printed in Germany
ISBN: 978-3-946128-73-1 (printed)
ISBN: 978-3-946128-74-8 (ebook pdf)
ISBN: 978-3-946128-75-5 (ebook epub)
Buchtitelseite: Tintometer GmbH, Lovibond® Water Testing, Schleefstraße 8-12, 44287 Dortmund; E-Mail: [email protected] - Web: www.tintometer.com
Umschlagseite 2, innen: Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG, Goethestraße 5, D-73557 Mutlangen, Web: www.ospa.info
Umschlagseite 3, innen: Wassertechnik Wertheim GmbH & Co. KG, Kiesweg 2, 97877 Wert-heim, www.wassertechnik.de
Umschlagrückseite: Witty GmbH&Co. KG, Herrenrothstr. 12-16, D-86424 Dinkelscherben. Web: www.witty.eu
5
Vorwort des Verfassers
für die wertvollen Hinweise zur vollständigen Bewältigung der Stoffgebiete herzlich gedankt. Besonderen Dank gilt den auf dem Bäderbau-Sektor führenden deutschen Firmen und Bäder-Fachleuten, die durch technische Informationen, Fachbeiträge, Konstruktionszeichnungen und Abbildungen zum Gelingen des Lernwerkes beitrugen (siehe auch Literaturverzeichnis und Bildbeschriebe).
Der Verfasser hofft den jetzigen und zukünftigen Auszubildenden und Lehrgangsteilnehmern des Schwimmmeisterberufes sowie den Ausbildern und Lehrern ein Unterrichts- und Lernwerk an die Hand zu geben, das sie in die Lage versetzt, die komplexe Technik der Schwimmbäder zu erfahren und anwenden zu können. In diesem Sinne fühlt sich auch der Autor verpflichtet, stän-dig an diesem Werk weiterzuarbeiten und es auf den jeweils neuesten Stand zu halten. Dazu wird die Bitte an alle Leser gerichtet auch weiterhin dieses Unterfangen durch Hinweise und Verbes-serungsvorschläge zu unterstützen.
Auch diese Auflage erscheint im Farbdruck und handlicheren Format. Hierfür wurden alle aktuel-len Grafiken farblich überarbeitet und die Fotos durch Farbbilder ersetzt und ergänzt. Dieser enorme arbeitstechnische und finanzielle Auf-wand, war nur mit der Unterstützung der führen-den Deutschen Fachfirmen zu erreichen, denen aus Dank auch eine Präsentationsebene zuge-standen werden musste. Obwohl die Fachbei-träge ergänzt und erweitert wurden, weicht die Stoff-Folge nicht von der alten Ausgabe ab. Die Übungseinheiten behielten ihre Nummerierung. Sie wurden lediglich den stofflichen Änderungen angepasst.
Wolfhagen,im November 2024- Der Verfasser
Dem Unterrichtswerk liegen der Bundesrahmen-lehrplan für den Ausbildungsberuf „Fachange-stellte für Bäderbetriebe“ und die Verordnung des Innenministeriums der BRD zum geprüften Schwimmmeister für Bäderbetriebe zugrunde.
Damit das Fachbuch, sowohl in der Ausbildung in Schule und Betrieb, als auch in allen Bundes-ländern und im deutschsprachigen Europa mit Erfolg eingesetzt werden kann, war es ein Anlie-gen des Verfassers die Fachgebiete der Bäder-technik nach dem Stand der Technik und den Rahmenlehrplänen anschaulich zu gliedern und die stofflichen Inhalte nach bewährten methodi-schen Gesichtspunkten aufzubereiten.
In dieser Auflage wurde der stoffliche Umfang überwiegend auf die Prüfungsanforderungen und das Berufsbild der Meister(in) für Bäderbe-triebe und der Fachangestellten ausgerichtet, wobei dem Autor die langjährige Unterrichtser-fahrung an der Landesfachklasse für Fachange-stellte für Bäderbetriebe in Baden-Württemberg und an der Meisterschule der Heinrich-Lanz-Schule I in Mannheim wertvolle Erkenntnisse lieferte. So ist das Lernwerk gleichermaßen für Ausbildung und Fortbildung bestens geeignet.
Durch die Einbeziehung der neuesten Normen, Richtlinien und Ausführungen nach dem Stand der Technik, dürfte diese Ausgabe für viele Jah-re ihre Aktualität bewahren. In allen Sachgebie-ten wurden die Unfallverhütungsrichtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unfallversiche-rungsträger der öffentlichen Hand -BAGUV- ein-gearbeitet.
Den Mitgliedern des Unterausschusses des Berufsbildungsausschusses des Landes Baden-Württemberg und der Zuständigen Stel-le am Regierungspräsidium Karlsruhe sei hier
Inhalt
6
Inhaltsverzeichnis
1 Bädergestaltung..........................13
1.1 Planen und Einrichten der Bäder.....13
1.1.1 Wichtige Normen, Richtlinien und Regeln für die Planung und Gestal-tung von Bädern...................................13
1.1.2 Bäderarten...........................................14
1.1.3 Bedarfsplanung....................................15
1.1.3.1 Standortwahl eines Bades................15
1.1.3.2 Größen und Beckenarten.................16
1.2 Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern......................17
1.2.1 Einrichtungen der Hallenbäder.............17
1.2.1.1 Flächen.............................................17
1.2.1.2 Bereiche und Räumlichkeiten der Hallenbäder......................................17
1.2.1.3 Beckenanlagen in Hallenbädern.......20
1.2.2 Einrichtungen der Freibäder.................20
1.2.2.1 Flächen.............................................20
1.2.2.2 Freibadbreiche, Räumlichkeiten.......20
1.2.2.3 Beckenanlagen in Freibädern...........22
1.2.3 Einrichtungen der freizeitorientierten Bäder....................................................22
1.2.3.1 Flächen.............................................22
1.2.3.2 Bereiche und Räumlichkeiten der Freizeit- und Spaßbäder...................23
1.2.3.3 Beckenarten in Freizeitbädern..........26
1.3 Bauliche Gestaltung von spezi-ellen Beckenanlagen..........................27
1.3.1 Allgemeine Konstruktionsmerkmale.....27
1.3.2 Schwimmer- und Sportbecken.............27
1.3.2.1 Einrichtungen, die der Sicherheit dienen...............................................27
1.3.2.2 Beckenausstiege, -Einstiege............29
1.3.2.3 Wassertiefen, Kennzeichnung..........30
1.3.2.4 Beckenböden, Beckenwände ..........31
1.3.2.5 Leinen, Seile, Befestigungen............31
1.3.2.6 Abdeckungen und Roste..................32
1.3.2.7 Ein- und Ausströmungen, Wasse-rentnahmeschächte in Becken.........33
1.3.2.8 Unterwasserscheinwerfer und Un-terwasserfenster...............................33
1.3.2.9 Rettungsgeräte.................................34
1.3.3 Nichtschwimmerbecken.......................35
1.3.3.1 Lehrschwimmbecken........................35
1.3.4 Variobecken.........................................37
1.3.5 Wellenbecken.......................................42
1.3.6 Springerbecken....................................45
1.3.6.1 Sprunganlagen E DIN EN 13451.......45
1.3.7 Planschbecken.....................................49
1.3.8 Durchschreitebecken...........................49
1.3.9 Kleinbecken, KSB: Kinder-, Senio-ren-, und Behindertenbecken ..............50
1.3.10 Warmsprudelbecken ...........................50
1.3.11 Bewegungsbecken...............................51
1.3.12 Thermalbecken, Solebecken, Mine-ralbecken..............................................51
1.3.13 Warmbecken (Warmwasserbecken)....51
1.3.14 Therapiebecken...................................51
1.3.15 Kaltwasserbecken................................51
1.3.16 Schwimmkanal.....................................52
1.3.17 Außenwarmbecken..............................52
1.3.18 Becken mit zusätzlichen Wasser-kreisläufen............................................52
1.3.19 Spaß- und Erlebnisbecken...................53
1.3.19.1 Wasser-Attraktionen.........................53
1.3.20 Landebecken für Wasserrutschen, Ausrutschbecken..................................58
1.3.21 Weitere Einrichtungen des Becken-bereichs................................................62
1.4 Anlagen zur Gesundheitspflege.......63
1.4.1 Sauna-Anlagen, Schwitzbäder.............63
1.4.1.1 Formen der Schwitzbäder.................63
1.4.1.2 Grundsätze der Planung undEin-richtung.............................................63
1.4.1.3 Römisches Dampfbad......................65
1.4.2 Künstliches Sonnenbad (Solarium)......66
1.5 Badegewässer - Naturbäder..............67
1.5.1 Arten der Naturbäder...........................67
1.5.2 Planungsgrundsätze............................67
1.5.3 Naturbadgrößen, Einrichtung...............68
1.5.4 Bauliche Anforderungen.......................68
1.5.5 Wartung und Aufsicht...........................68
1.5.6 Natürliche und künstliche Badeteiche..69
Inhalt
7
2 Schwimmbadreinigung...............71
2.1 Reinigungsgebiete.............................71
2.2 Materialien, Verschmutzungsarten...71
2.3 Reinigungsmittel................................71
2.3.1 Unterscheidung der Reiniger...............71
2.3.2 Aufbau und Zusammensetzung der Reiniger................................................72
2.4 Reinigungsmethoden........................74
2.4.1 Allgemeine Arbeitsregeln.....................74
2.4.2 Manuelle Reinigung ............................74
2.4.3 Reinigung mit Maschinen.....................74
2.4.4 Spezielle Reinigungsverfahren in Hallen- und Freibädern........................77
2.4.4.1 Grundreinigung.................................77
2.4.4.2 Beckenreinigung...............................77
2.4.5 Reinigung empfindlicher Bauteile.........79
3 Algenbekämpfung.......................81
3.1 Algenvorkommen...............................81
3.2 Bekämpfungsarten ............................81
4 Flächendesinfektion ...................83
4.1 Krankheitserreger..............................83
4.1.1 Bakterien .............................................83
4.1.2 Pilze.....................................................84
4.1.3 Viren.....................................................84
4.2 Desinfektionsmittel: Einsatz und Wirkungsweise...........................84
4.2.1 Wahl des Flächen-Desinfektionsmit-tels .......................................................85
4.3 Desinfektionstechniken.....................85
4.3.1 Arbeitsgrundsätze ...............................85
4.3.2 Manuelle Desinfektion..........................85
4.3.3 Maschinelle Desinfektion.....................85
4.3.4 Sprüh-Desinfektion im Anschluss an die Reinigung.......................................87
4.3.5 Kontrolle des Reinigungs- und Des-infektionserfolgs im Rahmen der betrieblichen Überwachung..................87
5 Überwinterung von Freibädern..90
5.1 Schutz der Beckenanlagen...............90
5.1.1 Überwinterung ohne Beckenwasser....90
5.1.2 Überwinterung mit Beckenwasser........90
5.2 Überwinterung sonstiger Anlagen....91
5.2.1 Rinnen und kleine Becken...................91
5.2.2 Filter.....................................................91
5.2.3 Leitungsanlagen...................................92
5.2.4 Pumpen - Motore.................................92
5.2.5 Chlor- (Vollvakuumanlage) und Do-sieranlagen ..........................................92
5.2.6 Sanitäranlagen.....................................93
5.2.7 Außenanlagen......................................93
6 Sicherheit im Bäderbereich........94
6.1 Umgang mit Gefahrstoffen................94
6.1.1 Kennzeichnung von Gefahrstoffen.......94
6.1.2 Lagerung von Gefahrstoffen................94
6.1.3 Transport von Gefahrstoffen................96
6.1.4 Entsorgung von Gefahrstoffen.............97
6.2 Gefahren-Kennzeichnungen im Bäderbereich......................................97
6.2.1 Kennzeichnung von Gefahrenberei-chen ....................................................97
6.2.2 Kennzeichnung von Rohrleitungen in Bädern..................................................98
6.2.3 Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403 (Auszug)...........................99
6.3 Arbeiten mit persönlicher Schutzausrüstung............................100
6.4 Sicherheit technischer Anlagen (nach DIN 19643-1,BGR/GUV-R108,GUV-R1/474)............................101
6.5 Prüfung technischer Einrich-tungen...............................................102
7 Wasser für den Bäderbetrieb...103
7.1 Wasserbeschaffenheit.....................103
7.1.1 Eigenschaften des Wassers...............103
7.1.1.1 Chemische Eigenschaften..............103
7.1.1.2 Physikalische Eigenschaften des Wassers..........................................103
7.1.2 Wasser als Lösungsmittel..................105
7.2 Wasserversorgung des Bades mit Trink- und Becken-Füllwasser..107
7.2.1 Anforderungen an das Trinkwasser...107
Inhalt
8
7.2.2 Gewinnung von Trinkwasser und Füllwasser .........................................107
7.2.3 Trink- und Füllwasseraufbereitung.....108
7.2.3.1 Enteisenung und Entmanganung durch Oxidationsverfahren .............108
7.2.3.2 Entfernung von Schwebe- und or-ganischen Stoffen durch Filtration..109
7.2.3.3 Entfernen der Stickstoffverbindun-gen..................................................109
7.2.3.4 Entfernung von Phosphat ..............110
7.2.3.5 Enthärtung .....................................110
7.2.4 Trinkwasserverteilung und Versor-gung des Bades.................................113
8 Wasserbeschaffenheit in Schwimm- und Badebecken.....114
8.1 Allgemeines......................................114
8.2 Anforderungen an das Füllwasser.115
8.2.1 Anforderungen an das sekundäre Füllwasser..........................................115
8.3 Anforderungen an das Becken-wasser, Filtrat und Reinwasser.......115
8.4 Anforderungen an die Qualität der Badegewässer (Naturbäder).....118
9 Überwachung der Wasser-qualität........................................121
9.1 Gesetzliche Grundlagen..................121
9.1.1 Überwachungspflichten der Auf-sichtsbehörde.....................................121
9.2 Kontrollen der Wasserbeschaf-fenheit / Maßnahmen nach DIN 19643...........................................123
9.3 Mess- und Bestimmungsme-thoden zur Überwachung der Wasserqualität..................................127
9.3.1 Kolorimetrische Bestimmungen.........127
9.3.1.1 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor (nach DIN 38408 Teil 4).....................................................127
9.3.1.2 pH-Wertbestimmung.......................127
9.3.2 Kolorimetrische Messgeräte...............127
9.3.2.1 Optische Messverfahren.................128
9.3.2.2 Fotometrisches Messverfahren......130
9.3.2.3 Elektrometrische Messung.............130
9.3.2.3.1 Chlormessungen..........................130
9.3.2.4 pH-Wert-Messungen.......................134
9.3.2.5 Messung der Redox-Spannung......135
9.4 Automatische Dosierungen und Regelungen.......................................137
9.4.1 Grundlagen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik......................................137
9.4.1.1 Messtechnik....................................137
9.4.1.2 Steuertechnik..................................138
9.4.1.3 Regeltechnik...................................139
9.4.2 Dosier- und Regelsysteme für die Beckenwasseraufbereitung................141
9.4.2.1 Automatisierungssysteme...............141
9.4.2.2 Automatische Chlorregelung..........142
10 Anlagen der Schwimm- und Badebeckenwasseraufberei-tung.............................................146
10.1 Allgemeine Anforderungen.............146
10.1.1 Anforderungen an Technik- und Ne-benräume (u.a. nach DIN 19643).............146
10.1.2 Anforderungen an die Aufbereitungs-anlage................................................147
10.2 Betrieb von Becken- und Auf-bereitungsanlagen...........................147
10.2.1 Verfahrenskombinationen .................147
10.2.1.1 Aufbereitungsleistung.....................148
10.2.2 Betriebliche Überwachungen.............150
10.2.2.1 Führung eines Betriebsbuches.......150
10.2.2.2 Wartung und Instandhaltung ..........150
10.2.3 Betrieb der Schwimm- und Badebe-ckenanlagen.......................................151
10.2.3.1 Betrieb der Beckenanlagen............151
10.2.3.1.1 Reinigung.....................................151
10.2.3.1.2 Betrieb von Warmsprudelbecken.151
10.2.3.1.3 Sonstige Becken und Anlagen......152
10.2.4 Betrieb der Wasseraufbereitungsan-lagen..................................................153
10.2.4.1 Allgemeine Hinweise......................153
10.2.4.2 Grundlagen der Verfahrenskombi-nationen nach DIN 19643-2............153
10.2.4.3 Betrieb der Verfahrenskombinati-on: Flockung - Filtration- Adsorpti-on an Aktivkornkohle- Chlorung .....154
10.3 Hydraulische Systeme.....................155
10.3.1 Leitungsanlagen für die Wasserauf-bereitung............................................155
10.3.1.1 Werkstoffe.......................................155
10.3.1.2 Leitungen für den Volumenstrom....156
Inhalt
9
10.3.1.2.1 Volumenströme.............................156
10.3.2 Pumpen..............................................158
10.3.2.1 Pumpenarten..................................158
10.3.2.1.1 Kolbenpumpen.............................158
10.3.2.1.2 Kreiselpumpen..............................159
10.3.2.1.3 Wasserstrahlpumpe......................160
10.3.2.2 Pumpeneinsatz im Bäderbereich....161
10.3.2.2.1 Förderung von Beckenwasser......161
10.3.2.2.2 Förderung von Chemikalien.........167
10.3.2.2.3 Erhöhen des Wasserdrucks.........170
10.3.2.2.4 Fördern von Heizungswasser.......171
10.3.2.2.5 Fördern von Abwasser (Schlammwasser).........................171
10.3.3 Beckendurchströmungen...................172
10.3.4 Beckenüberlauf und Oberflächen- Reinigung...........................................175
10.3.4.1 Skimmer..........................................175
10.3.4.2 Überlaufrinnen................................175
10.3.5 Wasserspeicher..................................177
10.3.6 Vorfilter...............................................180
10.4 Einstellung der Säurekapazität.......180
10.5 Adsorption an Pulver-Aktivkohle...183
10.5.1 Wirkungsweise ..................................183
10.5.2 Pulverkohledosierung.........................183
10.5.3 Anforderungen an die Pulver-Aktiv-kohle (nach DIN 19603)......................183
10.6 Flockung...........................................185
10.6.1 Bedeutung der Flockung....................185
10.7 Filtrationen .......................................188
10.7.1 Filterbare Stoffe:.................................188
10.7.2 Filtrationsvorgänge und Filtermateri-alien....................................................188
10.7.3 Filterarten ..........................................190
10.7.3.1 Festbettfilter....................................190
10.7.3.1.1 Offene Einschichtfilter...................190
10.7.3.1.2 Geschlossene, Einschichtfilter......190
10.7.3.1.3 Eliminierung von Desinfekti-onsnebenprodukten Adsorption durch Mehrschichtfiltration............193
10.7.3.1.4 Wartung der Ein- und Mehr-schichtfilter....................................194
10.7.3.1.5 Adsorption an Korn-Aktivkohle.....198
10.7.3.1.6 Probleme bei der Filtration...........200
10.7.3.1.7 Aufbereitung von aktivkohlehalti-gem Schlammwasser...................204
10.7.3.1.8 Spülluftgebläse.............................205
10.7.3.2 Anschwemmfilter............................207
10.7.3.2.1 Geschlossene Anschwemmfilter...207
10.7.3.2.2 Offene Anschwemmfilter...............210
10.7.3.3 Quarzsand-Niederdruckfilter (In DIN 19643 nicht behandelt)....................212
10.7.3.4 Unterdruckfilter...............................213
10.8 pH-Wert-Einstellung.........................215
10.8.1 Allgemeines: ......................................215
10.8.2 Mittel zur pH-Korrektur (DIN 19643)......215
10.8.3 pH-Regelung mit Kohlenstoffdioxid nach DIN EN 15513............................216
10.8.3.1 Grundlagen1)..................................216
10.8.3.2 CO2-Dosiertechnik..........................216
10.8.4 pH-Einstellung durch Säureabbau.....216
10.9 Desinfektionsanlagen für Schwimm- und Badebecken-wasser...............................................218
10.9.1 Allgemeines........................................218
10.9.2 Desinfektionsmittel.............................219
10.9.3 Chlorungsverfahren............................219
10.9.3.1 Leistungsvolumen der Chlor- Do-sieranlagen.....................................219
10.9.3.2 Chlorgasverfahren..........................219
10.9.3.2.1 Desinfektionsanlagen mit Chlor-gas nach DIN EN 15363 ...............219
10.9.3.2.2 Umgang mit Chlorgasanlagen......226
10.9.3.2.3 Chlorgaswarngerät.......................228
10.9.3.2.4 Räume für die Chlorgaslagerung..229
10.9.3.2.5 Verhalten bei unkontrolliertem Chlorgasaustritt............................230
10.9.3.3 Desinfektionsanlagen mit Chlor-gas elektrolytisch hergestellt am Verwendungsort..............................231
10.9.3.4 Chlor-Elektrolyseanlagen im Inline-Betrieb (Durchfluss-Chlor-Elektrolyse).....................................233
10.9.3.5 Desinfektion mit Natriumhypochlorit - Lösung (n. DIN EN 1577).................234
10.9.3.6 Desinfektionsanlagen mit Natrium-hypochlorit-Lösung, hergestellt am Verwendungsort (Chlorelektrolyse).234
10.9.3.7 Desinfektion mit Calciumhypochlo-rit.....................................................237
10.9.3.7.1 Dosieranlagen für Calciumhypo-chlorit............................................237
10.9.3.7.2 Calciumhypochlorit-Verfahren mit Entsedimentierung........................238
10.9.4 Sonstige Desinfektionsverfahren (In DIN 19643 nicht behandelt)................241
Inhalt
10
10.9.4.1 Chlor-Chlordioxid-Anlage................241
10.9.4.2 Dosierung von organischem Chlor (Trichlorisocianursäure)..................242
10.9.4.3 Ozon-Bromid-Verfahren..................243
10.9.4.4 UV-Bestrahlungensgeräte und UV-Anlagen für Schwimm- und Badebecken....................................244
10.9.5 Ozonanlagen......................................246
10.9.5.1 Eigenschaften des Ozons...............246
10.9.5.2 Einsatz des Ozons im Schwimm-badbereich......................................246
10.9.5.3 Ozonverfahren................................246
10.9.5.3.1 Flockungsfiltration bei der Ver-fahrenskombination „Flockung-Filtration-Ozonung-Sorptionsfilt-ration-Chlorung“ gilt:.....................247
10.9.5.3.2 Sorptionsfiltration bei der Ver-fahrenskombination „Flockung-Filtration-Ozonung-Sorptionsfilt-ration-Chlorung“............................249
10.9.5.3.3 Mehrschichtfiltration bei der Ver-fahrenskombination Flockung-Ozonung-Mehrschichtfiltration mit Sorptionswirkung-Chlorung“...251
10.9.5.3.4 Prüfung der Flockungsfiltration und der Sorptionsfiltration.............253
10.9.5.3.5 Chlorung.......................................253
10.9.5.3.6 Ozonerzeugung............................254
10.9.5.3.7 Anforderung an Ozonanlagen......254
10.9.5.3.8 Unfallverhütungsregeln zur Ver-wendung von Ozon.......................255
10.9.6 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser mit der Verfah-renskombination „Ultrafiltration!.........257
10.9.6.1 Beschreibung des Verfahrens.........257
10.9.6.2 Verfahrensstufen.............................257
10.9.6.3 Eliminierung von Desinfektionsne-benprodukten..................................258
10.9.6.4 Anlagenaufbau und Betrieb............258
10.9.6.5 Betrieb von UF-Anlagen.................260
11 Bauliche Durchbildungen der Hallen- und Freibäder...............263
11.1 Technische Grundlagen..................263
11.1.1 Baustoffe und Werkstoffe im Bäder-bereich ..............................................263
11.1.1.1 Einteilung der Werkstoffe................263
11.1.1.2 Wichtige Metalle.............................263
11.1.2 Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmit-tel für Wartung und Reparatur............268
11.1.2.1 Werkzeuge......................................268
11.1.2.2 Maschinen zur Wartung der Anla-gen..................................................270
11.1.2.2.1 Handmaschinen und Geräte.........270
11.1.2.2.2 Stationäre Maschinen...................271
11.1.2.2.3 Schweißmaschinen......................272
11.1.3 Verbindungen (Fügen).......................273
11.1.3.1 Lösbare Verbindungen....................273
11.1.3.2 Unlösbare Verbindungen................275
11.2 Konstruktion und Ausbildung wichtiger Bauteile............................277
11.2.1 Allgemeine sicherheitstechnische.....Anforderungen an die Anlagen..........277
11.2.2 Konstruktion wichtiger Bauteile..........277
11.2.2.1 Tragende Konstruktionsteile...........277
11.2.2.2 Wände und Decken........................278
11.2.2.3 Belichtungsflächen..........................278
11.2.2.4 Dachflächen....................................278
11.2.2.5 Bodenbeläge...................................278
11.2.2.6 Dehnfugen......................................279
11.2.2.7 Absperrung gegen Feuchtigkeit1)...........279
11.2.2.8 Potentialausgleich...........................280
11.2.3 Beckenanlagen..................................280
11.2.3.1 Stahlbeton-, Spannbetonbecken....280
11.2.3.2 Becken aus Edelstahl ....................280
11.2.3.3 Aluminiumbecken...........................283
11.2.3.4 Becken aus Kunststoffen................283
11.2.3.5 Beckenauskleidungen.....................285
12 Installationsanlagen..................286
12.1 Schließ- und Kassenanlagen..........286
12.1.1 Schlosskonstruktionen.......................286
12.1.1.1 Einfache Schlösser.........................286
12.1.1.2 Chubbschlösser..............................286
12.1.1.3 Zylinderschlösser............................286
12.1.2 Beschaffenheit von Schlössern und Türen nach (GUV 18.14) ...................287
12.1.3 Spezialschlösser im Bäderbetrieb......287
12.1.3.1 Einfaches Bäderschrankschloss.....287
12.1.3.2 Pfand- oder Kassierschloss............288
12.1.3.3 Kartenschloss (Billett-Depot-Schloss)..........................................288
12.1.3.4 Elektronische Schlösser.................288
12.1.4 Schlüssel- und Schlossanlagen.........289
12.1.5 Wartung der Schlösser.......................290
12.1.6 Kassenanlagen..................................290
Inhalt
11
12.2 Elektroinstallationsanlagen............293
12.2.1 Grundlagen der Elektrotechnik...........293
12.2.1.1 Der Strom im Leiter.........................293
12.2.1.2 Wirkungen des Stromes.................293
12.2.1.3 Der elektrische Strom fließt............294
12.2.1.4 Formen der Spannungserzeugung.295
12.2.1.5 Größen der Elektrotechnik..............296
12.2.1.6 Stromarten .....................................297
12.2.1.7 Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung............297
12.2.2 Stromversorgung der Bäderbetriebe..299
12.2.2.1 Leistungsbedarf..............................299
12.2.2.2 Niederspannungsversorgung..........300
12.2.2.3 Mittelspannungsversorgung............300
12.2.2.4 Stromkreise im Bad........................301
12.2.3 Aufbau und Wartung elektrischer Anlagen..............................................301
12.2.3.1 Wartung der Schalt- und Verteiler-stationen.........................................301
12.2.3.2 Notstrom- und Ersatzstromanlagen302
12.2.3.3 Motoren...........................................303
12.2.3.4 Beleuchtungsanlagen.....................304
12.2.3.5 Anlagen mit Schwachstrom............307
12.3 Sanitärinstallationen........................308
12.3.1 Leitungsanlagen für Trink- und Be-triebswasser.......................................308
12.3.1.1 Stahlrohre.......................................308
12.3.1.2 Kupferrohre.....................................309
12.3.1.3 Gussrohre.......................................309
12.3.1.4 Faserzementrohre..........................309
12.3.1.5 Kunststoffrohre...............................309
12.3.1.6 Rohrverbindungen..........................310
12.3.1.6.1 Lösbare Verbindungen.................310
12.3.1.6.2 Unlösbare Verbindung..................310
12.3.1.7 Ausgleichsrohre..............................311
12.3.1.8 Armaturen.......................................311
12.3.2 Entwässerungsanlagen......................313
12.3.2.1 Leitungsanlagen.............................313
12.3.2.2 Einbauteile......................................314
12.3.3 Entwässerung tiefliegender Räume Schutz gegen Rückstau.....................315
12.3.4 Korrosionsprobleme bei Installati-onsanlagen.........................................316
12.3.4.1 Chemische Korrosion.....................316
12.3.4.2 Elektrochemische Korrosion...........316
12.3.4.3 Spezielle Formen der Korrosion.......317
12.3.4.3.1 Interkristalline Korrosion..............317
12.3.4.3.2 Korrosion in Kaltwasserleitungen.317
12.3.4.3.3 Korrosion in Warmwasserbehäl-.tern und Warmwasserleitungen....319
12.3.4.4 Steinbildung....................................320
12.3.4.5 Korrosion in Dampfheizungsanla-gen..................................................321
12.3.4.6 Korrosion von Heizölbehältern........321
12.3.4.7 Korrosion durch Abgase.................321
12.3.4.8 Korrosion durch Schwimmbecken-wasseraufbereitung........................322
12.4 Heizungs- und Lüftungsanlagen....323
12.4.1 Grundlagen der Wärmelehre..............323
12.4.1.1 Entstehung der Wärme...................323
12.4.1.2 Temperatur......................................323
12.4.1.3 Wärmefortpflanzung.......................323
12.4.1.4 Wärmemenge.................................324
12.4.2 Heizungssysteme...............................324
12.4.2.1 Zentralheizungen............................324
12.4.2.2 Kesselarten.....................................324
12.4.2.3 Heizungssysteme, die nach der Wärmeabgabe unterschieden wer-den..................................................325
12.4.2.4 Rohrführungssysteme.....................325
12.4.2.4.1 Rohrleitungen...............................325
12.4.2.5 Verteilungen....................................326
12.4.3 Warm- und Heißwasserheizungen.....326
12.4.3.1 Grundlagen.....................................326
12.4.3.2 Offene Anlagen...............................327
12.4.3.3 Geschlossene Warm- und Heiß-wasser-Anlagen .............................327
12.4.4 Heizungsanlagen für den Badebe-trieb....................................................331
12.4.4.1 Warmwasserbereitungsanlagen.....332
12.4.4.1.1 Einzelbereitung für kleinere Was-sermengen....................................332
12.4.4.1.2 Zentrale Warmwasserbereitung...333
12.4.4.1.3 Warmwasserbereiter für das Schwimm- und Badewasser.........333
12.4.4.1.4 Beckenwassererwärmung im Sprühverfahren.............................335
12.4.4.2 Solarheizungen ..............................336
12.4.5 Dampfheizungen ...............................338
12.4.5.1 Grundlagen.....................................338
12.4.5.2 Arten der Dampfheizungen.............338
12.4.5.3 Niederdruckdampfheizung..............338
12.4.6 Fernwärmeversorgung.......................339
12.4.6.1 Heizkraftwerk..................................339
12.4.6.2 Blockheizkraftwerke (BHKW)..........339
12.4.6.3 Fernwärmeanschluss des Bades....340
Inhalt
12
12.4.6.4 Technische Bestimmungen für die Fernwärmeübergabe......................340
12.4.7 Luftheizungen und Klimaanlagen.......341
12.4.7.1 Luft als Wärmeträger......................341
12.4.7.2 Luftheizungen.................................343
12.4.7.3 Lufterneuerungsanlagen.................343
12.4.7.3.1 Behaglichkeit in der Schwimm-halle..............................................343
12.4.7.3.2 Richtwerte für Schwimmhallen.....344
12.4.7.3.3 Regulierung der Raumluft.............344
12.4.7.4 Lüftungs- und Klimaanlagen...........346
12.4.7.4.1 Lüftungsarten................................346
12.4.7.4.2 Klimaanlagen................................346
12.4.7.5 Regelungsgrundsätze nach KOK...347
12.4.7.6 Umweltbewusster Umgang mit der Energie...........................................349
12.4.7.6.1 Schwimmbeckenabdeckungen.....349
12.4.7.6.2 Wärmerückgewinnungseinrich-tungen...........................................350
12.4.7.6.3 Wärmerückgewinnung aus der Abluft............................................352
12.4.7.6.4 Wärmerückgewinnung aus Ab-wasser..........................................354
Literaturverzeichnis............................358
Technische Beschreibungen und Informationen der Firmen und Personen:...........................359
Index 360
13
Bädergestaltung Planen und Einrichten der Bäder
Bädergestaltung
Planen und Einrichten der Bäder
Das Badewesen, und besonders der öffentli-che Bäderbereich, hatten ihren Ursprung in der Erhaltung der Volksgesundheit. Heute werden die Bäder immer mehr zu Einrichtungen für den Erhalt der Fitness und der aktiven Freizeitgestal-tung.
Die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundene Umweltbelastung machen wieder Anlagen erforderlich, die der Gesundheit der Menschen förderlich sind. Da das Wasser als eine Quelle der Gesundheit anzusehen ist, bleibt es die Aufgabe der Bäder, die zum Teil verloren-gegangene Heilkraft natürlicher Bäder zu erset-zen und die Möglichkeit sportlicher Betätigung und Erholung zu bieten. Schon seit den siebzi-
ger Jahren wurde ein Trend vom Badegewässer über die Frei- und Hallenbäder alter Prägung zu freizeitorientierten Bädern feststellbar.
Dies erkannten nicht nur die Städte und Gemein-den, sondern auch Privatgesellschaften, so dass vermehrt der Bau eines Bädertyps zu beobach-ten ist, der aus der Kombination konventioneller Bäder mit überwiegenden freizeitorientierten Anlagen und deren vielfältigem Nutzungsange-bot besteht.
Verbände und Fachleute auf dem Gebiet des Bäderbaus und des Bäderbetriebs verfassten entsprechende Richtlinien, die zum Teil Geset-zeskraft erhielten und beim Neubau und Ausbau von Bäderanlagen Berücksichtigung finden.
Wichtige Normen, Richtlinien und Regeln für die Planung und Gestaltung von Bädern
Raumordnungs- und Planungsgesetze
Baugesetzbuch und Bauordnungen der Länder und Kommunen
Normen und Richtlinien für Schwimmbadanlagen 3.1 Richtlinien für den Bäderbau (KOK-Richtlinien); Herausgeber: Koordinierungskreis Bäder, 1996 3.2 Sicherheitstechnische Anfor-derungen an Planung und Bau (EN 15288 Teil1) 3.3 Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb (EN 15288 Teil2) 3.4 Sicherheitstechnische Anforderungen an Schwimmbadgerä-te: Schwimmsportgeräte, Wasserrutschen, Schwimmbadgeräte (Teile 1-11)
DIN 19643 - Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser, Teile 1, 2, 3 und 4; Chlor-gasdosieranlagen (DIN 19606); Ozonerzeugungsanlagen (DIN 19627)
Gesetzliche Grundlage zur Sicherung und Überwachung der Qualität des Schwimm- und Ba-debeckenwassers: „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-Gesetz - IfSG)”.
Europäische Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Paralaments und des Rates der Europä-ischen Union über die Qualität und Bewirtschaftung der Badegewässer.
FINA-Regeln (Internationale Schwimmsportrichtlinien der „Federation International de Natati-on de Amateur“) und DSV-Wettkampfbestimmungen (Deutscher Schwimmverband)
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Unfallverhütungsrichtlinien (UVR) der „Bundesar-beitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der Öffentlichen Hand“ (BAGUV)
Sicherheitsregeln für Bäder: GUV-R 1/111 (bisher GUV 18.14)
VDI-Richtlinie: VDI 2089 Blatt 1 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Hal-lenbäder
DIN-Bestimmungen, Normblätter und Richtlinien des „DIN Deutschen Institut für Normung e.V.“; Normenausschuss Sport- und Freizeitgeräte
Merk- und Informationsblätter von den „Technischen Ausschüssen“ der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.“ und dem „Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.“
14
Planen und Einrichten der Bäder Bädergestaltung
Sachverständige aus Wissenschaft, Industrie, Planung,
Aufsichtsbehörden, Hygieneinstitute und Bäderbetrieben
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.
Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.
Deutscher Sportbund (DSB)
Deutscher Schwimmverband (DSV)
Koordinierungskreis
Bäder
Richtlinien für den
Bäderbau
(KOK-Richtlinie)
DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
Richtlinie 2006/7EG über die Quali-tät der Badegewässer
Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union
Parlamente und Ministerien der Bun-desländer
⇓
⇓
⇓
⇓
Entstehungsschema von Richtlinien, Normen und Verordnungen für die Bädertechnik
Bäderarten
Unterscheidung nach der DIN EN 15288
Schwimmbad Typ1: Schwimmbad, bei dem die mit Wasser verbundenen Aktivitäten das Hauptan-gebot sind (z.B. kommunale Bäder, Freizeitbäder mit öffentlicher Nutzung)
Schwimmbad Typ2:Schwimmbad, das ein Zusatzangebot ist (z.B. Hotel-,Club- u. therapeutische Bäder)zum Hauptangebot ist.
Schwimmbad Typ3: Alle Schwimmbäder ausgenommen: Typ 1, Typ2 und privater Nutzung
Nach den „Richtlinien für den Bäderbau“ werden die Bäderarten wie folgt unterschieden:
Unterscheidung nach den Betreibern:
Benennung
Betreiber sind u.a.
Öffentliche Bäder
Kommunen, kommunale Gesellschaften
Vereinsbäder
Vereine
Kommerziell betriebene Bäder
Privatpersonen sowie private und kommunale Gesellschaften
Hotel- und Gemeinschaftsbäder
Hotel- und Bäderbetriebe, Wohngemeinschaften
Privatbäder
Privatpersonen (nur für Familienangehörige und Gäste)
Unterscheidung nach Anlage und Einrichtungen:
Schwimmbäder
Anlagen mit ein oder mehreren Wasserflächen für „Wasseraktivitäten“
Hallenbäder
Bäder mit künstlichen Wasserflächen innerhalb eines Gebäudes
Freibäder
Bäder mit künstlichen Wasserflächen zum Baden und Schwimmen im Freien
Hallenfreibäder
Kombinationen von Hallen- und Freibädern
Badegewässer (Naturbäder)
Bäder mit natürlichen Wasserflächen, die in der Richtlinien 2006/7/EG des europäischen Parlaments und -Rates behandelt werden. Zu ihnen gehören Meer-, See-, Flussbäder und Bäder an angestauten Flüssen oder Sand- und Kiesentnahmestellen.
15
Bädergestaltung Planen und Einrichten der Bäder
Unterscheidung der Bäder nach dem vorrangigen Nutzungsangebot und nach Benutzern:
Bäderart
Einrichtung
Benutzer
Kur- Heil- und medi-zinische Bäder (the-rapeutische Bäder)
mit speziellen Becken und Wasserarten1)sowie thera-peutischen Einrichtungen
Kranke, Patienten zur Therapie, Rehabilitation, Regeneration
Sportorientierte
Bäder
mit Beckenabmessungen, die an Sportregeln orientiert sind
für Schul- und Schwimm-sport sowie Öffentlichkeit
Leistungssportbäder
mit wettkampfgerechten Beckenab-messungen und Sprunganlagen
für den Leistungsschwimmsport (Leistungszentren, -stützpunkte)
Schulbäder
mit Sport- und Lehrschwimmbecken
für den Schulschwimmsport
Freizeitbäder
mit Becken für den Schul- und Schwimmsport sowie frei-zeitorientierten Anlagen
für die Öffentlichkeit, Schu-le und Schwimmsport
Spaßbäder (Erlebnisbäder)
mit Bademöglichkeiten und sonstigen Einrichtungen, die den Freizeitbedürfnissen und der Entspannung angepasst sind.
für die Öffentlichkeit; ihre Einrich-tungen lassen eine schwimmsportli-che Nutzung durch Gruppen, Schu-len oder Vereine nicht zu.
1)Hierzu gehören Meerwasser-, Mineralwasser-, Heilwasser- und Thermalbäder.
Die Errichtung von Bädern und deren Nutzungs-einrichtungen richtet sich in erster Linie nach der Zweckbestimmung und der Zahl der Einwohner eines Siedlungsgebietes. Auch der Fremden-verkehr oder der Naherholungsverkehr können eine gute Voraussetzung für die Errichtung eines Bades bieten. Bei dichterer Besiedlung, z.B. bei mehr als 50.000 Einwohnern, sollte mehr als ein öffentliches Bad vorhanden sein. Als maxi-male Entfernung vom Bad zur Einzugsgrenze sind bei dichter Besiedlung etwa 5 km und bei dünner Besiedlung etwa 10 km als vertretbar anzusehen. Darüber hinaus ist die Versorgung der Schulen und Vereine in einem vertretbaren, wirtschaftlichen Rahmen durch die Öffentliche Hand sicherzustellen.
Standortwahl eines Bades
Sie sollte unter Berücksichtigung folgender Kri-terien vorgenommen werden:
Ergebnis einer Bedarfserhebung
Besiedlungsdichte des Gebietes
Zentrale Lage
Verkehrsgünstige Lage
Integrationsmöglichkeit in andere Sport- und Freizeitanlagen ermöglichen
Erholungsraum, Feriengebiet, Kurort
Geländeeignung u. Baugrundbeschaffenheit
Gesetzliche Verordnungen, (z.B. Naturschutz, Fischereirechte...)
Ver- und Entsorgungsmöglichkeit (Wasser, Ab-wasser, Elektrizität, Wärme)
Bäderbestand des Einzugsbereichs
Zusätzliche Spiel- und Liegeflächen bei Hallen-bädern im dichten Siedlungsgebiet
Ansprechende Umgebung und windgeschützte Lage mit guter Sonneneinstrahlung bei Freibä-dern
Ungeeignet sind Standorte
mit Lärmbelästigung, Luftverschmutzung, In-sektenplage
in Sumpfgebieten, Überschwemmungsgebie-ten, in der Nähe von Friedhöfen, reinen Wohn-gebieten, Krankenhäuser oder unter Hoch-spannungsleitungen
Bedarfsplanung
16
Planen und Einrichten der Bäder Bädergestaltung
Größen und Beckenarten
Je nach Größe des Einzugsgebietes und der Nutzung kann nach dem „Leitfaden für Sport-stättenentwicklungsplanung“ eine entspre-chende Wasserfläche und Grundstücksfläche ermittelt werden. Als Orientierungswerte können
folgende Aufteilungen nach den Richtlinien für den Bäderbau dienen.
Planungsbeispiele für Hallenbäder
(Verhältnis der Wasserflächen für Schwimmer zu Nichtschwimmer ca. 2 : 1)
Gesamt-Wasserflä-che in m2
Grundstücksflä-che ohne Stell-flächen in m2
Beckenarten
Beispiel 1 für Beckengröße in m oder m2
Beispiel 2 für
Beckengröße in m oder m2
Sprunganlagen
bis 450
3.000
... 3.500
Variobecken Nichtschwimmer-Planschbecken
10,00 x 25,00
8,00 x 12,50 ca. 20
12,50x 25,00
10,00x12,50
ca. 20
1m-Brett +
3m-Plattform
bis 800
ca. 5.000
Variobecken Nichtschwimmer- Springerbecken Planschbecken
16,66 x 25,00
8,00 x 16,66
11,75 x 12,45
ca. 35
16,66x25,00
8,00 x 6,66
16,90 x 2,50
ca. 35
Beim Variobecken und Springerbecken: 2 x 1m+2 x 3m-Brett, 1m+3m+5m-Plattform
Planungsbeispiele für Freibäder
(Verhältnis der Wasserflächen für Schwimmer zu Nichtschwimmer ca. 2 : 3 bis 1 : 1)
Gesamt-Wasserflä-che in m2
Grundstücksflä-che ohne Stell-flächen in m2
Beckenarten
Beispiel für
Beckengröße in m oder m2
Wasser
flächen
in m2
Sprunganlagen
bis 1.500
15.000...
24.000
Schwimmer- Springerbecken Nichtschwimmer Planschbecken
16,66 x 25,00
12.50 x 11.75
750
ca. 100
417
147
750
100
1m-Brett + 3m-Brett
+ 1m-Plattfform
+ 3m-Plattform
+ 5m-Plattform
bis 3.000
30.000... 48.000
Schwimmer-Sprin-gerbecken Nicht-schwimmer-Planschbecken
25,00 x 50,00 18,35 x 15,00 1.500
ca. 200
1.250
275
1.500
200
1m-Brett + 3m-Brett + 1m- + 3m-+ 5m- + 7,50m- +10m- Plattform
Planungsbeispiele für Freizeit-Hallenbäder
(Verhältnis der Wasserflächen für Schwimmer zu Nichtschwimmer ca. 1:1 bis 2 : 3)
Gesamt-Wasserflä-che in m2
Grundstücksflä-che ohne Stell-flächen in m2
Beckenarten
Beispiel für
Beckengröße in m oder m2
Wasser-
flächen
in m2
Sprunganlagen
bis 600
5.500...
7.000
Variobecken Nichtschwimmer-Planschbecken
12,50 x 25,00
210
ca. 30
313
210
30
keine
bis 1.100
10.000... 12.500
Schwimmer-Springerbecken Nichtschwimmer-Planschbecken
12,50 x 25,00 10,60 x 12,50 ca. 600
ca. 45
313
133
ca. 600
45
1m-Brett + 1m-Plattf. kombiniert + 3m-Brett + 3m-Plattform komb.- + 5m- Plattf.
17
Bädergestaltung Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern
Bereiche und Einrichtungen:
Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern
Einrichtungen der Hallenbäder
Flächen
Die Größe der Schwimmhalle, die Abmessun-gen der Becken- und Sprunganlage sind von der zu erwartenden Zahl der Badegäste und der Nutzungsart abhängig. Auch weitere Einrich-tungen und Räumlichkeiten richten sich in ihrer Anzahl und Größe nach der zur Verfügung ste-henden Wasserfläche. Die Wasserfläche ist also ein Maß für die Zahl der Besucher, die das Bad aufnehmen kann
Für jeden m² Wasserfläche sollten 6 bis 8 m²
Grundstücksfläche zugeordnet sein. Zusätzlich werden Freiluftflächen, wie Sonnenterrassen, Liege- und Spielflächen von 10% bis 20% der Grundstücksfläche empfohlen.
Stellflächen:
1 Pkw-Stellplatz je 5 bis 10 Garderobenplätze.
1 Fahrradstellplatz je 5 Garderobenplätze.
1 Pkw-Stellplatz zusätzlich je 10 bis 15 Plätze bei Zuschaueranlagen.
Zusätzliche Stellplätze für Pkw bei Wirt-schafts- und Dienstleistungsbetrieben
Bereiche und Räumlichkeiten der Hallenbäder
Raumprogramm eines Freizeitbades als Hallenfreibad (Regensburg)
1 Eingangsbereich
2 Aufsichtsraum
3 Variobecken (Lehr-schwimmbecken)
4 Medizinische Abtei-lung, Therapie
5 Variobecken (50m mit Teilhubboden)
6 Wellenbecken
7 Nichtschwim-merbecken
8 Kinderbecken
9 Restaurant
10 Warmbecken
11 Springerbecken
12 Sauna, Solarien
13 Umkleidebereich
14 Sanitärbereich
18
Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern Bädergestaltung
1. Welche Richtlinien, Normen und Regeln sind für die Planung und Gestaltung eines Bades besonders wichtig?
2. Welche Personengruppen und Vereine waren an der Entstehung den Richtlinien für den Bäderbau beteiligt?
3. Nach welchen drei Kriterien können Bäder unterschieden werden?
In einem Hallenbad, das neben den schwimm-sportlichen Aufgaben einen hohen Freizeitwert zu erfüllen hat, können folgende Räumlichkeiten und Anlagen angetroffen werden:
1.Eingangsbereich:
Eingangsvorplatz, Wege, Stellplätze, Windfang, Eingangshalle, Kassen- und Kontrollanlagen, Personalräume, Verwaltungsraum, Toilette.
2. Umkleidebereich:
Umkleideplätze: Umkleidekabinen, Sammelum-kleiden, Wechselkabinen, Familien- und Behin-dertenkabinen, Garderobenschränke (Gardero-benplätze), Putzmittelraum.
Sanitärobjekte: Frisierplätze, Fußdesinfektions-stellen, Auswringbecken,
3. Sanitärbereich:
Duschen, Sitztoiletten, Urinalstände, Hand-waschbecken, Sanitärkabine für Behinderte.
4. Führen Sie fünf Bäderarten auf, die nach ihrem Nutzungsangebot unterschieden werden!
5. Nach welchen Kriterien ist der Standort eines Bades zu wählen? Zählen sie sechs auf!
6. Welche Standorte sind für die Errichtung eines Bades ungeeignet?
7. Nennen Sie zwei Gesichtspunkte, nach denen die Größe eines Bades festgelegt werden kann!
Übungen Planen und Einrichten der Bäder
Umkleidekabine für Familien und Behinderte
Ausführung einer Sanitär-Mindestausstattung (geteilter Duschraum nach den Richtlinien für den Bä-derbau)
Ausstattung eines Umkleidebereiches
19
Bädergestaltung Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern
4. Beckenbereich:
Beckenumgänge (Breiten: 1,25 m bis 4,50 m, siehe auch Beckenumgänge Seite 47), Schwimm- und Badebecken, Sprunganlagen, Schwimm-Meisterraum (Aufsichtsraum, der die Übersicht ermöglicht), Sanitätsraum (1.Hilfe -Raum mit 1. Hilfe-Material in ausreichender Menge und Trage, leicht erreichbar), Wärme-bänke, Sanitärobjekte (Kaltduschen, Anschluss-stellen für Flächendesinfektion und Reinigung, Trinkbrunnen), Geräteraum für Sport- und Absperrgeräte, Geräteraum für Reinigungsge-räte.
5. Technischer Bereich:
Heizungsanlage oder Fernwärmeübergabesta-tion, Warmwasserbereitung, raumlufttechnische Anlagen (Lüftungsgeräte, Luftkanäle), Wasser-aufbereitung, (Filter, Dosierstationen, Ozonan-lage, Chlorungsanlage), Elektroübergabe, Elek-troverteilung (Nieder- oder Mittelspannungs-versorgung), Trafostation, Ersatzstromanlage, Blockheizkraftwerk, Werkplatz, Lager.
Sonstige Räumlichkeiten wie:
Brennstofflagerung,
Wasserspeicher
Lagerräume (z.B. Ersatzteilraum, Reinigungsmittel-Lagerraum)
Abwasserhebeanlage
Die lichte Mindesthöhe über den Verkehrswegen soll 2,0m betragen, die Bedienteile und Mess-einrichtungen sind im Hand- und Sichtbereich anzuordnen.
Die Anzahl und Größe der aufgeführten Anlagen werden in den meisten Fällen von der zu erwar-tenden Besucherzahl und den Wasserflächen bestimmt. In den Richtlinien Abschnitt: „Objekt-planung Hallenbäder“ sind die Bemessungs-grundlagen für alle Anlagen und Einrichtungen aufgeführt.
6. Ergänzungsbereich:
Anlagen für Spiel, Sport und Freizeit:Wasser-spiel- und Abenteuerbecken, Wasserrutschen, Wildwasserkanäle, Freiluftflächen, Spiel- und Gymnastikraum, Tischtennisraum, Fitnessraum, Konditionsraum, Kinderspielbereich, Mutter-Kind-Bereich, Ruhe- und Lesebereich, (innen und außen), Geselligkeits- und Restaurations-
bereich (Kegelbahn, Cafeteria, Milchbar, Fern-sehraum, Ruheraum, Liegeplätze, Leseraum, Kommunikationsraum, Terrasse, Groß-Brett-spiele, Mehrzweckraum)
Anlagen zur Gesundheitspflege:Sauna, Solari-um; Dampfbad, Wannenbäder
Anlagen für den Wettkampfsport:Regieraum, Kampfrichter-, Wettkämpfer-, Unterrichts- und Vereinsraum; Zeitmess- und Anzeigeanlagen, Zuschaueranlagen, Arbeitsplätze für Presse, Funk und Fernsehen;
Anlagen zur Bewirtung: Gast-, Wirtschafts- und Lagerräume;
Sonstige Räumlichkeiten:Weitere Dienstleis-tungsbetriebe, Betriebswohnungen, Lager- und Abstellräume, Garagen.
Der Ergänzungsbereich ist in neuen Bädern immer vorhanden. Die Einrichtungen dieser Bäderart werden im Abschnitt „Freizeitorientierte Bäder“ ausführlich besprochen.
Übung
Einrichtungen der Hallenbäder
8. Welche Grundstücks-, Freiluft- und Stellflä-chen werden für Hallenbäder empfohlen?
9. In welche Bereiche werden die Räumlichkei-ten eines Hallenbades eingeteilt?
10. Welche Einrichtungen gehören zum Becken-bereich eines Hallenbades?
11. Welche Einrichtungen gehören zum Umklei-debereich eines Hallenbades?
12. Welche Installationsanlagen sind im techni-schen Bereich untergebracht?
13. Geben Sie die Beckenarten eines Hallenba-des mit je einer Beckengröße an!
20
Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern Bädergestaltung
Beckenanlagen in Hallenbädern
Einrichtungen der Freibäder
Flächen
Die Größe der Wasserflächen, Abmessungen der Becken und Sprunganlagen sowie der Räumlichkeiten sind wie bei den Hallenbädern nach der Anzahl der zu erwartenden Badegäste und der Nutzungsart festgelegt.
Für jeden m²Wasserfläche sollten 10 bis 16 m²Grundstücksfläche zugeordnet sein.
Freibadbreiche, Räumlichkei-ten
Neben den Wasser-, Spiel- und Liegeflächen, werden die Bereiche des Freibades wie folgt unterschieden:
1. Eingangsbereich:
Eingangsvorplatz, überdachte Eingangszone, personalabhängige und automatische Kassen-anlage und Kontrolle, Personalräume (20-30 m²)
2. Umkleidebereich:
Umkleideplätze, Garderobenplätze, Sammelum-kleiden, Fußwasch- und Auswringplätze, Fuß-desinfektionsplätze, beheizter Umkleidebereich, Unterstellfläche, Frisierplätze.
3. Sanitärbereich:
Mutter-Kind-Raum, Duschen, Toiletten, Urinal-stände, Handwaschbecken
4. Beckenbereich:
Beckenanlagen, Beckenumgang, Aufsichtskan-zel, Durchschreitebecken, -platz, Schwimmmeis-terraum, Sanitätsraum (Erste-Hilfe-Raum), Ver-einsräume (DLRG), Geräte- und Lagerräume.
Bei Bädern für Sportveranstaltungen:
Zuschaueranlagen, Arbeitsplätze für Rundfunk, Presse, Fernsehen.
Beckenart
Größe in m
Länge x Breite
Wassertiefe in m
Schwimmbahnen-zahl u. sonstiges
Wassertem-peratur in °C
Schwimmerbecken
25,00 x 12,50
25,00 x 16,66
50,00 x 16,66
50,00 x 21,00
50,00 x 25,00
mindestens 1,80
(Nach DIN 19643 gel-ten Becken mit Was-sertiefen >1,35m als Schwimmerbecken)
5
6
6
8
10
24° ... 28°
Variobecken
25,00 x 8,00
25,00 x 10,00
25,00 x 12,50
25,00 x 16,66
50,00 x 21,00
50,00 x 25,00
Bei Hubböden:
0,30 ... 1,80
im Schwimmerbereich:
mind. 1,80
im Springerbereich:
mind. 3,40
3
4
5
6
8
10
24° ... 28°
Nichtschwimmerbecken
12,50 x 8,00
16,66 x 10,00 od. Form beliebig
0,60 ... 1,35
max. Bodengefälle: 10%
bei Schulschwim-men: 2m breit, bei zwei parall. Seiten
24° ... 28°
Planschbecken
Form beliebig:
15,0 ... 35,0 m²
0 ... 0,30/0,40/0,60 od.
0,10/0,20/0,30 ... 0,60
Bodengefälle:
5% ... 10%
28° ... 32°C
Wellenbecken
beliebig, jedoch
mindestens:
12,50 x 33,00 od.
16,66 x > 33,00
21,00 x > 33,00
zum Ende auslaufend:
0,00 oder 0,15/0,30;
im tiefen Bereich:
2,00 oder nach Nut-zungsart: 1,80, 1,35
Wellenhöhe:
0,60 ...1,00
24° ... 28°
Springerbecken
Nach Ausführung der Sprunganlage
3,40 ... 5,00
bei 20m u. 25m für Training möglich
24° ... 28°
Lehrschwimmbecken (Sonderform der Nicht-schwimmerbecken)
12,50 8,00
16,66 10,00
0,60 ... 1,35
zu empfehlen:
0,80 ... 1,20
maximales Boden-gefälle:
10 %
24° ... 28°
21
Bädergestaltung Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern
5. Technischer Bereich:
Heizungsanlage (Fernheizungsübergabe), Wärmetauscher und Warmwasserbereitung, Wasseraufbereitung, Chlorungsanlage, Elekt-roverteilung (Nieder- oder Mittelspannungsver-sorgung), Werkplatz, Lager. Sonstige Räumlich-keiten wie: Brennstofflagerung, Wasserspeicher, Abwasserhebeanlage, Blockheizkraftwerk, Anla-gen zur Abfallbeseitigung.
6. Ergänzungsbereich:
Anlagen für den Wettkampfsport, Zuschauer-anlagen, Anlagen zur Bewirtung (Café, Restau-rant), Liegeflächen, Spiel- und Freizeiteinrich-tungen des Nass- und Trockenbereichs.
Lageplan eines Freibades
Stellflächen:
1 Pkw-Stellplatz und 2 Fahrradstellplätze je 200 m² bis 300 m² Grundstücksfläche.
1 PkW-Stellplatz zusätzlich je 10 bis 15 Plätze bei Zuschaueranlagen.
Zusätzliche Stellplätze für Pkw bei Wirt-schafts- und Dienstleistungsbetrieben.
Übung
Einrichtungen der Freibäder
14. Welche Grundstücks- und Stellflächen werden für Freibäder empfohlen?
15. Welche Einrichtungen gehören zum Beckenbereich eines Freibades?
16. Geben Sie die Beckenarten eines Freibades mit je einer Beckengröße an!
22
Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern Bädergestaltung
Beckenanlagen in Freibädern
Je nach Einwohnerzahl, die im Einzugsbereich des Bades wohnen, können folgende Beckenarten zur Verfügung gestellt werden:
Freibadbecken und Abmessungen
Beckenart
Größe in m
Länge x Breite
Wassertiefe
in m
Schwimmbahnen-zahl u. sonstiges
Wassertem-peratur in °C
Schwimmerbecken
25,00 x 12,50
25,00 x 16,66
50,00 x 16,66
50,00 x 21,00
50,00 x 25,00
mindestens 1,80 (Nach DIN 19643 gelten Becken mit Wassertiefen >1,35m als Schwimmerbecken)
5
6
6
8
10
23° ... 25°
Nichtschwimmerbecken
Form beliebig
600 ... 1500 m2
0,50/0,60 ... 1,35
0,50 ... 1,10
0,90 ...1,35
max. Bodengefälle:10%
bei Schulschwim-men: 2m breit, bei zwei paral-lelen Seiten
23° ... 25°
Planschbecken
Form beliebig:
80 ... 200 m2
0 ... 0,30/0,50/0,60 od.
0,10/0,20/0,30 ... 0,6
Bodengefälle:
5% ... 10%
24° ... 26°C
Wellenbecken
beliebig, jedoch
mindestens:
12,50 x 33,00 od.
16,66 x > 33,00
21,00 x > 33,00
zum Ende auslaufend:
0,00 oder 0,15 / 0,30
im tiefen Bereich:
2,00 oder nach Nut-zungsart: 1,80, 1,35
Wellenhöhe:
0,60 ...1,00
23° ... 25°
Springerbecken
Nach Ausführung der Sprunganlage
3,40 ... 5,00
bei 20m u. 25m für Training möglich
23° ... 25°
Lehrschwimmbecken (Sonderform der Nicht-schwimmerbecken)
12,50 x 8,00
16,66 x 10,00
050/0,60 ... 1,35
zu empfehlen:
0,80 ... 1,20
maximales Bo-dengefälle:
10 %
23° ... 25°
Durchschreitebecken
6,00 x 3,00/4,00
ca.3,00 x ca.3,00
0 ... 0,15 in der Mitte,
0,10 am Ein- u. Austritt
Muldenform
Kastenform
-
Einrichtungen der freizeitorientierten Bäder
Hierzu gehören Freizeitbäder und Spaßbäder als Hallen-, Frei- oder Hallen-Freibäder mit Einrichtungen, die überwiegend der sportlichen Betätigung, Erholung und Entspannung dienen.
Flächen
Die Größe der Halle und sonstiger Räumlichkei-ten, Abmessungen und Wahl der Becken, Attrak-tionen sowie sonstige Spaß und Entspannung vermittelnde Anlagen, sind von der zu erwarten-den Zahl der Badegäste und deren Nutzungs-wünsche abhängig.
Freizeit-Hallenbädern sollten je m2Wasserflä-che 9 m2bis 12 m2Grundstücksfläche zugeord-net sein. Bei Freizeit-Freibädern können sich die Grundstücksflächen mehr als verdoppeln.
Stellflächen bei Freizeit-Hallenbädern:
1 Pkw-Stellplatz je 5 bis 10 Garderobenplätze.
1 Fahrradstellplatz je 5 Garderobenplätze.
Stellflächen bei Hallenfreibädern:
1 Pkw-Stellplatz und 2 Fahrradstellplätze je 200 m2bis 300 m2Grundstücksfläche.
Auch bei Freizeitbädern sind zusätzliche Stell-plätze beim Vorhandensein von Wirtschafts- und Dienstleistungsbetrieben vorzusehen.
23
Bädergestaltung Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern
Räumlichkeiten und Einrichtungen eines Freizeitbades
Bereiche und Räumlichkeiten der Freizeit- und Spaßbäder
Hier gilt es im besonderen Maße alle Bereiche und Einrichtungen den Erwartungen an eine Erholungs- und Erlebnisanlage auszubilden.
Vorplatz
Großzügig und einladend mit Sitzgelegenheiten und künstlerischem Blickfang gestaltet.
Eingangshalle
Gemütliche, ansprechende Atmosphäre, Wind-fang mit Automatik-Türen, gute Orientierungs-möglichkeiten und besucherfreundliches Kas-sensystem sind hier als Hauptpunkte zu nennen. Die Kassenanlage sollte personalunterstützt sein. Kleine Ladengeschäfte sowie Kiosk, Fri-seur, Fußpflege, Proviantstand, Bistro und sons-tige werden vom Besucher eines Freizeitbades erwartet.
Umkleidebereich
Hier sind Übersichtlichkeit, Großzügigkeit der Wegführung sowie bei der Anzahl und Größe der Umkleidekabinen (Wechselkabinen und
Einzelkabinen) sowie Garderobenplätze gefor-dert. Garderobenschränke mit 0,33 m Breite und 1,80 m Höhe werden vorgezogen. Bei Frei-bädern kommt einer Wärmehalle besondere Bedeutung zu. Größe: je 1000 m2Wasserfläche: Grundfläche 50...100 m2.
Sanitärbereich
Besonders ansprechend wird die Eingliederung der Duschen und Toilettenanlagen in den Hal-lenbereich empfunden. Abtrennungen, Sicht- und Spritzschutz sind in ihrer Formgebung dem Beckenbereich anzupassen. Strahl- und Seiten-duschen oder Fußbecken ergänzen die übliche Ausstattung. Duschenanzahl: Mindestens 10 Stück pro Geschlecht oder je 20 m² Wasserflä-che 1 Dusche. Anzahl der Toiletten: je 50...75 m² Wasserfläche eine Toilette.
Freizeitbad-Becken und Attraktionsbereiche
Hier sind die Beckenanlagen mit besonderen Beckenarten und Formgebungen sowie mit
24
Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern Bädergestaltung
zusätzlichen Erlebniselementen ausgestattet.
Die Beckenumgangsflächen erhalten eine zusätzliche Funktion als Aufenthalts- und Aktivi-tätszone.
Bei Freibädern können größere Wärmehallen mit Schwimm- und Badebecken ausgestattet sein, die durch Attraktionen ergänzt werden. Bei einem ganzjährigen Badebetrieb sind solche Anlagen mit einem separaten Eingangs- und Kassenbereich sowie Umkleide- und Sanitäran-lage auszustatten. Man unterscheidet:
Trockenbereiche:Hierzu gehören alle Flächen außer der Wasserfläche. Ihre Größe sollte etwa zweimal bis dreimal der Größe der Wasserfläche entsprechen.
Einrichtungen des Trockenbereichs:Ruhezonen und Ruheräume mit Sitz- u. Liegemöglichkeiten
Spielzonen:Spieltische, Spielautomaten, Fern-sehraum, Krabbelstube
Aktivitätenzonen:Sport-, Spiel-, Fitnessanlagen
Gerätespielgarten, Sandkasten, Sandspielplatz.
Kommunikationszonen:Sitzgruppen, Liegen, Terrassen, Gärten, Innencafé.
Wasserfall, Strömungskanal und Sprunganla-ge im „Leobad“
Restauration:Theke, Bedienungsflächen, Ver-sorgungs- und Nebenräume.
Saunaanlagen (>150m2): Getrennte und Ge-meinschaftssauna (12...20 m2mit Temperatu-ren 80...100°C), Freiluftflächen, Ruheflächen, Dampfbad.
Solarien:Als Sonnenwiesen oder Einzelanlagen im eigenen Bereich.
Luftsprudler
Nacken-schwall
Strömungs-kanal
Massage-düsen
Attraktionen eines Spaßbades im Nassbereich (Ospa Schwimmbadtechnik)
25
Bädergestaltung Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern
Nassbereiche: Im Interesse einer vielfältigen Nutzung können Standardbecken (Schwim-mer- und Nichtschwimmerbecken) durch frei gestaltete Mehrzweckbeckenanlagen ergänzt oder ersetzt werden. Hier können neben der schwimmsportlichen Nutzung vielfältigste Was-serattraktionen vorhanden sein:
Wasserrutschen, Wasserfälle, Kaskaden,
Massagepilze, Wand- und Bodensprudler,
Grotten, Felsengruppen, Gleitflächen
Strömungskanäle, Inseln, Rutschen,
Wasserspeier, Geysire, Wasserkanonen
Schwimmkörper (Reifen, Flöße, Inseln),
Unterwasserliegen.
Um den unterschiedlichen Neigungen und Altersgruppen Rechnung zu tragen, sind aber auch Becken mit unterschiedlichem Nutzungs-charakter und Wassertemperaturen anzutref-
fen. Für Kinder werden im Eltern-Kind-Bereich Matschplätze und Wasserspielgärten eingerich-tet.
Freizeit-Freibad: „Leobad“ Leonberg/Eltingen: 2900 m² Wasserfläche, 9 Becken
Spielzone eines Freizeitbades mit Spielka-nal, Stauwehr und Matschspielbereich
26
Planen und Einrichten von Hallen- und Freibädern Bädergestaltung
Beckenarten in Freizeitbädern
Neben den klassischen Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Springerbecken, sind folgende Becken-arten anzutreffen:
Beckenart
Abmessungen und Form
Länge x Brei-te in m
Wasserflä-che u. Was-servolumen in m2,m3
Wassertiefe
in m
Was-sertem-pera-tur in °C
Aufbereitung
Attraktionen
sonstiges
Mehrzweckbecken
Größe und Form beliebig
mind.300m²
1,25 -1,80
28°
ggf. einige
Schwimmbahnen
demontierbare
Startsockel
Aktionsbecken
Form beliebig
100-200m2
bis 1,35m
28°...30°
Bewegtes Wasser mit vielfältigen Attraktionen
Kleinbecken
(Kinderbecken)
Form beliebig
bis 96m2
0,60 ... 1,00
max. 1,35
30°...32°
Nur Attraktionen die für Kleinkinder sinn-voll sind, Wasserspiel-geräte, Sitz- Wickel- u. Waschgelegenheit
Planschbecken
Form beliebig
50 ... 100m2
0 bis 0,30 0,30...0,60
32°
Außenwarmbecken (Nichtschwimmer)
Form beliebig
80-160m²
1,35m
28°...32°
mit Attraktionen Wind-schutzwände, Be-ckenabdeckung
Warmsprudelbecken
(Whirl-Pool)
Form beliebig
meist rund
1,6 m3
max. 10 Pers.
0,4 m3/Pers
≤ 1,00m
37°
erkennbare Sitzplätze
Kaltwasserbecken
als Therapiebecken
als Tauchbecken
als Tretbecken
Form beliebig
Form beliebig
Form beliebig
25...50m2
bis 10m2
ca10...20m2
1,35m
1,10...1,35m
0,35...0,40m
≤ 21°
≤ 15°
≤ 15°
Füllwasser mit Chlor; bei über 2m3Inhalt: Wasseraufbereitung
Bewegungsbe-cken Warmbecken
Form beliebig Form beliebig
ca. 40m2bis 20m2
≤ 1,35m ≤ 1,35m
ca. 35°
ca. 35°
Aufbereitungsanla-ge mit Ozonstufe, nach DIN EN 19643-3 oder Virendichte Mem-branfilteranlage nach DIN EN 19643-4
Therapiebecken
Form beliebig
ca. 12m2/Pers
≤ 1,35m
ca. 35°
Aufbereitungsanla-ge mit Ozonstufe
Wasserrutschen-
becken
meist recht-eckig und flach auslaufend
≥ 4,0 x 6,0m
≥ 1,00m
unter der
Einmündung
ca. 28°
Betrieb mit Beckenwas-ser und Reinwasser
Übung
Einrichten von freizeitorientierten Bädern
17. Geben Sie bei Freizeitbädern das Verhältnis der Wasserfläche zur Grundstücksfläche an.
18. Wie sind der Vorplatz, Eingangshalle, Umkleide-bereich und Sanitärbereich bei Freizeitbädern zu gestalten?
19. Welche Attraktionen des Trockenbereichs wer-den als Einrichtung empfohlen?
20. Welche Zonen und Bereiche sind noch einzu-richten?
21. Welche Attraktionen können für den Nassbe-reich angetroffen werden?
22. Welche Einrichtungen sind für den Nass-Spiel-bereich der Kleinkinder einzurichten?
23. Geben Sie 8 Beckenarten der Freizeitbäder an und nennen Sie die Wasserflächen, Wassertie-fen und die Nutzungstemperaturen.
27
Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
Allgemeine Konstruktionsmerk-male
Schwimmer- und Sportbecken sowie Nicht-schwimmerbecken sind so auszubilden, dass Sie den Wasserdrücken von innen und außen widerstehen und dicht sind. Die Tragkonstruk-tionen bestehen überwiegend aus Stahlbeton (örtlich hergestellt) oder Edelstahl. Tragteile aus glasfaserbewehrtem Kunststoff, Leichtme-tall oder Fertigteilkonstruktionen aus Stahl- und Spannbeton sind ebenfalls üblich.
Als Beckenauskleidung können entsprechend der Tragkonstruktion Keramikfliesen, Kunststoff-folien, Edelstahlbleche oder dauerelastische Kunststoffanstriche auf die Tragkonstruktion oder Verputz angetroffen werden.
Schwimmer- und Sportbecken
Sie sind in Ihren Abmessungen nach den Unfall-verhütungsvorschriften, den Richtlinien für den Bäderbauund den Bestimmungen des Interna-
tionalen Schwimmverbandes (FINA) auszubilden (Maßgenauigkeit: +0,03 m bei 50 m- und +0,02 m bei 25 m-Becken, niemals kürzer). Rutschfestig-keit, farbige Gestaltungsmöglichkeit, Resistenz gegen Wasser, Chemikalien und mechanische Beanspruchungen sind die Hauptanforderungen an eine geeignete Beckenauskleidung.
Einrichtungen, die der Sicher-heit dienen
Markierungen und Halterungen
Auf der Beckenauskleidung sind bei allen Becken die Markierungen, die der Sicherheit oder der Orientierung dienen, anzubringen
Man unterscheidet:Beckenmarkierungen, die der Sicherheit dienen und Beckenmarkierungen, die zum Abhalten von Schwimmwettkämpfen nach den Bestimmungen des Internationalen Schwimmverbandes (FINA) erforderlich sind (siehe Abb. 11u. Abb. 17).
Der Bereich zwischen dem Beckenumgang und der Wasserfläche ist der Beckenkopf. Er nimmt die Rinne, den Startsockel und die Halterungen für Leinen und Sportgeräte auf. Auf dem Becken-kopf sind die Beschriftungen, wie Wassertiefen, Angabe der Beckenbereiche, Gebote und Ver-
Schwimmstreifen (Bahnlinien) nach FINA, Maße gelten für Anstrich, bei Fliesen werden sie durch die Platten 11,5/24 oder 15/15cm bestimmt.
Startwand bei einer „Finnischen Rinne“ (Vil-leroy & Boch, D-66693 Mettlach)
Maßtoleranzen bei Schwimmerbecken
Nach FINA-Regeln dürfen die Beckenma-ße nicht unterschritten werden. Zulässige Abweichungen: 50 m-Becken +≤ 3 cm, bei 25m-Becken +≤ 2cm. Bei Zeitmessanlagen mit einer Anschlagmatte: 50,01 m bis 50,03 m (25,01 bis 25,02 m), bei zwei: 50,02 m bis 50,03 m.
28
Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung
Anforderungen an eine gute Erkennbar-keit der Beckenkante und Überlaufrinne:
1. Der gesamte Beckenkopf ist andersfar-big zu gestalten.
2. Die gesamte Rinne ist farblich abge-setzt.
3. Bei einer „Finnischen Rinne“ ist die senkrechte Wand mindestens 5cm und die waagerechte Fläche 2,5cm deutlich farblich abgesetzt.
bote sowie Spielfeldmarkierungen aufgebracht.Der Beckenkopfmuss so ausgebildet sein, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind. Alle Becken müssen eine durchgehende Fest-haltemöglichkeit besitzen. Dies können sein: Mindestens 15mm tiefe Mulden oder 15mm hohe Wülste in höchstens 60mm Abstand von der senkrechten Beckenwand. Haltestangen, an denen die Gefahr des Zwischentretens besteht, haben sich nicht bewährt.
Bei hoch liegendem Wasserspiegel müssen Beckenkante und Überlaufrinne deutlich erkenn-bar sein.
Oben liegende Rinnen sind bodenbündig zum Beckenumgang abgedeckt mit Öffnungsbreiten von max. 8mm auszuführen.
Sicherheit am Beckenkopf (Villeroy & Boch, Mettlach)
Rinnensysteme nach den Richtlinien für den Bäderbau und Herstellerangaben
Starblöcke aus Edelstahl oder Stahlbeton (Roigk GmbH, Gevelsberg)
29
Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
Beckenausstiege, -Einstiege
Beckenausstiege müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein. Dies ist erfüllt: Bei 50m Variobe-cken mindestens 6 Ausstiege, bei 25m- Schwim-mer- oder Variobecken mindestens 4 Ausstiege oder im Nichtschwimmerbecken eine längsseiti-ge Treppe mit zwei Leitern. Bei Mehrzweck- oder Variobecken müssen auch beim Übergang zum Schwimmerteil Beckenausstiege vorhanden sein. Von Beckenseiten, auf denen Sprunganla-gen stehen, müssen Ausstiege mindestens 8m entfernt sein. Dies gilt nicht für Startsockel.
Beckenausstiege müssen sicher begehbar und rutschhemmend ausgeführt sein. Schwimm-sportgeräte, Beckenleitern, Griffbögen und Maße der Treppen- und Steigleitern müssen der DIN 7930 entsprechen. Trittstufen der Wasser-treppen sind farbig zu kennzeichnen.
Leitern und verstellbare Einsteigtreppen
Beckensteigleitern sind wandbündig in Nischen bis zur Raststufe auszuführen. Jedoch mindestens eine Leiter sollte bis zum Beckenboden rei-chen. Leiternholme dürfen nicht ins Becken ragen und nicht mehr als 15cm vom Beckenrand zurückstehen.
Einzuhaltende Maße:
Abstand der Trittstufen unterein-ander: 230 - 300 mm
Stufentiefe ≥150mm
Bei Metall-Leitern gilt:
Breite zwischen den Holmen:
≥ 52 cm
Nischenbreite:
von Holmenachsen + je 10 cm
Nischentiefe:
Holmenachse bis Wand 11 cm
Bei Keramik- oder Kunststoff-Verbundkonstruktionen gilt:
ObersteTrittstufe nicht tiefer als 30cm unter dem Beckenkopf,
Abstand zur Nischenrückwand:
≤ 8 mm
Unterschiedliche Holmenhöhen:
Ein Holm ≥ 75 cm, zweiter Holm 20 cm höher
Schwimmerbecken/Sportbecken mit norm-gerechten Schwimmstreifen und Anordnung der Ein-stiege
Beckenecke mit Einstieg nach FINA und den Richtlinien für den Bäderbau (Villeroy & Boch, D-66693 Mettlach)
30
Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung
Einsteigtreppenin Schwimmbädern sind par-allel an der Längsseite mindestens 1m breit einzubauen. Sie enden auf einem Podest in Raststufenhöhe und sind mit einem Handlauf zu versehen. Podeste und Trittstufen sind rutsch-hemmend auszubilden. Man unterscheidet star-re Einstiege und verstellbare Treppen. Bei letz-teren dürfen die Stufen höchstens 18 cm hoch sein, und der Zwischenraum zum Beckenboden mind. 100mm betragen. Die Höhenverstellbar-keit beschränkt sich auf 1,50 m.
Wartung:Kontrolle des Belages auf Rutschfes-tigkeit und Haltbarkeit, Überprüfung der Veran-kerungen und Verstelleinrichtungen.
Beckensteigleiter, Trittstufen: Keramik (Meyer - Hagen, D-58095 Hagen)
Höhenverstellbare Edelstahltreppe für Hub-boden und Rinnensysteme (Meyer-Hagen, D-58095 Hagen)
Wassertiefen, Kennzeichnung
Nichtschwimmerbecken: max. 1,35m tief. Sprin-gerbereiche müssen zum Zeitpunkt ihrer Errich-tung mindestens den Angaben der „Richtlinien für den Bäderbau“ entsprechen. Unter Startso-ckeln: mindestens 1,80m Tiefe über 5m Länge. Wassertiefen müssen unmittelbar am Rand jeden Bereiches deutlich erkennbar und dau-erhaft angegeben sein. Die Kennzeichnungen müssen vom Beckenrand aus erkennbar sein.
Kennzeichnungen von Funktionsbereichen müs-sen mindestens auf zwei gegenüberliegenden Seiten, sowohl vom Beckenumgang als auch vom Becken, erkennbar sein.
In Bädern, in denen Gruppenschwimmen mit Nichtschwimmern abgehalten wird, muss zwi-schen Schwimmer- und Nichtschwimmerteil ein Trennseil auf der Wasseroberfläche angebracht werden können. Bei einem deutlichen Knick des Beckenbodens muss das Trennseil im Nicht-schwimmerbereich 1m vor dem Knick ange-bracht sein. Der Übergang eines Schwimmka-nals in ein Schwimmerbecken ist 1 m vor dem Schwimmerbecken zu kennzeichnen.
31
Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
Beckenböden, Beckenwände
Beckenwände müssen 1,50 m lotrecht, glatt,und Beckenböden eben ausgeführt sein. Bodennei-gungen bei Übergängen dürfen höchstens 30°, Schleppschürzen von Hubböden höchstens 45° gegen die Waagerechte betragen. Senkrechte Übergänge sind nicht zulässig, auch beim Über-gang in einen Schwimmkanal. Beckenböden sind rutschhemmend auszuführen (Ausnahme: Schwimmer- und Springerbereiche).
Gefälle des Beckenbodens soll ≤ 10% betragen. Schwimmer- und Springerbereiche müssen 1,00 m - 1,35 m unterhalb des Wasserspiegels eine umlaufende Beckenraststufe von mindes-tens 10cm Breite besitzen (Abb. 17).
Vorstehende Stufen dürfen höchstens 15 cm breit sein.
Einbauten unter der Wasseroberfläche sind so anzuordnen und auszubilden, dass Verletzun-gen vermieden werden. Dies sind: Stützkonst-ruktionen von Wasserrutschen, Haltegriffe, Sitz-stufen, vorgehängte Beckenleitern.
Sitzmulden und Sitzstufen sind deutlich zu kenn-zeichnen. Scharfe Kanten sind zu vermeiden.
Abflüsse und Pumpensaugleitungen im Becken-bereich müssen so beschaffen sein, dass Per-sonen durch Ansaugkräfte nicht zu Schaden kommen. Hierfür müssen Abdeckungen gegen Entfernen gesichert und nicht durch Körper voll-flächig abdeckbar sein.
Leinen, Seile, Befestigungen
Begrenzungsleinen(auch Begrenzungssei-le oder Trennleinen) trennen die einzelnen Beckenbereiche. Sie bestehen aus Stahlseilen oder Ketten mit Kunststoffummantelung. Die Leine muss 1m vor dem Bodenknick auf oder über der Wasserfläche liegen (Schwimmschläu-che). Begrenzungseile sind ausreichend stark in den Wänden zu verankern.
Absperrleinendienen zum Absperren von Hal-lenbereichen, um während des Betriebes Arbei-ten durchzuführen. Beckenseiten, von denen aus ein Sprung ins Wasser eine erhöhte Gefahr darstellt, müssen abgesichert sein.
Auch können mit ihrer Hilfe Beckenränder für den Einstieg gesperrt werden. Es sind Seile oder Kunststoffleinen, die sichtbare Markierungen
(z.B. Fähnchen) tragen. Pfosten für Absperrun-gen sind meist in vorgesehene Bodenhalterun-gen einzusetzen (Abb. 20).
Wartung:Bei allen Leinen und Befestigungen ist die Haltbarkeit in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Auf die Gefahr von Verletzungen durch defekte Schutzhüllen sei besonders hingewie-sen.
Trennleinen-, Begrenzungsleinenhalter (Meyer Hagen, D-58095 Hagen)
Übung
Einrichtungen die der Sicherheit dienen.
24. Welche Beckenmarkierungen sind zur Sicher-heit am Beckenkopf und Beckenumgang erfor-derlich?
25. Welche Markierungen regeln den Schwimmbe-trieb?
26. Welche Einrichtungen und Markierungen befinden sich am Beckenkopf?
27. Welche Anforderungen werden an die Sicher-heit einer Finnischen Rinne gestellt?
28. Wie viele Beckenausstiege sind bei 25m x 12,50m- und 50m x 25m-Becken erforderlich?
29. Welche Rinnensysteme unterscheidet man?
30. Geben Sie die Maße bei Einstiegen an:
30.1 Breite der Leitern
30.2 Breite zwischen den Geländerholmen
30.3 Geländerholmenhöhen
30.4 Stufenhöhen von Leitern und Treppen
30.5 Lage der Beckenraststufe
31. Wie sollten Wassertiefen angegeben sein?
32. Wo sind die Wassertiefen bei einem Kombibe-cken anzugeben?
32
Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung
Leinen für sportliche Nutzung
Trennleinen:Sie trennen zur Wellenberuhi-gung die Schwimmbahnen ab und bestehen aus dehnbaren Seilen von mind. 20 mm Dicke und Schwimmkugeln mit ≥ 80 mm Durchmesser. Far-ben: weiß-gelb, die letzten 5 m rot (nach FINA).
Fehlstartleine:Ist ein Seil mit bunten Markie-rungen, das im Abstand von 15 m nach dem Start auf das Wasser abgesenkt werden kann.
Spielfeldbegrenzungsleinen:Sind Leinen mit Schwimmkörpern und kräftigen Farben für die Abgrenzung von Wasserballfeldern.
Rückenwendeanzeiger:Es ist eine beflaggte Leine, die 5m vor der Wende in 1,80m Höhe über die Wasserfläche gespannt ist.
Fehlstart- und Rückenschwimmer-Sichtan-lage (zeichnerische Darstellung als Draufsicht, Meyer Hagen, 58095 Hagen)
Trenn- (Schwimm-) Leinenhalterungen (Roigk, Gevelsberg)
Fehlstart- und Rückenschwimmsichtanlage in der Draufsicht.
Übung
Leinenarten im Bad
33. Welche Leinen- oder Seilarten werden unter-schieden?
34. Geben Sie an, wie eine Begrenzungsleine (Trennleine) beschaffen sein muss?
35. Wo werden Absperrleinen verwendet?
36. Wo ist eine Fehlstartanlage (-Leine) zu instal-lieren? Geben Sie die Maße an!
Abdeckungen und Roste
Rinnenroste sind hydraulisch günstig auszubil-den. Die Roststäbe liegen senkrecht zur Becken-kante mit einem maximalen Abstand von 8mm. Sie sind in Teilstücken ab 0,5m herausnehmbar. Die Oberflächen sind durch Nocken und Riefen rutschhemmend ausgebildet.
Schwimmbahnleinenbestigung als Boden-durchführung (Roigk, Gevelsberg)
33
Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
Wartung der Rinnenroste:Regelmäßig reini-gen, Ablagerungen mit saurem Reiniger entfer-nen, Ebenheit der Kanten mit dem anschließen-den Belag, Korrosionsbefall und Befestigungen prüfen.
Abdeckplattenfür Schächte und Öffnungen, Einlaufroste für Entwässerungsanlagen sind überwiegend aus Edelstahl oder Kunststoffen. Auch hier ist die Oberfläche rutschsicher auszu-bilden. Ein Entfernen der Abdeckungen sollte für Unbefugte schwierig sein (z.B. verschrauben).
Wartung:Trittsicherheit und festen Sitz über-prüfen, fehlende Abdeckungen sofort ersetzen oder den Bereich mittels Leinen sperren. Hoch-stehende Kanten bedeuten eine Stolpergefahr. Verbogene oder angebrochene Teile sind aus-zuwechseln.
Ein- und Ausströmungen, Wasserentnahmeschächte in Becken
Ein- und Ausströmöffnungen der Beckenwasser-durchströmung sind aus Edelstahl oder Kunst-stoff ausgeführt. Verstellbare Austrittsdüsen müssen entsprechend der optimalen Durchströ-mung eingestellt sein.
Roste, Gitter und Siebe von Wasserein- oder -ausläufen sowie von Wasserentnahmeschäch-ten sind so auszubilden, dass sie keine Verlet-zungsgefahr darstellen. Größere Ausströmöff-nungen sind durch solche Siebe oder Gitter fest zu verschließen, die ein Ansaugen verhindern
Forderung der DIN EN 13451-3: Wasserge-schwindigkeit an Ausläufen ≤ 0,5 m/s.
Bei System mit mehreren Abläufen: 1. mind. 2 funktionierende Absaugöffnungen je Pumpe. 2. Abstand der Bauteile ≥ 2 m 3. Falls eine Ansaug-öffnung verstopft, muss die andere den Volu-menstrom bewältigen können.
Bei System mit nur einem Gitter: 1. Ein Nutzer darf nicht mehr als 50% abdecken. 2. Gitter muss gegen die Strömungsrichtung gewölbt
sein (Wölbungshöhe min. 10% des Durchmes-sers) 3. Bei Einzelgittern Fläche > 1m2
Wartung:Regelmäßige Überprüfung der Eben-heit und Befestigungen.
Unterwasserscheinwerfer und Unterwasserfenster
Unterwasserscheinwerfer werden ca. 1,00 m unter dem Wasserspiegel im Abstand von 2,00 ... 3,00 m angeordnet. Sichtfenster für Schwim-merbecken von 1,0...2,0 m x 0,50 m, bei Sprung-anlagen 0,75 m x 0,75 m, sind mindestens 0,50 m unter dem Wasserspiegel anzuordnen.
Lage und Maße eines Rinnenabdeckrostes bei einer Finnischen Rinne. (Schäfer, 42579 Heiligen-haus)
Gitterformen von Beckenausströmungen, die ein Ansaugen verhindern (Schäfer, 42579 Heili-genhaus)
Übung
Roste, Abdeckungen, Unterwasserscheinwerfer
37. Wie sind Roste und Abdeckungen unfallsicher auszubilden? Nennen Sie vier!
38. Welche Unfallgefahren können bei einem ungesicherten Wasserentnahmeschacht auftreten?
39. Wo sind Unterwasserscheinwerfer und -fenster anzuordnen?
34
Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung
Rettungsgeräte
Die Ausstattung für Rettungsgeräte und Erste-Hilfe-Ausrüstung ist nach GUV-R 1/111, VBG 109/GUV 0.3 und dem Merkblatt 25.02 geregelt.
An Schwimmer- und Springerbecken müssen mindestens zwei Rettungsstangen aus Leicht-metall oder Kunststoff und abhängig von der Beckengröße zusätzlich Rettungsbälle oder Rettungsringe mit mindestens 15m langen Wurf-leinen vorhanden sein. Rettungsringe und -bälle benötigen eine Auftriebskraft von 100...120 N. Die Rettungsgeräte müssen in Beckennähe gut sichtbar und gut erreichbar angebracht sein.
Mindestausstattung für ein Schwimmer- oder Variobecken 25 x 10m:
2 Rettungsstangen (z.B. 3m und 5m oder 6m lang) zusätzlich 1 Rettungsball oder Rettungsring, beide mit Haltevorrichtun-gen und mit 15m langen Wurfleinen.
Bei Naturbädern(Badegewässer) sind je 50 m Strand ein Rettungsring oder Ball mit 20-30 m langer Wurfleine erforderlich. Je nach Größe der Wasserfläche sind ein oder mehrere Rettungs-boote in einsatzbereitem Zustand vorzusehen. Das Vorhalten von Tauchgeräten mit ca. 1600 l Luftvorrat (8-Liter-Flasche mit 200 bar) und Ret-tungsbretter oder -bojen haben sich bewährt.
Erste - Hilfe - Räume
In Bädern müssen Erste - Hilfe - Räume (Sani-tätsräume) eingerichtet sein. Die Größe muss mind. 8 m2bei 2,50 m Höhe betragen, gut zugänglich sein und mit möglichst direkt verlau-fendem ≥ 1,20 m breiten Weg zum Standort des Rettungsfahrzeuges.
Die Ausstattung ist nach DIN EN 15288 und GUV-R 1/111 und Merkblatt 25.02 geregelt:
1 Tisch, 2 Stühle, 1 Drehhocker, Sanitätsliege mit Standplatz, Verbandstisch, Krankentrage, Wandschirm, Vakuumkissen mit Pumpe, Wasch-becken mit Kalt- und Warmwasser sowie eine Kommunikationseinrichtung.
Wiederbelebungsgeräte:
Absauggeräte, Beatmungshilfen (z.B. Maske mit Rohrstück), Beatmungsgeräte (z.B. Beutelbeat-mer od. Sauerstoff-Inhalationsgerät). Sonstige Wiederbelebungsgeräte, wie Pulmotor, Elektro-
Rettungsball und Rettungstange mit Ring (Roigk, Gevelsberg)
Rettungsring mit Halterung und Wurfleine
Aufsichtskanzel aus Edelstahl (Roigk, Ge-velsberg)
35
Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
lunge, Defibrillator usw. können bei fachgerech-ter Anwendung eingesetzt werden.
Erste-Hilfe-Material:
Allgemeine Hilfsmittel (z.B. Tücher, Lampe, Augenklappe, Handschuhe...); Instrumente, (z.B. Schere, Pinzette, Mundspatel, Fieberther-mometer); Verbandsstoffe (z.B. Verbandspäck-chen, Dreiecks- und Brandwundentücher, Heft-pflaster).
Sonstige Ausstattung:Informationstafel (z.B. „Erste Hilfe“, „Notrufe“, „Rettung Ertrinkender“, siehe Abb. 31,„Anleitung zur Ersten Hilfe“); Papierkorb, 4 Wolldecken, 5 Einweg-Laken, 1 Badetuch.
Wartung: Alle Geräte sind in kurzen Zeitinterval-len zu überprüfen. Haltbarkeit und ordnungsge-mäßer Zustand, der einen erfolgreichen Einsatz der Hilfsmittel erlaubt, müssen über die ganze Saison gewährleistet sein; Vollständigkeit der Geräte, Schwimmfähigkeit der Ringe und Bälle, Haltbarkeit der Leinen und Stangen, Probeläufe des Bootsmotors, Batteriewartung, Sauerstoff-druck des Beatmungsgerätes, Pflege der Gum-miteile gegen Verspröden sind dafür Vorausset-zung.
Der Beckenkopf und Konstruktionen, die der Sicherheit dienen, sind wie bei den Schwimmer- und Sportbecken ausgebildet. In Freizeit- und Spaßbädern können Nichtschwimmerbecken mit zahlreichen Beckenattraktionen ausgestat-tet und durch Schwimm- und Strömumgskanäle verbunden sein.
Lehrschwimmbecken
Beim Schwimmunterricht mit Anfängern werden Becken mit geringeren Wassertiefen benötigt. Um den Übergang beim Schwimmen vom fla-chen zum tieferen Wasser zu erleichtern, sollten Lehrschwimmbecken in Verbindung mit Schwim-merbecken erstellt werden.
Bauliche Einzelheiten
Für die Planung gelten die gleichen Richtlini-en und Grundsätze, die bei den Hallenbädern genannt werden, ebenso die allgemeinen Kon-struktionsmerkmale für den Bau von Hallen- und Freibädern.
Wassertiefe:An der Treppenseite mind. 0,60m auf der gegenüberliegenden Seite höchstens 1,35m. Empfohlen werden 0,80 bis 1,20m. Die Tiefe wird von der Oberkante Überlauf bis zum Beckenboden gemessen.
Wassertiefen-Veränderung:Sie kann durch höhenverstellbare Zwischenböden (Hubböden) erfolgen, wobei eine Treppenanlage hierbei nicht möglich ist. Durch Anstauen oder Fluten ist ebenfalls eine Veränderung der Wassertiefe möglich. Hier sollte eine zweite Überlaufrinne und ein Wasserspeicher vorhanden sein. Ein Anstauen ohne Überlaufrinne ist zur Erhaltung der Wasserqualität im Oberflächenbereich nicht erlaubt. Der Boden und die Stufen sind rutsch-hemmend und die Bodenfläche mit maximal 10% Gefälle herzustellen.
Übung:
Rettungsgeräte, Erste-Hilfe-Ausstattung
40. Welche Rettungsgeräte sind an einem 50-m-Schwimmerbecken anzuordnen?
41. Welche Rettungsgeräte sind an einem Natur-bad (Strandlänge von 150m) vorzusehen?
42. Geben Sie zehn Erste-Hilfe-Ausstattungen für ein Hallenbad an!
Nichtschwimmerbecken
Sie sind in ihrer Formgebung beliebig. Die Was-sertiefen sind nach GUV-R 1/111, KOK und DIN 19643 von 0,60 m bis 1,35 m zu wählen. Die Fußböden besitzen eine Neigung bis maximal 10% und sind rutschhemmend auszubilden. Um kleinere schwimmsportliche Wettkämpfe austragen zu können, wird empfohlen im tiefe-ren Bereich zwei parallele Seiten anzuordnen, die Bahnlängen ermöglichen, deren Vielfaches 100 m ergeben. z.B. 10 m, 12,50 m, 16,33 m, 25 m.
Querschnitt durch ein Lehrschwimmbecken
36
Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung
Informationstafel „Rettung Ertrinkender“ (BG Verkehr)
37
Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen
Treppen
Auf einer ganzen Längs- oder Querseite des flachen Teils sind Treppen anzuordnen. So können gleichzeitig eine





























