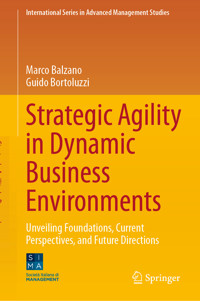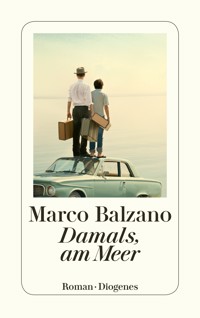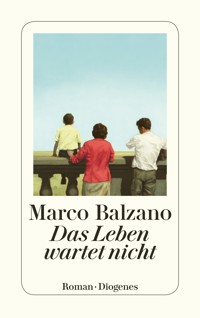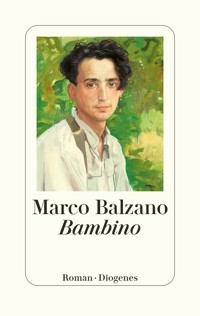
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Triest, 1920. Mattia ist ein Faschist der ersten Stunde. Sein Gesicht ist noch bartlos, weshalb man ihn Bambino nennt, aber seine Schläge sind so hart, dass die halbe Stadt sich vor ihm fürchtet. Mattia weiß nicht, wer seine Mutter ist. Gar eine von drüben? Eine Slowenin? Sein Vater, der Antifaschist und Uhrmacher, will es ihm nicht verraten. Im Schlamm und Schmutz des Zweiten Weltkriegs verliert Mattia schließlich alle Gewissheiten, und er muss erfahren, dass der Gewinner von heute der Verlierer von morgen sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Marco Balzano
Bambino
roman
Aus dem Italienischen von Peter Klöss
Diogenes
Denen, die über Grenzen schauen können
Was man die Geschichte nennt,
ist kein Anlass für Stolz,
Ist sie doch gemacht aus
Dem, was kriminell in uns.
Wystan H. Auden, Archeology
ERSTER TEIL
Niemandes Sohn
»Bambino.«
Abrupt drehe ich mich um. Ich stelle die Espressotasse auf die Theke und suche nach einem Ausweg, aber zu spät: Ein Pistolenlauf drückt gegen meinen Rücken und drängt mich zur Tür.
»Schau geradeaus«, sagen sie drohend, als ich mich zum Meer drehe.
Am Bürgersteig wartet ein Millecento. Sobald er uns im Rückspiegel sieht, lässt der Fahrer den Motor an. Sie fesseln meine Handgelenke mit Draht. Als die Stadt hinter uns liegt, verbinden sie mir die Augen.
Ich denke daran, wie ich auf die Welt gekommen bin. Aus dem sanften, dunklen Schoß meiner Mutter bis in diese Dunkelheit, aus der ich nicht mehr zurückkehren werde.
Eins
Meine Kindheit war voll endloser Langeweile. Ich verbrachte sie damit, in der Uhrmacherei meines Vaters die Zeit zu zählen: Den ganzen Tag saß ich auf dem Stuhl und reichte ihm Zangen oder winzige Schraubenzieher. Die Schule kam wie eine Befreiung, auch wenn ich nie viel Freude daran hatte. Noch heute glaube ich, dass ein Mensch alles, was ihm nützlich ist, selbst lernen kann. Schreiben, Lesen, Rechnen: Mehr braucht es nicht. Sogar im Hof war mir langweilig. Ich schoss einen zerfledderten Ball gegen die Mauer, den ich ein paar Rotznasen auf dem Campo San Giacomo abgenommen hatte. Erst wollten sie ihn mir nicht geben, da musste ich sie verprügeln.
Mein Bruder Adriano war zwölf Jahre älter als ich, zu viel, um miteinander zu spielen. Bis zu dem Tag, an dem wir ihn an die Pier begleiteten, wo er die Martha Washington bestieg, hatte ich zwei Väter. Der eine war aufdringlich, der andere schweigsam. Adriano ging kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Amerika und schickte mir noch jahrelang Ansichtskarten. Triest hat er nie geliebt, er mochte weder die Menschen noch das Meer. Auch sein Verhältnis zu unseren Eltern habe ich nie verstanden. Mich hatte er gern, aber so, wie man ein kleines Kind gernhat.
Einen einzigen Freund hatte ich: Er war so alt wie ich, Sohn eines Italieners und einer Slowenin, und wohnte nicht weit von uns. Ernesto war wie hundert Menschen zugleich, enthusiastisch, intelligent und witzig. Er war wirklich mein allerbester Freund. Wann immer ich konnte, blieb ich über Nacht bei ihm. Im Frühling schlichen wir uns spätabends, wenn seine Eltern schon im Bett waren, hinaus in den Hof und fingen Glühwürmchen. Wir steckten sie in ein Glasgefäß, setzten uns auf die Steintreppe und sahen ihnen zu.
Weil ich so oft bei Ernesto und seiner Mutter war und Topfenstrudel oder Gnocchi mit Pilzen aß, lernte ich bald Slowenisch. Eine wunderbare Frau war Ksenija und die beste Köchin der Stadt. Aus ihrem Mund floss die fremde Sprache wie Gesang, ganz anders als das Italienische. Meinen Vater erstaunten meine Fortschritte so, dass er ihr eines Tages zum Dank eine Tischuhr schenkte und meinem Freund einen Zeichenblock. Er meinte bei mir eine Neigung zum Studieren erkannt zu haben, dabei war mir, wenn ich über Büchern hockte, als würde ich das Leben verschwenden. Mit Slowenisch war das anders. Ich lernte es, weil Ksenija schön war und ich auch so eine Mutter haben wollte. Meine sah aus wie eine Oma, selbst ihr Name, Tella, klang nach alter Frau.
Zur Schule ging ich am einen Tag, am anderen nicht. Ich zog mir die Decke über den Kopf und jammerte, ich hätte Bauchweh, man solle mich in Ruhe lassen. Das stundenlange Stillsitzen machte mich verrückt. Einmal habe ich mit dem Taschenmesser »Der Direktor ist doof« ins Pult geritzt. Zacchigna, unser Lehrer, hat mir mit dem Rohrstock so viele Schläge auf die Fingerknöchel gegeben, dass ich den Schmerz noch heute spüre. »Womit habe ich bloß eine solche Beleidigung verdient?«, fragte mich der Direktor, als er mir am nächsten Tag den Suspendierungsbrief aushändigte. Dummheiten aus Langeweile, die mir regelmäßig blutige Hände oder Stunden hinter der Tafel einbrockten.
Später im Realgymnasium behielt ich es lieber für mich, wenn ich Bauchweh hatte, die Schule schwänzen hieß nämlich, den ganzen Tag in der Uhrmacherei zu verbringen. Aus Angst, ich könnte etwas umschmeißen, folgte mein Vater mir auf Schritt und Tritt, bis er entnervt aufgab und mir ein paar Münzen in die Hand drückte, damit ich mir einen Riegel Schokolade kaufen ging. Selbst als er herausfand, dass ich mir davon Zigaretten kaufte, gab er mir weiterhin Geld. Hauptsache, ich war ihm aus den Füßen oder saß brav auf der Ladenschwelle.
Als Schüler war ich mittelmäßig, nur in den Naturwissenschaften war ich gut. Blumen, Tiere und Planeten mochte ich viel lieber als die Menschen. Vielleicht habe ich deshalb Geschichte immer gehasst: weil es da nur um Menschen ging.
In jenen Jahren konnte man mir beim Wachsen zusehen, und wenn die Tanten und Kusinen zu Besuch kamen, sagten sie: »Ein richtiger Packesel wirst du mal!« Meine neuen Klassenkameraden konnte ich noch weniger leiden als die Kinder in der Volksschule, höchstens in den Pausen spielte ich mit ihnen. Mir genügte Ernesto, mit dem ich lange Schwimmtouren ins Pedocin unternahm, wo man die Frauen im Badeanzug beobachten konnte. Oder wir lagen auf der Kaimauer und erfanden Geschichten, bis wir es in der Sonne nicht mehr aushielten. Auch er wuchs, aber wie ein Slawe wirkte eher ich, blond und sehnig, wie ich war. Ernesto war eher mollig und hatte die Hautfarbe eines Mediterranen. Wenn er sprach, sog er immer die Wangen ein, das weiß ich noch. Ich beneidete ihn um seinen Bart auf der Oberlippe und um seine Koteletten, die er sich nie abrasieren wollte. Ich war völlig unbehaart.
Seit ein paar Monaten herrschte Krieg. Mein Bruder war gerade noch rechtzeitig fortgegangen. Jetzt waren unsere Eltern erleichtert, dass er ausgewandert war, so wussten sie ihn immerhin in Sicherheit. Als wir uns an der Pier ein letztes Mal umarmt hatten, hatte er mich gefragt: »Du kommst mich doch mal besuchen, oder? Bei deinem schönen Gesicht heiratest du bestimmt eine amerikanische Schauspielerin!« Dann hatte er seine Koffer genommen und war an Bord eines Schiffes gegangen, das mir vorkam wie eine Stadt. Adriano sagte immer, ich sei schön.
Dann wurde Tella krank, ihre Knochen wurden steif. Ihre Lippen bewegten sich in einem fort, als betete sie den Rosenkranz. Die Ärzte, die zu uns kamen, um sie zu untersuchen, verstanden ihre Krankheit nicht und verschrieben ihr Beruhigungsmittel. Sobald ich nach Hause kam, befahl Papa mir, mich zu ihr ans Bett zu setzen, und ging, um das Geschäft aufzusperren. »Leiste ihr ein paar Stunden Gesellschaft, ich muss arbeiten«, murmelte er leise, ohne mich anzusehen. Nach einem Monat stellte er für sie ein Feldbett mitten ins Esszimmer, damit sie ein wenig Unterhaltung hatte und nicht allein vor sich hin klagen musste.
An einem dieser Tage habe ich es erfahren. Ich kam von der Schule heim, und Tella deutete auf ein Brötchen mit Gulasch, das ihre Kusine vorbeigebracht hatte. Ich biss hinein und wartete, dass sie etwas sagte. Um einen Satz zu beenden, musste sie mehrmals Luft holen.
»Dein Vater und ich haben gestritten. Wegen deiner Mutter«, schnaufte sie. Ich aß weiter. »Hast du gehört?«, sagte sie mit verschrumpelten Lippen. »Du bist nicht von mir.«
»Von wem dann?« Jetzt konnte ich nicht mehr weiterkauen.
»Der Uhrmacher ist dein Vater, aber die Frau habe ich nie gesehen, ich weiß nicht, wer sie ist.«
Von diesem Tag an habe ich sie nicht mehr Mama genannt. Es war mir egal, dass sie im Sterben lag, ich wollte nicht mehr in ihrer Nähe sein.
»Warte doch mal, Mattia«, sagte sie am nächsten Tag und hielt mich am Arm zurück. »Ich wollte dir gestern nicht dein Mittagessen verderben, aber dein Vater hätte dir das bestimmt nie gebeichtet. Ich fand, es wäre unrecht, wenn ich dir die Wahrheit verschweige. Ich habe dich genauso geliebt wie Adriano.«
Als sie starb, war sie noch keine fünfzig. Hätte sie länger gelebt, hätte sie mich bestimmt auf den rechten Weg geführt, das weiß ich. Ich hätte mich nicht so viel auf der Straße herumgetrieben, sondern vom Nachmittag bis zum Abend über den Büchern gebrütet. Vielleicht hätte ihre Hartnäckigkeit mich woanders hingezogen, und mein Leben wäre nicht so verlaufen, sondern anders, aber richtig vorstellen kann ich mir das nicht.
Heute habe ich fast gar keine Erinnerung mehr an sie. Nur an ein paar Sprüche, wie: »Es kommt eine Zeit, da machen wir aus den Helmen der Soldaten Blumentöpfe.« Oder: »Die Seele ist die Schublade, in der man die Dinge aufbewahrt, die andere nicht wissen dürfen.« Ich weiß nicht, warum mir ausgerechnet dieser Satz im Gedächtnis geblieben ist, denn die Seele bedeutet mir nichts.
Zwei
Ich hatte erwartet, an ihrem offenen Sarg meinen Bruder wiederzusehen, doch in der Tür war nur der Postbote erschienen, atemlos und mit einem Telegramm in der Hand:
unmöglich rechtzeitig zu schaffen STOPP bin mit meinen tränen bei euch STOPP trage sie für immer in meinem herzen so wie ihr in euren STOPP küsse von = adriano
Am selben Abend setzte ich mich an den Schreibtisch und fragte ihn in einem Brief, was er über »diese Frau« wisse, Tella habe mich in alles eingeweiht, er müsse sich nicht länger verstellen. »Ich verlange, dass du mir alles erzählst, ich habe ein Recht darauf!« Jeden Tag steckte ich die Hand in den Briefkastenschlitz, aber es kam keine Antwort von Adriano. Als sie schließlich doch kam, bestätigte er nur, dass ich tatsächlich der Sohn einer anderen sei, deren Namen er aber nicht wisse. »Unser Vater hat immer alles abgestritten, und mir hat er strikt verboten, darüber zu reden.«
Ich schrieb ihm weitere Briefe, aber ohne Erfolg. Nur einmal gab er etwas preis. Dass er gut daran getan habe fortzugehen, schrieb er, und dass Mama und Papa ihm nicht fehlten, weil er ihre Träume und Gedanken nie geteilt habe. Sehnsucht nach Triest verspüre er auch keine. »Aber Amerika, Mattia … Amerika ist eine andere Welt. Amerika gehört denen, die hier geboren wurden, genauso wie denen, die hier neu ankommen, keiner träumt davon, es für sich allein zu haben.« Doch diese Seiten überflog ich nur, seine Worte bedeuteten mir nichts, weil sie mir nicht enthüllten, wer meine Mutter war. Was er über sein Leben schrieb, fand ich nicht der Rede wert, am nächsten Tag hatte ich es schon vergessen.
Bei meinem Vater, dem Uhrmacher, durfte ich nicht so direkt sein, da musste ich auf die richtige Gelegenheit warten. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass es nur einen Weg gab: ihn in die Enge treiben. Jeden Tag wartete ich auf den geeigneten Moment, um ihn dazu zu bringen, endlich den Namen auszuspucken, aber die Monate vergingen, und der Moment ergab sich nie. Er war so schwer fassbar und so schweigsam, dass er mir den Mut nahm, ihn zur Rede zu stellen. Ich wusste nicht, ob er wegen Tella litt oder ob er nur Theater spielte, um mir aus dem Weg zu gehen. Irgendwann beschloss ich, meine Mutter auf eigene Faust zu suchen.
Sonntags nahm Papa mich auf seinen Spaziergang mit und kaufte mir, als ob ich noch ein kleiner Junge wäre, eine Stange Lakritz, an der ich lustlos herumkaute. Nie erzählte er eine Geschichte, nie machte er einen Witz. Nur meine Schulnoten wollte er wissen. Wenn er auf der Straße Sprachen oder Dialekte hörte, die er nur schwer verstand, oder fremde Gesichter sah, paffte er an der halben Toscano, die er immer im Mund hatte, ging ihnen nach und lauschte den Gesprächen. Dann drückte er meinen Arm und sagte mit einem schmalen Lächeln: »Triest gehört allen.«
Ich konnte diese Spaziergänge nicht ausstehen, und wenn sie nicht ans Meer führten, hatte ich nur einen Gedanken: so schnell wie möglich zurück nach Hause zu kommen und in den Hof zu gehen, wo ich, isoliert in meiner Stille, Freude daran fand, Insekten und anderes Getier zu quälen. Den Eidechsen schlitzte ich mit einem Stein die Bäuche auf, den Fliegen riss ich die Flügel aus, versengte die der Schmetterlinge mit einem Streichholz.
Während wir unser eintöniges Leben führten, fuhren andere Väter und Söhne an die Front, und wir schätzten uns glücklich, dass der Krieg uns nur streifte. Papa, der infolge eines schlimmen Unfalls auf einem Bein hinkte, wurde natürlich nicht eingezogen, während ich, da die Schule irgendwie weiterlief, in der Stadt bleiben konnte und zu Hilfsdiensten herangezogen wurde. Die Schüler hatten genau festgelegte Aufgaben: Ernesto trug zusammen mit den Besten die Post der Einberufenen an ihre Familien aus; ich und die Stärkeren schleppten Verwundete. Die verstümmelten Körper und ihr Wehklagen berührten mich so wenig wie das erstickte Zischen der Eidechsen.
Am Tag der Abschlussprüfung war es drückend heiß, alle schwitzten in ihren Hemden. Alle außer mir. Mein entschlossener Blick und mein zusammengepresster Kiefer schüchterten meine Klassenkameraden ein und hielten die Lehrer davon ab, mich zu korrigieren. Als doch einer wagte, etwas anzumerken, fuhr ich ihm über den Mund: »Ich habe die Geschichte so gelernt und glaube nicht, dass ich das falsch verstanden habe.«
Nachdem der Letzte der Klasse die Prüfung abgelegt hatte, gingen wir in eine Trattoria in San Giusto, wo wir Schinken und Semmelknödel aßen. Dazu tranken wir Karaffen mit Rotwein und kleine Gläser Grappa. Beschwingt, die Jacken überm Arm und die Hemdsärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt, nahmen wir die Straßenbahn und fuhren nach Barcola, wo wir alle gemeinsam im Meer schwammen. Die Kleider ließen wir am Strand zurück wie einen Haufen Lumpen. Wir blieben im Wasser, bis die Sonne unterging und es schwierig wurde, über die dunklen Wellen zu springen. Während ich mich etwas abseits anzog, beobachtete ich die anderen, die Holz fürs Lagerfeuer aufschichteten. Ich wusste, dass ich sie nie wiedersehen würde.
Auch mit Ernesto ist es am Meer zu Ende gegangen. An einem Frühlingstag wie so viele andere. Während er mir von einem Traum erzählte, hörten wir von ferne Schreie. Sie kamen aus dem Meer, das plötzlich rau geworden war. Ein Mann strampelte im Wasser, Ernesto wollte sich in die Wellen stürzen, um ihn zu retten.
»Ich bleibe hier«, erwiderte ich.
»Mach schon, du schwimmst viel besser als ich«, sagte er, als ich mich nicht rührte.
»Er kann sich doch an die Felsen festklammern.«
»Feigling!«, erwiderte er und spuckte auf die Steine.
Ich sah ihn hasserfüllt an, zog mein Hemd aus und sprang vor ihm ins schäumende Wasser. Wir packten den Mann und legten ihn am Strand ab. Er war alt. Aus nächster Nähe schaute ich ihm in seine verstörten Augen, die Muskeln unter seiner schlaffen Haut waren noch immer angespannt. Ernesto und ich umarmten uns mit pochenden Herzen, die sich nicht beruhigen wollten. Keiner brachte ein Wort heraus. Ich erinnere mich an diese Umarmung, an unsere aneinanderklebenden Brustkörbe, die sich im Rhythmus unseres keuchenden Atems voneinander lösten und wieder zusammenkamen. Ich erinnere mich auch, dass meine Hose noch klatschnass war, als ich wegging, und ich das Hemd in der Hand hielt. Er blieb zurück, um auf Hilfe zu warten.
Seit jenem Tag sind wir uns fremd geworden, ich weiß nicht, warum. Vielleicht hat es auch nichts mit diesem Tag zu tun oder mit dem Krieg und dem Ende unserer Schulzeit: Die Wahrheit ist, dass er und all die anderen gern unter Menschen waren, während sie mir gleichgültig waren. So war ich als Junge, und so bin ich geblieben. Ein Einzelgänger.
Nach dem Krieg gab es Österreich-Ungarn nicht mehr, wer hätte das gedacht. Triest wurde italienisch, und im Karst, der zum Schützengraben geworden war, wimmelte es von Stahlsuchern, die abends mit Jutesäcken voller Metall von der Höhe in die Stadt herunterkamen.
Meine Schulkameraden hatte ich schon vergessen, wenn ich einen erkannte, grüßte ich ihn aus der Ferne. Ich wollte mich lieber den Schwarzhemden anschließen, die man auf einmal überall sah, wie die Herren der Stadt führten sie sich auf. Ich beneidete sie sofort: Die kennen keine Einsamkeit und Langeweile, dachte ich, wenn ich sie durch die Straßen poltern sah. Aber ich schien nicht zum Schwarzhemd geboren, wenn ich einem gegenüberstand, wurde ich ganz verlegen und gar nicht bemerkt. Ernesto hatte immer versucht, mich aus meiner Lethargie zu reißen. Er wollte mir helfen, meine Mutter zu finden, aber ich merkte schnell, dass er nicht daran glaubte: Ohne ein Foto oder einen Namen, fand er, sei es unmöglich, sie aufzuspüren. Dann lassen wir es eben, antwortete ich und machte mich allein auf die Suche, niedergeschlagen und mit einer Zigarette im Mundwinkel. Der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühlte, waren die Straßen und Plätze dieser Stadt, die unter einer Fahne in den Krieg gezogen und unter einer anderen wieder herausgekommen war. So wie ich geglaubt hatte, Tellas Sohn zu sein, und in Wahrheit das Kind einer Unbekannten war.
Bis in die entlegensten Stadtviertel drang ich vor, klebte wie eine Spinne mit den Fingern an den Türen der Läden und kletterte auf Fensterbänke, um in die Wohnungen zu spähen. Manchmal blieb ich die ganze Nacht draußen, schlief in Scheunen und stieg bei Tagesanbruch auf den Wagen eines Bauern, der von der Feldarbeit kam. Diejenigen, die mich ansprachen, konnten mir kein Alter geben, einige sagten, meine grünen Augen und meine glatte Haut seien die eines Kindes, andere fühlten sich unwohl, konnten meinem Blick nicht standhalten, als wären die kindlichen Züge, die mir noch im Gesicht geblieben waren, ein Zeichen von Wahnsinn.
Oder ich lieh mir ein Fahrrad und radelte einen halben Tag lang herum, hielt an, um unter einem Baum die Früchte zu essen, die ich in eine unter meinem Hemd geknotete Serviette gewickelt hatte. Bis in die von den Slowenen bewohnten Dörfer fuhr ich – nach Poverio, nach Cosina … – und fragte dort, ob jemand eine kenne, die um die Jahrhundertwende ihr Neugeborenes weggegeben hatte, oder wenigstens eine, die mir ähnlichsehe. Ich strich mir die Haare zurück, um meine Gesichtszüge besser zeigen zu können. Die Bäuerinnen lehnten sich an ihre Spatenstiele und sagten, ich hätte ein Engelsgesicht, oder sie zogen erschrocken den Kopf zurück, ehe sie lächelten, erstaunt, dass ich ihre Sprache sprach. Sie hatten schiefe Zähne und Falten um den Mund, junge Gesichter, die schon von der Arbeit gezeichnet waren. »Deine Mutter hat sich bestimmt mit einem Faschistenschwein eingelassen!«, sagten sie, oder sie schüttelten einfach nur den Kopf. Oft schenkten sie mir Trauben, ich aß sie, während ich enttäuscht nach Hause fuhr und die Kerne ausspuckte.
Ich weiß nicht, warum, aber ich redete mir immer mehr ein, meine Mutter müsse Slowenin sein. Vielleicht wünschte ich mir, dass sie dieselbe Anmut hätte wie Ksenija, vielleicht erschien es mir auch nur natürlich, dass sie von außerhalb kam, nicht aus der Stadt.
Auf dem Rückweg stellte ich mir vor, wie es sich damals mit uns abgespielt haben musste. Ein Sommermorgen, sie nimmt mich auf den Arm und verlässt das Haus. Die ganze Nacht hat sie kein Auge zugetan. Sie frühstückt nicht, trinkt nicht mal ein Glas Wasser. Auf der Suche nach ihrer Brust tasten meine winzigen Finger über ihr Unterhemd, aber sie hält meine Händchen weg von ihrem Kleid und geht rasch weiter. Grausamkeiten erledigt man besser schnell. Immer wieder muss ich an diesen Moment denken: Hat sie mich auf dem Treppenabsatz abgelegt oder vor der Uhrmacherei? Bestimmt habe ich verzaubert auf den Türgriff aus Messing gestarrt, bis Tella, deren Geruch mich sofort stört, mich hochnimmt und hineinträgt. Vielleicht habe ich auch mit großen Augen ein schwingendes Pendel im Schaufenster verfolgt, bis mein Vater endlich das Wimmern bemerkte. Als er mich aufhebt, begreift er, dass er sie für immer verloren hat.
Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich im Geschäft kennengelernt haben. Sie, viel jünger als er, der damals schon Anfang dreißig war, auf der Suche nach einem neuen Armband für ihre Uhr. Sie tritt ein und wird neugierig auf diese emsige Ameise, meinen Vater. Ein paar Tage später kommt sie unter dem Vorwand einer kleinen Reparatur wieder. Nanni – wie alle ihn nennen – hat sie schon erwartet, und als die Tür aufgeht, sieht er zum ersten Mal von seiner Arbeit auf. Ja, zweifellos war sie es, die den ersten Schritt gemacht, sich immer mehr an diesen freundlichen und schweigsamen Ladenbesitzer gebunden hat. Sie mag diese jungenhafte Geste, mit der er sich ständig die blonden Haare aus der Stirn streicht, die ihm widerspenstig ins Gesicht fallen, sobald er sich vornüberbeugt, um »die Zeit zu reparieren«, wie er sagt. Eines Tages dann muss er sich ein Herz gefasst haben, hat auf seine Frau und den Tratsch der Triester gepfiffen und sie ins Caffè degli Specchi ausgeführt. Der Flügel mit seinem komplizierten mechanischen Innenleben erinnert Nanni an seine Uhren, und das beruhigt ihn. Mit der Musik im Hintergrund, umgeben von den matten Fensterscheiben und gusseisernen Tischchen mag es ihm leichter gefallen sein, ein wenig von sich preiszugeben. Vielleicht haben sie eine Schokolade getrunken – es war Winter, die Bora wehte so heftig, dass man sich festhalten musste –, und später, in dem nach Leder riechenden Hinterzimmer des Geschäfts, wird er sie sanft genommen, ihre Hüften mit seinen mageren und rastlosen Händen umfasst haben. Und während sie sich mit ihren glatten Ellbogen auf seine Werkbank stützte, inmitten all der Zangen und Scheren, die auch einem Chirurgen hätten gehören können, haben sie sich im Stehen geliebt. Bis ich, ohne dass sie es ahnten, zu existieren begann.
»Zieh deine Schuhe aus, und geh.«
Unter den Fußsohlen spüre ich nicht mehr Asphalt, sondern Grashalme und spitze Steine.
»Geh!«, wiederholen sie und schlagen mir auf den Rücken.
»Macht schnell.«
»Du wirst genug Zeit haben, um dein Leben an dir vorbeiziehen zu lassen«, antwortet eine Stimme, die ich wiedererkenne.
Drei
Mein Vater sagte, ich solle genauer auf die Leute achten. Überall in Triest begegnete man jetzt Gesichtern, die nichts Gutes versprachen, Abenteurern und traumatisierten Kriegsheimkehrern.
Damals trieb ich mich mit Piero Tonetti in der Stadt herum, dem Schrecken meiner Schule: Einen aus der Klasse hätte er beinahe mit bloßen Händen erwürgt, wegen einer harmlosen Bemerkung. Mich hatte er Gott sei Dank nie auf dem Kieker gehabt, obwohl ich die ganze Schulzeit über ein Außenseiter gewesen war. Aber Tonetti war auch einer, auf den man sich verlassen konnte. »Alles Schwarzhemden, wie ich«, sagte er eines Abends, als er mich seinen Freunden vorstellte und eine Runde ausgab.
Sein Vater nahm ihn seit einiger Zeit mit zu den Treffen ehemaliger Arditi und Nationalisten, die sich für die Eroberung von Fiume, die Schriften D’Annunzios und das Vaterland begeisterten und gegen Arbeiter und Gewerkschafter, Kroaten und Slowenen hetzten, immer mehr von denen gebe es in der Stadt, wollten keine Fischer und Bauern mehr sein. »Die S’ciavi muss mal einer spüren lassen, wo ihr Platz ist! Ab hinter die Grenze mit denen, alle!« Und er war beileibe nicht der Einzige, der so dachte. Manchmal hörte man auch die Alten so reden, die noch unter den Habsburgern aufgewachsen waren, aber nie so hasserfüllt wie die Faschisten. Die Slawen bekamen diese Beschimpfungen auf der Straße zu hören, gingen aber meist nicht auf die Provokation ein. Triest gehört auch uns, sagten ihre trotzigen Gesichter.
Eines Abends nahm Tonetti mich mit zu einer solchen Zusammenkunft. Ein rauchgeschwängerter Keller in einer Gasse der Altstadt, es wurde gebrüllt und mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Ich saß schweigend dabei und trank Rotwein. Verglichen mit meinem Vater waren das hier ordinäre Leute. Als einer fragte, ob ich bei ihnen mitmachen wolle, nickte ich. Da rückte er mit seinem Stuhl näher und erklärte mir, die Schwarzhemden aus Julisch Venetien seien die stärksten in ganz Italien und zu Taten bereit, die sogar bei Mussolini Eindruck machen würden.
»Bald machen wir was, daran wird diese Stadt sich noch lange erinnern!«, rief er und kippte den Grappa, als wäre es Medizin.
Ich richtete meinen Hemdkragen: »Ich bin dabei, aber ihr müsst mir auch helfen.«
»Gar nichts müssen wir«, fuhr ein alter Mann dazwischen.
»Ich suche meine Mutter. Ich habe sie nie kennengelernt, ich weiß nicht mal, ob sie Italienerin ist.«
»Bei deinem Gesicht glaube ich kaum, dass sie Italienerin ist«, spottete der Alte.
»Und wenn schon«, unterbrach der Erste. »Du hilfst uns, und wir helfen dir.«
»Ihr wollt mir wirklich helfen?«, fragte ich in kindlichem Überschwang und biss mir sofort auf die Zunge.
»Natürlich! Wir sind doch keine Sozis!«
Alle lachten.
Wir redeten draußen weiter, unten war es zu stickig. Die frische Luft roch nach Regen, und ich atmete sie gierig ein. Ich teilte ihre Verachtung für den Bolschewismus, die Gewerkschaften, die Roten in der Emilia Romagna und selbstredend auch für die S’ciavi, die wieder in die Höhlen verschwinden sollten, aus denen sie gekrochen waren. Aber seit ich mir in den Kopf gesetzt hatte, meine Mutter sei Slowenin, kam mir dieses Wort nicht mehr über die Lippen.
Tonetti packte mich am Arm und schüttelte mich, als wollte er mir die Zweifel nehmen. »Du hast jetzt Brüder, du kannst dich freuen.«
Plötzlich erhob sich ein Wind und fegte den Mond frei, der hoch über dem Meer hing. Ich stand da und betrachtete die stille Stadt über den Wellen. Wie majestätisch Triest dalag, der Adria offen zugewandt.
Ein paar Zigaretten noch, dann ging ich nach Hause. Ich stellte mir vor, wie ich im Café an einem Tischchen mit ihr saß und sie mich die ganze Zeit ansah, bis ihr Espresso kalt geworden war.
»Ich bestelle dir einen neuen, Mama.«
Ohne Tella herrschte im Haus öde Stille. Zu ihren Lebzeiten waren die Zimmer vom Geräusch ihrer Schritte und ihrem leisen Trällern erfüllt gewesen. Ich erinnere mich, wie sie sich über das Fensterbrett lehnte und mit den Passanten unterhielt oder wie sie vor dem Käfig mit dem Kanarienvogel die Zeit verbummelte.
»Führst du Selbstgespräche?«, fragte ich sie.
»Ach, mit dem Piepmatz hier kann man sich leichter unterhalten als mit dem Uhrmacher«, gluckste sie.
Immer roch es gut nach Essen, und der Boden war spiegelblank, weil sie ihn auf Knien gewienert hatte. Unermüdlich war sie: Frühmorgens hängte sie Decken und Kissen zum Fenster hinaus, polierte die Gläser mit Essig, damit sie glänzten, wischte über die Vitrine mit den Uhren und die Rahmen der Fotografien. Zum Frühstück blitzte alles, und der Duft des Milchkaffees legte sich freundlich über den Geruch der kalten Luft von draußen. Die Hausarbeit nahm ihr die trüben Gedanken.
Aber schon wenige Tage nach der Beerdigung hatte Papa die Wohnung in eine Werkstatt verwandelt. Ungelüftet, roch sie jetzt abgestanden, es war, als lebte man im Museum. Nichts durfte man berühren. In einem Koffer brachte er die zu reparierenden Uhren herauf und arbeitete bis spät am Nähmaschinentisch, im marmornen Aschenbecher die halbe Toscano. Daneben ein Glas Rotwein, der mit Sprudel verdünnt war, und eine schummrige Lampe, die mehr Schatten spendete als Licht.
»Wenn du so weitermachst, wirst du noch blind«, sagte ich und warf die Jacke über den Stuhl.
»Wo warst du?«, entgegnete er, ein Armband an einen Korpus schraubend.
»Unterwegs.«
»Manchmal kommen Leute ins Geschäft, die nichts kaufen wollen.«
»Wie meinst du das?«
Er verzog nur das Gesicht und konzentrierte sich auf die Arbeit.
»Hast du schon zu Abend gegessen, Papa?«
»Brot und Käse, mehr mag ich nicht.«
Ich setzte mich neben ihn. Er nannte die Werkzeuge, ich reichte sie ihm. In allen Einzelheiten beschrieb er, wie man diese oder jene Reparatur auszuführen hatte, und ich hörte zu und versuchte mir die einzelnen Schritte einzuprägen. Aus dem Deckel einer Zwiebeluhr hatte er eine Fotografie gelöst: zwei junge Männer in Militärkleidung. Gut möglich, dass sie im Karst gefallen waren und dies die Uhr des trauernden Vaters war.
»Mitternacht«, sagte er plötzlich und packte die Sachen in die Schublade. »Gehen wir schlafen.«
Früher oder später würde ich den Mut aufbringen, würde mich nicht länger von diesem Schweigen und dieser Verstocktheit einschüchtern lassen. Dann würde ich von ihm Auskunft über meine Mutter verlangen, ihn zwingen, mir alles zu erzählen und mich zu ihr zu bringen.
Ich folgte ihm ins Schlafzimmer. Er legte sich auf die Seite seiner Frau neben der Waschschüssel aus Majolika. Ohne die schmutzigen Kleider vom Tag auszuziehen, ließ ich mich neben ihn aufs Bett fallen. Noch nie hatten wir im selben Bett geschlafen. Als draußen vor dem Fenster der Morgen dämmerte, hörte ich ihn im Schlaf reden.
Den ganzen Sommer über machte ich mit Tonetti und den Schwarzhemden die Stadt und ihr Umland unsicher. Unser Ziel waren die Arbeiter und ihre Organisationen. Der Plan war immer derselbe: Provokationen und Schläge. In drei Lastwagen und mit reichlich Männern fuhren wir nach Pola, wo wir uns vor der Arbeiterkammer versammelten und schließlich die Türen aufbrachen. Damals riefen die Arbeiterführer ständig Streiks aus und hetzten die Menschen auf den Plätzen auf. »Jetzt bringen wir euch mal vaterländische Gesinnung bei«, brüllten wir, und schon brach eine wilde Schlägerei aus. Meist waren wir besser bewaffnet als sie. Die Direktoren der Fabriken und Versicherungen bezahlten uns dafür, dass wir uns die Hände schmutzig machten und die Ordnung wiederherstellten. Keine Gefahr einer roten Revolution mehr und keine S’ciavi mehr: Nur noch Italiener, das wollten sie. Und da sie wussten, wie es in der Welt zugeht, wussten sie auch, dass gewisse Dienste gut entlohnt werden mussten. Trotzdem lief es nicht immer glatt. Auch die Arbeiter wussten sich zu wehren, und mehr als einmal waren sie drauf und dran, uns alle Knochen zu brechen. In Monfalcone wollten sie uns mit Nagelbrettern die Augen ausstechen: Davon trage ich noch eine lange Narbe an der Wade. An diesem Tag waren sie viel zahlreicher als erwartet. Sie umzingelten uns, drei stießen mich gegen eine Mauer und schlugen auf mich ein, bis ich ohnmächtig wurde. Erst nachdem sie mehrmals in die Luft geschossen hatten, gelang es meinen Kameraden, mich auf einen Laster zu laden und zu fliehen, sonst wären wir nicht mit dem Leben davongekommen. Normalerweise aber waren wir die Angreifer und sie diejenigen, die hinterher blutüberströmt am Boden lagen, und den ganz Aufsässigen unter ihnen flößten wir Rizinusöl ein.