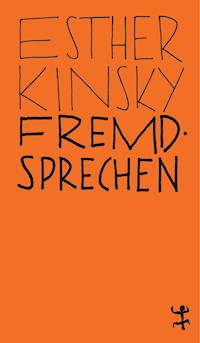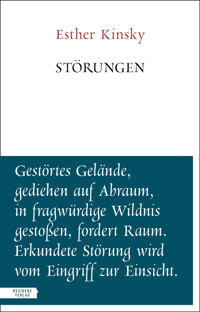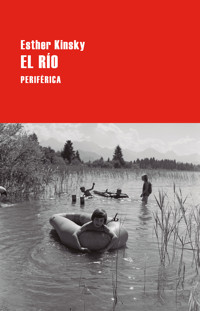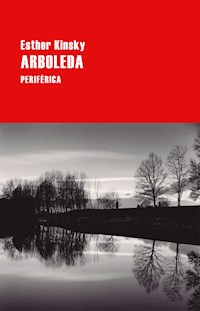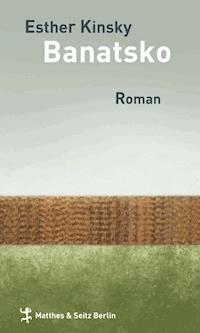
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Banatsko ist die Feier einer Landschaft, des nördlichen Banat. Noch nie wurde dieses Niemandsland zwischen Ungarn, Serbien und Rumänien mit einem so liebenden Blick betrachtet, seine melancholische Poesie so zum Blühen gebracht wie in diesem neuen Roman von Esther Kinsky. Während der Leser sie in die halbverfallenen Straßenzüge Battonyas und die sie überwuchernde, sirrende und flirrende Natur begleitet, erzählt sie von einem alten Kino, den Kontakten zu den Dorfbewohnern, einer Liebschaft und der langsamen Eroberung des eigenen Zuhauses in dieser neuen Welt. Vom Rhythmus ihrer Sprache getragen wird der Alltag im ländlichen Banat zum Erlebnis, Kinsky macht ihn hörbar, riechbar. In aller Stille ereignet sich dabei Welt: Den Worten und Dingen wird eine Bedeutung verliehen, die aus der langsamen Annäherung an die fremde Sprache erwächst. Durch genaues Hinsehen wird Einzelheiten auf den Grund gegangen, mit einem Blick, der den Schmerz, der den Dingen innewohnt, mitfühlt, ihn aber nicht beklagt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir alle kommen von irgendwoher und wir alle gehen weiter irgendwohin, weil wir Menschen sind.
László Darvasi, ›Die Legende von den Tränengauklern‹
Esther Kinsky
BANATSKO
Roman
Die Autorin bedankt sich bei der Robert Bosch-Stiftung für die großzügige Förderung im Rahmen des Grenzgänger-Programms.
Erste Auflage 2011
© 2011 MSB Matthes & Seitz Berlin
Verlagsgesellschaft mbH
Göhrener Str. 7, 10437 Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Falk Nordmann, Berlin
www.matthes-seitz-berlin.de
eISBN: 978-3-88221-575-5
INHALT
Battonya – Der Aufenthalt – Stadt – Battonya – Stadt – Battonya – Das frühere Land – Battonya – Der Akkordeonspieler – Battonya – Der Melonenwächter – Battonya – Stadt – Mezöhegyes – Battonya – Das frühere Land – Battonya – Totenland – Határ – Battonya – Warten – Battonya – Der Fleischer – Turnu – Das Werk – Battonya – Hunger – Der Zaun – Arad – Stadt – Arad Nou – Covasinţ – Der Apfelbaum – Battonya – Die Reisen – Krähenland – Kanijža – Battonya – Das Meer – Gottlob – Grabaţ – Lenauheim – Der Fisch – Jimbolia – Frontiera – Battonya – Granica – Bočar – Pađej – Die Fischsuppe – Senta – Stadt – Battonya – Die Mongolei – Halta Aranca – Arad – Battonya – Die Liebe
BATTONYA
Es war Sommer, als ich nach Battonya kam. Die Eisenbahnstrecke war zu Ende. Die Gleise versickerten ein paar hundert Meter weiter in Gestrüpp und Schotterhaufen. Der Bahnhof war klein und alt, der gelbe Putz blätterte ab. Die Bahnsteigveranda trug ein holzgeschnitztes Giebeldach, blaugrün und verwittert. Im Giebel stand ›Battonya‹. Drähte hingen aus den Metallbuchstaben, als wäre der Name früher in der Dunkelheit erleuchtet gewesen.
Auf der Veranda saßen zwei Männer in hellblauen Hemden. Bitte Ihre Papiere, sagten sie. Sie betrachteten meinen Ausweis und zeigten auf die Straße, die in den Ort führte. Dann drehten sie den Oberkörper und machten in schönem Einvernehmen eine träge Gebärde mit dem Arm. Dort, sagten sie wie aus einem Mund, dort ist die Grenze und dahinter schon das andere Land. Ihre Hände wiesen dabei ungefähr auf ein Feld, auf dem Klatschmohn blühte.
Der Fahrplan im Warteraum war sorgfältig handgeschrieben und zeigte sechs Züge an, die ankamen und abfuhren. An dem kleinen Schalterfenster saß eine Frau mit übereinandergelegten Händen. Sie nickte freundlich, schaute in den Warteraum, in dem eine zerkratzte Holzbank stand. Wahrscheinlich konnte sie von ihrem Schalter aus auch durch das Fenster des Warteraums auf die Veranda blicken und zwischen den Pfosten der Veranda hindurch auf ein Stück der Gleise, das Ende des Zuges und das dahinterliegende Gestrüpp. Ein Streifen Sonne lag auf ihren Fingerknöcheln.
Am Fenster summten Fliegen. Hinter der Kassenkammer stand eine Glastür offen. An einem Kleiderständer hing eine Jacke. Die Fliegen zogen ihre Kreise um eine dreiarmige Lampe an der Decke. Ein Radio murmelte und aus der Ferne, wie aus der Tiefe weiterer Räume, hörte man eine Frau auflachen.
Vor dem Bahnhof blühten magere Blumen in einem kleinen Vorgarten, zwei kleine Kinder in Unterhosen winkten hinter dem Zaun. Auf dem verwitterten Schild neben dem Bahnhofseingang stand ›Bahnhof‹ auf Ungarisch, Serbisch und Rumänisch.
Ich trug schwer an meinem Koffer unter dem Gebell der Hunde, die hinter den hohen Hoftoren anschlugen. Katzen hockten rundbucklig im Gras am Straßenrand. Vor einer geöffneten Kneipentür war ein Rollstuhl umgekippt, in der Kneipe saßen Männer still an hellen Tischen und starrten mit starr hochgerecktem Kopf aus der Tür oder dem Fenster. Die Frau an der Theke fuhr mit der Hand auf und ab über den Bauch einer Getränkemaschine.
Alle Straßen verliefen schnurgerade, und am Ende jeder Straße lag der Horizont. Fahrräder, Fuhrwerke, Autos kreuzten das Blickfeld, tauchten auf, verschwanden, langsame, bewegliche Figuren auf einem großen Panorama. Ich sah mich selbst mit meinem Koffer gehen, das Blickfeld eines anderen kreuzend, eines Mannes, einer Frau, eines Kindes, die unter der an die Stirn gelegten Hand Ausschau hielten, werweißwonach, die gingen, fuhren, standen, verharrten, die sich anschickten fortzugehen oder einen Heimkehrer erwarteten. Hier, wo alle Straßen in die Ferne führten, schien das Gehen, Sehen, Kreuzen des Blicks eine unaufhörliche große Bewegung, ein Schaukasten des leisen Welttheaters, ein Aufziehspiel, das nie zu Ende ging.
Dünner Staub bedeckte alles, bei jedem Schritt wirbelte eine kleine Wolke empor, ein Wind kam auf, kleine Trichter bildeten sich, schwebten dicht über dem Boden. Sand kreiselte um ein vorzeitig abgefallenes trockenes Blatt, ein Zigarettenstummel gesellte sich in den Strudel, ein Schokoladenzellophan, ein Lospapier. Wenn der Wind sich legte, sackten die Wirbel in sich zusammen.
Am Abend wurde die Luft klebrig vom Geruch der Lindenblüten. Paare glitten durch den lauen Dämmer, Männer führten auf dem Fahrrad ihre Liebsten aus, die auf der Querstange saßen. Die Frauen hatten eine anmutige, reglose Haltung eingenommen, die Beine artig aneinandergelegt und ausgestreckt, die Hände um kleine Handtaschen gefaltet. Die Taschen hielten sie an den Bauch gepresst. Aus Kneipen fiel Licht auf den Schotter oder das Stück Straße davor, die Gäste schauten, lachten, schwiegen, halb drinnen, halb draußen, hier und da spielte Musik. Vor einem geschlossenen Zeitungskiosk an einer großen leeren Kreuzung lehnten sich junge Männer an ihre Autos und zerhackten die Klänge aus den Autoradios mit ihren Rufen. Jemand fuhr davon, ein anderer kam an, der Davonfahrer kehrte in einer Schleife zurück.
Der Sonnenuntergang hatte einen schmutzigen Streifen am Horizont hinterlassen. Ich fand ein Quartier kurz bevor ein Gewitter aufzog. Es donnerte lange von ferne, der Wind blähte sich auf und erschlaffte dann wieder. Die Nacht war voller Geräusche, die nirgendwo ganz hingehörten, nicht zu Luft, nicht zu Wasser, nicht zu Erde. Dann schlug ein Blitz mitten in die schwere Nacht, es begann zu regnen, und der Regen hing wie Tücher vor dem Fenster, die Tücher wurden hin und her gezogen, ein Vorhang ohne Bühne, ohne Publikum, ohne Drinnen, ohne Draußen, und alles sog Nässe in sich auf. Hinter dem Haus floss der Fluss.
DER AUFENTHALT
Vor langer Zeit einmal fuhr ich durch gebirgiges Land. Es war Sommer, die Tage waren sehr heiß, der Himmel blau, manchmal hitzeweiß, am Abend vielfarbig über einem Gebirge. Fliegen summten im Abteil, die Reisenden dösten. An jeder kleinen Station hielt der Zug, immer mehr Leute stiegen ein. Frauen mit Körben, Männer mit Taschen, Familien mit Koffern, alte Ehepaare mit Vogelkäfigen. Bahnhofsvorsteher hoben und senkten die Arme und stießen in ihre Pfeifen. Angekommene lagen in den Armen derer, die sie erwartet hatten, oder hievten einsam großes Gepäck über die sommermüde Erde an den kleinen Bahnhöfen vorbei. Zurückbleibende winkten oder starrten suchend in die Fenster des zögernd anfahrenden Zugs.
Ich teilte ein Abteil mit zwei jungen Männern, die am Fenster saßen und unter stetem leisem Gespräch ein Picknick verzehrten, einer alten Frau in einem schwarzen Kleid und dicken schwarzen Wollstrümpfen, einem Geschäftsreisenden mit einem flachen Koffer und einer Goldkette um den Hals, einer fleckhäutigen Frau, die in einem zerfledderten Buch las, einem dunkelhaarigen Herrn mit vielen Goldzähnen, die er beim Gähnen blitzen ließ, und einem Mann in heller Ausflugskleidung. Am Fenster des Abteils klebte eine Fotografie, über die schon oft gewischt, gerieben und gekratzt worden war, zwar ließen sich noch die ungefähren Züge eines Gesichts erkennen, doch nicht mehr, ob es sich um das Bild einer Frau oder eines Mannes handelte. Es war so dünn geworden, dass die Schatten der vorbeiziehenden Bäume und Telegrafenmasten hindurchschienen.
Es wurde Abend. Auf dem Zugkorridor schlichen, hinkten und krochen Bettler mit körperlichen Gebrechen, sie schoben die Abteiltüren auf, streckten ihre Hände herein, die schmutzigen Handflächen warteten auf eine Gabe. Die jungen Männer am Fenster reichten jedem eine kleine Münze. Die meisten Bettler musterten die Geldstücke mit ungerührten Blicken, manche murmelten ein Wort, andere spuckten auf das Geld und rieben es an Hemd oder Hose. Eingefahrene Gesten wie die des Schaffners unter seiner steifen und zu großen Mütze.
Es wurde dunkel, die Lichter im Zug gingen an, und wir sahen die Spiegelbilder unserer Gesichter im schmutzigen Abteilfenster, weiße Flecken, in die hier und da das Viereck des verwischten Fotos ragte. Der Zug hielt mitten in tiefer Finsternis. Man hörte die Geräusche des Waldes. Ein Unfall!, hieß es draußen im Korridor. Eisenbahner mit grellen weißen Lampen gingen neben dem Zug auf und ab, ihre Schritte knirschten auf dem Schotter. Sie herrschten die neugierigen Reisenden an, die den Kopf aus dem Fenster streckten oder Anstalten machten auszusteigen. Unruhe machte sich breit, man wechselte Worte, mutmaßte. Die beiden jungen Männer am Fenster wurden erst ungeduldig, dann fingen sie an, Geschichten zu erzählen, um die Zeit zu vertreiben. Ihre Geschichten waren sehr kurz, und nach einiger Zeit sagten sie ins Abteil: Erzählt ihr doch auch etwas.
Die alte Frau mit den dicken schwarzen Wollstrümpfen nickte mit dem Kopf. Ich habe einen Verwandten begraben, erzählte sie.
Der Geschäftsreisende stellte sich schlafend, dabei hielt er die Hände er so fest um den Koffer geklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten.
Ich komme aus einem sehr flachen Land, sagte der Mann in Ausflugskleidung, davon kann ich hier in den Bergen etwas erzählen.
Mein Land hat weder Berge noch Meer, begann er, es breitet sich flach wie ein ausgelaufener Ozean von einem Horizont zum anderen. Im Sommer blickt man unter schräg an die Stirn gelegter Hand in die Ferne, auf den Lidern liegt das Licht und verklebt die Wimpern, der Blick schwimmt über schwarz gewordene Sonnenblumenfelder, Felder und Wiesen mit flachem, hartem, sirrendem Gras. Vögel schwirren mit kurzen Flügelschlägen, sie schimmern weißlich im Licht, dann drehen sie sich hoch oben und sind schwarz. Ihre hellen Laute erfüllen die Luft mit Wolken leiser Pfeiftöne. Hunde schleichen im Schatten der Häuser entlang. Die Katzen schlafen im Verborgenen. Man schaut und schaut und stellt sich vor, was der Horizont zu bieten haben könnte: die graublauen, an den Rändern verschwimmenden Umrisse großer Städte. Sanfte Landschaften der Vielfalt, wo man anderen Beschäftigungen nachgeht als dem Schauen. Oder Häfen, die sich zu einem bewegten Meer öffnen, mit kleinen, bunten Booten, von Bewohnern der Hafengegenden gesteuert, weißen, reglos vor Anker liegenden Schiffen, riesig wie Fabriken, mit Reihen fast in die Wolken ragender Kräne, Wänden und Türmen ausgebleichter und rostig verwitterter Kästen mit Waren, Gut und Besitz, von denen niemand mehr weiß, was angekommen ist und was noch auf Verschiffung wartet. Möwen sind dort, und erst wenn man sich die Möwen vorstellt mit ihren von Gier und Unruhe geplagten schreienden Kehlen, entdeckt man die Stille des flachen Landes, wo die Langsamkeit gedeiht.
Im Winter gibt es wenig anderes zu tun als zu schauen. Man steht am Fenster, manche hüllen sich in ihre Mäntel und treten vor die Tür, doch die schweren Mützen behindern den Blick. Alle Vögel sind jetzt schwarz und fliegen schräg und lautlos durch das Blickfeld. Hunde bellen aus ihren winterlichen Verschlägen, die Katzen schlafen auf den Fensterbänken. Die Sonnenblumen sind verschwunden. Mit bloßem Auge will man die Bilder aus der schmalen Linie des Horizonts locken, aber nichts tut sich auf. Trotzdem bleibt man stehen, sieht die kurzen Helligkeiten kommen und schwinden, fügt sich in die Nacht und liegt mit offenen Augen in der kalten Dunkelheit.
Mit der Zeit gewöhnen sich die Augen an die Leere des Winterlands und eines Morgens erkennt man, dass in der von schütterem Schnee oder dünnem Raureif überzogenen Landschaft alles – jeder Zaunpfahl und Grashalm, jede Unebenheit des brachliegenden Bodens – seinen Platz hat.
Über den letzten Worten hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt. Unvermittelt schwieg der Ausflügler, wie betreten über seine Rede. Die Frau in Schwarz schnarchte leise. Die beiden Reisenden am Fenster schienen in ihr Spiegelbild vor dem dunklen Draußen vertieft. Unter lauten Rufen sprangen die Lampenträger vom Bahnkörper auf den anfahrenden Zug.
STADT
Ich kam aus der Stadt und suchte das Weite. Überall ächzte, stöhnte, schrie und lachte es, in den schmalen Gassen prallte jedes Geräusch an den porösen Häuserwänden ab, riss kleine Stücke Mauerwerk mit sich, die im Fall zu dunklem Staub zerrieselten. Jedes Wort, jede Bewegung stieß an Grenzen. Nachts hörte man das Auf und Zu der Deckel der Abfallkübel, das Scharren und Poltern suchender Hände, gelegentlich erzitterten die Wände vom Aufprall der Schritte Fliehender. In der Stadt glänzte der Asphalt unter schlierigen Lichtern, roch es nach Unglücksfällen, brach Hunger auf. Jeder zur Schau gestellte Gegenstand mahnte an die Möglichkeit seiner Abwesenheit, jedes Vorhandensein warf den Schatten seines Fehlens, bis die Schatten die Dinge eingeholt haben würden.
Der Staub der sich unter dem unablässigen Geräuschanprall zersetzenden Häuser ließ sich in allen Poren nieder, er überzog die Speisen, rieb die Lider beim Schlafen wund und knirschte zwischen den Seiten der Bücher, trocknete das Papier aus, das brüchig und spröde wurde. Ich zog ein Buch hervor, ein kleines Heft fiel mir entgegen, zerstob im Fall zu dünnen gilbigen Blättern, die sich über den Boden verstreuten. Es war ein kleines Heftbuch mit hellem Umschlag, vertraut aus der Schulzeit.
›Von der Verwilderung des Herzens‹ stand darauf.
Ich hob ein Blatt vom Boden auf. Die Seitenränder hatten sich bis fast an den Rand der gedruckten Buchstaben verzehrt, die dunkel auf gedunkeltem Papier saßen, die Seitenzahlen waren verschwunden.
Es ist gemeinhin bekannt, dass das Herz ein Muskel ist, ein Stück Fleisch und Blut, ohne dessen stete Bewegung wir verloren wären. An der Unstetheit unseres Lebens findet es seine Erprobung. Jeder dem Gefühl zugefügte Schmerz dringt in die zähen Fasern des Herzens, dehnt sie und reißt an ihnen, und jede solche Einübung des Herzens in die Widrigkeiten der Welt hinterlässt ihre Spur in Gestalt von Aufwerfungen, Verwulstungen und Verhärtungen. Die sanfte Wölbung des Herzmuskels verzieht und verfältelt sich, wird zu einer Landschaft der Klüfte und Steilheiten, der jähen Abgründe und wenigen verbliebenen sanften Hänge, zu einer großen, unvorhersehbaren und in einem jeden Menschen anders gearteten Unebenheit.
Wenn ich mich in der Dämmerung ans Fenster lehnte, sah ich ein Stück grauen Abendhimmel. Vielleicht stand irgendwo der Mond. Tauben hockten auf den Gesimsen der Häuser, und die Steinfiguren der Fassaden sahen sanft und müde aus, mit geschlossenen Augen trugen sie die schartigen Fensterbänke und die vom Lärm zermürbten Scheingiebel.
BATTONYA
Ich blieb in Battonya und zog in ein altes gelbes Haus. Es roch nach Holz und Wein und Asche. Morgens kam mein Nachbar und klopfte ans Fenster. Mein Nachbar war ein alter Serbe namens Todor. Er trug eine Kappe zum Schutz gegen die Sonne. An der rechten Hand fehlten ihm drei Finger. Er sprach langsam, seine Augen schweiften dabei immer in die Ferne. Jeden Morgen hatte er einen anderen Ratschlag. Wenn ich etwas sagte, schaute Todor einfach durch mich und meine Worte hindurch und schwieg.
In meinem Haus hatte Todors Tante gelebt. An den Wänden hingen Fotografien schöner Frauen und stattlicher Männer, deren Gesichter sich aus dem weichen Dunst der alten Bilder neigten. In einem Raum standen Holzwannen, in denen beim Schweinschlachten das Blut aufgefangen wurde, und in einem anderen Raum Aluminiumbecken, in denen man die Trauben für den Wein gestampft hatte. Die Tante hatte ein geblümtes Sofa hinterlassen und einen kleinen runden Tisch.
Die Fenster waren mit grobem Tuch verhängt, dahinter hatten sich über die Jahre Fliegenleichen angesammelt. Das grobe Tuch war morsch geworden und riss, wenn man es berührte.
Unsere Seite der Straße war ganz serbisch, sagte Todor immer wieder. Seine Stimme klang dann stolz. Er zeigte auf den Garten hinter meinem Haus.
Das war ein Weinfeld. Wir hatten viel Arbeit damit. Der Wein braucht den Menschen, sonst wird es kein Wein.
Beim Umgraben im Garten fand ich bunte Keramikscherben. Auf dem Speicher roch es süß nach Holz, das sich mit staubiger Hitze vollgesogen hatte. Zwischen den Balken lagen Geräte, für die sich kaum ein Zweck ausdenken ließ: Metallscharniere, Holzstangen mit kleinen Radscheiben an den Enden, Eisenkanister, Stangen mit Kurbeln, schartig und gefurcht von Handhabungen, die fremden Händen in jede Faser gewachsen waren. Im Schlaf, hatte mein Großvater gesagt, wenn er von Arbeiten sprach, die weit hinter ihm lagen, das hab ich im Schlaf gekonnt.
Nachts schien der Mond in mein Fenster, ich fand keinen Schlaf.
Ich ging zu einer Näherin und brachte ihr Stoff für Vorhänge. Die Näherin hieß Rozalia, sie lebte in einem kleinen Haus am Rande des Ortes. Im Fenster lag eine Flasche mit einem Segelschiff, angeschwemmt werweißwoher in diese Ebene, wo vom Meer nur in Geschichten die Rede ist. Es war Sommer, sie hatte wenig Zeit, jetzt arbeitete sie auf den Feldern. In zwei Wochen, zeigte sie mit der Hand. In zwei Wochen solle ich wiederkommen.
Im Frühling und Sommer warteten die Tagelöhner im Morgendämmer an den Straßenecken auf die Busse, die sie auf die Felder brachten. Männer und Frauen mit morgengrauen Gesichtern rauchten, hielten sich an ihren Klapphockern, Hacken, Jausenbeuteln fest, während es zwischen Erde und Himmel hell wurde. Die Kneipen waren schon geöffnet. Männer saßen an den langen Tischen neben der Durchfahrtsstraße und tranken Bier. Die hellblauen Busse waren so staubbedeckt, dass die Fenster blind waren. Alle paar Kilometer setzten sie eine Gruppe ab. Melonenfelder, Maisfelder, Sonnenblumen, Getreide. In den Pausen hockten die Arbeiter am Straßenrand im Schatten, aßen, rauchten, tranken Bier. Die Melonen keimten unter weißen Tunneln, die sich bis fast an den Horizont zogen. Später verschwanden die Tunnel, und das Geschling von Pflanzenarmen schob sich jeden Tag ein Stück weiter. Die reifen Melonen wurden zu Bergen aufgetürmt. Nach der Ernte breitete sich Leere über die Felder.
STADT
Auf einem Platz in einer Stadt am Meer sah ich, wie eine Möwe auf eine Taube herabstieß, die in einem Stück Abfall pickte, und sie tötete. Im Verlauf des Kampfes warfen die Vögel mir Blicke zu. Beider Vögel Augen waren gleich dunkel.
Als die Taube tot war, flog die Möwe davon. Ein Passant schob die tote Taube mit dem polierten Schuh in den gemauerten Wassergraben, der den Platz durchschnitt.
Ich dachte an die Möwen, die ich in London jeden Tag gehört hatte. Sie kreisten zweimal täglich über meinem Haus und stießen ihre Meeresrufe aus, während die Tauben zu Tausenden in den Ziegelbögen unter den Eisenbahngleisen gurrten. Die Eisenbahn fuhr über den Taubenballungen hin und her, von meinem Fenster aus sah ich die Züge, nach Einbruch der Dunkelheit waren sie Lichterketten, die über den Himmel segelten.
Wenn ich durch die Stadt ging, hielt ich beim Durchqueren von Unterführungen die Luft an, während mein Körper den Vorhang aus Taubenfedern und zu Staub zerfahrenem und zerschrittenem Taubendreck durchteilte.
In Budapest lebten die Tauben auf den Gesimsen und Dachvorsprüngen, fern aller Möwen erschien ihr Leben beschaulich. Im gezeitensicheren Binnenland allerdings verdunkeln Krähenschwärme den stadtwärtigen Schneehimmel.
BATTONYA
Auf dem Feld neben meinem Garten wuchs der Mais in die Höhe. Das Feld gehörte einem kleinen Mann und seiner Schwester, beide hatten einen Buckel. Der des Mannes war groß, der der Frau klein, und wenn sie saß, war ihr Gesicht streng vor Bemühen, gerade zu sitzen wie in einer Schul-bank. Sie war alt, doch ihre Schürzen hatten an den Schultern Rüschen wie die Schürzen von Schulkindern.
Morgens kamen die buckligen Geschwister und strichen durch das Feld. An den hohen Stängeln raschelten die Blätter. Der Mann und die Frau sprachen nie miteinander, höchstens flüsterten sie sich etwas zu, und das Flüstern ging im Rascheln auf. Alle paar Wochen mähte der Bucklige im Morgengrauen das Gras vor seinem Feld mit der Sense. Er schliff die Klinge mit dem Wetzstein und fuhr mit der Sense durch das Gras. Es war ein eintöniges Gespräch, das im Angesicht einer Unabänderlichkeit geführt wurde. Der scharfe Ton des Steins auf dem Metall, das Sirren der Klinge durch das Gras. Ohne Unterbrechung, bis das Stück gemäht war und das dunkle Sommergras in gleichmäßigen langen Wülsten auf dem Boden lag. Die Schwester des Buckligen stand dabei. Sie hatte die Hände in die Schürzentaschen gesteckt und schwieg. Wenn das Gras gemäht war, gingen sie zusammen in ihr Haus. Es war noch früh am Tag.
Mittwochs war kleiner Markt in Battonya und samstags großer Markt. Händler kamen in alten Autos über die Grenze, aus Rumänien. In der Puschkinstraße breiteten sie ihre Waren aus. Die Grenzer lungerten an den Ecken. Frauen in breiten weiten Röcken gingen auf und ab, Zigi, Zigi, murmelten sie den Käufern entgegen, unter den weiten Röcken hatten sie die Zigaretten versteckt. Ein alter Mann kam mit seiner Frau, die Wurzelgemüse und Eier auf einem Stück Zeitungspapier bot. Der Mann trug eine braune Kappe und eine alte Tweedjacke. Zigi, Zigi, flüsterte er scheu im Schatten seiner Gemüsefrau. Gelegentlich stießen die Grenzer zwischen die Käufer und Händler und verlangten Papiere.
Auf den Wachstuchdecken und Zeitungspapieren am Boden lagen Werkzeuge, Streichhölzer, Süßigkeiten, Unterhosen, Sägeblätter, Bohraufsätze. Eine Zigeunerfamilie kam samstags und bot große Teppiche an, auf denen sich blassfarbene Blumen und Tiere ineinander verschlangen. Die Familie stand hinter ihrem Teppichaufbau verborgen und palaverte.
Ich ging über den Markt, streifte an Körbe und stolperte in Auslagen. Jedermann sah, dass ich fremd war. Die buckligen Geschwister standen auf dem Gemüsemarkt am Fluss und verkauften Gemüse und Eier. Die Schwester stand hinter dem Bruder und drückte die Hände in die Schürzentaschen. Um ihre langen grauen Haare hatte sie ein geblümtes Tuch gebunden. Der Bruder stützte sich mit beiden Händen auf die Betonplatte mit den Waren und stieß den Kopf weit vor, als wollte er die Waren unter seinem Körper schützen oder die Käufer durch bloßes Hinausstarren über seinem Feilgebotenen zum Kaufen bewegen.
In der Luft schwirrten die rumänischen Worte und rieben sich an den ungarischen.
Abends spazierte ich zum Bahnhof. Hinter den gestutzten Weidenbäumen am Rand der Gleise ging die Sonne unter und tauchte die Bahnhofsveranda, die Grenzer mit ihren Fahrrädern und das Riedgras jenseits der Bahngleise in ein rötliches Licht, das sich bis in den Warteraum ergoss, alles glänzte: der Fahrplan, das Schalterfenster, die Klinke der Glastür zum Zimmer des Bahnhofsvorstehers, die dünnen Flügel der Fliegen.
Ich sah den Bahnhofsvorsteher auf der Couch hinter der Glastür liegen. Ein dicklicher Mann in dunkler Hose und Unterhemd. Fliegen zitterten schwarz auf seiner Haut und schwirrten davon, als er sich reckte. Wenn ein Zug ankam, stieg er auf sein Fahrrad und radelte zum Bahnübergang, kurbelte die Schranke herunter und wieder hinauf, wenn der Zug den Übergang passiert hatte. Den Zeitpunkt der Überfahrt trug er in ein Buch ein. Durch das Fenster des Bahnwärterhäuschens sah man das aufgeschlagene Buch mit den säuberlichen Eintragungen, eine alte Schreibtischlampe, einen Kleiderständer, einen Eisenofen für die bittersten Wintertage und einen Besen für Schnee und Laub. Über der Tür brannte eine Lampe und beleuchtete die Aufschrift ›Battonya‹.
Der Zug von Battonya kannte nur eine Strecke. Doch es war eine Reise zwischen den beiden Endstationen, sie führte durch Felder und an schütteren Hainen vorbei, zweimal hielt der Zug an kleinen Unterständen, wo gelegentlich Reisende ein- oder ausstiegen.
DAS FRÜHERE LAND
Ich lernte die Sprache langsam, doch hier sprach man nicht nur eine sondern etliche Sprachen. Man sprach mit den Augen, den Händen und dem Mund, und eine Geste, beispielsweise ein kurzes Zuschlagen des einen Augenlids, mochte in der einen Sprache etwas Bestimmtes und in einer anderen etwas ganz Ungefähres oder gar das Gegenteil des Bestimmten bedeuten.
In meinem früheren Land sprach man mit dem Mund und auf dem Rücken zusammengelegten Händen, während die Augen stets einem hübschen, gänzlich außerhalb des jeweiligen Gespräches liegenden Gegenstand zugewandt sein sollten. Hier war mir jede Sprache fremd, doch Hände und Augen gewöhnten sich schneller als der Mund, und ich sah mir zu, aus der Ferne, und dann war ich eine Sprechpuppe an einem Ort, wo die Sprechpuppen noch zu den Erfindungen aus einer Welt von Sage, Lüge oder waghalsiger Aufschneiderei gehören.
Manchmal dröhnten mir die kurzen Sprechpuppensätze im Schädel, und ich wollte vor irgendeine beliebige Gruppe von Menschen treten, vielleicht ein paar in ihren Schwatz vertiefte Frauen, eine Traube von Männern, die sich im Schatten einer Kneipe herumdrückten, Kinder, die an dem kleinen Fluss spielten, oder auch nur die eine Frau, die abends im warmen heftigen staubigen Wind in der Dunkelheit großer Pappeln auf einen Mann wartete, der jedoch verweilte in der Kneipe mit der weit offenen Tür und dem hellen Viereck auf dem Weg davor, und dem polternden Stimmenschlag, der sich unterm Wind duckte – vor irgendeinen, irgendwelche wollte ich treten und sagen: Ich komme aus einem Land, hört zu, da riecht die Luft salzig, und das Meer ist nie weit, und jeden Morgen wachte ich dort vom Schreien der Möwen auf, die über dem Dach meines Hauses kreisten, sie zogen ein paar Kreise und riefen, schrien, heulten, und dann verschwanden sie wieder, und all das gegeneinander kreisende Knirschen und Schleifen und Scharren der Stadt schlug über den Dächern zusammen, die eben noch im hellen Licht der Meeresnähe und der Möwenrufe gelegen hatten.
Ich wollte gern eine solche unpassende kleine Rede halten, in der ich ihren an keinen Laut aus meinem Mund freundlich gewohnten Ohren Erzählungen über das Morgenlicht aufdrängte, das dort vor meinem Fenster gelegen hatte, weiß und grau, ein Licht, das weit über kleine Herzensdinge hinausreichte. Doch was wäre damit getan, was erwirkt, außer möglicherweise der allergeringfügigsten Herzenserleichterung meinerseits, denn meine Zuhörer hätten ja nichts verstanden als ein Malmen meines Mundes um unfassbare Laute, von denen sie noch nicht einmal behaupten könnten, dass sie an Worte erinnerten, und ich müsste ihnen demnach bei einem derartigen Vortrag vorkommen wie ein versprengtes Tier.
Womöglich hätten sie recht. Ich konnte noch gar nicht ermessen, was die Flucht von den schwindenden, bröckelnden Küsten aus mir gemacht hatte, dieser gewaltige Sprung, mit dem ich mich aus dem fahlen Gras über den Klippen gerissen, mich eigenhändig aus dem weißen Licht gehackt, aus den windbleichen krummen Straßen geschnitten hatte.
Ich wollte dem Schatten nachweinen, der in England geblieben sein musste, denn hier, im weißen Sommerlicht der Ebenen erkannte ich meinen Schatten nicht mehr, blau und scharf heftete er sich an meinen Schritt, keinen Spiegel brauchte ich in diesem Land, der Schatten allein legte mich bloß.
BATTONYA
Battonya hatte viele Kneipen. Die meisten trugen keinen richtigen Namen. Sie hießen ›Trinkgeschäft‹ oder ›Kneipe‹ oder auch ›Presszó‹, und waren meistens mit einer Musikbox oder einem Radio geschmückt. An manchen Abenden ging es in der einen oder anderen Kneipe laut zu, es wurde gesungen, getanzt und gebrüllt, Frauen und Männer lagen sich in der Armen, eine Welle Ausgelassenheit schwappte, Musik und Stimmengewirr tönten über den kleinen Fluss, die Gärten, die schnurgeraden Straßen hinauf und hinunter, bis zum Horizont.
Es gab Abende, an denen wusste ich nichts mit mir anzufangen. Alles ringsum erschien mir schwer, klebrig vor Erde und Feuchtigkeit, sogar die Luft. Ich streifte umher und schaute durch die erleuchteten Fenster in die Kneipen. In einer Kneipe saß ein Akkordeonspieler.
Eines Abends stand ein Mann hinter mir. Er war klein, seine Augen flackerten, und sein Mund war schief. Geh doch rein, sagte er zu mir auf Deutsch.
Der Mann hieß Zoran. Ich bin Serbe, sagte er.
Ich bestellte Wein. Die Leute in der Kneipe starrten und schwiegen. Der Akkordeonspieler saß in einer Ecke, das Kinn auf sein Instrument gelegt, als schliefe er, wie nur Akkordeonisten schlafen können, denn das Akkordeon ist die Stütze in diesem ganz besonderen Schlaf.
Zoran bot mir einen Platz an. Jetzt warf er englische Worte ein. Sein schiefer Mund zuckte dann und wann um die Ausdrücke, die linkisch zwischen seinen Sätzen klemmten. Zorans Zähne standen kreuz und quer. Zoran war einmal in New york gewesen, dort lebte ein Freund, der ihn einlud, mit ihm zu arbeiten.
Wir gehen zusammen von Haus zu Haus, den ganzen Tag, sagte Zoran, es hörte sich an, als sei ihm dieses von-Haus-zu-Haus-Gehen im fernen New york eine Gewohnheit, die nur kurzfristig und zufällig durch sein Leben als Serbe in Battonya unterbrochen worden sei.
Was macht dein Freund?, fragte ich ihn, und Zoran antwortete:
Lockshmit. Er ist AA Lockshmit.
In New york schneit es viel, sagte Zoran, es ist bitterkalt, wir arbeiten ohne Handschuhe, unsere Finger können an ein Eisenschloss frieren.
New york ist wie Battonya, sagte ich, alle Straßen sind gerade.
Aber sie haben nur Nummern, antwortete Zoran. Keine Namen.
Das Akkordeon spielte ein erstes Lied. Es war langsam und drehte sich im Kreis, als ich mich umschaute, saß der Musikant immer noch in sich zusammengesunken auf dem Stuhl, nur die Finger und Unterarme bewegten sich.
Sobald die Musik erklang, erhob sich ein Stimmengewirr im Kneipenraum. Auf die Musik hatten sie gewartet, ein Meer, auf dem ihre Worte segeln konnten.
Der Akkordeonspieler erwachte allmählich von seiner eigenen Musik. Sein Blick glitt durch den Raum, weit oben, in der Nähe der Decke, über den Köpfen der Gäste, während sein Lied lauter wurde, auch die Blicke der Gäste schweiften zwischen und über ihren Sätzen und Rufen umher, unruhiger, unbeholfener als die Musikantenblicke, die zu seiner Kunst gehörten, sie alle suchten nach der Leidenschaft, die indessen zusammengefaltet in einer ungeputzten Ecke lag und nicht erwachen wollte.
Auf dem Heimweg kam ich am Kino vorbei. Ein dunkles großes Gebäude hinter immergrünen Bäumen, die sogar nachts Schatten warfen. ›Mozi‹ stand in blassen Lettern einer alten Schrift auf der Fassade, hoch über dem leeren Schaukasten.
Ich sagte das Wort vor mich hin. Mozimozi. Ein fremdes Wort.
Aus der Kellerkneipe gegenüber kam Musik. Ein Betrunkener stand auf der obersten Treppenstufe und hielt sich an den bunten Plastikschnüren des Sommervorhangs fest.
Ihr seid ja alle Zigeuner rief er.
DER AKKORDEONSPIELER
Der Akkordeonspieler war ein einsamer Mensch. Sein Leben galt den langgezogenen Klängen seines Instruments und deren Zwischenräumen. In diesen Zwischenräumen hausten seine Träume. Wenn er spielte, wurden die Träume gepresst und gebeutelt, unablässig quetschte er sie zwischen den Klängen zu kaum noch erkennbaren dünnen Blättchen zusammen, denen man schwerlich ein Leben zutraute. Dabei starrte der Akkordeonspieler in den Wirtsraum, wo die Gäste saßen oder tanzten und die Augen ziellos wandern ließen, vorbei an den mit Nacht gefüllten Fenstern, und sein Gesicht blieb reglos, während er seine Träume so zurichtete, doch sie waren beständig und zäh. Am grauen Morgen hörte man zwischen den breiten faserigen Tönen aus den Falten des Instrumentes schon das Zwitschern der Träume, die Luft holten und sich zu neuem Leben anschickten. Dieses Zwitschern war Zeichen für die letzten Gäste, sich auf den Heimweg zu machen. Die Trunkenen erhoben sich von ihren Stühlen und die Tanzenden ließen voneinander ab. Ein Glas zerbrach, ein Stuhl fiel mit stumpfem kurzem Poltern zu Boden. Die Eigenbrötler krochen aus den dunklen Winkeln, wo man sie fast vergessen hatte, und der Wirt stand mit dem Besen neben seinem Schanktisch. Der Akkordeonspieler entließ die abschließenden schwerfälligen Klänge. Er begleitete die letzten Gäste hinaus, er spielte gern den Türhüter ihrer Vergnügungen. Hinter ihm fiel die Wirtshaustür ins Schloss, und er taumelte durch den Frühnebel zu seinem abgelegenen Haus, von dessen Fenstern er einen unverstellten Blick auf die Ebene hatte. Der Akkordeonspieler verbrachte die Tage damit, die weite Ebene mit den Blicken zu überschweifen und die Träume – nach ihrer Befreiung aus den Ritzen und Falten seines Instruments und dem Einsammeln der unweigerlich beim Musizieren entschlüpften und noch in Reichweite durch die Luft schwebenden Traumfetzchen – ungehindert ihr Spiel um sein Herz und seinen Kopf treiben zu lassen. Das, dachte der Akkordeonspieler, wie er an seinem Fenster saß und in die Stille der Ebene lauschte, das ist das wahre Leben.
BATTONYA
Die Nächte wurden länger, und morgens lastete die Luft jetzt nass auf der Erde, manchmal roch es bitter, manchmal brandig-faul nach Tierkadavern, die in einem großen, eigens nahe der Grenze dafür errichteten Ofen verbrannt wurden. Aus dem ganzen Land brachte man Tierkadaver herbei, um sie hier, wo der häufige West- oder Nordwind den üblen Rauch über die Grenze in ein anderes Land blies, in der unbeschreiblichen Hitze der sogenannten Verbrennungsanlage in kürzester Zeit zu Asche werden zu lassen.