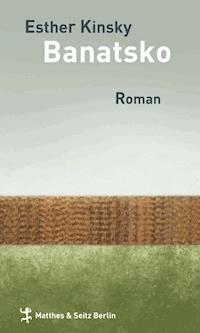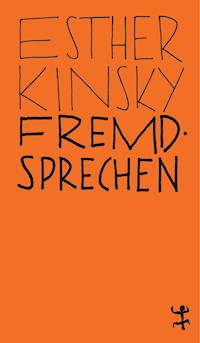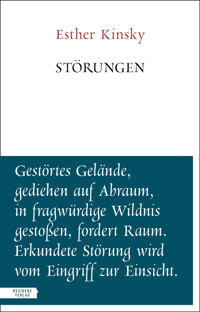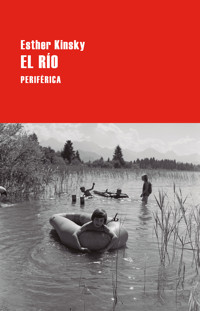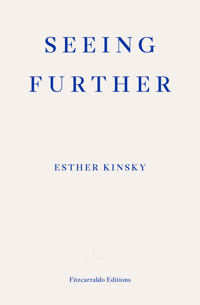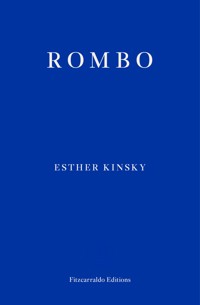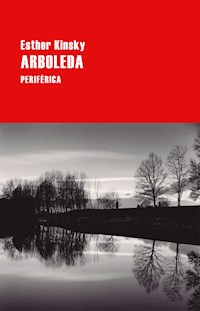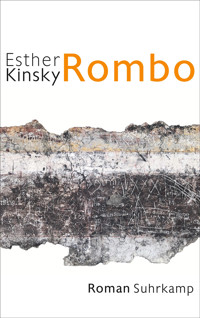
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mai und im September 1976 erschüttern zwei schwere Erdbeben eine Landschaft im nordöstlichen Italien. An die tausend Menschen sterben unter den Trümmern, unzählige sind ohne Obdach, viele verlassen ihre Heimat. In Esther Kinskys preisgekröntem Roman berichten sieben Bewohner eines abgelegenen Bergdorfs, Männer und Frauen, von ihrem Leben, in dem das Beben tiefe Spuren hinterlassen hat. Von der gemeinsamen Erfahrung von Angst und Verlust spleißen sich bald die Fäden individueller Erinnerung ab und werden zu eindringlichen und berührenden Erzählungen tiefer, älterer Versehrung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Cover
Titel
Esther Kinsky
ROMBO
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildung: Erhaltenes Fragment des Fresko in der Apsis der Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Venzone. Foto: Esther Kinsky
eISBN 978-3-518-77233-1
www.suhrkamp.de
Motto
»Finito questo, la buia campagna
tremò sì forte, che dello spavento
la mente di sudore ancor mi bagna.
La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento«
Dante Alighieri, La Commedia, Inferno, Canto III, v. 130-135.
Unbeknownst to me at the time, I just wanted to be seen.
C. Fausto Cabrera, The Parameters of Our Cage.
ROMBO
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
I
Landschaft
Beben
Anselmo
6. Mai
Sisma
Störungen
Monte San Simeone
Strada Statale 13
Bett
Stimmen
Tal
Störstufen
Ta Lipa Pot
Fabel
Erinnerung
Olga
Anselmo
Gigi
Silvia
Toni
Mara
Lina
Zuträger
Abgrund
II
Landschaft
Anselmo
Vipern
Mara
Kuckuck
Olga
Ziegenmelker
Gigi
Stein
Toni
Brennender Busch
Silvia
Teufelssporn
Lina
Distel
Olga
Orchis maculata
Anselmo
Trauerfalter
Gigi
Toni
Mara
Nieswurz
Lina
Mannstreu
Silvia
Vogel Fremd
III
Weiß und Schwarz
Anselmo
Lina
Der pharaonische Fisch
Silvia
Anselmo
Märchen vom Hemd
Mara
Legende
Toni
Olga
Stumm
Silvia
Toni
Bile ma¡kire
Olga
Die Sage von der Riba Faronika
Gigi
Der Läuterungsberg
IV
Der Pfad des Hundes
Lina
Tanz
Anselmo
Sisma
Mara
Partisanen
Toni
Mara
Nunatak
Lina
Die Entstehung der Gebirge. Glaube 1
Gigi
Musik
Olga
Gigi
Entstehung der Gebirge. Glaube 2
Silvia
Carnevale
Toni
Entstehung der Gebirge. Glaube 3
Anselmo
V
Miniera
Fundstück
Mara
Toni
Natur
Silvia
Fundstück
Gigi
Fundstück
Lina
Retina
Silvia
Fundstück
Lina
Zersetzung
Olga
Fundstück
Anselmo
Fundstück
Mara
Dämpfe
Silvia
Fundstück
Silvia
VI
Laub
Olga
Lina
Anselmo
Silvia
Toni
Mara
Silvia
Gigi
Anselmo
Toni
Olga
Lina
Silvia
Anselmo
Toni
Mara
Olga
Anselmo
Toni
Mara
Gigi
Lina
Olga
VII
Sattel
Himmel
Memorial
Anmerkungen
Informationen zum Buch
I
Eine der wenigen Erscheinungen, welche fast immer die Erdbeben begleiten und sie oft ganz kurz vorher ankündigen, besteht in einem eigenthümlichen unterirdischen Geräusch, welches fast überall, wo seiner Erwähnung geschieht, von derselben Beschaffenheit zu seyn scheint. Es besteht dieses Geräusch aus dem rollenden Tone einer aneinander hängenden Reihe von kleinen Explosionen, und man vergleicht es oft dem Rollen des Donners, wo es in geringerer Stärke statt findet, mit dem Rasseln vieler Wagen, welche hastig über ein holpriges Steinpflaster fahren. … In Peru scheint die Stärke dieses eigenthümlichen Schalls in geradem Verhältnisse mit der Stärke der darauf folgenden Erschütterungen zu stehen; dasselbe erzählt man auch von Calabrien, wo man diese gefürchtete Erscheinung il rombo nennt.
Friedrich Hoffmann, Geschichte der Geognosie und Schilderung der vulkanischen Erscheinungen, 1838, S. 328.
Landschaft
Ringsum: Auslaufende Moränenlandschaft. Sanfte Hügel, Felder, Torfmoore in abgelegenen Senken, versprengte kalksteinige Karstauswüchse mit Eichenhainen, Kastanienbäumen, scharfem, dünnhalmigem Gras auf den Kämmen, die sich gebirglicher geben, als sie sind, doch einen Ausblick bieten: über das Hügelland, die Kuppen, besteckt mit Kirchen und Dörfern und hier und da einer burgichten Ruine, die allerdings in Wirklichkeit zerfallendes Überbleibsel des Ersten Weltkriegs ist. Ihre Lieblichkeit verdankt die Landschaft einer gewaltigen Materialverschiebung, Gletscher, Felsen, Masse, die es bis hierher gebracht hat, unweigerlich unter einem Lärmen, das weit über das Grollen eines Rombo hinausgeht. Kein präludirendes Getöse, wie man es vor zweihundert Jahren nannte, sondern ein anhaltendes Tosen, dem kein menschliches Ohr gewachsen gewesen wäre.
Nach Süden ergeben sich die Hügel dem Flachland, der Größe des Himmels, der Offenheit des Meers. Riesige Maisfelder, Industriestreifen, Autobahn, Kieswerke an den Flüssen, die in die Adria münden. Piave, Tagliamento, Isonzo, ein jeder Fluss führt sein Teil Alpen ab, dolomitige Metamorphite, Voralpenkonglomerate, die karstigen Kalksteine im Isonzo, deren grelles Weiß man bis heute den vielen Knochen der gefallenen Soldaten der Isonzofront zuschreibt. An klaren Tagen sieht man von den Hügelkuppen bis ans Meer, die mit Inselbüscheln betupfte Lagune von Grado, die kantigen Hotels der Badeorte wie scharfe ungleiche Zähne am Horizont.
Der Fluss, der diese Hügelgegend bestimmt, ist der Tagliamento. Ein Wildfluss, wie es heißt, doch das Wilde ist außerhalb der wenigen Wochen reißenden Wassers nach Schneeschmelze und Sturzregen eher die Leere, die Riesigkeit des ungeregelten Steinbetts, die Willkür der spärlichen Rinnsale, die sich ihre Wege und Verläufe immer wieder neu suchen. Beim Eintritt aus den Bergen in die Moränenlandschaft knickt der Fluss von seinem Verlauf nach Osten in Richtung Süden ab und nimmt die Fella von Norden auf, zögernd, unschlüssig beide, türkis und weiß, die Unschlüssigkeit hat ein riesiges dreieckiges Kiesel- und Schotterfeld entstehen lassen, das die Karnischen Alpen von den Julischen Voralpen trennt, eine helle Fläche wie Versehrung, ein Zögerraum vor dem Hintergrund der Bergtäler, vor den abgeschiedenen Zonen mit ihren eigenen, von schwindender Nutzung abgestumpften Sprachen, ihren schrillen, hilflosen Liedern und ihren vertrackten Tänzen.
Die Friedhöfe der Dörfer im Hügelland haben ihre eigenen kleinen abgelegenen Kuppen mit Kirchlein und Blick nach Norden, auf die Berge, den Einschnitt des Tagliamentotals, die schmale Passage des Fellatals, durch das die Römer nach Norden und die Kelten nach Süden zogen. Nach Nordwesten liegen die Karnischen Alpen, klüftige Spitzen hinter Voralpenketten, ein Bilderbuch der Gewaltigkeiten, die sich zur Entstehung dieser Gebirge ereignen mussten. Das Bilderbuch steht genau auf der unsicheren Überlappung zweier Kontinentalplatten, denen so, wie sie liegen, nicht wohl ist. Ihr Unmut strahlt nach Osten aus, in die Bergtäler der Italia Slava und bis ins liebliche Hügelland nördlich des Küstenstreifens.
Nach Nordosten geht der Blick auf die Julischen Voralpen und Alpen, den je nach Licht und Klarheit grauen, blauen, violetten, orangen Riegel des Monte Musi. In jedem Licht sind die Hänge schroff, eine dunkle Schranke, unerklimmbar, unübersteigbar, am östlichen Ende überwölbt von der kalk- oder schneeweißen Kuppe eines Berges, dem Monte Canin, dem stumpfen Eck- und Grenzzahn eines Tals im Dahinter.
Zwei Zonen treffen vor dem Gebirge aufeinander, kontinentales und mittelmeerisches Klima, die Winde, Niederschläge und Temperaturen zweier Migrationsfelder zu Lande und zur See. Gewitter, Stürme, Regenfluten, Erdbeben, die unentwegt an den Spuren der Menschenwanderungen schleifen, die sich durch diese Gegend ziehen und sich, egal wie verschliffen, doch nie tilgen lassen. Der Himmel gibt sich dunkelstimmig, der Rombo ist nie weit.
Beben
Das Erdbeben ist überall. In den efeuüberwucherten Trümmern eingestürzter Häuser an der Staatsstraße Nummer 13, in den Rissen und Narben der großen Gebäude, den geborstenen Grabmälern, den Schiefheiten wiederaufgebauter Kathedralen, den leeren Gassen der bienenwabig verschachtelten alten Dörfer, den hässlichen neuen Häusern und Siedlungen, die sich am Sehnsuchtsort Vorstadt aus amerikanischen Fernsehserien orientieren. Draußen auf dem Feld stehen die neuen Häuser, abseits der erschütterten Orte, oft nur einstöckig, Hauptsache, nicht zu viel fällt einem aufs Haupt, falls es noch einmal … – wie in jenem Jahr, dem Erdbebenjahr 1976. Jetzt liegt es ein halbes Leben zurück oder mehr, aber die Schrift, mit der es sich in aller Gedächtnis eingeschrieben hat, ist nicht verblasst, sie wird immer wieder neu gekerbt vom Wiedererinnern, vom Reden über all die Wos und Wies, vom Schutzsuchen und Ängsten und Horchen auf weiteres Grollen, in Garagen, im Freien, an den Familienfiat gepresst, unter Trümmern, zwischen Toten, mit einer Katze im Arm. Mit all den heraufbeschworenen Bildern könnte man die ganze Strecke auslegen von hier, dem Friedhof mit Nordblick, bis zu der fernen lilablauen harsch schraffierten Kette des Monte Musi, eher Maul- und Schnauzengipfel als Musenberg, Zacken um das Maul für den Eckzahn Monte Canin. Alles gebirgig buchstabiert. Am Ende findet sich vielleicht sogar ein unverhofft gebahnter Weg bis zu ihrem Kamm, von dem man aus in das Tal zu Füßen des Monte Canin schauen würde, ein kleines Flusstal, das im rechten Winkel zu der mit Erdbebenerinnerungsbildern ausgelegten Strecke stünde. Windstille wäre für einen solchen Tag der Bilderauslegung zu erhoffen, eine feierliche Windstille, in der man den Bilderweg abschreiten könnte.
Doch der Tag ist windig. Gleich an der Mauer mit Blick auf die im schattenlosen Licht wie zusammengefalteten Berge, an einem betonversiegelten Grab, glatt und weiß mit einem Kranz aus blass gewordenen Plastikblumen, steht ein kleiner Mann mit weißem Haar und schlimmen Zähnen und spricht in sein Telefon. Er beschreibt das Grab, betont, dass es sauber und aufgeräumt ist, und spricht langsam die Namen darauf aus und lässt auch den Kranz nicht unerwähnt, allerdings ohne auf die Erblasstheit der Blumen hinzuweisen, und sagt zum Schluss wie in Erwiderung auf die Stimme am anderen Ende: Die Erinnerung ist ein Tier, das aus vielen Mäulern bellt.
Anselmo
Der kleine Mann mit den weißen Haaren und den schlimmen Zähnen heißt Anselmo. Er ist Gemeindearbeiter und ersucht immer um Arbeit am Friedhof. Es gibt hier viel zu tun, die Erdschicht über dem Felsbuckel des Hügels ist dünn, und die Anzahl der Gräber ist begrenzt. Die Kolumbarien werden erweitert, Gräber geebnet, Gebeine ins Beinhaus verbracht, Bäume beschnitten und gefällt, die Grabplatten und Grabsteine auf ihre Stabilität geprüft. Anselmo kennt sich aus. Er weiß, an welchen Stellen Gräber absinken, welche Schäden an Grabsteinen entstehen können und welcher Grabplatz im Falle eines Erdbebens am sichersten ist. Von Mausoleen rät er ab und verweist auf die Risse in den Wänden der prunkenden Familiengrabstätten. Er verwickelt die Grabbesucher gern in Plaudereien und bietet sich auswärtigen Hinterbliebenen als Vertrauensperson an.
Der Friedhof ist ein empfohlener Zwischenhalt für Wanderer und Radler, denn an der Nordwestseite der Mauer ist eine lange Panoramatafel angebracht, auf der man den Namen eines jeden Gipfels lesen kann. Das Halbrund der Gipfel und Kämme, die wie eine bergende Umarmung die Moränenlandschaft nach Westen, Norden, Osten umgeben, liegt auf der Panoramatafel wie eine gerade Kette vor den Betrachtern, die sich erst einmal an diese Verzerrung der Landschaft gewöhnen müssen und die Blicke immer wieder zwischen Abbildung und Gebirge hin- und herwandern lassen, wobei sie mit den Fingerspitzen über die Gipfel auf der Panoramatafel fahren, als könnten sie dort ihre Beschaffenheit ertasten. Auch an diese Ausflügler tritt Anselmo gerne heran und erklärt die Landschaft. Immer lenkt er den Blick auf den Monte Canin und seine bis in den Frühling beschneite Kuppe und erwähnt, dass er im Schatten dieses Berges aufgewachsen sei. Wenn der Gipfel von Wolken verdeckt ist, sagt Anselmo: Heute will er sich nicht zeigen. Das macht er oft. Er zeigt sich nur, wann er will. Der ist ein ganz Launischer, der Canin.
6. Mai
Am Morgen des 6. Mai legt sich kurz ein rosiges Licht über den verbliebenen Schnee auf dem Gipfel des Monte Canin. Es verblasst bald, die Sonne hält sich bedeckt. Es ist still auf den Hängen an diesem Morgen im frühen Mai im Tal, kalksteinweiß und grün von Buchen und Haselgebüsch, grausilbrig von Ölweiden am Ufer. Unter dem dünnen Gewölk breitet sich Hitze aus.
*
Olga geht früh aus dem Haus, die Straße hinunter zum Bus. Später befragt, wird sie sagen: Als ich an jenem Morgen die Stufen zur Straße hinabging, sah ich eine Schlange, eine Carbon, wie sie sonst eher unten am Fluss sind, nicht oben im Dorf. Auf einem Stück Mauer lag sie, als sonnte sie sich, ein schwarzer Stock, dabei schien die Sonne gar nicht, doch es war warm. Der Kuckuck hat gerufen, pausenlos, schon am Morgen. Daran, an den Kuckuck und an diese Schlange und all die Geschichten über diese Art Schlange, die mir dann einfielen, daran erinnere ich mich sehr gut.
*
Anselmo hilft am Nachmittag beim Sensen. Es ist noch früh im Jahr für den Schnitt. Er wird sich an den Donnerstag erinnern. Das weiß ich noch genau, wird er sagen. Donnerstags kamen wir früher aus der Schule. Ich weiß noch, dass es heiß war, und nach dem Essen mussten meine Schwester und ich auf die Wiese unten am Hang, um beim ersten Mähen zu helfen. Das Gras stand schon hoch.
Die Sonne ist ein grelles Loch in den Wolken an dem Tag, sie brennt den Kindern auf den Nacken, bis es weh tut. Die Grillen ratschen dünn und hastig, als hätten sie es eilig. Die Großmutter schneidet das Gras mit der Sense. Das Gras ist schwer, sie schwitzt, und die Sense stumpft immer wieder ab, öfter als sonst, und die Klinge muss geschärft werden. Die Kinder beeilen sich mit dem Rechen und Schichten. Macht schon!, hört man die Großmutter immer wieder rufen, macht schneller!
Anselmo wird sich erinnern, dass sie böse auf die Kinder war, wegen ihrer Langsamkeit, aber sie ist auch böse auf das Gras, das so trocken und borstig scheint und doch die Sense abstumpft, als wäre es nass. Der Wetzstein schlägt auf die Klinge, und es gibt kein Echo, als schluckte die Luft den Klang. Dabei, wird Anselmo später berichten, dabei hörten wir den Grünfink unserer Nachbarin bis auf die Wiese hinauf.
Der schreit ja, als ob es brennt, sagt der Mann, der das Wiesenstück neben dem ihren mäht. Er holt weit aus und fährt mit der Sense in die Halme, und die Schwaden sinken auf die Erde. Er muss jedoch genauso oft innehalten und die Klinge wetzen wie Anselmos Großmutter.
*
Am 6. Mai schimmert der Schnee auf dem Gipfel ins schattenlose Morgenlicht. Bei der kleinsten mechanischen Einwirkung können die Schneefelder schnell ins Rutschen kommen und zu Tal gehen. Ein unbedachter Wanderer, ein Steinschlag, das reicht schon aus. Doch um diese Jahreszeit ist niemand dort im Gebirge unterwegs.
*
Die Schlange, die Olga am Morgen auf der Mauer sieht, ist kohlschwarz. Sie liebt die Feuchtigkeit. Sie lebt im Wasser und zu Lande und hat kein Gift. Bei der Paarung im Frühjahr umwinden die männliche und die weibliche Schlange einander, wie zu einem gedrehten Zopf. Fürchten sie eine Störung, schließen sie sich, so verflochten, zu einem Ring, der bei Berührung von außen einen Stromstoß versetzen kann. Nach der Paarung gehören die beiden Carbon zusammen, bis dass der Tod sie scheidet.
*
Lina ist nervös an diesem Morgen. Der Zeisig im Käfig ruft jämmerlich. Ihr Bruder sucht Arbeit, und sie weiß, er wird keine finden. Doch anderes bleibt ihr im Gedächtnis.
Was ich vom 6. Mai noch weiß, fängt sie später einmal an, als schreibe sie einen Schulaufsatz: Weil es schon so warm war, häufelten wir an jenem Tag bereits um die Kartoffelstauden auf, das weiß ich noch. Wir haben Sperber gehört, die kurzen scharfen Laute, mit denen sie einander rufen, darüber haben wir geredet. Wir waren zu dritt am Feld. Mein Bruder war damals zurück aus dem Ausland. Er hat immer gern Dinge erzählt, die Angst machten. An dem Tag war es eine überfahrene Schlange vor dem Dorf. Die hatte er gesehn. Wenn es ein Schlangenweibchen war und sie die Eier noch nicht abgelegt habe, bringe das Unglück, sagte er. Dann krieche die männliche Schlange durchs Dorf und suche den Schuldigen. Bestimmt war es der Busfahrer, hat er gesagt. Ich kenne den Busfahrer, hab ihn auch damals gekannt. Er wohnt nicht bei uns im Dorf. Nach der Mittagsfahrt parkt er immer draußen am Friedhof und macht Jause. Ich habe mich bei der Geschichte meines Bruders gefragt, ob eine Schlange den Busfahrer ausfindig machen könne. Bei der Arbeit kam plötzlich ein kalter Wind auf, ganz kurz. Der Wind kommt vom Schnee, der noch dort oben liegt, sagte mein Bruder. Der Schnee und diese Hitze, die passen nicht zueinander.
*
Am 6. Mai bedeckt eine dünne weiße Wolkenschicht den Himmel und lässt die Sonnenstrahlung durch die vielfache Brechung in den winzigen Dunsttröpfchen besonders stechend werden. Am Mittag kommt es zu einer merkwürdigen Erscheinung. In einer doppelten Spiegelung stehen kurz zwei blasse Sonnen direkt über dem verschneiten Gipfel des Canin, Auge in Auge mit der Sonne, die diesig über dem Tal gleißt. Die Doppelsonne löst sich bald auf.
*
In den Wiesen stehen schon Wolfsmilch, Flockenblumen, Lichtnelken, an den Wegrändern blauer Günsel. Und die blassrosa Silene. Hier heißt sie Sclopit. Die Blüte besteht zum größten Teil aus einer zweiteiligen Blase. Kinder zupfen die Blüten ab und drücken sie auf den Rücken der zur Faust geballten Hand, so dass sie mit zwei kurzen Knallen platzen. Das hört sich an wie Sclo-pit. Die Blume ist benannt nach diesem Laut der berstenden Blüte. Die Blätter des Sclopit erntet man vor der Blüte. Sie sind spitz und schmal und haben ein helles, etwas stumpfes Grün. Jeder kennt seine Plätze mit Sclopit, manche geben sie preis, andere behalten sie für sich.
Mara geht am 6. Mai Sclopit sammeln. Bevor sie ausgeht, muss sie die Mutter einsperren, die die Welt schon halb vergessen hat. Sie fügt sich immer still, doch an diesem Vormittag schreit sie hinter der versperrten Tür, als gehe es ihr ans Leben. Mara läuft bergauf, dem Schreien davon. Wenn später die Sprache auf den 6. Mai kommt, erwähnt sie das Schreien nicht: Ich kam an eine Wiese am Waldrand oberhalb von einem steilen Hang, dort stand alles voll von Sclopit, noch ganz ohne Blüten, erzählt sie dann. Zwischen den Tannen riefen Häher. Ich füllte mein Tuch, bis es sich kaum noch zuknoten ließ. Als ich nach Hause kam, war der Sclopit welk geworden und zusammengesackt, als hätte jemand darauf gesessen. Er roch wie geschnittenes Gras. Ich hörte ein Kind schreien und bin erschrocken. So kam der Abend.
*
Am Nachmittag des 6. Mai färbt sich der Himmel über dem Bergkamm nach Südwesten graublau und dunkel, als käme von dort ein Gewitter, was selten geschieht. Diese Scheinwand aus Wolken steht eine Zeitlang reglos, dann löst sie sich auf, und die Sonne steht weiß und grell und groß am Himmel. Die dem Tal zugewandte Schneefläche unterdessen liegt wie in ein gewitterliches Gelb getaucht.
*
Manche Leute stellen nachts Milch in ausgehöhlten Holzscheiben vor die Haustür, die ist für die schwarzen Schlangen. Morgens ist die Schale immer leer, wie es heißt. Das bringt Glück. Die Carbon ist eine kluge Schlange. Eine Geschichte handelt davon, wie einmal ein Sperber eine Carbon gegriffen hat. Zwischen den Fängen hielt er sie in der Luft und brachte sie in sein Nest. Doch bevor er sich versah, hatte die junge Schlange die Eier im Nest verschluckt. Ich geb sie wieder her, wenn du mich zurückbringst, sagte die Schlange. Der Sperber versprach es, und sie hat die Eier wieder ausgestoßen. Dann hat der Sperber die Schlange zurückgetragen, und seitdem greifen die Sperber im Tal keine Schlangen mehr.
*
Im Tal halten die einen Ziegen, die anderen, die reicher sind, eine Kuh oder zwei. Die Ställe sind nicht groß. Gigis Familie hat immer Ziegen gehabt. Ich kenn nur was von Holz und von Ziegen, sagt Gigi. Das Holz verstehe ich zu schlagen, die Ziegen versteh ich zu melken.
Am 6. Mai kommt er am Nachmittag von der Arbeit im Wald nach Hause. Die Sonne brennt, ohne zu scheinen. Er geht am Friedhof vorbei, wo kein Schatten ist, und schwitzt. Auf der Straße sieht er eine überfahrene Schlange. Eine Carbon. Schwarz liegt sie in einem Blutfleck. Fliegen sitzen auf dem Blut. Vom Waldrand ruft der Kuckuck. Gigi weiß noch, dass die Ziegen störrisch gewesen sind. Ihr Fell fühlte sich klebrig an. Es war heiß. Man hat sich in jenen Tagen gefragt, wann der Canin wohl den Schnee lässt. Als ich mit der ersten Ziege fertig war, wollte die zweite nicht kommen, erinnert er sich. Das war noch nie passiert. Schief stand sie hinter dem Handkarren. Hinter dem Karren sah sie aus, als gehörten Kopf und Beine nicht zusammen. Ein Vogel in der Nachbarschaft pfiff in seinem Käfig so laut, als sollte die Milch davon sauer werden. Alle Hunde im Dorf bellten. Nach dem Melken wollten beide Ziegen hinter den Handkarren. Dort standen sie ganz still. Es wurde schon dunkel. Die Milch roch bitter.
*
Am späten Nachmittag des 6. Mai breitet sich ein dunkler Schatten über den Gipfel des Canin und die Schneefelder, die sich dort noch halten, und er liegt darauf wie eine Hand. Ein kurzer kalter Windstoß folgt, und der Schatten verschwindet, als werde die Hand weggezogen.
*
Warum soll ich mich erinnern?, sagt Toni. Warum soll ich das nicht alles lieber vergessen? Ach, Toni, erzähl was, sagen die Leute, wir wissen alle was vom 6. Mai. Na gut, sagt Toni:
Freitags räucherte meine Mutter Käse. Ich musste am Vorabend das Holz holen, damit für den Morgen in der Räucherkammer alles bereit war. An jenem Abend wollte ich nicht Holz holen gehen. Warum, weiß ich nicht mehr. Ich saß auf der Veranda und schnitzte an etwas. Geh und hol Holz, sagte mein Vater, doch ich blieb sitzen. Unten auf der Straße gingen Leute nach Hause. Jemand hat ein Lied gepfiffen, glaube ich. Die Hunde in der Nachbarschaft jaulten. Mein Vater hat mir auf den Hinterkopf geschlagen. Ich nahm den Korb und ging hinunter zum Holzschuppen. Es war kein richtiger Schuppen, nur ein paar Pfosten und Bretter und ein Dach darüber. Die Rückwand war der Abhang. Erde und Stein. Es war nicht spät. Noch hell. Ich nahm ein Scheit vom Stapel, da schoss eine Schlange aus dem Spalt zwischen Holzstoß und Abhang. Sie war schwarz und lang und sicher so dick wie mein Arm. Ich war ja fast noch ein Kind. Das Gras knisterte unter der Schlange, sie verschwand zum Fluss hinunter. Ich rannte hinauf ins Haus und schrie, ich hätte eine riesige Schlange gesehen. Das glaube ich dir nicht, sagte mein Vater. Ich musste allein wieder hinunter und das Holz holen und den Korb hinauftragen, dabei horchte ich auf jedes Geräusch. Alles war mir unheimlich, auch die Stimmen von der Straße unten, das Jaulen der Hunde, die Vogelrufe.
*
Vor Anbruch der Dämmerung am 6. Mai liegt der bloße Fels auf der Südseite des Gipfels in orangem Rot, als strahle von einem unsichtbaren westlichen Horizont eine untergehende Sonne wider. Kurz wirft das Leuchten eine Art Abglanz auf die Schneeflächen, die schon dabei sind, in den Abendschatten zu sinken.
*
Die Vögel in den Bäumen sind unruhig. Silvia steht am Dorfausgang und wartet auf ihren Vater. Sie lauscht auf ein Motorengeräusch. Doch sie hört nur die kurzen, aufgeregten, flachen Triller der Vögel in den Bäumen. Wie ein Klirren. Die Vögel haben so geklirrt, wird sie sagen.
Der Himmel ist schwer. Die Berge nach Westen undeutlich. Wie Schatten.
Mein Vater hatte versprochen, auf einem Moped nach Hause zu kommen, sagt Silvia. Weggefahren war er auf dem Scherenschleiferfahrrad, mit dem Nachbarn. Das war schon Wochen her. Dann hat er einen Brief geschrieben, ich komme am 6. Mai zurück. Daran erinnere ich mich noch genau. Er hatte eine Arbeit in der Fabrik bekommen und würde sich das Moped kaufen, hat er geschrieben. Ich hab ins Tal gehorcht und gehorcht. Dann hab ich ihn kommen sehen. Er sah so klein aus, und man sah das Humpeln, und er hat ein Moped geschoben. Ich bin ihm entgegengegangen und über einen Riss in der Straße gesprungen. Erst beim Springen habe ich gesehen, dass es eine Schlange war. Überfahren. Also eigentlich keine Schlange mehr. Ein Schlangenmatsch. Ich bin zu meinem Vater gelaufen, ich war so froh, dass er da war. Mir war unheimlich geworden da draußen vor dem Dorf allein, es wurde ja schon Abend.
Der Vater ist sehr müde. Er hebt Silvia hoch und setzt sie auf den Sitz des Mopeds. Der Treibstoff ist ausgegangen. Da hat einer Pech gehabt, sagt er, als sie an der überfahrenen Schlange vorbeikommen. So jedenfalls erzählt Silvia es später.
*
Gelegentlich wird die Carbon von einer Art Raserei ergriffen, dann beißt sie sich selbst in den Schwanz und erstarrt zu einem elektrisch aufgeladenen Ring. In dieser Gestalt wirft sie sich in Bewegung, der rollende Ring gewinnt schnell an Geschwindigkeit und rast unter einem hohen Sirren und Zischen voran, bis ihn ein Hindernis zu Fall bringt, der Strom sich entlädt und der Kopf die Schwanzspitze loslässt, die Schlange liegt ermattet wie von einer unglaublichen Anstrengung und vermag kaum, sich in Deckung und Sicherheit zu bringen. In diesem ermatteten Zustand nach dem Rasen ist die Schlange verwundbar.
*
Anselmo muss früh ins Bett, es ist Schulzeit. Draußen ist es noch nicht dunkel, ein gelbliches Zwielicht. Keine Mauersegler sind zu hören, die sonst im Dämmer um die Dächer und den Kirchturm stoßen. Dafür heult der Hund im Hof, als würde er getreten. Die Musikanten kommen bei Anselmos Nachbarn an, um zu proben. Daran erinnert sich Anselmo: Sie haben gestimmt und gestimmt und ein paar Takte gespielt und geflucht und wieder gestimmt, und kaum schien es zu passen, war der Bass wieder schief, oder eine der Geigen, und die Musikanten haben geflucht und gestritten, und dann ging wieder der Bogen über die Saiten vom Bass, und über die Saiten von der ersten und dann von der zweiten Geige, und wieder vom Bass, und so im Kreis und hin und her, der Kanari im Käfig, am Haus unten beim Weg, der hat dann gepfiffen und gepfiffen wie um sein Leben, so laut, dass die Musikanten auch über ihn geflucht haben, und zwischendurch war es ganz still, es war fast dunkel und still wie noch nie, so eine ganz tiefe Stille auf einmal, und dann begann ein tiefes Summen, und da lief ein Grollen und Zittern und Knirschen durch alles, und ich sprang auf und sah noch im allerletzten Dämmerlicht aus dem Fenster den dunklen Schnee, der sich vom Canin löste.
Sisma
Am Abend des 6. Mai erschüttert ein Erdbeben die Gegend. Der Boden tut sich auf, Häuser stürzen ein, Menschen und Tiere werden unter Trümmern begraben, die Uhren an den Kirchtürmen bleiben stehen, es ist neun Uhr, schwarze Schlangen flüchten in den Fluss, unterhalb des Gipfels des Monte Canin geht eine Wolke aus Schnee durch den Abend zu Tal.
Das Erdbeben ist die Folge einer Verschiebung tektonischer Platten. Es gibt etliche Wörter, die zur Anwendung kommen, um zu erklären, was sich am Ende eines Tages der drei Sonnen, der jaulenden Hunde, der rastlosen Carbonschlangen, der gellenden Vögel ereignet. Wörter wie Bruchfugen, Spreizungszone, Lithosphäre. Schöne Wörter, die man in der Hand halten kann wie kleine fremde versteinerte Lebewesen: Herdfläche. Spaltbildung. Erdbebenleuchten. Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Bebens. Stoßlinien. Das Erdbeben hat eine oberflächenverändernde Wirkung, hört man sagen. Es lässt sich messen. Die Stärke des Bebens am 6. Mai ist nicht einmal so hoch, an den Einheiten einer menschengemachten Skala gemessen. »So haftet das Urtheil an dem physischen Leibe und liebt zu vergessen, dass der Planet wohl von dem Menschen bemessen werden mag, aber nicht nach dem Menschen«, heißt es in einem Buch. Jedenfalls: Die Welt ist nicht mehr dieselbe.
Zuckungen haben einzelne Stücke des äußeren Felsgerüstes der Erde ergriffen und alles weit und breit durcheinandergeworfen. Dislocationen haben sich ereignet, und den verschreckten Überlebenden fällt unweigerlich wieder ein, dass sie in einer Störungsregion leben, und ohne überhaupt je so weit zu kommen, dass sie die Landschaft auf Flexuren und Brüche, auf Streichungslinien und Radialspalten betrachten und befragen oder sich wissentlich auf einer Haldenlandschaft am Rande eines Senkungsgebiets verstehen, begreifen sie doch, und seis nur im Streifen von Mörtel und Steinkrümeln aus dem Haar, dass das, was ihnen gerade widerfahren ist, sich nicht tilgen oder wiedergutmachen lässt, weil es außerhalb der Kategorien von Gut oder Böse ist.
Störungen
Wie sah das Land vorher aus? Auf einmal hat man es vergessen und wird in Träumen über Jahre danach suchen – wie sah der Erdboden aus vor dem Riss, vor den Bruchstücken, Trümmern, Schleifspuren, der Boden unter den Füßen, von Tag zu Tag?
Der Boden des täglichen Lebens wird zum gestörten Gelände, auf dem ein jeder nach Verlorenem sucht, tastend, schauend, horchend.
In den buchenumstandenen Senken am Fuß des Canin indessen halten die Kalköfen stand, wo der weiße Stein aus den Bach- und Flussbetten gebrannt wurde, eine mühsame Arbeit, beinah vergessen: das Herbeitragen der Kalksteine, das Befeuern, Ausharren am Kalkofen und Abdecken mit Lehm. Holz und Kalk, die beiden Erträge der Kargheit, denen alles Gedächtnis ausgetrieben wird, um Lebensunterhalt zu gewähren. Stätten kurzer Herrschaft des Feuers über den vom Wasser geformten Stein.
Monte San Simeone
Am Zusammenfluss von Fella und Tagliamento bei Venzone erhebt sich der Monte San Simeone, ein hoher, kegelförmiger Berg mit bewaldetem Rücken und felsigen Nasen. Dem Berg schreibt man in den schweifenden, schwankenden, immer wieder erzitternden Erzählungen vom Erdbeben den Ursprung des Rombo zu. Darunter, oder darin, wie es im geläufigen Erzählton heißt, ergrollte der Orcolat, das Ungeheuer Erdbeben von 1976. Ein Fabelwesen mit Spuren, die sich nicht verwischen lassen.
Den Gipfel des Monte San Simeone kann man von zwei Seiten erklimmen, von der steilen felsigen Seite des Zusammenflusses oder, sanfter, in vielen Serpentinen von der Seite des tiefblauen eisigen Lago di Cavazzo, des Sees, der vom einstigen Bett des Tagliamento zurückgeblieben ist. Über die Gründe für den Richtungswechsel des Flusses kann man spekulieren, nichts scheint sich so verschoben zu haben, dass der Weg versperrt war. Ein Stimmungsumschwung. Eine Hingezogenheit zum anderen Fluss, zum anderen Tal, zu anderem Gestein, nach Osten. Flüsse haben ihre eigenen Beweggründe. Die verlassenen Betten, längst von Besiedlung überwunden, markiert auch nach Jahrtausenden noch ein dünner Dunst an Herbst- und Wintermorgen, eine ungreifbare Spur.
Der Monte San Simeone mitsamt dem ihm zugeschriebenen Ungeheuer wird von den Betten des Tagliamento, dem alten, dem neuen und dem mit der Fella vereinten, umrahmt. Aus der Höhe blickt man nach Westen auf den glatten See hinunter, nach Nordosten auf das große geröllige Dreieck, das sich am Zusammenfluss gebildet hat. Und man sieht die beiden Farben der Flüsse, den trotz der vielfältigen dunkleren Gesteine weißen Tagliamento und die trotz ihres gleißend weißen Kalksteins türkise Fella. Die beiden Flüsse fließen nach Süden, in einem Bett, doch ohne sich zu vermischen, türkis und weiß bleiben sie nebeneinander, bis sich die Farben unter dem Licht verlieren und nur noch blendend spiegeln, ein Netz von Wasserläufen in einem sich immer weiter ausdehnenden Kiesbett, das die Ost- und Westseite des Tagliamento trennt.
Der Blick von der Ostseite des Monte San Simeone geht auf Venzone, den wiedererrichteten Dom, die belassene Ruine einer Kirche aus weißem Stein daneben. Auf die überwucherten Erdbebenhinterlassenschaften kleiner Orte nahe am Berg und am Fluss, die neuen Siedlungen gleichförmiger Häuser auf vermeintlich festerem Boden. Dort tritt das Gebirge zurück. Die Moränenhügel wellen aus in Ebene, bis zum Meer. Hier, am Monte San Simeone, verläuft eine Linie, die zweierlei Licht trennt, das scharfe, schattenreiche, bläuliche Licht des Gebirges und das weiche, vibrierende, schattenarme Licht der Ebene. Zweierlei Passagenland. Unzählige kamen hier durchgezogen, brachten, nahmen, lernten, gingen weiter. Goldholer und Glasbringer, Kriegslustige, Kriegsmüde, Kriegsversehrte. Erschöpfte Sucher nach dem rechten Ort, die dem Ruf des Grünspechts folgten, sich schließlich nach dem Vogel nannten, als würden sie so die ihnen anhaftende Fremdheit verlieren, könnten sich damit eine Heimat zaubern, einen Aufbewahrungsort für all die Geschichten vom sagenhaften Aufbruch bis zur sagenhaften Sesshaftigkeit. Scharen wurden von den Wehen der einen oder anderen Zeit in die Täler gespült, klommen bergauf, immer den Fluss im Sinn, der das Tal zu seinem machte und den sie nicht aus dem Gedächtnis verlieren wollten. Immer den Fluss lang würde man aus dem Tal hinausfinden, sollte es sich als nötig erweisen. Sie lernten leben, überleben, weiterleben, legten allem, was sie sahen, einen Namen bei, aus ihren Sprachen von anderswo, und sangen, wie es sich gehörte, ihre Lieder im Namen des Anderswo, in Sprachen, die in der Abgeschiedenheit verkümmerten und außer zum Singen nur noch dazu taugten, das Verschlagensein in ein Tal, an einen Fluss zu bestätigen. Ein Wir in einer Landschaft zu benennen, die niemandem gewogen war und sich nach Gesetzen verhielt, die zu verstehen niemand alt genug werden konnte. Lawinen, Schlammbäche, Muren, jede einzelne Verwerfung und Verschiebung begleitet von einem tiefen bebenden Seufzen. Das Seufzen der Materie, ohne Melancholie.
Strada Statale 13
Die Staatsstraße 13, La Pontebbana, wie sie früher, schmaler, holpriger hieß, ist 222 Kilometer lang und verläuft zwischen Tarvisio und Venedig. Sie führt durch das Kanaltal, hält sich an den Fellafluss und folgt dem Verlauf der alten Via Iulia, der Cäsarenstraße, die Handel, Migration und Eroberungen getragen hat. Vorstöße in die Fremde von beiden Seiten, Norden und Süden, im gebirgigen Teil durch ein schmales, zuweilen enges, zuweilen liebliches Tal, einem Bodenschatzpfad mit verschlungenen Abzweigungen in Schatzsuchergelände. Nördlich der Stelle, der das Erdbebenzentrum zugschrieben wird, verläuft die Staatsstraße heute im Schatten einer Autobahn, die nach dem Erdbeben entstand und die einst allen Reisenden gewogenen, in ihre Landschaft gebetteten Orte zerschnitt, abschnitt, von den Wanderbewegungen kappte, die das Tal so lange und über so viele Erschütterungen hinweg und hindurch genährt und ernährt hatten.
Am Zusammenfluss der Fella mit dem Tagliamento tritt die Statale 13 aus den Bergen in die milde Hügellandschaft ein. Es ist eine Transitstraße, eine unruhige Lastwagenstrecke, markiert von schwarzen Bremsstreifen auf der Fahrbahn und Wegrandkreuzen an den Leitplanken, mit staubigen Plastikblumen umwunden, zum Gedenken an Unfallopfer. Kasernen stehen in dezentem Abstand zur Straße, ihre Parkplätze sind groß wie die einer Fabrik. Souvenirläden mit Amphoren, Gipsengeln und Gartenzwergen für heimkehrende Touristen auf dem Weg nach Norden, Motels, Lokale im Schatten der zurückweichenden Hänge, mit Blick auf den niemandsländlichen Streifen, der die Straße vom Flussufer trennt. Auf dem Parkplatz eines rosagestrichenen Motels drängen sich die Lastwagen. Das Motel hat einen hochtrabenden Namen mit einem falsch geschriebenen englischen Wort darin. Neben dem Motel liegt eine kleine Tankstelle mit einer Mittagsküche, die Tankwartin ist auch die Köchin. Leute holen ihr Mittagessen dort, manchmal müssen sie anstehen, es gibt immer nur ein Gericht und Wasser und Wein. Wenn ein Auto kommt, um zu tanken, wird die Essensausgabe unterbrochen, doch das kommt nicht oft vor. Die Frau ist groß und schmal und trägt die grausträhnigen Haare im Nacken zusammengesteckt. Sie heißt Silvia. Wenn die Kunden der Mittagsküche fort sind, nimmt sie sich selbst ihr Essen und steht mit einem tiefen Teller in der Hand an die Tür gelehnt und isst. Sie blinzelt in die Sonne. Auf der Straße zieht der Verkehr vorbei. Manche Lastwagenfahrer hupen. Sie trägt immer ein Kleid, gepunktet, gestreift, geblümt, verschossene Kleider aus einer anderen Zeit. Wären nicht ihre Kleider und das rosa Motel, ließe sich dieser ganze Abschnitt der Staatsstraße wie ein Schwarzweißfilm betrachten. Fast jeden Tag kommt ein Lieferwagen mit Schutt und hält an der Tankstelle. Der Fahrer steigt aus, manchmal tankt er, nie kauft er Essen. Gelegentlich stellt er sich direkt vor die Frau und stützt sich mit einer Hand an den Türpfosten, an den sie sich beim Essen lehnt. So stellen sich Männer gerne zu Frauen in alten Filmen und schauen auf sie hinab. Isst du immer im Stehen?, könnte er dabei fragen. Die Frau zuckt nur mit den Schultern. Sie gibt keine Antwort auf die Frage, schlägt ihm nicht vor, alte Anzüge eines verstorbenen, abständigen oder fallengelassenen Liebhabers zu besichtigen, die sich womöglich im Hinterzimmer ihres Köchinnen- und Tankwartinnenlebens stapeln. Sie trägt ihr Geschirr zum Spülbecken und macht sich zu schaffen, bis ein Tankstellenkunde kommt. Der Lieferwagenfahrer steigt wieder ein und fährt weiter, nach Norden. Er ist unterwegs zu der Sammelstelle für Bauschutt, die auch an der Staatsstraße 13 liegt. Das ist sein Beruf. Gegen Geld sammelt er Bauschutt in der ganzen Region und bringt ihn zur Sammelstelle, die einem Aushang am Tor zufolge schon voll ist mit Betontrümmern und keine unvergänglichen Reste mehr entgegennehmen kann. Alles ist mit dickem Staub bedeckt, wie eine Absonderung der Trümmer. Immer lungern ein paar Männer in schmutzigen Overalls zwischen den unförmigen Bruchstücken herum und warten auf die Bekannten, die ein kleines Geld bereithalten, um, des Schildes ungeachtet, hinter ihrem Aufenthaltsschuppen abladen zu dürfen. Die Overallträger räumen kleinere Stücke hin und her und schichten die Stapel ineinander verkanteter Toiletten, Waschbecken, Bidets und Badewannen um. Inerti werden die Trümmer elegant benannt, sie regen sich nicht, schon vertraut mit der Trägheit der Ewigkeit. Sie werden sich in keinem dem Menschen ermesslichen Zeitraum zersetzen, werden einfach so bleiben, wie sie sind, ihre den Menschen unendlich überlegene Lebenserwartung ungerührt hier verbringen, höchstens mit Moos überwuchern, in ihren groben Poren und Rissen anspruchslosen kleinen Kriechpflanzen Ansiedlung bieten. Der Trümmerfahrer gibt sich freundschaftlich mit den Männern in Overall, die ihn mit erhobener Hand grüßen, Toni heißt er, ein willkommener Gast. Die Ladefläche des Lieferwagens wird geräumt, und beim Hinabwerfen der Trümmer steigt Staub auf, nach dem Abladen trinken die Männer ein