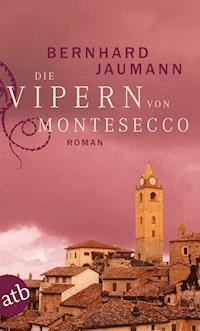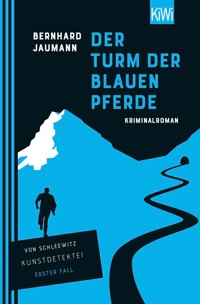9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kunstdetektei von Schleewitz ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mit einer Ratte fängt es an, schnell folgen weitere Graffiti in der ganzen Stadt: Ist Banksy in München unterwegs? Auf der Suche nach dem mysteriösen Sprayer stößt die Kunstdetektei von Schleewitz auf immer weitere Rätsel. Was hat es mit den seltsamen Ratten-Graffiti auf sich, die plötzlich überall auftauchen? Für die Presse ist schnell klar: Banksy, das weltberühmte Kunst-Phantom, ist in der Stadt. Auf einmal lassen Hausbesitzer Graffitis nicht mehr entfernen, sondern lösen stattdessen das besprühte Mauerwerk heraus, um es meistbietend bei Kunstauktionen zu verkaufen – immerhin geht es hier um einen echten Banksy. Oder? Die Agentur des Künstlers leugnet die Echtheit der Graffiti, und doch liefern sich reiche Sammler wahre Bieterschlachten um die Werke des Münchner Banksys. Die Kunstdetektei von Schleewitz soll herausfinden, was gespielt wird. Aber dem Ermittlerteam eröffnen sich dabei immer neue Abgründe. Sie geraten mitten hinein in den Konflikt um Guerillakunst und gnadenlose Kunstvermarktung – und müssen erkennen, dass bei ihrer Recherche nicht nur die Wahrheit auf der Strecke bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bernhard Jaumann
Banksy und der blinde Fleck
Ein Fall der Kunstdetektei von Schleewitz
Kriminalroman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bernhard Jaumann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bernhard Jaumann
Bernhard Jaumann, geboren 1957 in Augsburg, arbeitete nach dem Studium als Gymnasiallehrer. Zurzeit lebt er in Bayern und Italien. Er schrieb mehrere Krimiserien, für die er vielfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem Friedrich-Glauser-Preis für den besten deutschsprachigen Kriminalroman 2003 und für die beste Kurzgeschichte 2008. Für seinen Roman »Die Stunde des Schakals« erhielt er 2011 den Deutschen Krimipreis. Seit 2018 erscheint bei Galiani seine Krimireihe um die Münchner Kunstdetektei von Schleewitz, deren ersten beiden Bände von der Presse als »raffiniert konstruierte Unterhaltung« (NDR) und »große Kunst« (Berliner Zeitung) gelobt wurden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit einer Ratte fängt es an, schnell folgen weitere Graffiti in der ganzen Stadt: Ist Banksy in München unterwegs? Auf der Suche nach dem mysteriösen Sprayer stößt die Kunstdetektei von Schleewitz auf immer weitere Rätsel.
Was hat es mit den seltsamen Ratten-Graffiti auf sich, die plötzlich überall auftauchen? Für die Presse ist schnell klar: Banksy, das weltberühmte Kunst-Phantom, ist in der Stadt. Auf einmal lassen Hausbesitzer Graffitis nicht mehr entfernen, sondern lösen stattdessen das besprühte Mauerwerk heraus, um es meistbietend bei Kunstauktionen zu verkaufen – immerhin geht es hier um einen echten Banksy. Oder?
Die Agentur des Künstlers leugnet die Echtheit der Graffiti, und doch liefern sich reiche Sammler wahre Bieterschlachten um die Werke des Münchner Banksys. Die Kunstdetektei von Schleewitz soll herausfinden, was gespielt wird.
Aber dem Ermittlerteam eröffnen sich dabei immer neue Abgründe. Sie geraten mitten hinein in den Konflikt um Guerillakunst und gnadenlose Kunstvermarktung – und müssen erkennen, dass bei ihrer Recherche nicht nur die Wahrheit auf der Strecke bleibt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: Banksy, »Flower Thrower«
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31126-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
1
Wann sich die ersten Ratten aus ihrer verborgenen Welt hervorgewagt hatten, war im Nachhinein kaum mehr festzustellen. Bevor sich der Münchner Anzeiger auf die Geschichte stürzte, hatte Klara Ivanovic jedenfalls eine selbst gesehen. Das war Anfang Januar gewesen, vielleicht am dritten oder vierten, als sie vom Büro der Kunstdetektei von Schleewitz zu ihrer Haidhausener Wohnung fuhr. Am Rosenheimer Platz stieg sie aus dem S-Bahn-Schacht, zog den Kragen ihres Wintermantels hoch und verfluchte den Schneeregen, der die Straßenbeleuchtung ungefähr so grau wirken ließ, wie ihre Stimmung war. Im Büro hatten die Kollegen genervt, und nun stand ihr ein voraussehbar anstrengender Abend mit ihrem Vater bevor. Zu allem Überfluss klemmte ihr Schirm. Um ihn zu öffnen, bevor sie völlig durchnässt war, trat sie in den Durchgang zum Innenhof des Deloitte-Bürokomplexes. Da fiel ihr Blick auf die Ratte.
Sie stand keine fünf Meter entfernt auf ihren Hinterbeinen. Ein dunkelgraues Riesenvieh, mehr als einen halben Meter groß, den leicht hochgereckten Schwanz nicht mitgerechnet. Die spitze Schnauze war heller, genau wie die fast grotesk abstehenden Barthaare. Die Ratte hatte den Kopf zur Seite gewandt, so als ob sie hinten im Innenhof ein verdächtiges Geräusch gehört hätte und nun wittern musste, ob wirklich Gefahr drohte. Die Vorderpfoten hatte sie vom Körper weggestreckt. Die linke war so gedreht, dass Klara den Fußballen und die Unterseite der Zehen erkennen konnte. Sie waren blutrot.
Vier fingerartig abgespreizte Zehen. Dass die fünfte Zehe bei Ratten verkümmert und praktisch nicht wahrnehmbar war, hatte Klara erst später nachgelesen. Ihr wäre wohl auch gar nicht aufgefallen, dass es sich nur um vier Zehen handelte, wenn nicht ein blutiger Pfotenabdruck an der Mauer neben der Ratte geprangt hätte. Er zeigte die roten Fingerglieder und darunter die etwas verschmierte Spur des Ballens, aus dem zwei Blutrinnsale nach unten liefen. Als hätte sich die Ratte gegen die Wand gestützt, nachdem sie verstümmelt worden war. Nachdem ihr ein Teil der Pfote von einem Schlageisen abgerissen oder von einem Konkurrenten abgebissen worden war.
Klara ging näher heran, auch wenn sie die Szene ziemlich abstoßend fand. Alles, was Blut darstellen sollte, war mit einem Pinsel auf die Granitplatten der Hausmauer aufgetragen worden. Die Ratte dagegen hatte jemand mit Hilfe einer Schablone aufgesprüht und nachträglich mit einigen Schattierungen akzentuiert, so dass das Fell des Tiers plastisch wirkte. Wie lange es wohl dauerte, bis ein solches Graffito fertiggestellt war? Es schien nicht so, als habe der Sprayer sonderlich hastig gearbeitet, obwohl die Stelle vom belebten Rosenheimer Platz aus einsehbar war. Er musste spätnachts unterwegs gewesen sein. Oder schauten die Passanten geflissentlich weg, wenn sich einer selbstbewusst genug an seine illegale Arbeit machte?
Vielleicht war er auch gar nicht fertig geworden. Man fragte sich als Betrachter doch zum Beispiel, wieso die Ratte eine blutüberströmte Pfote hatte. Wer oder was hatte sie verwundet? Warum wurde das auf so drastische Art an der Mauer dokumentiert? Darauf lieferte das Stencil keine Antwort, nicht einmal andeutungsweise. Und auch der misstrauische Blick des Tiers in die entgegengesetzte Richtung fand keinen Zielpunkt, der irgendwie Sinn machte. Im Hof gab es nur dunkle Bürofenster, nass glänzende Bodenplatten, einen vor sich hin kümmernden, winterlich kahlen Baum, vor dem ein SUV parkte, und ein paar modernistische Beleuchtungssäulen, durch deren Licht der Regen schnürte. Klara rüttelte am Schließmechanismus ihres Schirms, doch das Ding öffnete sich einfach nicht. Dann eben nicht. Sie machte sich auf den Heimweg.
Ein paar Tage später schaute sie noch einmal vorbei, ohne genau zu wissen, warum. Dass das Graffito überstrichen worden war, überraschte sie nicht. Ein global agierendes Finanzberatungsunternehmen wie Deloitte hatte die Finger in so vielen schmutzigen Geschäften, dass wenigstens die Fassade blitzblank erscheinen musste. Wahrscheinlich hatte der Hausmeister zeitnah eine entsprechende Order erhalten. Sehr sauber gearbeitet hatte er allerdings nicht. Die Ratte war zwar unter einem metallgrauen Anstrich verschwunden, doch wenn man wusste, wo man zu suchen hatte, sah man den roten Pfotenabdruck noch leicht durchschimmern. Ähnlich einem Blutfleck, der immer noch in den tiefen Schichten des Gewebes zu erahnen ist, obwohl man ihn mehrfach aus einem Pullover herauszuwaschen versucht hat. Auch wenn Klara das Graffito nicht gerade für ein großes Kunstwerk gehalten hatte, empfand sie eine gewisse Befriedigung, dass es nicht völlig spurlos beseitigt worden war.
Wie sich herausstellen sollte, war die Ratte vom Rosenheimer Platz nicht die einzige in München, und einige davon überlebten lange genug an irgendwelchen Hauswänden, Fabrikmauern und Wartehäuschen, um einem breiteren Kreis von Menschen und auch der Lokalredaktion des Münchner Anzeigers aufzufallen. Ob es am Mangel an relevanten Themen lag oder ob der professionelle Instinkt gebot, gleich mit einer halben Zeitungsseite darauf einzugehen, wusste Klara nicht. Aufhänger war ein Rattengraffito in der Balanstraße, und schlagzeilenträchtig war die Vermutung, die damit verbunden war und schon im Titel des Artikels bündig formuliert wurde: Banksy in München?
Die Autorin, eine gewisse Lydia Sommer, formulierte zwar mit leicht ironischem Unterton, referierte aber ausführlich die Ansicht einiger Anwohner, dass der britische Streetartkünstler Banksy für das Graffito verantwortlich sei. Sie unterfütterte die These mit einigen Zusatzinformationen. Banksy sei nicht nur in England, sondern auch in Palästina, New York, Berlin, Paris, Venedig und x anderen Orten auf der ganzen Welt künstlerisch tätig geworden. Warum nicht auch in München? Eines seiner Hauptmotive sei bekanntermaßen eine Ratte, die trotz unterschiedlicher Ausprägung und Ausstattung immer eindeutig als Banksy-Ratte zu identifizieren sei. Und gleiche nicht die Balanstraßenratte den bekannten Vorbildern stilistisch bis ins letzte Barthaar?
Schon in der nächsten Ausgabe der Zeitung konnte jeder Leser diese These anhand zweier Abbildungen überprüfen. Eine von Banksy selbst auf seinem Instagramkanal verifizierte Ratte schaute etwas verwundert auf ihr Gegenüber, das diesmal nicht die Balanstraßenratte war, sondern – wie der nebenstehende Text verriet – an der Gerner Brücke über den Nymphenburger Kanal abfotografiert worden war. Sie stand aufrecht am Fuß der Brücke, breitete die Vorderbeine aus und hatte rote, verweinte Augen, die der Banksy-Ratte fehlten. Ansonsten war eine gewisse Ähnlichkeit in der Tat nicht zu leugnen.
»Ja, und?«, fragte Rupert von Schleewitz, dem Klara die Seite des Münchner Anzeigers über den Schreibtisch hinweg zugeschoben hatte. Er hatte den Artikel bis zum Ende gelesen, aber vielleicht nur, weil ihn das von seiner aktuellen Beschäftigung, einem Einspruch gegen den Steuerbescheid des Finanzamts, ablenkte. Seit die Geschäfte der Kunstdetektei von Schleewitz nicht mehr so gut liefen, dass man sich einen Steuerberater leisten konnte, musste man das selbst erledigen. Klara war für kunsthistorische Fragen zuständig, und Max Müller, der einzige andere Mitarbeiter, hatte zwar einige Qualitäten, doch Expertise in finanziellen Dingen gehörte eindeutig nicht dazu. So blieb die ungeliebte Arbeit an Rupert als Inhaber und Chef der Detektei hängen.
»Das sind Stencils«, sagte Rupert. Er tippte kurz auf seinem Laptop herum. »Die Rattenschablonen kann sich jeder Idiot bei Amazon kaufen, für … warte mal … ab 5,13 Euro aufwärts, je nach Größe.«
Und wenn man nicht zwei linke Hände hatte, konnte man sich nach solchen Vorbildern auch leicht veränderte Schablonen zurechtschneiden, die ziemlich echt wirkende Ergebnisse hervorbrachten. Klara gab Rupert recht. Auch Max, der sich sonst für unwahrscheinlich klingende Theorien schnell begeistern ließ, verwendete zumindest einen relativierenden Konjunktiv, als er sagte: »Eine irre Sache wäre das schon: Banksy, der nachts am Nymphenburger Kanal herumturnt!«
»Bevor er dann zu seinem Wohnblock in der Balanstraße zurückkehrt, wo er in einer Zweizimmertraumwohnung seinen künstlerischen Lebensmittelpunkt gefunden hat?«, fragte Rupert. »Wir sind in München, Max, und das ist nun mal nicht der Nabel der Welt.«
Die Lokalredakteure des Münchner Anzeigers sahen das naturgemäß etwas anders und schlachteten in den folgenden Tagen die Banksy-Geschichte weiter aus. Ein Kunstpädagogikprofessor und ein bekannter Münchner Graffitiveteran kamen zu Wort und zu völlig konträren Erkenntnissen bezüglich der möglichen Autorenschaft des englischen Streetartkünstlers. Hintergrundberichte zu Banksys Karriere ergänzten die aktuelle Berichterstattung. Im Mittelpunkt stand dabei seine ungeklärte Identität. Dass niemand wusste, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg, hatte schon in der Vergangenheit zu wilden Spekulationen geführt und wurde nun zum unausgesprochenen Argument für die Authentizität der Münchner Graffiti. Denn wenn Banksy jeder sein konnte, dann konnte er auch überall tätig werden.
All das geschah unter reger Anteilnahme des Publikums, was die schnell steigende Zahl von Leserbriefen und Onlinekommentaren bewies. Die innerstädtische Pressekonkurrenz vom Süddeutschen Kurier und vom Abendboten konnte nicht umhin, auf den Zug aufzuspringen. Wahrscheinlich aus Neid, zu spät eingestiegen zu sein, gaben die beiden Blätter dem Thema aber deutlich weniger Raum und versuchten, sich als seriöse Alternativen darzustellen. Dass kein Beweis für eine Anwesenheit Banksys in München existierte, war zwar richtig, lockte aber niemanden hinter dem Ofen hervor. So blieb der Münchner Anzeiger das unangefochtene Zentrum der Banksy-Diskussion, und das schlachtete die Redaktion auch weidlich aus. Sie rief die verehrten Münchnerinnen und Münchner zur Mitarbeit auf und würdigte jedes bisher unbekannte Rattengraffito, das ihr von der Leserschaft gemeldet wurde. Eine Woche nach dem ersten Bericht zählte man schon zehn einschlägige Kunstwerke in verschiedenen Stadtteilen von Pasing bis Riem.
Die Münchner Polizei befürchtete wohl, dass das erst der Anfang einer unerwünschten Welle sein könnte, und sah sich in Person ihres Pressesprechers bemüßigt, auf die rechtlichen Folgen illegalen Graffitisprühens hinzuweisen. Sachbeschädigung begehe nach Paragraph 303 des Strafgesetzbuchs, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändere. Dies könne mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geahndet und auch teuer werden, da sich der Geschädigte die Kosten für die Beseitigung des Graffito vom Täter erstatten lassen könne. Die Reaktionen auf die polizeiliche Ermahnung waren zwiespältig. In den Onlinekommentaren verteidigte eine knappe Mehrheit inbrünstig die Freiheit der Kunst, während der Rest genauso entschieden die Meinung vertrat, dass Vandalismus mit Kunst gar nichts zu tun habe.
Über letztere Fraktion war niemand so erbost wie Klaras Vater. Banksy hin oder her, das interessiere ihn wenig, aber dass jeder ahnungslose Depp sich anmaße, Kunst definieren zu wollen, sei eine bodenlose Frechheit. Er als Künstler mische sich doch auch nicht ein, wenn es um Techniken der Schlangenbeschwörung oder die kostengünstigste Herstellung von Halbleitern gehe. Und dieser angebliche Gegensatz existiere natürlich nicht. Kunst sei immer auch Vandalismus, ein Schaffensprozess ohne Zerstörungsimpuls sei seit mindestens hundert Jahren nicht mehr denkbar, schon weil wahre Kunst scheinbare Gewissheiten und eingeschliffene Wahrnehmungsweisen zertrümmern müsse. Ach was, zertrümmern. Pulverisieren müsse sie den Alltagsscheiß, zernichten. Dafür sei jedes Mittel recht, so wahr er Ivanovic heiße.
Dass ihm Konventionen und Vorschriften egal waren, hatte er bei seinen eigenen Kunstprojekten in der Vergangenheit eindrücklich bewiesen. Doch das war vorbei, Alter und Krankheit forderten ihren Tribut. Was er körperlich nicht mehr zuwege brachte, versuchte er inzwischen durch vermehrte Verbalradikalität auszugleichen. Freundlicher formuliert, konnte man ihn als ziemlich meinungsstark bezeichnen. Immerhin war er noch klar im Kopf und an Gott und der Welt interessiert. Dafür war Klara durchaus dankbar, auch wenn ihr Vater sie oft genug mehr forderte, als ihr lieb war.
Zugespitzt hatte sich das, seit er bei ihr wohnte. Seine Haushälterin und Pflegerin war zurück nach Polen gegangen, und da Klara auf die Schnelle keinen Ersatz hatte finden können, den ihr Vater akzeptiert hätte, holte sie ihn für eine Übergangszeit zu sich nach München. Die Alternative hätte darin bestanden, jeden Tag die sechzig Kilometer zu seinem Bauernhof in Berbling hinauszufahren, aber das konnte sie noch weniger leisten, als sich mit ihrem Vater zusammenzuraufen. Er hatte ihr Gästezimmer bezogen, machte nach der morgendlichen Zeitungslektüre regelmäßig einen Spaziergang und kannte nach einer Woche mehr Anwohner ihres Viertels, als Klara in den letzten Jahren kennengelernt hatte. Offensichtlich fühlte er sich wohl, was ihn aber nicht daran hinderte, sich andauernd über Stadt und Leute zu echauffieren. Am liebsten stellte er in langen Monologen deren Banausentum bloß, und dafür bot ihm die im Münchner Anzeiger breitgetretene Banksy-Geschichte einen willkommenen Anlass.
»Ratten«, sagte er, »Ratten waren als Streetartmotiv vielleicht in den 1980er-Jahren originell, als Blek le Rat mit seinen ersten Stencils Paris verschönerte. Banksy hat ihm die Idee einfach geklaut. Epigonentum schimpft sich so etwas. Dass er seine Ratten etwas süßlicher ausführte, macht die Sache nicht besser. Und schon gar nicht, dass er damit auch noch Erfolg hatte. Geschieht ihm recht, dass jetzt er kopiert wird, aber das ändert nichts am Grundsätzlichen: Wenn einer von Banksy klaut, was der von Blek le Rat geklaut hat, ohne die geringste eigene Idee beizusteuern, was soll daran bitte schön Kunst sein?«
»Du glaubst also nicht, dass Banksy hier gearbeitet hat?«, fragte Klara.
»Niemals. Und selbst wenn, wäre es immer noch bloß belangloses Zeug.«
Als Klara im Büro davon erzählte, widersprach überraschenderweise Max. Natürlich komme es darauf an, wer etwas geschaffen habe. Zumindest in der realen Welt. Man solle sich nur den Salvator Mundi anschauen, den einer dieser saudischen Prinzen für 450 Millionen US-Dollar ersteigert habe, bloß weil das Bild plötzlich als eigenhändiges Werk von Leonardo da Vinci angesehen wurde. Ein paar Jahrzehnte vorher sei es für fünfundvierzig britische Pfund zu haben gewesen. Als wertvolle Kunst gelte nun mal, was ein anerkannter Künstler fabriziere, und ein solcher sei Banksy inzwischen zweifelsohne.
»Was meinst du dazu, Rupert?«, fragte Klara.
»Ich meine, dass irgendwer dem Finanzamt mal eine Bombe ins Haus schicken sollte«, sagte Rupert.
Er war schon seit Längerem nicht besonders gut drauf, und diese Rattengraffiti mussten ihn ja nicht interessieren. Die Berichterstattung im Münchner Anzeiger zu verfolgen, war auch für Klara bis dahin nur ein mehr oder weniger amüsanter Zeitvertreib. Das änderte sich erst, als die Kunstdetektei von Schleewitz wenige Tage später beruflich mit den angeblichen Banksy-Werken konfrontiert wurde.
Das Feuer bricht im Treppenhaus zwischen dem zweiten und dritten Stock aus. Eine dort gelagerte Matratze gerät in Brand, wie seltsamerweise schon einmal zwei Jahre zuvor. Damals kam niemand zu Schaden, doch diesmal greift das Feuer auf die hölzerne Treppe über und breitet sich schnell aus. Es entwickelt sich starker Qualm, der bei elf Personen zu Rauchvergiftungen führt. Aber das ist nichts im Vergleich zum Inferno im fünften Stock. Wie durch einen Kamin lodern die Flammen im Treppenhaus nach oben und erzeugen in der Dachgeschosswohnung eine Hitze von etwa 660 Grad.
Manche sprechen von einem Schicksalsschlag.
Die Ursache für den Matratzenbrand ist bislang ungeklärt. Ein technischer Defekt ist unwahrscheinlich, Fahrlässigkeit ist denkbar, Brandstiftung eines Bewohners kann nicht ausgeschlossen werden, da die Empörung über die Zustände im Haus groß war. Unmittelbar Tatverdächtige sind nicht bekannt, wohl aber die Umstände, die den Brand zur Katastrophe werden ließen.
Der fünfte Stock ist zum Treppenhaus hin mit einer Brandschutztür gesichert. Die hätte nach Einschätzung der Ermittler die Flammen für dreißig Minuten aufhalten und der Feuerwehr die Rettung der in der Wohnung befindlichen Personen ermöglichen können. Doch die Tür steht offen. So finden die Einsatzkräfte nur drei verkohlte Leichen vor. Im vergeblichen Bemühen, seine jüngere Tochter zu schützen, hat sich der Vater über sie gebeugt. Die Überreste ihrer Schwester liegen ein paar Meter weiter im Flur.
Viele sprechen von einer Tragödie.
Keiner der Hausbewohner kann sich erinnern, die Brandschutztür je geschlossen gesehen zu haben. Das verhindert schon die Sitzbank, die seit Jahren vor ihr steht. Einen Hinweis, die Tür nicht offen stehen zu lassen, gibt es nicht, und selbst wenn es ihn gegeben hätte, hätten die meist osteuropäischen Mieter ihn wohl kaum verstanden. Der Hausmeister, der die Kontrollen unterließ, und der Hausbesitzer, der für die Verkehrssicherheit im Gebäude verantwortlich ist, lehnen jede Verantwortung ab.
Ein paar wenige halten das für fahrlässige Tötung durch Unterlassen.
Der Dachboden des hundertfünfzig Jahre alten Hauses war schon vor Jahrzehnten zu einer Wohnung umgebaut worden. Die fünf Zimmer der Wohnung werden aber aus Gründen der Profitmaximierung einzeln vermietet. Für ein zwölf Quadratmeter großes Zimmer ohne Küche sind fünfhundert Euro zu bezahlen. Es gibt für nominell zehn Personen eine Etagendusche und zwei Toiletten, eine für Frauen, eine für Männer. Im ganzen Haus sind zum Zeitpunkt des Brandes siebenundneunzig Bewohner gemeldet. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal, die Mieter wechseln ständig, eine Hausgemeinschaft, die den Namen verdient, existiert nicht.
Keiner fordert deswegen gerichtliche Schritte.
Die fünf Zimmer im Dachgeschoss waren nie genehmigt, wurden aber geduldet, sagt der Brandsachverständige des TÜV. Das Bauamt habe überdies vor Jahren bemängelt, dass nicht alle Wohnungen von der Feuerwehr erreichbar seien. Die Behörde gab sich aber mit der Montage einer Fluchtleiter im Innenhof zufrieden, die aus unerfindlichen Gründen sieben Meter über dem Boden endet und für dramatische Szenen bei der Evakuierung sorgt.
Das demselben Besitzer gehörige Hinterhaus soll nun zeitnah auf bauliche Mängel brandschutztechnischer Art untersucht werden. Falls dabei eine Gefahr für Leben und Gesundheit festgestellt werde, will der Vermieter unverzüglich von seinem dadurch begründeten Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Im Zuge der nötigen Renovierung werde er auch den Wohnwert der Immobilie entscheidend verbessern. Statt wucherisch Schlafplätze zu vermieten, kann er dann schweineteure Luxuswohnungen mit Sicherheitsvorkehrungen vom Feinsten anbieten.
Zwischen sechzig und hundert der jetzigen Bewohner, vornehmlich aus Bulgarien, werden allerdings von einem Tag auf den anderen ohne Wohnung dastehen. Der Vermieter rät ihnen prophylaktisch, sich schon mal bei der Obdachlosenunterkunft in der Bayernkaserne um einen Platz anzustellen. Immerhin sind sie nicht bei lebendigem Leib geröstet worden.
Doch wann fragt sich mal einer, ob immer die Opfer Opfer sein müssen?
Girl with Balloon zeigt ein junges Mädchen, das ihre Hand einem herzförmig gestalteten Luftballon hinterherstreckt, der vom Wind davongetragen wird. Ob es den knallroten Ballon absichtlich auf die Reise geschickt hat oder nach ihrem versehentlich losgelassenen Besitz greift, ist nicht eindeutig zu erkennen. Banksy sprühte das Stencil erstmals 2002 an den Südaufgang zur Waterloo Bridge und danach noch mehrmals in verschiedenen Stadtteilen Londons. Keines dieser Graffiti ist heute noch am ursprünglichen Platz zu sehen. Das letzte wurde im Februar 2014 von der Mauer eines Copyshops in der Great Eastern Street entfernt und für eine halbe Million Pfund zum Verkauf angeboten.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten griff Banksy das Motiv immer wieder auf, wenn auch meist mit Variationen, die auf aktuelle politische Ereignisse eingingen und den Ort ihrer Realisierung berücksichtigten. So zum Beispiel an den Grenzanlagen, mit denen die israelische Regierung das Westjordanland abschottet. Auf einer acht Meter hohen Mauer schwebt dort das Mädchen an Ballons nach oben. Und in einer Variante aus dem Jahr 2017 weist ein Mädchen mit Kopftuch auf das Schicksal der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge hin.
Zur selben Zeit wurde das ursprüngliche Girl with Balloonbei einer Umfrage zum beliebtesten Kunstwerk Großbritanniens gewählt. So verwundert es nicht, dass auch Druckversionen des Werks ihren Verkaufswert immens steigerten. Vor allem die erste, auf fünfundzwanzig signierte Exemplare begrenzte Auflage ist bei Sammlern heiß begehrt. Den Rekorderlös erzielte ein gerahmter Druck des Motivs aus dem Jahr 2006, der 2018 bei Sotheby’s versteigert wurde. Für etwas mehr als eine Million Pfund wurde das Los einer anonymen Sammlerin zugeschlagen, doch das war erst der Anfang einer Geschichte, die durch die Weltpresse ging.
Natürlich hatte Rupert von Schleewitz das damals mitbekommen. Kaum war der Hammer im Auktionssaal gefallen, als sich Girl with Balloon ratternd in Bewegung setzte. Die Leinwand glitt nach unten, durch den unteren Teil des Rahmens hindurch, und kam in längs zerteilten Streifen wieder hervor. Ungefähr auf halbem Weg streikte der im Rahmen versteckte Schredder, so dass der rote Ballon noch auf der unversehrten Leinwand zu sehen war, während das Mädchen mit Ausnahme der Haarspitzen dem Zerstörungsmechanismus zum Opfer gefallen war. Einem Moment ungläubigen Staunens folgte der trockene Kommentar des Auktionators, man sei wohl gerade gebanksyt worden. Tatsächlich schien der unerkannt anwesende Künstler den Schredder per Fernbedienung in Gang gesetzt zu haben.
Der Skandal löste sich für alle Beteiligten schnell in Wohlgefallen auf. Sotheby’s erklärte, dass man einer Weltpremiere beigewohnt habe. Von Zerstörung könne keine Rede sein, im Gegenteil sei zum ersten Mal während einer Auktion ein Kunstwerk live erschaffen worden. Der Künstler schloss sich faktisch dieser Meinung an, indem er das halb geschredderte Bild neu betitelte: Aus Girl with Balloon wurde Love is in the Bin. Die Liebe der neuen Besitzerin zu ihrer Erwerbung war trotz der Umbenennung keineswegs im Eimer. Sie trat von dem Geschäft nicht zurück, wohl weil sie sich überzeugen ließ, dass das weltweite Aufsehen den Wert des Werks weiter steigern würde. Drei Jahre später reichte sie es wieder bei Sotheby’s ein. Diesmal verlief die Auktion ohne besondere Vorkommnisse, wenn man davon absah, dass sich der Verkaufspreis versechzehnfacht hatte.
Sechzehn Millionen Pfund entsprachen knapp neunzehn Millionen Euro. Ruperts Meinung nach war das der pure Wahnsinn, mochte das Werk auf noch so einzigartige Weise entstanden sein und mochte noch so sehr Banksy draufstehen. Im Grunde handelte es sich um ein recht kitschiges Motiv, das nicht gehaltvoller wurde, bloß weil es halb zerstört war. Aber Rupert würde den Kunstmarkt nicht ändern können. Das wollte er auch gar nicht, schließlich basierte seine eigene geschäftliche Existenz auf den Unsummen, die da im Spiel waren. Deswegen hatte er sich auch gleich über Banksy und speziell den Marktwert der Girl-with-Balloon-Werke informiert, als er den Anruf von Frau Zimmermann erhalten hatte.
Und nun standen Klara und er vor Frau Zimmermanns Domizil in Bogenhausen. Eine verdammt teure Wohngegend und eine Villa, die garantiert in irgendwelche Baudenkmallisten aufgenommen worden war. Das neobarocke Gebäude protzte mit reicher Stuckverzierung über dem Eingangsportal und am Giebel. Fenster und Schmuckelemente waren weiß abgesetzt, während der Korpus des Hauses blassrosa gestrichen war. Der herzförmige rote Luftballon, der zwischen zwei Fensterbrettern des ersten Stocks schwebte, hob sich deutlich davon ab. Von dem aufgesprühten Mädchen, das nach der Ballonschnur griff, waren nur der Kopf und ein ausgestreckter Arm sichtbar. Der Rest des Körpers schien von einer direkt darunterliegenden Fensteröffnung des Erdgeschosses verschluckt worden zu sein. Nur wenn man genau hinsah, erkannte man die schwarze Farbe auf der Fensterscheibe. Hier den Karton zum Sprühen anzulegen, musste schwierig gewesen sein, denn das Fenster war durch eng stehende senkrechte Gitterstäbe gesichert. Sie sorgten dafür, dass Kleid und Beine des Mädchens wie geschreddert wirkten.
»Love is in the Bin«, sagte Rupert. »Nur dass hier deutlich mehr zu sehen ist als bei dem Banksy nach der Auktion.«
»Trotzdem, ein eindeutiges Zitat, um nicht von Imitation zu sprechen«, sagte Klara. »Immerhin ist es einigermaßen kreativ an die baulichen Gegebenheiten angepasst worden.«
»Frau Ivanovic, meine kunsthistorisch versierteste Mitarbeiterin«, sagte Rupert. Dann fragte er zu Frau Zimmermann hin: »Haben Sie eine Ahnung, wann …?«
»Erst heute Nacht. Als ich am Morgen aus meinem Haus kam, hat mich fast der Schlag getroffen.« Frau Zimmermann zog sich mit der rechten Hand den Mantelkragen zu. Die eleganten schwarzen Wildlederhandschuhe wollten nicht recht zu dem Pelzmantel passen, der bis zu den Winterstiefeln hinabreichte.
Irgendwelchen braun-weiß gescheckten Tieren war dafür das Fell über die Ohren gezogen worden. Karakullämmern? Oder einem Dutzend Polarfüchsen im Sommerkleid? Natürlich könnte es auch ein gut gemachter Kunstpelz sein, Rupert kannte sich da nicht so aus. Allerdings traute er einer distinguierten Dame wie Frau Zimmermann eigentlich nicht zu, in einem Fake herumzulaufen. Was würden denn die Freundinnen beim Kaffeekränzchen dazu sagen? Rupert fragte: »Wollen Sie Strafanzeige erstatten?«
»Anzeige? Um Gottes willen, nein. Nicht, solange ich nicht weiß, von wem das Graffito ist.«
»Und das sollen wir herausfinden?« Rupert konnte sich spannendere Aufgaben vorstellen, doch man wurde eben nicht alle paar Wochen mit einem geklauten Caravaggio oder einem dubiosen Franz Marc konfrontiert.
»Es könnte doch wirklich von Banksy stammen«, sagte Frau Zimmermann.
Das könnte sein. Theoretisch. Praktisch brauchte die Detektei dringend einen gut bezahlten Auftrag. Einer bedürftigen Rentnerin würde Rupert zwar abraten, ihre Spargroschen für ein solches Vabanquespiel auszugeben, doch wer eine Villa in Bogenhausen sein Eigen nannte, war alles andere als arm. Von Rupert aus durfte die Dame ihr Vermögen verschleudern, wie sie wollte. Er entschloss sich, die Honorarforderung der Kundschaft anzupassen und zwanzig Euro auf den üblichen Satz aufzuschlagen. »Wir berechnen neunzig Euro pro Arbeitsstunde. Kein Grundhonorar, keine Spesen, keine versteckten Kosten, da ist alles enthalten.«
»Aber machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen«, sagte Klara.
»Halten Sie es für qualitativ zu schlecht? Nicht auf Banksys Höhe?«, fragte Frau Zimmermann.
»Schwer zu sagen. Von der Ausführung her ist ein Stencil kein großes Problem«, sagte Klara. »Schon gar nicht, wenn es Vorbilder hat.«
Frau Zimmermann nickte. »Wissen Sie, ich bin eigentlich ein misstrauischer Mensch. Ich glaube nicht alles, was in der Zeitung steht. Diese Rattengraffiti, Banksy in München, nun ja.«
»Das kann eine aufwendige Recherche werden, und wenn sich dann herausstellt, dass nur einem Siebzehnjährigen aus der Nachbarschaft langweilig war …« Klara brach ab.
»Andererseits interessiere ich mich sehr für Gegenwartskunst, speziell für Streetartkünstler«, sagte Frau Zimmermann. »Ich sammle seit Jahren, Hambleton, C215, Above und andere. Ich hatte mich bereits mit dem Gedanken getragen, auch einen Banksy zu erwerben. Wenn jetzt einer sozusagen freiwillig zu mir nach Hause käme, wäre das schon sehr apart.«
Dass eine geschätzt sechzigjährige Villenbesitzerin mit Polarfuchsmantel Streetart sammelte, überraschte Rupert durchaus. Aber warum nicht, wenn sie es sich leisten konnte? Er hätte gleich einen runden Stundensatz von hundert Euro verlangen sollen.
»Ich will das jetzt wissen.« Frau Zimmermann blickte auf das Gitter vor der besprühten Fensterscheibe. »Ich engagiere Sie.«
»Abgemacht«, sagte Rupert. Frau Zimmermann bat, auf dem Laufenden gehalten zu werden, und verschwand in ihrer Villa. Klara schüttelte den Kopf. Auch Rupert hielt es für nahezu ausgeschlossen, dass Banksy hier am Werk gewesen war, aber Job war Job, und die Kunstdetektei von Schleewitz würde ihn nach besten Kräften ausführen. Ergebnisoffen. Und engagiert bis hin zur letzten, momentan ausgesprochen lustlos dreinschauenden Mitarbeiterin.
»Also frisch ans Werk, Frau Ivanovic«, sagte Rupert. »Wenn wir schon mal da sind.«
Als Erstes mussten die Anwohner befragt werden. Vor der Villa gab es keinen Vorgarten und keine Hecke, die Sichtschutz geboten hätte. Wer da auf Höhe des ersten Stocks ein Luftballonherz malen wollte, musste mit einer Hebebühne vorfahren oder seine Leiter direkt am Gehweg der Ismaninger Straße aufstellen. Selbst in tiefer Nacht sollte so eine Aktion samt An- und Abfahrt nicht unbemerkt geblieben sein.
»Willst du mal da drüben anfangen?« Rupert deutete zu den fünfstöckigen Wohnhäusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite hin.
»Ob ich will?«, fragte Klara zurück. Sie schien in ihrem Mäntelchen zu frieren.
»Sobald wir ein paar Millionen im Plus sind, schenke ich dir auch so einen Polarfuchspelz.«
»Das war Waschbär«, sagte Klara.
»Echt?«, fragte Rupert. »Wir machen uns trotzdem an die Arbeit, solange es noch hell ist. Du nimmst dir Hausnummer 68 vor, und ich beginne nebenan.«
Waschbären abzuhäuten, war politisch wahrscheinlich korrekter, als sich an Polarfüchse zu wagen, dachte er. Sie gehörten einer invasiven Art an, die in Europa nichts verloren hatte. Ein bisschen putziger als Ratten, aber genauso unerwünscht.
Die befragten Anwohner der Ismaninger Straße ließen sich im Wesentlichen in drei Kategorien einteilen. Die erste Gruppe hatte gar nichts bemerkt, noch nicht einmal, dass Frau Zimmermanns Haus verschönert worden war. Die zweite Gruppe hatte genauso wenig mitbekommen, was sie aber nicht daran hinderte, irgendeinen unliebsamen Nachbarn zu beschuldigen, dem diese wie jede andere Schweinerei zuzutrauen wäre. Und dann gab es noch die Senioren, die von ihren ums Erbe fürchtenden Kindern gut instruiert worden waren. Sie witterten eine perfide Abart des Enkeltricks und drohten mit der Polizei, falls Klara nicht augenblicklich verschwinden würde.
Nur ein einziger Nachbar fiel etwas aus der Reihe. Kaum hatte Klara beim Namensschild Moser geklingelt, riss ein Mann die Wohnungstür auf und zischte ihr zu, schnell hereinzukommen. Sie begann zu erklären, dass sie nur ein paar Informationen über das Graffito schräg gegenüber sammle, da griff der Mann sie schon am Arm und zog sie resolut nach innen. Er blickte sich um, nach schräg hinten, und schob gleichzeitig mit dem Ellenbogen die Tür zu. Wenn er ein Triebverbrecher ist, mit dem Knie in die Weichteile, dachte Klara, aber so wirkte der Typ eigentlich nicht. Es klang auch nicht besonders bedrohlich, als er sagte: »Es ist nur wegen Herrn Karl.«
»Herr Karl?«
»Der will raus«, sagte der Mann und wies zu einem Bild an der Flurwand. An der oberen Kante des Rahmens krallte sich ein knallgelber Wellensittich fest, der offensichtlich aus dem Käfig entkommen war. Dass sich vereinsamte alte Menschen einen zwitschernden Hausgenossen hielten, verstand Klara, doch bei einem Typen in ihrem Alter war das eher ungewöhnlich. Und der hier sah auch mehr nach Fitnesstrainer als nach Vogelflüsterer aus. Vielleicht war ihm sein Auftritt selbst etwas peinlich, denn die gespielte Verzweiflung, die er nun in seine Stimme legte, klang schon ziemlich ironisch. »Ich sage ihm immer wieder, dass es draußen eiskalt ist, dass es nichts zu fressen gibt und dass so ein instinktloses Tier wie er sowieso von der erstbesten Katze erwischt wird.«
»Er hört einfach nicht auf Sie?«, fragte Klara.
»Nein. Und er hat keine Ahnung, was gut für ihn ist. In der Hinsicht ähnelt er seinem Herrn. Na ja, ich glaube, eigentlich dem Großteil der Menschheit.«
Daran mochte etwas Wahres sein. Auch was sie selbst betraf, war Klara ein solcher Verdacht schon ab und zu gekommen. Aber wegen solcher Themen war sie nicht hier. Sie fragte: »Herr Moser, ist Ihnen zufällig gestern Nacht, wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden, draußen auf der Straße etwas aufgefallen?«
»Schon.« Herr Moser nickte. Er musterte Klara von oben bis unten. Erst jetzt schien er sie bewusst wahrzunehmen. »Ich sage es Ihnen gleich, aber vielleicht könnten Sie mir erst helfen, Herrn Karl einzufangen?«
»Meine letzte Großwildjagd ist schon eine Weile her.«
»Sie stellen sich einfach dahinten in den Weg und fuchteln mit den Armen, wenn Herr Karl vorbeiwill. Ich brauche Sie sozusagen als Vogelscheuche.«
»Danke für das Kompliment«, sagte Klara.
»Nein, so war das nicht gemeint. Ich wollte damit nicht sagen, dass Sie …« Er brach ab, zupfte sich am Bart.
»Dass ich was?«, fragte Klara. Sie hatte noch nie verstanden, wie jemand an Bärten Gefallen finden konnte. Bei dem Typen hier sah es allerdings nicht ganz so schlimm aus wie bei anderen Männern, die meinten, auf Naturbursche machen zu müssen. Oder vielleicht war es eher so, dass er trotz des Vollbarts einigermaßen attraktiv wirkte.
»Ich nehme das böse Wort zurück und behaupte das Gegenteil, okay?« Er streckte Klara die Hand entgegen. »Ich heiße übrigens Kilian.«
»Klara Ivanovic.« Sie übersah seine ausgestreckte Hand. »Wo soll ich also herumfuchteln?«
Wie zu erwarten, machte sie sich als Vogelscheuche eher mittelprächtig, und Herr Karl kapierte natürlich nicht, dass sie nur sein Bestes wollten. Er krächzte empört und flatterte ein paarmal in Todesangst über Klaras Scheitel hinweg, bis sein Herr ihn auf der Garderobe zu fassen bekam. Das Köpfchen des Vogels schaute zwischen seinen Fingern hervor, als er ihn mit festem, aber auch vorsichtigem Griff zum Käfig trug. Die Gittertür schloss sich hinter Herrn Karl, und er hackte noch einmal nach der Hand, die ihn gerade losgelassen hatte.
»Irgendwann drehe ich dir den Hals um«, sagte Moser. Dann wandte er sich zu Klara um. »Danke.«
»Gern geschehen. Und was haben Sie nun gestern gesehen?«, fragte sie.
»Es war ziemlich genau halb vier. Ich schaue zufällig aus dem Fenster und sehe gerade noch, wie eine Person mit einem Rucksack und einer Klappleiter unterm Arm die Straße überquert und Richtung Cuvilliésstraße vorläuft. Da ist sie dann abgebogen und war verschwunden.«
Klara hätte es schon interessiert, wieso jemand wie Kilian Moser um halb vier Uhr morgens zufällig aus dem Fenster schaute, doch das ging sie nichts an. Sie fragte: »War es ein Mann?«
»Ich glaube schon.«
»Alt, jung, groß, klein?«
Moser zuckte mit den Achseln. »Ich sah ja nicht viel von ihm. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze übergezogen.«
»War er allein?«
»Ich habe niemand anderen gesehen.«
»Das ist nicht gerade viel«, sagte Klara.
»Wenn Sie mir Ihre Telefonnummer geben, melde ich mich, falls mir noch etwas einfällt. So ähnlich klingt das doch immer in den Fernsehkrimis, oder?«
»Ich schaue keine Krimis«, sagte Klara. Mit so einer billigen Masche hatte es schon lange niemand mehr bei ihr versucht.
Auch Rupert konnte am nächsten Morgen keine hilfreiche Zeugenaussage vermelden. Das schien ihn jedoch nicht anzufechten. Dann müssten sie eben die Spur des Sprayers an den anderen Münchner Tatorten aufnehmen. Wie gerufen käme dabei die neueste Ausgabe des Münchner Anzeigers. Das Blatt hatte die auf ihrer Banksy-Hotline eingegangenen Meldungen ausgewertet und einen großformatigen Lageplan aller vermeintlichen Banksy-Kunstwerke veröffentlicht. Neben zwei bisher unbekannten Rattenstencils waren darin auch Frau Zimmermanns Love is in the Bin sowie eine Version des Flower Thrower verzeichnet.
Tatorte, Spur aufnehmen. Für Klara klangen Ruperts Worte eine Nummer zu groß. Die wären bei Mord, Entführung oder schwerem Raub angemessen, doch nichts davon traf hier zu, und mit solchen Verbrechen umzugehen, war sowieso nicht die Aufgabe einer privaten Kunstdetektei. Graffiti zu sprühen, war zwar illegal, es als wirklich kriminelle Tat anzusehen, gelang Klara jedoch nicht so recht. Genauso wie sie zweifelte, ob man dabei von ernstzunehmender Kunst sprechen sollte. Ausnahmen mochte es geben, aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle war Sprayen doch nur eine Freizeitbeschäftigung sich selbst suchender oder geltungsbedürftiger Jugendlicher. Klara schätzte, dass sich das auch bei den angeblichen Banksys bewahrheiten würde. War das so viel Aufhebens wert?
»Wenn jemand den Sprayer irgendwo beobachtet hätte, würde er sich damit wichtigmachen. Das würde sich der Anzeiger doch auf keinen Fall entgehen lassen«, sagte Klara. »Garniert mit einer möglichst detaillierten Beschreibung und der Bitte um sachdienliche Hinweise.«
»Ein wenig mehr Dankbarkeit bitte. Die zeigen uns immerhin, wo wir nachforschen müssen«, sagte Rupert und riss den Lageplan aus der Zeitung.
»Und wieso sollten wir dort mehr erfahren als die Reporter?«
»Wenn du eine bessere Idee hast, raus damit!«
Die beste Idee wäre, einen ordentlichen Auftrag an Land zu ziehen. Die nächstbeste, abzuwarten, bis der Sprayer von der Polizei einkassiert und als Linus B. oder Mehmet F. oder sonst wer identifiziert würde.
»Ist doch ein wunderbarer Tag heute«, sagte Rupert. »Zumindest ist das Wetter nicht ganz so grässlich wie gestern. Gerade richtig, um sich ein paar Graffiti anzuschauen und Volkes Stimme dazu zu hören.«
Vielleicht kalkulierte er insgeheim, wie viele Arbeitsstunden er Frau Zimmermann in Rechnung stellen konnte, vielleicht ging ihm auch das Herumsitzen im Büro auf die Nerven. Im Moment gab es wirklich nicht viel Sinnvolles zu tun, und auch wenn Klara die meist frustrierenden Erfahrungen von gestern noch in den Knochen saßen, bot ein Trip durch München wenigstens etwas Abwechslung. Und Rupert war sowieso nicht von seinem Vorhaben abzubringen. So machten sich beide ein paar Minuten später auf den Weg zu einem der neuen Rattengraffiti in der Dachauer Straße nahe dem Hauptbahnhof.
Die Gegend um den Tatort war von Billighotels, Imbissbuden, Callshops und Läden für den An- und Verkauf von Gold geprägt. Zwei Friseursalons und ein Geschäft für Bilderrahmen konnten als einigermaßen seriös durchgehen. Das Traditionskino Gabriel, das Klara zu Studentenzeiten ein paarmal besucht hatte, war geschlossen und stand leer. Nur die Spuren des demontierten Schriftzugs waren noch an der Fassade zu erkennen. Umrisse einer Schreibschrift, die den Charme der 1950er-Jahre versprühte. Die Spielhöllen ein Stück weiter nördlich schienen jedoch gut zu gedeihen. Über einer von ihnen versteckte sich der Boobs Gentlemen’s Club hinter diskret rauchschwarz getönten Scheiben.
Aus der Reihe fiel der offensichtlich neu eröffnete Laden im Haus Nummer 24. Über den fast bodentiefen Schaufenstern erstreckte sich auf die ganze Breite des Anwesens ein Schild, das ihn als Gifft Flagship Store auswies. Gifft mit zwei f, als könne man damit die an Zyankali erinnernden Assoziationen abschwächen. Zwischen zwei Fenstern des ersten Obergeschosses hatte ein nächtlicher Besucher mit seiner Spraydose allerdings explosivere Gefahren heraufbeschworen.
An der Oberkante des Firmenschilds klammerten sich die Hinterbeine einer aufgesprühten Ratte fest. Sie stand leicht gebückt, beugte sich vom mittleren Fenster weg und hielt in der ausgestreckten Pfote ein aufgeklapptes Sturmfeuerzeug. Daraus züngelte eine rote Flamme empor, der einzige Farbklecks in dem ansonsten schwarz-weiß gehaltenen Stencil. An der Flamme entzündete sich Funken sprühend das Endstück einer Lunte, die als gekringelte Linie über das Fenster führte und in einer kugelförmigen schwarzen Bombe endete. Ein halbmondförmiger heller Streifen verdeutlichte deren Rundung.
Das ganze Werk folgte einer konventionellen Comic-Ästhetik. Es fehlten nur noch Sprechblasen oder ein lautmalerisches »Zischhhh« neben der brennenden Lunte. Einzig der Gesichtsausdruck der Ratte widersprach dem Erwartbaren ein wenig. Statt hämisch zu grinsen oder bösartig das Maul zu verziehen, schaute sie unbeteiligt nach oben. Fast als hätte sie mit dem Entzünden der Bombe nichts zu tun und wäre in Gedanken bei etwas völlig anderem. Den Ratten, die Klara am Rosenheimer Platz und in den Zeitungsabbildungen gesehen hatte, glich sie von der Ausführung her so sehr, dass man vom selben Urheber ausgehen musste. Und ja, den Banksy-Ratten ähnelte sie ebenfalls.
»Der Sprayer muss hier auch eine Leiter benutzt haben«, sagte Rupert.
»Oder es war einer mit einem fliegenden Teppich«, sagte eine Frau neben ihm mit leicht kehligem Akzent. Eine Russlanddeutsche wahrscheinlich, auch wenn sie einen urbayerischen Dackel an der Leine mitführte. Das Tier hatte einen Hundemantel umgeschnallt, schaute mit treuen Augen zu Klara auf und hob dann das Bein am Hinterreifen eines parkenden Autos.
»Sind Sie eine Nachbarin?«, fragte Rupert.
»Wir wohnen gleich da vorn.«
»Beobachtet haben Sie nichts, oder?« Rupert deutete auf das Graffito hoch. Der Dackel pinkelte gegen die Radkappe.
»Nachts geh ich nicht aus dem Haus. Hier in der Gegend ist mir zu viel ausländisches Gschwerl unterwegs. Bulgaren, Rumänen und was weiß ich. Und jede Menge Araber. Deswegen sag ich das ja mit dem fliegenden Teppich.«
Klara fragte sich, woher die Frau das Dialektwort Gschwerl kannte. Und ob man dessen Verwendung plus die Verbreitung gängiger Vorurteile als Beleg für eine gelungene Integration werten durfte.
»Sieht für mich gar nicht nach Tausendundeiner Nacht aus«, sagte Rupert.
Die Frau zuckte mit den Achseln. Der Dackel zog an der Leine, und das Frauchen setzte sich gehorsam Richtung Stiglmaierplatz in Bewegung. »Ja, dir ist kalt, mein Liebling. Genug Gassi gegangen.«
»Volkes Stimme«, sagte Klara, als die Frau weit genug entfernt war. »Die wolltest du doch hören.«
»Ich frage mal im Laden nach«, sagte Rupert.
Neben dem Firmenlogo verkündete eine kleinere Inschrift, dass es sich bei Gifft um eine Marketing-App handelte. Die hatte wohl irgendetwas mit dem Gastronomiesektor zu tun, wie ein Blick durch die Fenster nahelegte. Wieso die Firma einen Flagship-Store in dieser Schmuddelecke der Stadt brauchte, erschloss sich Klara nicht, aber sie musste ja nicht alles verstehen. Es dauerte fünf Minuten, bis Rupert wieder herauskam und verkündete, dass das Graffito bereits vier Tage alt sei. Zeit genug, um die Neuigkeit bis zum letzten Nachbarn durchdringen zu lassen. Trotzdem sei den Angestellten bis heute niemand bekannt geworden, der das Attentat oder seine Vorbereitung beobachtet habe.
»Das Attentat?«, fragte Klara.
»Das war die Wortwahl der Frau da drinnen«, sagte Rupert. »Ob die Konkurrenz, Links- oder Rechtsterroristen dahintersteckten, mochte sie nicht entscheiden. Wer aber eine Bombe mit brennender Lunte an ein Geschäft male, drohe eindeutig mit Gewalt.«
»Und was sollte die Firma Gifft ins Visier einer Terrorgruppe bringen?«
»Vielleicht die Qualität ihrer Restaurantempfehlungen?«
»Sehr witzig«, sagte Klara. »Hast du das Thema Banksy angesprochen?«
Rupert nickte und sagte: »War ihr bis zu den Zeitungsberichten kein Begriff. Mit Kunst hätte so eine Schmiererei ihrer Meinung nach jedenfalls nichts zu tun.«
Letzterem konnte Klara bedingt zustimmen. Ansonsten war der Besuch hier ein einziger Fehlschlag. Keine Zeugen und nicht die Spur eines Hinweises auf den Sprayer. Bei den noch ausstehenden Graffiti würde das kaum anders ein. Der Tag versprach, einer der Sorte zu werden, an denen man besser im Bett geblieben wäre.
Max Müller hatte seine Hilfe angeboten, als Rupert und Klara am Morgen zu ihrer Vor-Ort-Recherche aufbrachen. Aber Rupert hatte gesagt, sie kämen auch zu zweit klar. Na, wenn sie meinten. Im Grunde konnte Max froh sein, dass er nicht draußen in der Kälte von Haustür zu Haustür ziehen musste. Bloß klang der Auftrag, den er von Rupert erhalten hatte, eher nach Beschäftigungstherapie. Er solle mal recherchieren, wo Banksy sich in letzter Zeit aufgehalten habe und ob er überhaupt in München sein könne. Das war schnell erledigt. Die letzten Beiträge auf seinen Social-Media-Kanälen deuteten alle auf England hin, waren aber schon zwei Monate alt. Aktuelleres war im Internet nicht zu finden gewesen. Über Banksy selbst allerdings umso mehr.
Mysteriös, geheimnisumwoben, sagenumrankt, anonym, subversiv, scheu, schwer fassbar. Die Onlinejournalisten sparten nicht mit wohltönenden Adjektiven, wenn sie über ihn berichteten. In einem Beitrag war sogar von »Mister Nobody« die Rede, was Max unwillkürlich an einen alten Westernklamaukfilm erinnerte. Terence Hill in der Hauptrolle nannte sich darin »Nobody«, bloß damit am Schluss auf dem Grabstein des von ihm erledigten Revolverhelden ein zweideutiges »Niemand zog schneller als er« stehen konnte. Und existierte für das Niemand als Name nicht auch ein Vorbild in irgendeiner antiken Sage?
Egal. Banksy war sicher kein Niemand, ganz im Gegenteil. Über seine Bedeutung für die Gegenwartskunst hatte Klara sich sehr zurückhaltend geäußert, und da zu widersprechen, maßte sich Max nicht an, obwohl ihm einige der Werke durchaus gefielen. Vor allem die witzigen, wie zum Beispiel das, bei dem ein Dienstmädchen eine Hausecke hochhebt, um den Schmutz darunterzukehren. Dass man nicht Kunst studiert haben musste, um die Bilder zu verstehen, war in Max’ Augen auch kein Nachteil.
In puncto Selbstvermarktung war Banksy unbestreitbar genial. Dass er die Öffentlichkeit nicht wissen ließ, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg, machte natürlich neugierig. Die Geheimniskrämerei kam bei ihm aber nicht als bloße Attitüde daher. Er sprayte illegale Graffiti und hatte guten Grund, der Polizei seinen wahren Namen nicht zu verraten. Zumindest war das am Anfang seiner Karriere so gewesen, während heute wohl keiner über Sachbeschädigung klagen würde, dessen Eigentum von Banksy mit einem Stencil bedacht wurde. Trotzdem lüftete der Künstler seine Identität nicht und wahrte damit geschickt den Nimbus des Halbkriminellen. Er blieb seinen Ursprüngen treu, opponierte weiterhin gegen das Establishment und pfiff demonstrativ darauf, den Ruhm, den er sich erarbeitet hatte, offen einzuheimsen. Street Credibility nannte sich das wohl, und das faszinierte besonders diejenigen, die sich im wirklichen Leben mit Alarmanlagen und Überwachungskameras vor lichtscheuem Gesindel schützten.
Banksy, was sollte das eigentlich bedeuten? Im Internet fand Max ein paar Theorien, die alle nicht sonderlich überzeugten. Der Name sollte zum Beispiel vom englischen »Bang«, dem Comicausdruck für »Peng«, abgeleitet sein. Da Banksy in seiner Jugend als Fußballtorwart aktiv gewesen sein soll, könnte er einer anderen Meinung nach auch den Weltmeistertorhüter von 1966, Gordon Banks, gewürdigt haben. Am wahrscheinlichsten schien noch, dass sich der Name aus dem ursprünglichen Pseudonym Robin Banks entwickelt hatte, welches wiederum wegen des annähernden Gleichklangs mit »robbing banks«, also Banken ausrauben, attraktiv gewirkt habe.
Deutlich mehr Spekulationen existierten zu der Frage, wer sich hinter Banksy verbarg. Max holte sich einen Espresso aus der Kaffeemaschine, und da er sonst nichts zu tun hatte, begann er, eine Liste der irgendwann mal verdächtigten Personen anzulegen:
Robert Del Naja, der Frontmann der Band Massive Attack
Der Streetartkünstler King Robbo alias John Robertson
Der weltbekannte Maler Damien Hirst
Paul Horner, der durch satirische Internetbeiträge bekannt wurde
Robin Gunningham, ein Künstler aus Banksys wahrscheinlicher Heimatstadt Bristol
Der Breakdancer Banxy
Ein Mitglied der Rockband Chumbawambaw
Der Möchtegernkünstler Thierry Guetta alias Mr. Brainwash, die Hauptfigur in Banksys Film »Exit through the gift shop«
Jamie Hewlett, Comiczeichner, Gründer der Band Gorillaz und Hauptaktionär von Banksys früherer Vermarktungsfirma Pictures On Walls
Ein gewisser Richard Pfeiffer, der in Manhattan auf frischer Tat verhaftet wurde
Eine nicht identifizierte blonde Frau, die in einem von Banksy erstellten Dokumentarfilm auftaucht
Gar keine Einzelperson, sondern eine Gruppe, zu der keiner, einer oder mehrere der Genannten zählen könnten
Das meiste davon war offensichtlicher Blödsinn. Nummer zwei, King Robbo, starb 2014 und hätte aus dem Grab heraus die vielen Banksy-Aktionen der folgenden Jahre durchführen müssen. Paul Horner war nun auch schon seit fünf Jahren tot und hatte überdies in Arizona gelebt, als Banksy in Europa sprühte. Ähnliches galt für Guetta, der sich lange Jahre fern von Banksys Wirkungskreis, in Kalifornien, herumgetrieben hatte, bevor er in dessen Film verwurstet wurde. Außerdem war er gebürtiger Franzose und entschieden talentlos, wie seine eigenen Arbeiten bewiesen. Damien Hirst hatte wahrscheinlich beim Mural Keep it spotless – das war das witzige mit der Hausecke – mit Banksy zusammengearbeitet, seine gut dokumentierten Aufenthaltsorte stimmten ansonsten aber ebenfalls nicht mit den Entstehungsorten der Werke von Banksy überein. Die Punkband Chumbawamba kam nur ins Gerede, weil Banksy einen ihrer Songs in einem Video verwendete, doch gegründet wurde sie 1982, als Banksy ungefähr acht Jahre alt gewesen sein dürfte. Der Breakdancer Banxy war einfach wegen der Namensähnlichkeit verwechselt worden, und die Anklage gegen Richard Pfeiffer wurde fallen gelassen, da er sich als Tourist herausstellte, der ein frisches Banksy-Werk bewundert hatte. Für die blonde Frau existierte gar kein Argument außer der Tatsache, dass Banksy vergleichsweise oft weibliche Figuren in seinen Graffiti verwendete. Das war Max dann doch zu wenig.