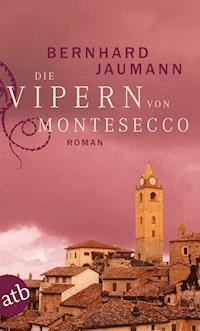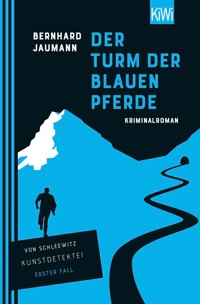
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kunstdetektei von Schleewitz ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein packender Krimi um eines der legendärsten verschollenen Gemälde der Kunstgeschichte: Der Turm der blauen Pferde von Franz Marc. Der Start einer neuen Reihe von Krimipreisträger Bernhard Jaumann. Zwei Jungs entdecken in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in einem verlassenen Tunnel einen Zug, randvoll mit Kunstschätzen. Vor allem das Gemälde mit den geheimnisvollen blauen Pferden fasziniert sie – doch dann kommt es zur Katastrophe. Und Franz Marcs Der Turm der blauen Pferde verschwindet für immer. Oder ...? Sprung in die Gegenwart: Die Münchner Kunstdetektei von Schleewitz erhält einen neuen Auftrag. Marcs legendäres Gemälde, von den Nazis zur »entarteten Kunst« erklärt und anschließend in Görings Privatbesitz gewandert, soll wieder aufgetaucht sein. Ein steinreicher, kunstsammelnder Industrieller behauptet, das Bild auf verschlungenen Wegen von einem Unbekannten gekauft zu haben. Handelt es sich wirklich um das Original? Es wäre eine Weltsensation. Das Team der Detektei beginnt zu ermitteln. Rupert von Schleewitz, Klara Ivanovic und Max Müller führen nicht nur äußerst unterschiedliche Privatleben – von Töchtern in Teenagerkrisen über unvorsichtige Affären mit Verdächtigen bis zu einem Vater, der als alternder Aktionskünstler in der bayerischen Provinz für mächtig Ärger sorgt –, sie haben auch sehr individuelle Ermittlungsmethoden. Schnell geraten die drei Detektive in ein Gewirr aus Fälschungen, mysteriösen Todesfällen und einem hollywoodreifen Kunstdiebstahl. Und plötzlich scheint es ein halbes Dutzend Exemplare des Turms der blauen Pferde zu geben. Welches ist das echte Gemälde? Oder ist das Original vielleicht gar nicht dabei? Die Grenzen zwischen Authentizität und perfektem Imitat verschwimmen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Bernhard Jaumann
Der Turm der blauen Pferde
Ein Fall der Kunstdetektei von Schleewitz
Kriminalroman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bernhard Jaumann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bernhard Jaumann
Bernhard Jaumann, geboren 1957 in Augsburg, arbeitete nach dem Studium als Gymnasiallehrer. Zurzeit lebt er in Bayern und Italien. Er schrieb mehrere Krimiserien, für die er vielfach ausgezeichnet wurde, u. a. mit dem Friedrichlauser-Preis für den besten deutschsprachigen Kriminalroman 2003 und für die beste Kurzgeschichte 2008. Für seinen Roman Die Stunde des Schakals erhielt er 2011 den Deutschen Krimipreis.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zwei Jungen entdecken in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in einem verlassenen Tunnel einen Zug, randvoll mit Kunstschätzen. Vor allem das Gemälde mit den geheimnisvollen blauen Pferden fasziniert sie – doch dann kommt es zur Katastrophe. Und Franz Marcs Der Turm der blauen Pferde verschwindet für immer. Oder …?
Sprung in die Gegenwart: Die Münchner Kunstdetektei von Schleewitz erhält einen neuen Auftrag. Marcs legendäres Gemälde, von den Nazis zur »entarteten Kunst« erklärt und anschließend in Görings Privatbesitz gewandert, soll wieder aufgetaucht sein. Ein steinreicher, kunstsammelnder Industrieller behauptet, das Bild auf verschlungenen Wegen von einem Unbekannten gekauft zu haben. Handelt es sich wirklich um das Original? Es wäre eine Weltsensation. Das Team der Detektei beginnt zu ermitteln. Rupert von Schleewitz, Klara Ivanovic und Max Müller führen nicht nur äußerst unterschiedliche Privatleben – von Töchtern in Teenagerkrisen über unvorsichtige Affären mit Verdächtigen bis zu einem Vater, der als alternder Aktionskünstler in der bayerischen Provinz für mächtig Ärger sorgt –, sie haben auch sehr individuelle Ermittlungsmethoden. Schnell geraten die drei Detektive in ein Gewirr aus Fälschungen, mysteriösen Todesfällen und einem hollywoodreifen Kunstdiebstahl. Und plötzlich scheint es ein halbes Dutzend Exemplare des Turms der blauen Pferde zu geben. Welches ist das echte Gemälde? Oder ist das Original vielleicht gar nicht dabei? Die Grenzen zwischen Authentizität und perfektem Imitat verschwimmen …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2019, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln, nach dem Originalumschlag von Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31970-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Berchtesgadener Land, 5. Mai 1945
Starnberger See, Sommer 2017
Berchtesgadener Land, 2. Januar 1948
München, Sommer 2017
Berchtesgadener Land, Oktober 1957
Berbling, Sommer 2017
Bei Berchtesgaden, 12. Mai 1962
Berchtesgaden, Sommer 2017
München, September 1967
München, Sommer 2017
Huber-Hof, Berchtesgaden, 26.Dezember1995
Berchtesgaden, Sommer 2017
Huber-Hof, Berchtesgaden, 5.April 2005
München, Sommer 2017
München-Pasing, 12. Oktober 2012
Hüttenbrechtshofen, Sommer 2017
München-Pasing, 2. November 2012
Berchtesgaden, Sommer 2017
München, Herbst 2017
Khomas-Hochland, Namibia, 12. Januar 2018
München, 3. Februar 2018
Leseprobe »Banksy und der blinde Fleck«
Erkennt, meine Freunde, was Bilder sind: das Auftauchen an einem anderen Ort.
(Franz Marc: Briefe, Aufzeichnungen, Aphorismen,hg. v. Günther Meißner, Leipzig 1980, S. 160)
Berchtesgadener Land, 5. Mai 1945
Jemand anderer als er selbst zu sein, hätte Ludwig Raithmaier nicht schlecht gefallen, aber ob er zum Werwolf taugte, wusste er nicht.
»Was sind eigentlich Werwölfe genau?«, fragte er. Xaver hatte ihm nur erzählt, was er im Radio gehört hatte. Dass die Werwölfe mithelfen würden, den Endsieg zu erringen. Dass sie zusammen mit den Wunderwaffen des Führers die Wende erzwingen würden. Auch wenn der Führer in heldenhaftem Kampf gefallen war, würde das deutsche Volk niemals untergehen. Es würde sich in seiner uneinnehmbaren Alpenfestung verschanzen und Widerstand leisten, bis Russen und Amerikaner sich gegenseitig abschlachteten.
Xaver starrte auf das schwarze Loch des Eisenbahntunnels hundert Meter vor ihnen und sagte: »Werwölfe sind Männer, die sich in der Nacht in reißende Wölfe verwandeln.«
Es war noch nicht Nacht, und auch wenn die Sonne schon hinter den Bergen verschwunden war, zerfloss das Tageslicht nur langsam. Ludwig schaute zu den Gipfeln auf, über denen zerfetzte Wolken Richtung Osten jagten, als hätten sie ein Ziel. Aus dem Blau der Nordhänge schimmerten abgezehrte Restschneefelder hervor. Über die schwarzen Wälder weiter unten liefen kaum merkliche Wellen dahin, nur hier in der Nähe beugten die Fichten ihre Wipfel unter dem harten Wind. An der Wetterseite hatte Moos die Stämme besetzt. Aus dem Schotter zwischen den Eisenbahnschwellen spross Unkraut.
»Werwölfe schlagen nachts hinter den feindlichen Linien zu, und tagsüber sehen sie völlig harmlos aus«, sagte Xaver.
Seit gestern befanden er und Ludwig sich hinter den feindlichen Linien. Ohne auf größeren Widerstand zu treffen, waren Amis und Franzosen in Berchtesgaden einmarschiert. Voll Verachtung hatte Xaver erzählt, dass seine Mutter den Ofen in der Stube mit den Seiten von Mein Kampf gefüttert hatte, während sein Vater ein weißes Bettlaken aus dem Fenster gehängt hatte. Da hatte Xaver seine HJ-Uniform angezogen und war trotz strikten Verbots abgehauen. Um Ludwig kümmerte sich eh keiner. Er war als Kostgänger auf dem Huber-Hof untergebracht, und wenn er nicht da war, gab es halt einen weniger, mit dem man die dünne Suppe teilen musste.
»Wir sind Werwölfe«, sagte Xaver, »und wir werden das deutsche Volk bis zum Letzten verteidigen.«
Wahrscheinlich waren die Amis bereits zum Berghof des Führers auf dem Obersalzberg vorgestoßen, doch den Zug hier im Tunnel hatten sie noch nicht entdeckt. Seit Wochen stand er im Berg, geschützt vor Luftangriffen und rund um die Uhr von SS-Männern bewacht. Bis gestern. Sie waren spurlos verschwunden, als die Amis sich näherten. Nur der Zug war noch da. Acht Waggons, die – wie man munkelte – von Reichsmarschall Göring persönlich hierherbefohlen worden waren. Über die Ladung wusste man nichts, doch Xaver vermutete, dass es sich um Wunderwaffen des Führers zur Verteidigung der Alpenfestung handelte. Die SS habe den Zug nicht zum Spaß vor aller Augen abgeschirmt!
»Aber die SS lässt doch die Wunderwaffen nicht einfach so zurück«, hatte Ludwig eingewandt.
»Das sind dreckige Verräter. Die gehören aufgeknüpft«, hatte Xaver gesagt und an das Werwolfmotto aus dem Radio erinnert: Hass ist unser Gebet, und Rache ist unser Feldgeschrei. Es galt, rücksichtslos durchzugreifen. Schwäche war Verrat. Der Endsieg stand unmittelbar bevor. Unbeugsamer Widerstand, eiserner Wille, Wunderwaffen, Werwölfe. Worte, die Taten werden wollten. Und dann hatte Xaver gesagt: »Wenn wir die Wunderwaffen hätten …«
Ludwig hatte genickt, weil er nicht gewusst hatte, was ein Werwolf sonst hätte tun sollen. Aus der Werkstatt von Xavers Vater hatten sie ein Brecheisen und zwei Taschenlampen mitgehen lassen, und nun hockten sie seit Stunden hier am Waldrand und beobachteten den Tunneleingang. Sie konnten fast sicher sein, dass sich niemand mehr dadrinnen aufhielt. Fast sicher. Xaver richtete sich auf, doch Ludwig hielt ihn am Arm zurück. »Warte noch!«
Ludwig legte den Zeigefinger über die Lippen. Keine noch so ferne Stimme war zu hören, kein Geschützdonner, keine Gewehrsalven. Auch kein Vogel schlug an, nur der Wind ließ die Fichten rauschen. Ein an- und abschwellendes Summen, das einen verrückt machen konnte, wenn man sich darauf konzentrierte. Vielleicht war es auch gar nicht der Wind, sondern das Blut, das unerbittlich in Ludwigs Ohren pochte und ihm in einer fremden Sprache Geheimnisse zuflüsterte. Vor seinen Augen spannten unsichtbare Spinnen allmählich Zwielicht zwischen den Bäumen aus. Die Dämmerung, in der reißende Wölfe geboren wurden. Ludwig zog sich seine Joppe enger um die magere Brust.
»Los, wir schauen nach!« Xaver griff nach dem Brecheisen, trat aus dem Schutz der Bäume heraus und stapfte parallel zum Bahngleis los. Ludwig tappte hinterher. Er war weder ein Feigling noch ein Verräter. Er zweifelte nicht am Endsieg. Dass er eine Gänsehaut hatte, lag nur an der Kälte. Oder verwandelte er sich gerade in ein anderes Wesen? Würde ihm ein Wolfsfell aus der Haut sprießen, sobald er in die Nacht des Tunnels eintauchte? Ludwig versuchte sich vorzustellen, wie sich eine solche Verwandlung anfühlte. Ein Reißen, ein Ziehen, wenn sich die Muskelstränge verdickten und die Klauen aus den Tatzen sprossen? Ein Knurren in der Kehle, und im Kopf statt Gedanken nur Blutrausch? Ludwig fragte sich, ob ein Werwolf noch wusste, dass er eigentlich ein Mensch war.
Als sie die Tunnelöffnung erreicht hatten, hörte der Wind schlagartig auf. Nur ein leicht modriger Hauch schien ihnen aus dem Stollen entgegenzuströmen. Ein Geruch wie vom Fell ertränkter junger Katzen. Auch Xaver war stehen geblieben. Er schaltete seine Taschenlampe ein und ließ den Strahl über die Rundung der Tunneldecke wandern. Ein Tropfen Wasser löste sich und fiel durch das Licht nach unten. Ludwig hörte ihn nicht aufschlagen. Er rief halblaut ins Dunkel: »Ist da wer?«
»Da ist keiner mehr, glaub mir doch!«, zischte Xaver.
Da war keiner mehr, da war nur ein Bahngleis, das im Schwarz verschwand, und aus der Decke tropfte Wasser, und darüber türmte sich ein Berg auf, der dich zermalmen und so endgültig begraben konnte, dass sie dich nicht einmal beim Jüngsten Gericht wieder ans Tageslicht brachten. Wenn es überhaupt ein Jüngstes Gericht gab. Wenn der Pfarrer nicht bloß Schmarrn erzählte. Wenn nicht alle bloß Schmarrn erzählten. Ludwig knipste seine Taschenlampe an. Der Lichtkegel strich an den Schienen entlang. Ludwig folgte Xaver mit ein paar Schritten Abstand. Ein deutscher Junge hatte keine Angst. Schwäche war Verrat. Ein Werwolf kämpfte für den Endsieg. Und wenn die ganze Welt auseinanderbrach, war es unterm Berg auch nicht schlimmer als anderswo.
Fünfzig Meter weiter stand der erste Waggon. Es war ein Viehwaggon ohne Fenster. An der Seite waren mit Kreide Zahlen und Abkürzungen aufgezeichnet, deren Bedeutung Ludwig nicht verstand. Geheimcodes für die Wunderwaffen? Ludwig ahnte, dass etwas nicht stimmte. Eigentlich stimmte gar nichts. Alles, was da war, war falsch, und was richtig war, das gab es nicht.
»Keine Menschenseele, siehst du?«, sagte Xaver lauter, als nötig gewesen wäre. Er rüttelte an der Schiebetür des Waggons. Sie war verschlossen.
»Leuchte mal hierher!« Xaver setzte das Brecheisen an, drückte, knirschte mit den Zähnen, warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen das Werkzeug. Ein Ächzen, ein Splittern, ein Krachen, als wäre ein Riss durch die Welt gegangen, und dann sprang die Tür auf. Das Brecheisen fiel auf den Schotter. Xaver bückte sich, hob es auf und wog es in der Hand wie der Brunnhuber in der Schule den Tatzenstock.
»Schau her!«, sagte er und grinste. »So sieht ein Werwolf aus. Jetzt wird den Amis das Lachen vergehen.«
Er zog sich hoch und kletterte in den Waggon. Ludwig folgte ihm. Der Schein der Taschenlampen wanderte über Kisten und große, aus Sperrholzplatten zusammengenagelte Transportbehälter. Im Nu hatte Xaver den ersten aufgebrochen. Unter dem Holz fand sich ein gut zwei auf anderthalb Meter messendes Ding, das in Packpapier eingewickelt war. Xaver riss einen Streifen heraus und schabte mit dem Brecheisen nach, als eine zweite Lage auftauchte. Die Papierfetzen segelten nach unten. Xaver drehte sich um und sagte: »Verdammt, das ist bloß ein Bild.«
»Wie, ein Bild?« Ludwig kam näher.
»Ein Scheißgemälde«, zischte Xaver. Er legte seine Taschenlampe auf den Boden, richtete sie auf eine kleinere Kiste aus und machte sich wieder mit dem Brecheisen ans Werk. Ludwig blickte auf die Leinwand unter dem Loch im Packpapier. Im Schein der Lampe leuchtete ihm goldenes Gelb entgegen. Nach oben wurde es begrenzt von einer Art Regenbogen, dessen Farben in überirdischem Licht zu zerfließen schienen. Die Rundung ging in kräftige blaue Pinselstriche über. Nach rechts oben flohen weiße und rote Schatten, und aus einer mit groben Linien begrenzten Raute blickte ein Auge ins Nichts. Das war ein Pferdekopf. Da hatte jemand ein blaues Pferd gemalt.
Blau? Ludwig hatte schon einen Apfelschimmel gesehen, dessen Fell ein klein wenig bläulich schimmerte, und wenn auf einen frisch gestriegelten Rappen das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel einfiel, mochte man auch denken, dass sich etwas Blau ins Schwarz gemischt hatte. Aber das hier war ein ganz anderer Farbton, viel stärker, viel tiefer. Vielleicht wie der von Kornblumen? Nein, auch das traf es nicht, das Blau wirkte metallischer, geheimnisvoller und irgendwie fremd. Wie nicht von dieser Welt.
Das Brecheisen schlug irgendwo auf Holz. Xaver fluchte.
Ludwig riss das Packpapier nach unten hin auf. Ein weiterer Pferdekopf und noch einer. Köpfe und Kruppen von vier blauen Pferden drängten sich in- und übereinander, als wären sie eins, ein zugleich kraftvolles wie scheues Wesen. Stilisiert und doch lebendig, hart in den Konturen und doch in weichen, wie vor Energie schwingenden Rundungen sich selbst beseelend. Zu einem Turm aus geballtem Leben schichteten sich die Pferde auf, zu einem tiefblauen Leben, das sich selbst genügte und alle anderen Farben an den Rand drängte. Ludwig folgte dem Blick der Pferde nach links, wo Gelb, Grün, Rot, Violett, Weiß und Braun durcheinanderstürzten. Eine Gebirgslandschaft nach einem Erdbeben? Eine Stadt im Bombenhagel? Von unten schienen Flammen hochzuschlagen und …
»Verdammt«, sagte Xaver weit hinten, »da ist eine Madonna drin.«
… und rechts waberte roter Nebel. Den Pferden, die aus ihm emporwuchsen, konnte er nichts anhaben. Vielleicht waren das gar keine Pferde, sondern etwas anderes. Verwandelte Menschen zum Beispiel. Wie bei den Werwölfen, nur umgekehrt. Beim ersten Morgenlicht verwandelten sich die durch die Nacht irrenden Menschen womöglich in blaue Pferde. Ludwig wünschte sich, dass sie die Hälse wenden und ihn ansehen sollten. Er hätte sich nicht gewundert, wenn sie zu sprechen begonnen hätten. Aber das geschah natürlich nicht. Das war genauso unmöglich wie … wie … ein Turm aus blauen Pferden.
Und da spürte Ludwig, dass das Leben jetzt erst begann. Sein Leben. Jetzt war er plötzlich sicher, dass zutraf, was er in letzter Zeit dunkel geahnt hatte: dass das, was draußen in der Welt gerade in sich zusammenbrach, alles Schwachsinn und Lüge gewesen war. Was immer sie im Radio von Sieg oder Untergang herumbrüllen mochten, ihn ging das alles nichts an. Und ob die Amis die Nazis an die Wand stellen würden, ging ihn auch nichts an. Er blickte auf das körnige Blau über den Nüstern des vordersten Pferds und fühlte sich, als sei er gerade neu geboren worden. Hier, in einem Viehwaggon unter der Erde, vor einem Gemälde, das er nicht recht begriff. Nur eins hatte er verstanden. Die blauen Pferde sagten ihm, dass alles ganz anders war, als er gedacht hatte. Es gab einen Sinn, es gab eine Wahrheit. Sie versteckte sich tief unter der sichtbaren Oberfläche der Welt und hatte eine Farbe, die man nicht vorherahnen konnte. Er würde danach suchen.
»Los, wir schauen im nächsten Waggon«, sagte Xaver. »Irgendwo müssen die Wunderwaffen ja sein.«
»Nein«, sagte Ludwig.
»Was nein?«
»Du siehst doch, dass hier keine Wunderwaffen sind. Wahrscheinlich gibt es gar keine.«
»Spinnst du? Der Führer …«
»Der Führer ist tot, der Krieg ist verloren.«
»Hör auf, Ludwig, das ist Hochverrat!«
»Jetzt beginnt eine neue Zeit. In der gibt es keine Werwölfe, da gibt es nur …«
»Was?«
»Blaue Pferde.« Ludwig wies auf das Gemälde neben sich.
Xaver kam heran, warf einen Blick auf das Bild, schüttelte den Kopf. »Das ist entartet. Hässlich, lächerlich. Jetzt halt das Maul und komm mit! Wir holen uns die Wunderwaffen und …«
»Nein!«
»Zum letzten Mal. Du weißt, was Verrätern blüht. Zwing mich nicht …!« Xavers Faust ballte sich um das Brecheisen. Ludwig hatte keine Angst. Jetzt nicht mehr. Er kicherte bloß, als Xaver auch mit seiner zweiten Hand zupackte und das Brecheisen zum Schlag erhob. Werwölfe, was für ein Schmarrn! Wenn Xaver die Wahrheit nicht sehen konnte, dann war er genauso zum Untergang bestimmt wie die alte Zeit. Da konnte er sich nicht herausprügeln. Und außerdem, er würde es nicht tun. Sie waren Freunde, Xaver und er. Zumindest waren sie es bis gerade eben gewesen.
»Schlag mich doch!«, sagte Ludwig spöttisch und leuchtete Xaver mitten ins Gesicht. Dessen Pupillen verengten sich, er wandte den Kopf etwas zur Seite. Um seinen Mundwinkel zuckte es. Über der Schulter zitterte das Brecheisen. In seinem gerundeten Ende klaffte ein keilförmiger Spalt. Wunderwaffen und Hochverrat, dachte Ludwig und begriff plötzlich, dass Xaver tatsächlich zuschlagen würde. Aus Enttäuschung und hilfloser Wut und aus der dumpfen Ahnung der eigenen Verblendung.
»Nein!«, schrie Ludwig. Nicht auf ihn würde Xaver eindreschen.
»Das ist mein Bild!«, brüllte Ludwig, und dann schlug er mit aller Kraft zu, traf Xaver mit der Taschenlampe an der Schläfe. Etwas splitterte, das Licht erlosch, aus Xaver brach ein dumpfer, fast tierischer Laut heraus, und das Brecheisen polterte auf Holz hinab. Im Widerschein der zweiten Lampe, die irgendwelche Kisten im hinteren Teil des Waggons beleuchtete, sah Ludwig Xaver gegen das Gemälde taumeln. Seltsam verkrümmt presste er sich dagegen, die rechte Hand schien sich in der Mähne des zweiten blauen Pferds festkrallen zu wollen. Langsam öffneten sich seine Finger und glitten über Kopf, Hals und Brust des vordersten Pferds nach unten. Fast so, als wolle er das Tier liebkosen.
»Xaver?«
Xaver lag zusammengesunken am Boden. Dort, wo die Beine des Pferds im Höllenrot verschwammen.
»Xaver!«
Er antwortete nicht, er stöhnte nicht, er rührte sich nicht. Ludwig brauchte sich nicht hinabzubeugen, um zu wissen, dass Xaver tot war. Von ihm erschlagen. Er blickte auf das Gemälde und entdeckte eine dunkelblaue Mondsichel auf der Brust des vordersten Pferds. Es war Notwehr gewesen. Ludwig hatte nur das Leben der blauen Pferde verteidigt. Seiner blauen Pferde.
Starnberger See, Sommer 2017
Der Blick von der Terrasse der Villa war beeindruckend. In der Ferne schimmerte die Kette der Alpengipfel, und unten auf dem Starnberger See kreuzte eine Unmenge weißer Segelboote. Klara Ivanovic versuchte sich vorzustellen, dass das scheinbar ziellose Hin und Her einem geheimen Sinn folgte. Wenn die Spuren der Boote auf dem gleißenden Wasser sichtbar blieben, könnte man womöglich ein Muster erkennen, Schriftzeichen, die sich zu einer Botschaft formten. Zumindest für jemanden, der sie zu deuten verstand.
Egon Schwarzer, der Hausherr, hatte Klara und Rupert die Plätze mit dem besten Blick auf den See angeboten. Vielleicht aus Höflichkeit, vielleicht auch, weil es ihm im Blut lag, zu zeigen, was er besaß. Mein Grundstück, meine Villa, mein Panorama. Alles solide zusammengeschraubt, hatte Rupert auf der Herfahrt vom Münchner Büro gesagt. Das war wörtlich zu nehmen, denn Egon Schwarzer hatte sein Vermögen mit Schrauben gemacht, Flachkopf-, Rundkopf-, Senkkopf-, Vierkant-, Sechsrund-, Kopfschlitzschrauben. Irgendwann hatte er sein Unternehmen verkauft und sich mit prall gefüllten Taschen dem Kunstbetrieb zugewandt. Inzwischen nannte er die bedeutendste Privatsammlung der klassischen Moderne in Deutschland, wenn nicht in Europa sein Eigen.
»Echt schön haben Sie es hier«, sagte Rupert. Da er für die Kundenbetreuung zuständig war, verzichtete Klara auf einen Kommentar und lächelte freundlich. Schönheit und Echtheit waren schillernde Konzepte, doch leider gingen sie viel seltener Hand in Hand, als man glaubte. Klara blickte auf den See hinab. Das Falsche an Postkartenidyllen war, dass kein Makel die Schönheit störte. Den Makel gab es aber immer. Man musste sich nur in die Idylle hineinbewegen, um ihn zu spüren.
»Kunstdetektei von Schleewitz«, las Schwarzer von Ruperts Karte ab, als wüsste er nicht genau, wen er zu beauftragen gedachte. Er schob die Sonnenbrille wieder über die Augen und fragte: »Alter Adel? Irgendwo aus dem Osten?«
»Schlesien«, sagte Rupert, »aber da waren wir nur ein paar Jahrhunderte. Bis 1945.«
»Ja, die Russen«, sagte Schwarzer.
»Ist lange her«, sagte Rupert.
»Sie wissen natürlich, dass die damals ordentlich geplündert haben, auch was Kunst anging?«
»Sollen wir das Bernsteinzimmer für Sie finden?« Rupert lachte und ging dann in einen geschäftsmäßigen Ton über. »Wir sind keine Schatzsucher. Die Detektei ist auf Provenienzforschung spezialisiert. Wir arbeiten Kanzleien zu, die Restitutionsforderungen im Bereich Raubkunst vertreten, und übernehmen durchaus auch die Feldarbeit, wenn es um die Entlarvung von Fälschungen geht, aber …«
»Kommen Sie!« Schwarzer stand ruckartig auf. Ohne sich nach seinen Gästen umzusehen, ging er auf die offene Terrassentür zu.
Der Salon wurde durch Fenstertüren erhellt, deren Sprossen harte Schatten auf das Eichenparkett warfen. Der große Raum war nur spärlich möbliert. Ein Sekretär, ein kleiner Wandtisch mit Spiegel, ein Sofa und ein paar Stühle, die nicht so wirkten, als habe schon einmal jemand darauf gesessen. Alles war in klaren, elegant reduzierten Formen gehalten und passte perfekt zusammen. Wiener Werkstätte, schätzte Klara, und angesichts des Schwarzer’schen Vermögens wahrscheinlich Originale vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das galt auch für die meist kleinformatigen Bilder an den Wänden. Da links, das war unverkennbar ein Kandinsky. Daneben hingen zwei in Form und Farbpalette typisch plakative Landschaften Gabriele Münters, gefolgt von einem expressiven weiblichen Akt, der von Jawlensky stammen könnte.
Schwarzer ging zielstrebig auf eine Staffelei an der hinteren Wand des Raums zu. Er wartete, bis Rupert und Klara zu ihm aufgeschlossen hatten, nahm die Sonnenbrille ab, steckte sie in den Hemdausschnitt und zog mit einer fast achtlosen und gerade deswegen großspurig wirkenden Bewegung die Decke von dem Gemälde auf der Staffelei.
»Das ist doch …«, sagte Rupert.
»Franz Marc, Der Turm der blauen Pferde«, sagte Schwarzer. »Seit Kriegsende verschollen. Ich habe es letzten Dienstag gekauft. Für drei Millionen. Ein absolutes Schnäppchen, wenn es echt ist. Ist es Ihrer Meinung nach echt?«
»Ich …« Für einen Moment schien es selbst Rupert die Sprache verschlagen zu haben. »Ich bin da eher Laie. Für derlei Fragen ist meine Kollegin, Frau Ivanovic, zuständig.«
Klara starrte auf das Bild. Der Turm der blauen Pferde, eine Ikone der klassischen Moderne. In Bildbänden, auf Postkarten und Kalenderblättern war sie wahrscheinlich zehntausendfach reproduziert worden. Die blauen Pferde hingen in Versicherungsbüros und Rentnerküchen, sie prangten auf Porzellanvasen und stritten sich mit Justin-Bieber-Postern um die Vorherrschaft in Mädchenzimmern. Zweifelsohne war Marcs Gemälde im Massengeschmack angekommen. Und dadurch für eine authentische, um neue Erfahrungen ringende Kunst verloren, wie Klaras Vater sagen würde. Nur noch historisch interessant!
Dass es 1913 bei der überwiegenden Mehrheit des Publikums Hohn, ja Empörung ausgelöst hatte, schien heute unvorstellbar. Doch das lag nur daran, dass die Revolution, die damals ausgerufen worden war, auf ganzer Linie gesiegt hatte. Die Maler der Brücke und des Blauen Reiters hatten genau das geschafft, was die heutigen Künstler anstrebten: die Sehweisen radikal zu verändern. Die bittere Ironie dieses Siegs war offensichtlich. Je mehr man sich an blaue Pferde und abstrakte Kompositionen gewöhnte, desto mehr ging der Revolution die Luft aus. Bis ihre gemalten Protestschreie als hübsche Wanddekoration endeten. Und doch hatte dieses Bild auf der Staffelei da etwas an sich! Ein Geheimnis, das durch die unzähligen Reproduktionen nicht ganz zerstört worden war.
»Halten Sie es für echt, Frau Ivanovic?«, fragte Schwarzer.
Mein Gott, dachte Klara. Das war ja, als würde man von einem Lebensmittelchemiker verlangen, aus ein paar Metern Entfernung ein salmonellenbefallenes Ei zu identifizieren. Sie sagte: »Das müssen die Spezialisten entscheiden. Ohne genauere Untersuchung …«
»Ich habe schon Baumgartner zugezogen, aber mich würde Ihre Meinung interessieren. Keine Angst, ich lege Sie nicht darauf fest. Mir geht es um den unmittelbaren Eindruck, den das Bild auf Sie macht.«
Klara blickte auf das Bild, versuchte den Duktus der Pinselstriche nachzuempfinden. Wenn es eine Fälschung war, dann eine sehr gute. Natürlich war das möglich. Nicht erst seit Beltracchi wusste man, dass begnadete Fälscher über Jahre hinweg die ganze Fachwelt zum Narren halten konnten. Der unmittelbare Eindruck, mein Gott! Nichts konnte mehr täuschen. Fakt war, dass Der Turm der blauen Pferde seit siebzig Jahren vermisst wurde. Da sollte man bei seiner wundersamen Wiederauffindung lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zweifeln.
Schwarzer verlor die Geduld. »Es ist das Original, sagt Baumgartner. Zu neunundneunzig Prozent. Und auf das eine Prozent Unsicherheit verzichtet er nie. Das steht sozusagen in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen.«
Dr. Anian Baumgartner war die unbestrittene Franz-Marc-Koryphäe, Herausgeber des Werkverzeichnisses und Autor zahlloser Studien. Schwarzer wäre auch schön blöd gewesen, drei Millionen auf den Tisch zu legen, ohne sich bei einem Spezialisten rückzuversichern.
»Trotzdem«, sagte Schwarzer, »hätte ich gern eine lückenlose Provenienzgeschichte. Bekannt ist ja, dass die Nazis das Bild beschlagnahmt haben und Göring höchstpersönlich es 1937 in Besitz nahm. Doch wo befand es sich zwischen 1945 und heute? Können Sie das für mich herausfinden?«
»Eher, als halb Europa nach dem Bernsteinzimmer umzugraben«, sagte Rupert. »Von der juristischen Seite muss ich Sie aber darauf hinweisen, dass seit dem Washingtoner Abkommen Nazi-Raubkunst …«
»… von staatlichen Stellen zu restituieren ist.« Schwarzer winkte ab. »Nun bin ich zwar keine staatliche Stelle, aber ich weiß natürlich um meine Verantwortung. Die Berliner Nationalgalerie hat den Turm der blauen Pferde 1919 angekauft. Sie ist die rechtmäßige Eigentümerin, und der werde ich das Bild selbstverständlich zurückgeben. Ich will mich bloß nicht blamieren und mit großem Tamtam eine Fälschung überreichen.«
»Gut«, sagte Rupert, »dann schießen Sie mal los! Wer hat Ihnen das Bild angeboten?«
Dass ein van Gogh nach hundert Jahren auf einem Dachboden entdeckt wurde oder eine für fünf Euro auf dem Flohmarkt erworbene Leinwand einen übermalten Rembrandt preisgab, konnte man immer wieder lesen, doch die Geschichte, die Schwarzer erzählte, klang noch unglaublicher. Er hatte einen Vortrag im Franz-Marc-Museum in Kochel besucht. Als er nach Hause fahren wollte, stand auf dem Parkplatz neben seinem Mercedes ein kleiner Lieferwagen, bei dem ein Mann wartete. Etwa dreißigjährig, ein Meter fünfundsiebzig groß, blond, untersetzt, in Jeans und T-Shirt. Er sprach Schwarzer mit Namen an und bat ihn mit starkem bayerischen Dialekt, einen Blick in den Laderaum zu werfen. Dort lag Der Turm der blauen Pferde. Schwarzer dachte an einen Scherz à la Vorsicht Kamera und sah sich nach einer versteckten Filmcrew um. Ungerührt bot ihm der Mann das Gemälde zum Kauf an, für drei Millionen Euro.
»In kleinen, gebrauchten Scheinen, nehme ich an«, hatte Schwarzer halb belustigt, halb verärgert gesagt.
Der Mann hatte genickt. »Und keine Fragen!«
»Hören Sie, Herr …«
»Beilhart. Josef Beilhart.«
»Ich habe meine Zeit nicht gestohlen, Herr Beilhart, und nun einen schönen Tag!«, hatte Schwarzer gesagt. Erst zu Hause war ihm der Gedanke gekommen, möglicherweise einen Fehler begangen zu haben. Mochte die Wahrscheinlichkeit auch noch so gering sein, vielleicht war das Bild tatsächlich echt. Dann hatte Schwarzer die einmalige Chance verpasst, ein verloren geglaubtes, ideell unschätzbares nationales Kulturgut zu retten. Er hatte kurz überlegt, die Polizei einzuschalten, aber was, wenn dieser Beilhart – wie fast sicher anzunehmen war – sich doch nur als harmloser Spaßvogel entpuppte? Ihn selbst ausfindig zu machen, schien Schwarzer unmöglich. Nicht einmal die Autonummer hatte er sich gemerkt.
Doch das war auch nicht nötig gewesen. Ein paar Tage später hatte Beilhart ihn angerufen und gefragt, ob er das Geld beisammenhabe. So, als sei der Handel schon beschlossen gewesen. In dem Moment, behauptete Schwarzer, habe er gespürt, dass an der Sache etwas dran war. Instinkt, auf seinen Instinkt könne er sich verlassen. Am Telefon hatte er taktiert und versucht, mehr Informationen herauszukitzeln. Ohne jeglichen Erfolg, doch im entscheidenden Punkt war er unnachgiebig geblieben. Nach langem Hin und Her hatte Beilhart seiner Forderung zugestimmt, dass ein Fachmann zugezogen werden müsse.
Die Begutachtung hatte am vergangenen Dienstag unter konspirativen Umständen stattgefunden. Schwarzer hatte den Marc-Experten Baumgartner und – so sicher war er sich inzwischen schon – einen Koffer mit Geldscheinen in seinen Wagen geladen. Sie kurvten stundenlang durchs Voralpenland, meist über kleinste Nebenstraßen und immer dirigiert durch Handy-Anweisungen Beilharts, der vermutlich überprüfen wollte, ob die Polizei eingeschaltet war. Endlich wurden sie zu einem Landgasthof gelotst. Dort warteten sie in einem Nebenzimmer etwa eine Viertelstunde lang, bis Beilhart mit dem Bild eintraf. Er lehnte den Turm der blauen Pferde so achtlos gegen die holzgetäfelte Wand, als handle es sich um eine Kreidetafel mit den Tagesspezialitäten.
Baumgartner hatte sich Zeit gelassen. Mit der Lupe studierte er die Pinselführung und die Craquelierung in der obersten Malschicht. Auch die Rückseite der Leinwand inspizierte er genau. Dann nahm er Schwarzer beiseite und flüsterte ihm sein Urteil ins Ohr. Schwarzer zögerte keinen Moment. Im schlimmsten Fall hätte er halt ein paar Millionen in den Sand gesetzt. Na und? Er überreichte den Geldkoffer. Beilhart füllte das Geld in zwei Aldi-Plastiktüten um, zählte aber nicht nach. Dann wünschte er viel Vergnügen mit dem Bild und machte sich davon.
»Jetzt steht es hier«, schloss Schwarzer seinen Bericht. »Und Sie sollen herausfinden, wo es die letzten siebzig Jahre war.«
Zu Klaras Überraschung nahm Rupert den Auftrag sofort an. Er fragte nur bei ein paar Details nach, handelte die Tagessätze plus eine Erfolgsprämie von 30000 Euro aus und unterschrieb eine von Schwarzer vorbereitete Geheimhaltungsverpflichtung. Klara merkte, dass er es eilig hatte, die Villa zu verlassen. Erst als sich das Elektrotor hinter ihrem Wagen geschlossen hatte, fragte sie, ob er diese Geschichte wirklich glaube.
»Wieso?«
»Dich spricht einer auf dem Parkplatz an, zeigt dir kurz ein Bild, und zwei Wochen später fährst du mit drei Millionen in bar durch die Gegend, um es zu kaufen?«
»Es ist ja nicht irgendein Bild.«
»Nein«, sagte Klara, »und deswegen liegt es auch nicht in Lieferwägen und Dorfwirtschaften herum.«
»Wir werden das nachprüfen.«
»Wenn dieser Beilhart das Gemälde auf irgendeinem Dachboden gefunden hätte, hätte er kein Geheimnis daraus machen müssen. Also ist er entweder auf kriminellem Weg rangekommen oder er hat eine Fälschung verhökert. Würdest du dich mit drei Millionen im Köfferchen von Kriminellen irgendwohin bestellen lassen? Ohne Absicherung?«
»No risk, no fun. Ich hätte mir so eine Gelegenheit auch nicht entgehen lassen.« Rupert fuhr mit mindestens sechzig an den Tempo-30-Schildern vorbei und bremste nur vor den Bodenschwellen kurz ab. »Ich frage mich eher, warum einer wie Schwarzer nicht versucht, sich ein solches Gemälde selbst unter den Nagel zu reißen.«
»Das stinkt doch alles zum Himmel. Beilhart hat Dreck am Stecken, und das Bild ist gefälscht. Da kann Baumgartner sagen, was er will.«
»Idiot!« Rupert fuhr dicht auf eine dicke Limousine auf, die langsam vor ihm herzockelte. Mit seinen achtunddreißig Jahren mochte er nach Recht und Gesetz als erwachsen gelten, aber manchmal schien da immer noch ein kleiner Junge auf Abenteuersuche durch den Stadtpark zu streifen. Egal, was er vorher behauptet hatte, er würde natürlich nach dem Bernsteinzimmer suchen, wenn er nur den Hauch einer Spur hätte.
»Wir sollten die Finger davon lassen und die Polizei einschalten«, sagte Klara.
Rupert drückte auf die Hupe, scherte aus und überholte.
»Muss das sein?«, fragte Klara. »Hier ist Tempo 30.«
»Weißt du, was dein Problem ist, Klara? Du bist so abgeklärt, geradezu ekelhaft vernünftig. Der Turm der blauen Pferde, stell dir das mal vor! Einmal im Leben kreuzt etwas Aufregendes deinen Weg, und du drehst dich weg und rufst nach der Polizei. Lass dich doch einfach drauf ein!«
»Danke für den Tipp«, sagte Klara, doch Rupert war mit seinen Gedanken schon wieder ganz woanders.
»Nationales Kulturgut, wie komisch!«, sagte er und gab Gas. »Der Schraubenkönig vom Starnberger See entdeckt sein Herz für die Allgemeinheit.«
Rupert brachte Klara nach Haidhausen. Da in ihrer Straße kein freier Parkplatz zu finden war, hielt er in zweiter Reihe und schaltete die Warnblinkanlage ein. Wie immer fragte er, ob er noch mit hochkommen solle, doch während Klara die ritualisierte Anmache sonst nur mit einem Lächeln quittierte, erinnerte sie ihn diesmal daran, dass sie leider ekelhaft vernünftig war. Es klang harscher, als sie gewollt hatte.
Rupert breitete die Arme aus und sagte: »Na gut, dann nehme ich das vernünftig halt zurück.«
Klara warf ihm eine Kusshand zu und schloss die Haustür auf. Im Treppenhaus war es vergleichsweise kühl. Fast wie in einer Gebirgsschlucht oder in einer ausladenden Grotte tief unter der Erde. Klara mochte die großzügige Anlage, die breiten, ausgetretenen Holzstufen und das Geländer mit dem abgerundeten Handlauf zu jeder Jahreszeit, aber erst in einem heißen Sommer zeigte sich, dass der Architekt um die Jahrhundertwende keineswegs sinnlos Platz verschwendet hatte. Ein Neubautreppenhaus hätte sich schon längst aufgeheizt. Auch in der Wohnung war die Temperatur erträglich. Trotzdem konnte sich Klara jetzt kaum etwas Angenehmeres vorstellen, als Hitze und Schweiß des Tages abzuspülen. Nur noch schnell den Knöterich auf dem Balkon gießen! Und ihren Vater anrufen. Klara ließ es achtmal klingeln, aber niemand nahm ab. Vielleicht saß er draußen und hörte das Telefon nicht. Oder Agnieszka begleitete ihn auf einem Spaziergang durchs Dorf.
Unter der Dusche drehte Klara dann doch nicht ganz kalt auf, sondern schob den Regler so weit in die Mitte, dass sie gerade angenehm fröstelte. Sie schloss die Augen und spürte dem Wasser nach, das über ihre Haut nach unten rann. Abgeklärt, geradezu ekelhaft vernünftig hatte Rupert sie genannt. Kein Grund, sich aufzuregen. Er war eben so, wie er war. Da durfte man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Erstaunlich blieb aber, wie unkritisch er Schwarzers Erzählung aufgenommen hatte. Nein, das war nicht ganz richtig. Rupert traute dem Mann durchaus Halbwahrheiten und Intrigen zu. Nur schien er felsenfest davon überzeugt, dass er wirklich vor dem originalen Turm der blauen Pferde gestanden hatte. Als ob das Bild gerade ihn gesucht hätte, um nach siebzig Jahren seine Auferstehung zu feiern. Klara stellte das Wasser ab und warf sich ein Badetuch über.
Rupert war Feuer und Flamme, und die Rolle des ungläubigen Thomas blieb ihr vorbehalten. Wunder mochten sich manchmal ereignen, aber im Kunstbetrieb doch eher selten. Sehr selten sogar. Klara schaltete den Computer ein und las im Internet nach, was über den Turm der blauen Pferde bekannt war.
Franz Marc hatte das Bild Anfang 1913 in Sindelsdorf gemalt. Zum ersten Mal öffentlich ausgestellt wurde es im selben Jahr auf Herwarth Waldens Erstem deutschen Herbstsalon in Berlin. Nach Marcs Kriegstod 1916 erbte seine Witwe Maria das Gemälde und verkaufte es 1919 für 20000 Reichsmark an die Nationalgalerie Berlin. Im dortigen Kronprinzenpalais war es öffentlich ausgestellt, bis die Nazis 1937 Franz Marc zum unerwünschten Künstler erklärten und seine im Besitz der Nationalgalerie befindlichen Bilder beschlagnahmten. Der Turm der blauen Pferde und vier andere Marc-Werke wurden in der Münchner Schmähausstellung »Entartete Kunst« gezeigt, nach Protesten des Deutschen Offiziersbunds aber schon einen Tag später abgehängt. Die Herren wollten einen bei Verdun gefallenen Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs nicht in einer Reihe mit Juden und Kommunisten präsentiert sehen. Dann krallte sich Hermann Göring das Bild und ließ es nach Berlin bringen. Dort wurde es nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch zweimal gesichtet, bevor sich seine Spur endgültig verlor.
Natürlich war das der Nährboden, aus dem Fälschungen wuchsen. Nichts bot sich dafür besser an als ein Bild, das lange genug verschollen, aber nicht zweifelsfrei zerstört worden war. Ein Bild, dessen Aussehen zwar bekannt war, aber bei der farblichen Unzuverlässigkeit der frühen Fotografien genügend Spielraum für eine kreative Neugestaltung ließ. Hatte sich Beltracchi nicht auch von Werken inspirieren lassen, die in alten Katalogen abgebildet oder beschrieben waren? Was machte der Mann eigentlich jetzt, nachdem er seine Gefängnisstrafe abgesessen hatte?
Klara googelte und fand eine Fernsehserie mit dem Titel Der Meisterfälscher. In jeder Folge porträtierte Beltracchi darin einen Prominenten im Stile eines anderen Künstlers, zum Beispiel Ferdinand Hodlers oder Otto Dix’. Klara sah sich ein paar Ausschnitte auf Youtube an. Der Meister kokettierte mit seiner Kunstfertigkeit und dem Mythos der Verruchtheit, die Porträtierten versuchten, sich zumindest verbal als ebenbürtig zu erweisen. Mit Kunst hatte das alles rein gar nichts zu tun. Es blieb eine mehr oder weniger unterhaltsame Show, deren einziges Verdienst darin lag, dass sie gar nicht versuchte, Authentizität vorzutäuschen. Der Fälscher wusste genau, dass er als Mensch nur interessierte, weil er die Manier eines wirklichen Künstlers erfolgreich imitierte. Sein Ureigenes bestand darin, ein anderer zu sein. Und da sich die Prominenten seinen Bemühungen bereitwillig auslieferten, galt das für sie ebenso. Besonders deutlich wurde das, wenn sie das Endergebnis betrachteten. Man mochte kaum entscheiden, was falscher war, das entstandene Porträt oder der Mensch, der es kommentierte.
Klara fuhr den Computer herunter. Die Flecken, die ihre nassen Sohlen auf den Dielen hinterlassen hatten, waren noch nicht ganz verdunstet. Im Schlafzimmer zog sie sich etwas Leichtes an. Dann entkorkte sie eine Flasche Verdicchio, schenkte sich ein und stellte die Flasche in den Kühlschrank zurück. Klara öffnete die Balkontür, setzte sich aber nicht hinaus. Die paar Minuten, bis die Abendsonne hinter dem gegenüberliegenden Haus verschwunden sein würde, konnte sie auch in der Küche bleiben. Aus dem Innenhof drangen die Stimmen spielender Kinder herauf. Klara versuchte vergeblich, den Sprachfetzen zu entnehmen, ob sie Fangen, Verstecken oder sonst etwas ihr Bekanntes spielten. Für einen Moment war sie versucht nachzusehen, aber so wichtig war es ja nicht. Sie nippte an ihrem Weißwein.
Abgeklärt, geradezu ekelhaft vernünftig, hatte Rupert gesagt. Wieso brachte Klara das nicht aus ihrem Kopf heraus? War sie wirklich so? Und wenn, was sollte daran verwerflich sein? Klara bemühte sich eben, ihr Leben im Griff zu behalten. Das hatte nichts mit Konventionen zu tun, nichts mit Bausparverträgen oder einem Bündel an überflüssigen Versicherungen. Ein Mindestmaß an Kontrolle und von ihr aus auch Selbstkontrolle brauchte sie einfach. Dass sie analytisch denken konnte und die beiden Seiten einer Sache zu sehen vermochte, wusste Rupert sonst ja durchaus zu schätzen. Vielleicht sollte sie ihm mal erklären, dass man dafür Distanz benötigte.
Distanz, Abstand, sich nie so weit in etwas hineinziehen zu lassen, dass sie nicht mehr herausfand, das hatte sie sich hart erarbeitet. Sie hatte ja auch keine andere Wahl gehabt in der Künstlerfamilie, in die sie wohl nur hineingeboren war, weil ihre Eltern zu bekifft gewesen waren, um zuverlässig zu verhüten. Nicht, dass sie drangsaliert worden wäre. Ganz im Gegenteil, so viel Freiheit wie sie hatte seit Pippi Langstrumpf niemand genossen. Wenn sie mit elf oder zwölf Jahren ein paar Tage lang abgehauen wäre, hätten ihre Eltern das wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Zu sehr waren sie mit sich und ihren Projekten beschäftigt. Und natürlich damit, sich gegenseitig die Hölle heißzumachen. Dabei war jeder willkommen, der sich als Verbündeter im Ehekrieg missbrauchen ließ, seien es Künstlerkollegen, irgendwelche obskuren Freunde oder Schmarotzer, die sich gern mal für ein paar Wochen bei ihnen einquartierten. Auch Klara sollte dauernd gegen Papa oder Mama in Stellung gebracht werden, als wäre sie ein mausgraues Feldgeschütz. Himmel, was hatte sie gelitten! Was hätte sie nicht darum gegeben, einmal, nur ein einziges Mal einen Familienausflug zu erleben, der die Bezeichnung verdiente. An irgendeinen See fahren, spazieren gehen, ein Eis essen, miteinander reden, ohne sich in einer Tour anzugiften. Welches Glück darin gelegen hätte, konnte sich einer wie Rupert gar nicht vorstellen.
Ekelhaft vernünftig. Was meinte er eigentlich damit? Dass sie nicht auf jeden Unsinn hereinfiel, dass sie misstrauisch blieb, wenn Misstrauen geboten war? Oder eher, dass es ihr an Spontaneität mangelte? An unreflektierten Ausbrüchen aus dem Alltag? Lass dich doch einfach drauf ein, hatte er gesagt. Es stimmte schon, sie war einen unspektakulär geraden Weg gegangen, zumindest nachdem sie dem Chaos ihrer Kindheit entkommen war. Nach dem Abitur hatte sie brav studiert, hatte ihren Abschluss gemacht, hatte als Praktikantin und dann als feste Freie bei einer Kunstzeitschrift gearbeitet, bis Rupert sie abgeworben hatte. Keiner hatte sie zu ihrem Weg gezwungen, sie hatte sich dafür entschieden, und das war richtig gewesen. Sie mochte nun mal, was sie tat, sie genoss, dass sie dabei weitgehend unabhängig war. Wieso sollte sie ausbrechen wollen, warum sich in einem Fass die Niagarafälle hinabspülen lassen oder auch nur in einem voll besetzten Fußballstadion nackt auf den Rasen rennen?
Wer solche adrenalingesteuerten Fluchten suchte, belog sich selbst und merkte es nicht einmal. Dagegen wirkte sogar ein Beltracchi halbwegs authentisch. Ob es stimmte, dass noch Dutzende seiner Fälschungen in anerkannten Museen hingen und Tag für Tag die bewundernden Blicke der Besucher auf sich zogen? Oder strickte er nur an seinem eigenen Mythos? Klara ging zum Kühlschrank und holte die Flasche Verdicchio.
Gefälschte Bilder ließen sich entlarven, wenn man sie nur genau genug untersuchte. Für gefälschte Leben existierten keine allgemein anerkannten Analysemethoden. Doppelt schwer fiel es, wenn man für sich selbst beantworten wollte, ob man ein Leben aus erster Hand führte. Ob man war, wer man war. Klara kippte den Wein hinab und schenkte sich nach. Herrgott, sie sollte mal ich sagen statt man. Führte sie ein authentisches Leben? Doch. Sie war ziemlich zufrieden mit sich. Um nicht zu sagen, glücklich. Nur jetzt gerade fühlte es sich nicht ganz so an. Das mochte am Wein liegen oder an sonst etwas. Jedenfalls führst du genau das Leben, das du führen willst, dachte sie. Ich, dachte sie, ich bin, was ich sein will. Authentischer ging es nicht. Oder?
Oder machte auch sie sich etwas vor? Vielleicht hatte sie mit ihrer ganzen Abgeklärtheit nur eingemauert, was tief in ihr pochte und schrie. Sie erinnerte sich, mit welchem Schauder sie in Rom zum ersten Mal Caravaggios Judith und Holofernes betrachtet hatte. Die Unmittelbarkeit der Enthauptungsszene hatte sie tief verstört und gleichzeitig fasziniert. Später hatte sie begriffen, dass Caravaggio nur ein extremes Beispiel für das war, was sie an den bedeutenden Malern insgesamt interessierte: der neue, unerhörte Blick auf die Welt, der Tabubruch, der Wille zum Unbedingten. Erst jetzt fragte sie sich, ob ihr die ganze Geschichte der Malerei etwa nur das ersetzte, was sie sich nicht zu leben traute.
Draußen hatte die Dämmerung vom Innenhof Besitz ergriffen. Die Kinder waren verschwunden. Klara setzte sich mit Weinflasche und Glas auf den Balkon hinaus. Der Stuhl strahlte noch die Hitze des Tages ab.
Hüttenbrechtshofen war wohl immer ein lausiges Bauernkaff gewesen. Völlig ruiniert worden war es durch das Pech, nur fünf Fahrminuten von der Autobahn München–Garmisch entfernt zu liegen. Die vergleichsweise günstige Verkehrsanbindung hatte zur Ausweisung eines Neubaugebiets geführt, das den alten Ortskern an Fläche übertraf. Äcker hatten sich in Bauland verwandelt, Pflugscharen in klingende Euromünzen. Die Profite waren anscheinend dafür verwendet worden, jeden einigermaßen ansehnlichen Bauernhof mit Glasbausteinen und Doppelgaragen zu verunstalten, und die Reihenhaussiedlung war so hässlich, wie Reihenhaussiedlungen eben sind. Man konnte darauf wetten, dass sie überwiegend von Pendlern bewohnt wurde, die sich in München keine Wohnung leisten konnten und das gern mit dem Satz umschrieben, dass es für die Kinder doch besser sei, in der Natur aufzuwachsen.
Mal abgesehen davon, dass die Natur hier hauptsächlich aus Maisfeldern bestand, mochte das sogar stimmen. Zumindest, solange die Kinder nicht an Geigenstunden, Karatekursen, Eisdielen, schnellem Internet, Clubs oder sonstigen Vergnügungen interessiert waren. In Orten wie Hüttenbrechtshofen fieberten schon die Dreizehnjährigen der Führerscheinprüfung entgegen, und wenn sie den Schein dann endlich hatten und besoffen aus der Disco zurückrasten, legte die Hälfte von ihnen Papas Wagen mit Karacho aufs Dach. In einem Maisfeld natürlich, wo die Rettungssanitäter den verderblichen Einfluss des Menschen auf die Natur studieren könnten, wenn sie auf dem langen Weg dorthin nicht mit leerem Tank liegen bleiben würden.
Rupert von Schleewitz hatte drei Jahre seines Lebens in einem Internat auf dem Land gelitten. Er wusste, wie das so lief. Er wusste auch, dass in einem solchen Kaff praktisch alles Ungewohnte Gesprächsstoff bot. Sein grasgrünes VW Beetle Cabrio zum Beispiel. Vor allem, wenn es im Schritttempo an der Kirche vorbeizuckelte und auf dem verwaisten Parkplatz vor dem Gasthaus »Zum Hirschen« stoppte. Sicher war auch ein sündteurer Mercedes-Van mit Starnberger Kennzeichen nicht unbemerkt geblieben. Wenn Rupert an Beilharts Stelle gewesen wäre, hätte er das Gemälde eher an einem Autobahnparkplatz übergeben.
Rupert machte sich nicht die Mühe, den Wagen abzuschließen. Er nahm seine Lederhaube ab und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Dann betrat er die Wirtschaft. Aus dem breiten Flur des »Hirschen« schlug ihm miefiger Geruch entgegen. Im Halbdunkel stand ein Kicker herum. Rupert war versucht, eine Münze einzuwerfen, nur um nach langen Jahren wieder das Geräusch zu hören, mit dem die Bälle in die Ausgabeschiene fielen. Doch wahrscheinlich waren sie schon längst aus dem antiken Gerät geklaut worden. Rupert öffnete die Tür zum Gastraum. Unter einer niedrigen Decke empfingen ihn Tische und Stühle aus schwerem, nachgedunkeltem Holz. Zwischen den kleinen Fenstern hingen naiv bemalte Schützenscheiben an der Wand. Bis auf drei ältere Männer am Stammtisch war der Raum leer.
Entweder hatten sich die Stammtischbrüder schon den ganzen Vormittag angeschwiegen oder ihr Gespräch abrupt unterbrochen, weil sie ganz damit gefordert waren, den Neuankömmling anzustarren. Rupert schmetterte ein fröhliches »Grüß Gott« in ihre Richtung und fragte nach dem Wirt. Einer der Männer stand auf und schlurfte zur Theke vor. Rupert überreichte seine Geschäftskarte, setzte eine bedeutungsvolle Miene auf und redete von einem Haftpflichtfall nicht unbeträchtlicher Größenordnung, bei dem noch Klärungsbedarf bestünde. Letzten Dienstag hätten doch zwei Herren ein großes Gemälde hinausgetragen …
»Dienstag? Warten’s, da kann Ihnen vielleicht meine Tochter helfen. Lisa!« Der Wirt rief Richtung Küche, drehte Rupert den Rücken zu und hatschte zum Stammtisch zurück.
Als die Schwingtür von der Küche aus aufgestoßen wurde, musste Rupert seine Meinung über Hüttenbrechtshofen relativieren. Das Kaff hatte doch eine Attraktion aufzuweisen. Dass diese Lisa einen silbernen Augenbrauenring trug, mochte ja noch angehen, aber sich das Kopfhaar gänzlich abrasieren zu lassen, das musste hier ungefähr genauso verwerflich sein, wie ins Weihwasser zu pinkeln. Rupert konnte sich die Kommentare zwischen »Mei Madl, wo du so schöne Haar hättst« und »Spinnerte Kuh!« lebhaft vorstellen. Er fragte: »Die Tochter des Hauses?«
»Worum geht’s?« Sie trocknete sich die Hände an ihrem T-Shirt ab. Rupert sagte die Geschichte auf, die er schon ihrem Vater gegenüber begonnen hatte. Die junge Frau hörte zu und sagte dann spöttisch: »So, ein Haftpflichtfall!«
Wenn man sich das Piercing wegdachte, hatte sie ein schönes, perfekt proportioniertes Gesicht. Große dunkle Augen, über die man romantische Gedichte schreiben könnte, in denen sich Waldsee auf Sternschnuppenweh reimte. Doch Rupert war alles andere als ein Romantiker. Immerhin musste er zugeben, dass auch ihre Figur ziemlich schnittig war. Hätte sie sich nicht kahlrasiert, würden ihr sämtliche Burschen des Schützenvereins die Bude einrennen. Und sie hätte sich heraussuchen können, an wessen Seite sie versauern wollte. Genau darauf war sie wohl nicht scharf. Die wollte keinen von denen, die wollte bloß eins: Raus hier! Möglichst weit weg von Hüttenbrechtshofen. Weiß der Himmel, warum sie nicht längst schon abgezischt war.
»Ja, Haftpflicht«, sagte Rupert. »Genauer gesagt, geht es um den sachgerechten Transport und die Übergabe des Gemäldes.«
»Nun, die waren die ganze Zeit im Nebenzimmer. Der Typ kam extra ein paar Tage vorher vorbei und hat es für Dienstagnachmittag angemietet. Ich habe mich schon gefragt …«
»Was?«
»Na ja, die wollten wohl ihre Ruhe haben.«
»Kannten Sie den Mann, der das Bild angeschleppt hat?«
»Nie gesehen, aber warte mal, ich habe bei der Reservierung den Namen aufgeschrieben.« Lisa wandte sich um, zog eine Schublade auf und beugte sich nach unten. Am Nackenansatz trug sie ein Tattoo. Irgendein chinesisches Schriftzeichen. Wenn Rupert jetzt einen bis über beide Ohren verknallten Schützenvereinsburschen neben sich hätte, würde er ihm raten, mit dem Zeigefinger an den Linien des Schriftzeichens entlangzustreichen und sich sanft zu erkundigen, was das bedeutete.
Mit einem dicken Kalender in der Hand tauchte Lisa wieder auf. »Hier. Walter Goldschnigg. Dienstag, 14 Uhr bis 20 Uhr. Er ist aber gegen 18 Uhr gegangen, und die anderen beiden mit dem Bild gleich danach.«
»Ach, da steht ja auch eine Telefonnummer dabei. Darf ich mal?« Rupert notierte sich Handynummer und Namen. Walter Goldschnigg alias Josef Beilhart. Nun ja, wahrscheinlich waren beide Namen falsch. Immerhin schien Schwarzers Übergabegeschichte den Tatsachen zu entsprechen.
»Das soll ein Haftpflichtfall sein, und du kennst die Namen der Beteiligten nicht?«, fragte Lisa.
»Reine Routine«, sagte Rupert.
»Jetzt komm, sag schon, worum es hier geht!«
»Du bist eine ganz Schlaue, was?« Unwillkürlich war auch Rupert zum Du übergegangen. Er sah ihr in die Augen. »Was machst du eigentlich in so einem Kaff?«
»Warten.«
Auf den Märchenprinzen, der sie zu sich auf einen prächtigen Schimmel hob, um am Meeresstrand der Abendsonne entgegenzureiten? Rupert fragte: »Worauf denn?«
»Auf den Weltuntergang«, sagte Lisa. »Wenn alles auseinanderbricht und in Flammen aufgeht. Das muss hier besonders schön sein.«
»Lisa, bringst uns noch drei Weißbier?«, fragte es vom Stammtisch her. Schweigend sah Rupert zu, wie Lisa die Flaschen öffnete und mit routiniertem Schwung die Gläser füllte. Sie brachte sie zum Stammtisch und kam mit drei leeren Gläsern zurück. Das Tablett stellte sie auf der Theke ab.
»Bevor die Welt untergeht«, sagte Rupert, »könntest du mir noch den Raum zeigen, in dem die Übergabe stattgefunden hat?«
Im Stüberl fragte er Lisa weiter aus. Ihre Beschreibung des Bildlieferanten entsprach der von Schwarzer. Ob dieser angebliche Walter Goldschnigg in einem Lieferwagen gekommen war, wusste sie nicht, denn er hatte anscheinend nicht direkt am Wirtshaus geparkt. Dass er mit einem Auto unterwegs gewesen sein musste, war klar. Wie kam man sonst nach Hüttenbrechtshofen? Und hier aus der Gegend stammte er Lisas Überzeugung nach nicht. Schon seine Dialektfärbung habe das verraten.
»Ja, dann danke für deine Hilfe!«, sagte Rupert. »Und viel Glück!«
»Gibst du mir noch deine Handynummer?«, fragte Lisa. Rupert blickte sie an. Schnittig oder nicht, das konnte er gerade überhaupt nicht brauchen. Sie hob den kahlgeschorenen Kopf fast ein wenig herausfordernd und schaute mit ihren großen dunklen Augen zurück. Dann sagte sie: »Falls mir noch etwas Wichtiges einfällt.«
Bevor Rupert in seinen Wagen stieg, wählte er die Telefonnummer, die dieser Walter Goldschnigg hinterlassen hatte. Eine angenehme Telekomstimme vom Band sagte, dass ihr diese Nummer nicht bekannt sei. Aber man könne den Anrufer gern an die Auskunft weiterleiten.
Die Kaffeemaschine brummte und schaltete sich aus. Klara nippte an ihrem fast kalten Cappuccino und betrachtete den Druck der Blauen Pferde, den sie im Büro aufgehängt hatte. Trotz des Glanzpapiers wirkten die Farben gedeckter und wiesen darüber hinaus einen leichten Rotstich auf. Die Oberflächentextur war natürlich überhaupt nicht mit dem möglichen Original in Schwarzers Villa vergleichbar.
»Dein Fahndungsplakat?«, fragte Klaras Kollege Max Müller, als er kurz von seinem Computerbildschirm aufsah.
Gesucht wird …? Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an …? Darum ging es nicht. Eher schon darum, sich die Aufgabe vor Augen zu halten. Das Mangelhafte verlangte nach dem Vollkommenen, es schrie geradezu nach seinem authentischen Urbild. Eine Reproduktion ersetzte eben kein Original. Genauso wenig, wie ein Fahndungsfoto oder eine Phantomzeichnung identisch mit der gesuchten Person war, die es zu finden galt oder deren Schicksal aufgeklärt werden sollte. Klara vermutete, dass auch in den entsprechenden Abteilungen der Kriminalpolizei Fotos der Vermissten an der Wand hingen, selbst wenn die Beamten deren Gesichtszüge längst auswendig kannten.
Überhaupt existierten jede Menge Parallelen zwischen Menschen und Gemälden. Beide alterten, bekamen Risse und Falten, beide waren einzigartig unter ihresgleichen, wurden dafür geliebt, geschmäht oder ignoriert, beide blieben unverwechselbar sie selbst, obwohl sich ihre Rolle und ihre Bedeutung in der Welt stetig wandelten. Die Lebensgeschichten beider hingen von Zufällen, ökonomischen Interessen und historischen Ereignissen ab. Klara stellte sich eine solche Geschichte gern als Seil vor, das mal straff gespannt, mal knotenreich und in verschlungenen Windungen durch den Nebel der Zeit reichte.
Wenn Schwarzers Turm der blauen Pferde echt war, hatten sie in diesem Fall das Glück, beide Enden des Seils in der Hand zu halten. Vor ein paar Tagen erst war das Gemälde wieder aufgetaucht. Es galt einerseits, den Verkäufer ausfindig zu machen und sich beharrlich in die Vergangenheit zu hangeln. Wie lange hatte er das Bild besessen und woher hatte er es bekommen? Wo hatte es sich zuvor befunden? Andererseits konnte man seine Geschichte auch von der Entstehung an verfolgen und versuchen, über den letzten nachgewiesenen Verbleib hinaus nach vorn zu forschen. Irgendwo würden sich die Wege treffen, falls es sich wirklich um ein und dasselbe Seil handelte.
Den zweiten Weg hatte Max Müller eingeschlagen. Rupert hatte ihn eingestellt, weil er eine Bibliothekarsausbildung abgeschlossen hatte und somit als Wühlmaus der Detektei prädestiniert erschien. Zwar jammerte Max immer, wenn er sich tagelang in Archiven vergraben musste, doch darin bestand nun mal ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Vorerst sichtete Max jedoch nur die Informationen, die das Internet hergab. Er fand einiges mehr heraus als Klara bei ihrer Kurzrecherche am Abend zuvor.
Nach seinem kurzzeitigen Auftritt bei der Münchner Ausstellung 1937 wurde Der Turm der blauen Pferde nach Berlin transportiert und mit anderen Gemälden in einem ehemaligen Getreidespeicher deponiert. Im November desselben Jahres wurde das Bild unter der Nummer 14126 in einer Liste beschlagnahmter »entarteter« Kunst inventarisiert. Dort stach es Reichsmarschall Hermann Göring ins Auge. Zusammen mit zwölf anderen Meisterwerken ließ er es beiseiteschaffen und übergab diese seinem Bevollmächtigten Josef Angerer mit dem Auftrag, sie zu Geld zu machen. Angerer legte später eine Abrechnung über sieben ins Ausland verkaufte Bilder vor. Der Turm der blauen Pferde war jedoch nicht darunter. Auch für die folgenden Jahre gab es keinen Hinweis darauf, dass Göring das Gemälde weiterveräußert hätte. In der großen Luzerner Auktion am 30.Juni 1939, bei der die Nazis Meisterwerke der verachteten Moderne gegen Devisen losschlugen, wurden die Blauen Pferde nicht angeboten. Noch 1942 tauchte in der Harry-Fischer-Liste der mehr als sechzehntausend beschlagnahmten Kunstwerke »RM Göring« als aktueller Besitzer des Werks auf. Daran dürfte sich bis 1945 nichts geändert haben.
Wo sich das Bild während dieser Jahre befunden hatte, war unklar. Ob es in Görings Landsitz Carinhall, im Preußischen Staatsministerium oder im Reichsluftfahrtministerium aufbewahrt wurde, ob es dem Depot »entarteter« Kunst in Schloss Schönhausen zugeführt oder während des Kriegs in einen Berliner Bunker ausgelagert wurde, blieb Spekulation. Schon 1943 ließ Göring jedenfalls einen Teil seiner zusammengeraubten Schätze ins österreichische Salzbergwerk Altaussee bringen. Kurz vor Kriegsende folgten drei weitere Sonderzüge, die bis in die Berchtesgadener Gegend gelangten. Vollständige Inventarlisten der Transporte existierten nicht mehr, und unter den von den Amerikanern sichergestellten Kunstschätzen aus Görings Sammlung fanden sich neben Plastiken, Glasfenstern, antiken Möbeln und Teppichen zwar 1375 Gemälde, nicht aber Der Turm der blauen Pferde.
So weit, so schlecht. Allerdings gab es eben die Aussagen zweier Zeugen, die das Gemälde noch in Berlin gesehen haben wollten. Der eine 1945 direkt nach Kriegsende im Haus am Waldsee, das in der NS