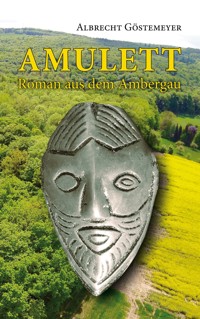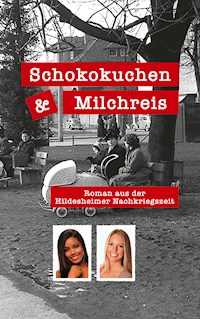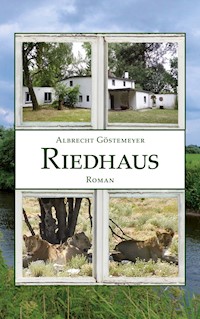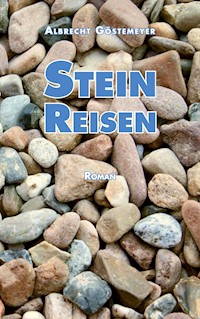Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, in den Jahren um 1968. Der Abiturient Bernhard Lindtmeyer ist nach Westberlin gezogen um zu studieren. Der Stadtteil war damals eine Insel inmitten der DDR, umgrenzt von Mauern und Stacheldraht und nur über eine Anfahrt mit schikanösen Grenzkontrollen zu erreichen. Doch er fühlt sich auf Anhieb wohl und seine Beziehung zu der Chemiestudentin Annette lässt beide in einer Gefühlswelt versinken, die sie genießen. Aber die Zeiten ändern sich. In der Universität wird es unruhig; dieStudenten sind nicht mehr bereit, den innenpolitischen Stillstand hinzunehmen, der sich in Westdeutschland und auch Westberlin eingeschlichen hatte. Gleichzeitig entsteht weltweit eine neue Kultur. Berlin gärt, die Studenten provozieren und Demonstrationen und Vorlesungsstreiks wechseln einander ab. Annette muss aus Berlin wegziehen und verlässt Bernhard, dem es gelingt, eine neue Beziehung zu der angehenden Lehrerin Christine aufzubauen, die aus seiner Heimatstadt stammt. Bernhard beendet sein Studium und muss sich die Frage stellen, ob er zurückkehren oder in Berlin, dieser Stadt, in der er über acht Jahre glücklich gewesen ist, bleiben soll? Der Roman beschreibt das Ende der gemütlichen Nachkriegszeit in Deutschland und den Übergang zur Zeitenwende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
Aufbruch 1964 im März
Hildesheim
Suche
Berliner werden
Musik
Es wird ernst
Freizeit
Norweger und Mädchen
Bundeswehr
Sommerfeste
Ende des ersten Semesters
Siemens
Hauskauf
Bärenhaus
Berliner
Chemie
Kuppelei
Annette
Berliner Sommer
Europa-Center
Anatomie
Prüfungen
Abschied
II
Zeitenwechsel
Beatles und Minirock
Robert
Zum Braunen Bären
Christine
Deutsch-Amerikanisches Volksfest
Semesterferien
Cariogena
Düppel
Staatsexamen
Kreuzberg
Korsika
Haschi
Haustiere
Brandenburgische Philharmonie
Ostberlin
Veränderungen
Abgesang
I
AUFBRUCH 1964 IM MÄRZ
„Gommense her.“
Der Grenzwächter, angetan mit seiner graugrünen Diensttracht, schien genervt, weil ich offensichtlich dem Wink seines Zeigefingers nicht schnell genug gehorchte.
Das Fenster meines Fiat Jagst hatte ich schon seit geraumer Zeit heruntergekurbelt, so dass die kalte Märzluft von außen herein drang; hier am Grenzkontrollpunkt Marienborn war sie noch eine Spur kälter. Ich gab langsam Gas und rollte auf ihn zu. Hinter meinem Auto puffte eine schwärzliche Wolke in den Himmel.
Als sich der Grenzbeamte mit seinem Gesicht dem Fenster näherte, schlug mir ein Appetit verschlagender Geruch entgegen, eine Mischung aus Tabakrauch, Achselschweiß und Desinfektionsmitteln. Eine ähnliche Mischung kannte ich auch aus den Amtsstuben meiner Heimatstadt Hildesheim, nur, dass sie statt nach Desinfektionsmitteln nach ausgelaufener Tinte roch. Ich wunderte mich, dass der Plastschirm seiner Ordnungsmütze, fabriziert in Tschopau oder sonst wo, nicht an den Rand der Fensterkante meines Kleinwagens stieß.
Doch auf einmal wusste ich, woran es lag. Seine Mütze mit dem Schirm hatte er weit in das Gesicht hinab geschoben, so dass sie einen dreifachen Zweck erfüllte: einerseits stieß sie nicht an mein Autofenster an, andererseits verhüllte sie seine Gesichtszüge, dritterseits legte sie seinen glattrasierten Nacken frei, auf dessen sichtbare Muskelzüge er wahrscheinlich stolz war. Die Amis trugen ihre Mützen genauso, noch extremer, vielleicht hatte er Westfernsehen gesehen, verboten in der Deutschen Demokratischen Republik, denn die Russen pflegten, zumindest bei ihren gemeinsamen Paraden mit den Streitkräften der Republik, ihre Schirmmützen nach hinten zu ziehen. Denn helle, sozialistische Gesichter sollten den alten Politleuten entgegenstrahlen, die sich pflichtgemäß auf den Tribünen versammelten, um ihrer Genugtuung Ausdruck zu verleihen, dass weder Ochs noch Esel den Sozialismus verhindern könnten.
„Papiere!“
Dies war ein Befehl, dem man sich wohl nicht entziehen konnte. Ich reichte ihm meine Unterlagen durch das Fenster entgegen, den alten Führerschein in bürograu, die Autozulassung in stumpfgrün und ein von der Stadt Hildesheim ausgestelltes Dokumentenheft, den Personalausweis, welcher mich befugte, die Deutsche Demokratische Republik zum Zwecke des Transits in die selbständige politische Einheit Westberlin zu durchqueren. Dass dieser Ausweis schon in Kürze seine Gültigkeit verlieren würde, konnte ich noch nicht ahnen. Nach Sichtung der Unterlagen wies mich der Beamte an, mein Fahrzeug in die qualmende Kolonne missmutig wartender Autos einzureihen, welche auf der rechten Fahrspur abgefertigt wurden.
Nachdem sich andere Grauuniformierte nach äußerer und innerer Kontrolle des Fiat davon überzeugt hatten, dass ich nicht vorhatte, Spione, Waffen, Drogen oder pornographische Literatur in die DDR einzuschleusen, also alles, was dem Sozialismus abhold war, gelangte ich zur Endkontrolle, der letzten Schranke, wo ich meine Unterlagen zurückerhielt. Zusätzlich wurde ich mit einem Durchlaufzettel auf grobem Papier versehen, auf dem genau Anlass und Zeitpunkt meines Eintretens in das Gebiet der DDR vermerkt waren. Ich reiste in ein unbekanntes Land. Auf den ersten Blick hatte sich die Landschaft nicht verändert. Der Helmstedter Wald mit seinen Fichten und Buchen setzte sich noch eine Weile fort, bis er sich in den Niederungen der Magdeburger Börde verlor.
Doch die Orte hießen anders; sie endeten auf -leben wie Eilsleben, Irxleben, ganz anders als in der Gegend um Hildesheim, wo die Endungen der Ortsnamen häufig und irgendwie familienhaft die Silben -um oder -sum trugen, wie Einum, Achtum, Machtsum oder Hönnersum.
Leben konnte man jedoch in der Landschaft nicht entdecken, als hätten sich die Menschen aus Angst vor der Autobahn in ihre Häuser verkrochen.
Nachdem ich die fetten und fruchtbaren Felder der Börde durchfahren hatte, kam ich zu einem Hang, an dem das Rasthaus „Magdeburger Börde“ mit Tankstelle lag, offensichtlich gut frequentiert von Fahrzeugen der Marke „Trabant“ mit ihrem hüstelnden und stinkenden Auspüffen. Im Obergeschoss der Gaststätte war die Stasi zwischen halb zugezogenen Fenstern heimisch, was niemand so richtig wusste.
Die Stadt Magdeburg selbst war nur aus der Ferne zu sehen; offensichtlich hatten die Erbauer der Autobahn kein großes Interesse an ihrer Anbindung gehabt. Doch langsam musste man doch zur Elbe kommen, so stand es jedenfalls auf der Landkarte!
Sie machte sich dann auch bald bemerkbar, indem sie den einzigen Stau auf der Strecke produzierte, denn ihre Brücke besaß nur zwei Spuren, also mussten sich ihre Überschreiter einreihen und in Geduld üben.
Nach der Elbe ein anderes Landschaftsbild. Gerade und adrett aufgestellte Kiefern dominierten den Wald beidseits der Autobahn, man merkt, wir kommen bald nach Preußen!
Aber was kommt jetzt?
Autobahnausfahrt Lehnin. Wer hat denn da das „h“ vergessen?
Flach und kleinhügelig wurde es, Berlin nähert sich. Bei Michendorf wieder eine Ansammlung von Trabbis, Benzin der Marke „Minol“ tankend. Nun kommt eine Kreuzung. Auf der einen Seite geht es geradeaus. Da steht auf dem Schild, ganz groß:
Berlin. Hauptstadt der DDR
Wenig später, nach rechts, ganz klein:
Selbstständige politische Einheit Westberlin
Da wollte ich hin.
Bei Babelsberg ging alles noch einmal von vorn los, Papierkontrolle, Auto von oben bis unten durchsuchen, sächselnd und unfreundlich. Irgendjemand hatte dicke Betonbalken auf Rollen gesetzt, mit einer Vorrichtung, welche bei Bedarf verhindern sollte, dass Fahrzeuge die letzte Schranke durchbrachen. Der Sozialismus muss sich vor sich selbst schützen.
Danach eine Slalomfahrt über eine mit Schlaglöchern übersäte Autobahn, begrenzt von wolkenartig geschichteten Stacheldrahthaufen und Betongebilden, daneben gab es Anlagen mit Hunden, Laufleinen und Hundehütten. Auf der rechten Seite erschien ein angestrichener Kriegspanzer auf einem Denkmalssockel. Jetzt kam eine Brücke, unter der sich ein einfaches, gelbschwarzes Schild befand, mit der Aufschrift:
Berlin
Nun war ich da. Berlin ist eine komische Stadt.
Viergeteilt hatte man sie, als ob sie geschlachtet oder hingerichtet wäre, sie lag im Osten, in der Zone, wie wir in der Schule sagten, und gehörte doch nicht ganz dorthin.
Es hatte lange gedauert, bis wir in der Schule begriffen hatten, warum das so war, denn ansonsten hatte man das Land mit einer ordentlichen Grenze durchzogen, welche klarmachte, wohin man gehörte.
Berlin litt wohl auch Not. Über lange Zeit gehörte auf jeden Brief eine Notopfermarke, blauweiß, im Wert von zwei deutschen Pfennigen, betitelt mit: Notopfer Berlin, benachbart der normalen Briefmarke. Warum das zusätzliche Gekaufe und Geklebe, hätte doch genügt, wenn die normalen Marken zwei Pfennige teurer gewesen wären?
Doch die deutsche Bürokratie denkt nicht so und frisst alles durch die Verwaltung wieder auf, was sie zuvor den Leuten aus der Tasche gezogen hatte, so auch das Berliner Notopfer.
In Hildesheim ärgerte man sich besonders über die Autos von Mercedes und Porsche mit einer Berliner Nummer auf dem Autoschild, die ab und zu in der Stadt auftauchten.
Doch jetzt war ich in Berlin – West – und schaute mich um, soweit es die kleinen Fenster meines Fiat Jagst erlaubten.
Die Autobahn von Magdeburg mündete übergangslos in die „Avus“, eine zeitweilige Rennstrecke, einzige Möglichkeit für die Berliner, ihre Automotoren mal so richtig hochzudrehen. Das merkte ich auch sofort und hielt mich bescheiden am rechten Rand der Strecke. In der Ferne erschien ein Wahrzeichen der Stadt, der Funkturm, den ich wie die meisten Berliner innerhalb von vierzig Jahren noch nie betreten hatte …
Die Avus führte an Tribünen vorbei und endete in einem Kreisel, der mich dann zum Kurfürstendamm leitete, in die Stadt hinein.
In der Stadt angekommen, suchte ich mir eine Bleibe. Eine Pension in der Nähe des Kurfürstendammes schien zu passen, anderes hätte mein Geld aufgefressen, denn jetzt war ich Student. Auf einem Schild vor einem Altbau in der Leibnizstraße stand: Pension Leibniz. Ich parkte mein Auto und ging drei Treppen hinauf. Die Klingel öffnete mir eine Wohnungstür, hinter der mich eine nette Frau mit ihrer bebrillten Tochter begrüßte, die neugierig hinter dem Rücken ihrer Mutter zu mir schaute.
„Wie lange wollense denn bleiben?“
„Vielleicht zwei, drei Tage. Ich will mir ein Zimmer suchen.“
„Wat machense denn hier? Kommense aus Westdeutschland?“
Ein Anflug von Überraschung ließ mich stutzen. Entweder man kam aus Deutschland oder aus der Zone, meine Denke.
Aus Berlin zu kommen war etwas Besonderes und brachte beispielsweise den Gästen der schwarzweißen Fernsehshows von Hans-Joachim Kulenkampff einen zusätzlichen Klatschmarsch ein, wenn sie das Studio betraten. Nun war ich wohl ein „Westdeutscher“ und sollte es auch für die nächsten acht Jahre bleiben, jedenfalls für die Berliner.
„Ja. Ich will hier an der Uni studieren.“
Mitleidig schaute mich die Pensionsmutter an.
„Det wird aber schwierich für Sie sein, ein Zimmer zu suchen. Bei uns kostet det Zimmer zehnfuffzich am Tag. Mit Frühstück.“
Ich war einverstanden und bezog ein riesiges Altbauzimmer, sympathisch aussehend, möbliert mit einem Mix aus neunzehntem Jahrhundert und den zwanziger Jahren des darauffolgenden Jahrhunderts. Der dezent muffige Geruch störte mich nicht, weil er mich an das Wohnzimmer von Tante Minna erinnerte, einer alten Verwandten meiner Mutter. Ich musste ihn als Kind häufig schnuppern.
Ich nahm mir vor, am nächsten Tag die Makler anzusteuern, welche ihre Zimmerangebote den Menschen weitergaben, die eine mittel- oder langfristige Bleibe suchten.
Die großen Berliner Altbauwohnungen hatten – wenn sie nicht durch den Krieg zerstört waren – genug Möglichkeiten, einen oder mehrere Studenten aufzunehmen, denn ihre Bewohner waren durch Alter bereits dezimiert. Dienstpersonal, welches im Zuschnitt der Wohnungen einkalkuliert war, gab es nicht mehr. Doch sie wollten meist für sich allein bleiben und mochten oft keine Studenten. Also vermieteten sie nur dann Teile ihrer Wohnung, wenn sie darauf angewiesen waren.
Neue Wohnungen gab es nicht – das Studentenheim der Freien Universität am Schlachtensee, ein Tropfen auf dem heißen Stein, kam nur für diejenigen in Frage, die sich durch ihre Beziehungen oder sonst was da hineingekungelt hatten. Also: kämpfen, suchen, irgendwas findet sich schon. Wenn ich schon nicht kungeln kann, muss ich eben makeln lassen.
Mein Fiat Jagst hilft mir dabei, finde ich doch überall einen Parkplatz. Er hat sich wohl schon an Berlin gewöhnt, säuft an den Tankstellen Berlins und trauert wohl Hildesheim nicht nach. Ich übrigens auch nicht.
HILDESHEIM
Hildesheim, na ja.
Man kann sich die Stadt nicht aussuchen, in der man aufgewachsen ist.
Leider hat sie dich geprägt, hat sich in dich eingeschlichen, auch wenn du es nicht wolltest. Doch irgendwann wirst du sie verlassen können oder müssen, und das solltest du auch tun.
Hildesheim war von viel Pech verfolgt. Der Krieg hatte die Stadt wohl in ihre Seele getroffen, denn ihr historisches Zentrum wurde in den letzten Kriegstagen vollständig und sinnlos von den Bomben der Briten und Kanadier zerstört, so schwer, dass sie ihre Identität verloren hatte.
Nach ihr sucht sie noch heute.
Mit ihren mehr oder weniger als hunderttausend Einwohnern weiß sie nicht, ob sie eine Groß- oder Provinzstadt ist, und das belastet sie. Sie kann nicht so locker und offen sein, wie es einer wirklichen Großstadt ziemt: siehe München, welches noch mehr zerstört war und sich damals in südlicher Gelassenheit zur „heimlichen Hauptstadt Deutschlands“ hochstilisiert hatte.
Auf der anderen Seite fehlt ihr die deftige Spontaneität der Provinzstädte; sie kann nicht richtig ausgelassen feiern, muss irgendwie immer ernst sein, alles, was geschieht, wird auseinandergenommen, von der Stadtpresse, den Zirkeln aufgeblasener Provinzler, den Vereinen, Männerbünden und sonst was.
Dazu kamen schwere Fehler in der Stadtplanung. Eigenartige Konstellationen in der Zusammensetzung des Stadtrates meinten, den Großstadtcharakter der Stadt betonen zu müssen, indem sie die Innenstadt mit Fernstraßen und Autobahnzubringern zerschnitten.
Zentrale Plätze und die letzten romantischen Ecken wurden mit gesichtslosen Neubauten bestückt, der noch verbliebene unzerstörte historische Bestand wurde teilweise vernichtet, so auch der noch gut erhaltene Bahnhof, ein Prunkstück aus der Gründerzeit.
Umso anregender die perlonbestrumpften Beinchen der kleinen Buchhändlerin, welche keine Gelegenheit ausließ, mit ihnen während meiner Aushilfstätigkeit nach dem Abitur vor meinen Augen hin und her zu wippen, auf einem Stapel Bücherkartons sitzend.
Die Süße hatte ihre Lehrzeit bei der Buchhandlung Scholz gerade beendet und war auf der Suche nach ihrer Zukunft. Ihre großen frechen Augen schauten mich herausfordernd an, ihre Stimme fragte nach wenigen Begegnungen unverhohlen, ob ich schon vergeben, also beweibt sei? So ungefähr, aber ungefähr auch nicht, antwortete ich wahrheitsgemäß. Mochte ich sie? Sicher, sie mich bestimmt auch, sonst käme sie nicht dauernd zu mir.
Der Aushilfsjob, angeboten von Herrn Scholz für heimatlose Abiturienten zwischen Prüfung und Studium, bestand darin, dass die Bücher für das kommende Schuljahr mit Bleistift auf der vorletzten Seite mit dem aktuellen Preis ausgezeichnet werden mussten, in einem ruhigem, uneinsehbaren Raum oberhalb der Buchhandlung. Die Beinchen liefen also mehrfach am Tag die Treppe hinauf, wir ließen die Arbeit liegen und sprachen miteinander, aber Bär und Eichhörnchen wollten sich nicht gegenseitig vernaschen, schon gar nicht während irgendwelcher dubiosen Gelegenheiten. Immer wenn die Kleine ging, musste sie sich an den Bücherstapeln drehen, an mir vorbei, sodass mich ihre kleinen, spitzen, mit Bügel-BH bewehrten Brüste streiften, was uns beide immer erfreute.
Eines Tages kam ein dicker blauer Umschlag bei mir an.
Ich hatte mich bei zwölf Universitäten in Deutschland … nein, Westdeutschland und Berlin, beworben, denn ich bin jetzt Berliner und gehalten, auch so zu sprechen. Jede Universität konnte selbst entscheiden, wen sie aufnehmen wollte, was zu einem Rennen auf die begehrten Studienplätze in Medizin und Zahnmedizin führte. Beide Fächer hatte ich in meinen Bewerbungsschreiben angekreuzt, auf Druck und Anraten meines Vaters, der sich etabliert hatte, als erfolgreicher Zahnarzt in Hildesheim. Also schrieb sinngemäß die Freie Universität Berlin:
„Sie haben einen Studienplatz im Fach Zahnmedizin erhalten. Melden Sie sich bitte in der Zahnklinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Aßmannshauser Straße 4-6 in Berlin-Wilmersdorf, und zwar am Dienstag, den 21. April 1964, zwecks Antritts des Studiums.“
Doch was war nun mit der Bundeswehr?
Weil ich am 11. Februar, meinem Geburtstag, gerade mein neunzehntes Lebensjahr vollendet hatte, ist die Schule der Nation nicht hinterhergekommen, mich ordentlich in den Kreis der pflichtbewussten und wehrwilligen Staatsbürger einzureihen, sie hat es einfach verschlafen. Meine einzige Berührung mit dem „Bund“ bestand also darin, dass ein müder alter Beamter in einem Nebenraum der städtischen Verwaltung am Marktplatz meine Personalien nach gewissenhafter Aufnahme in einen wehrmachtsgrauen Pass eintrug, den ich an diesem Tag zum ersten und letzten Mal gesehen hatte. Dieser Vorgang nannte sich „Erfassung“. Pflichtgemäß wies er mich darauf hin, dass ich innerhalb der nächsten vier Wochen mit weitergehenden Maßnahmen seitens des „Bundes“ zu rechnen habe, nämlich der „Musterung“, bei der die Wehrpflichtigen in der Waterloo-Kaserne durch Amtsärzte auf körperliche und seelische Abweichungen jenseits der Norm besehen und geprüft wurden, wie Krankheit, Kurzsichtigkeit oder Schwulität. Nach dieser „Musterung“ unterlag man der „Wehrüberwachung“, musste jedwede Bewegung vom Heimatort, Urlaub, Verwandtenbesuch und ähnliches der zuständigen Behörde anzeigen, damit die Wehrkraft der Bundesrepublik Deutschland auch erhalten blieb.
Dazu ist es bei mir nicht gekommen, siehe Berlin, denn Westberliner waren von der Wehrpflicht der westlichen Republik ausgenommen, was in meinem Fall später zu wütenden Protesten amtlicher und privater Art führte.
Den Ostberlinern ging es anders; die östliche Republik verzichtete nicht auf den Beitrag ihrer Volksgenossen zur Wehrkraft.
Über solche Angelegenheiten musste ich mir im Moment also keine Gedanken machen.
SUCHE
Was macht man, wenn man schnell Wohnung in einer fremden Stadt finden will, in der man noch nie gewesen war? Man geht zum Makler.
Also ein paar Mal um die Blocks am Kurfürstendamm herum, und ich stieß erwartungsgemäß auf ein Emailschild mit abgeplatzten Ecken, befestigt neben dem Eingang zu einem Wohnhaus, das irgendwann einmal ansehnlich gewesen sein musste. Die schmuddelige, staubige Fassade hätte wohl einen Anstrich nötig gehabt, auch die Einschusslöcher der russischen Maschinengewehre im Bereich des ersten Stockes wirkten auf den ersten Blick etwas erschreckend. Auf dem Schild stand:
Egon Riebsam, Makler Häuser, Wohnungen, möblierte Zimmer
Im Erdgeschoß, zwischen einem Tabakladen und einem Geschäft für Damenwäsche breitete sich eine ausladende, doch äußerlich wenig einladende Haustür aus, verschmutzt und angestoßen. Als ich auf die Klinke drückte, konnte ich sie aufschieben und über mehrere breiten und staubigen Holztreppen, welche schon lange kein Bohnerwachs mehr gesehen hatten, den zweiten Stock erreichen, in dem Herr Riebsam offensichtlich sein Domizil aufgeschlagen hatte. Ein verschnörkeltes und in der Mitte geteiltes Holztürelement mit Messingbeschlägen ließ vermuten, dass sich zur Rechten und Linken zwei große Berliner Altbauwohnungen die Etage teilten. Doch der Eingang zu Herrn Riebsam lag auf der linken Seite des Treppenabsatzes, wie ein weiteres kleines Schild anzeigte. Es ging durch eine niedrige Tür, die man offensichtlich vor einigen Jahren in einen Durchbruch zur Wohnung eingelassen hatte.
Als ich eintrat, gab es ein rätschendes Geräusch, mit dem ich unversehens eine Bürofrau aufscheuchte, die gerade damit beschäftigt war, auf ihrem kleinen Schreibtisch Stapel von papiernem Material zu ordnen und zwei Pappordnern mit der Aufschrift „Leitz“ zuzuführen. Angetan war sie mit einem Faltenrock und einem grauen Jersey-Pullover, was ihr ein altersloses Ansehen verlieh.
„Guten Tag. Ich suche eine Wohnung in Berlin“, antwortete ich. Sie musterte mich von oben bis unten. „Wie heißense denn“, fragte sie mich, „und wo wohnense?“
„Lindtmeyer, Bernhard“, stellte ich mich vor. „Dass ich nirgendwo wohne, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, sonst würde ich keine Wohnung suchen.“
Sie fauchte mich an.
„Redense nicht son kariertes Zeugs. Die meisten kommen hierher, weil se de Wohnung wechseln wollen, oder sind Se schwer von kappee? Im übrigen jloobe ick, Se suchen mehr`n möbliertes Zimmer!“ „Das könnte auch sein.“
„Dann jehn Se jleich durch. Herr Riebsam is da.“ „Danke.“
Ich trat durch die nächste Tür, diesmal größer und höher, umrahmt von einer Regalwand voller Aktenordner. Herr Riebsam, dicklich mit Halbglatze, thronte hemdsärmelig hinter einem riesigen Schreibtisch, der mit einem Telefon besetzt war. Ich überlegte kurz, dass seine Sekretärin oder Schreibhilfe oder was sie sonst war, diese große Fläche wohl eher benötigt hätte als ihr Chef. Es stank bestialisch nach Zigarre. Neben dem Telefon stand eine halbgefüllte Flasche mit Rotwein und ein gefüllter Aschenbecher.
„Juten Tach. Wat suchen Se denn?“, sprach Herr Riebsam mich an und räumte die Flasche und den Aschenbecher mit den Zigarrenkippen weg.
„Ich fange hier mit meinem Studium an und suche ab sofort eine Wohnung oder ein Zimmer.“ Riebsam musterte mich von oben bis unten. „Wohnung is nich, aber Zimmer können Se krijen. Wat studieren Se denn?“
„Zahnmedizin.“
„Aha. Dann brauchen Se wat in die Nähe von die Mecklenburgischen, also in Wilmersdorf, Steglitz oder Zehlendorf. In Dahlem jibt et nix, wär auch zu teuer. In Schmarjendorf wohnt et sich auch sehr jut.“ Er zog eine Schreibtischschublade auf, holte einen Kasten mit Karteikarten heraus und blätterte sie durch. „Hier hab ick wat in Steglitz, Friedenau und Schmarjendorf. Lassen Se sich de Adressen von Frau Schulze aufschreiben und melden Se sich, wenn et klappt. Wenn nich, dann kommen Se wieder.“
Als ich wieder auf der Straße stand, faltete ich meinen Stadtplan auseinander und verglich die Adressen, die mir Herr Riebsam gegeben hatte, mit dem Standort der Zahnklinik in der Aßmannshauser Straße. Schmargendorf lag am nächsten. Also auf nach Schmargendorf.
Erste Anlaufadresse: Tölzer Straße 4, bei Hoffmann. Hoffmann wohnt in einem schlichten Mehrfamilienhaus und entpuppt sich als kleines, faltiges Männchen, mit einer nervigen Fistelstimme sprechend.
„Was möchten Sie von mir?“
„Guten Tag. Mein Name ist Lindtmeyer. Ich habe von Herrn Riebsam erfahren, dass Sie ein Zimmer vermieten.“
Herr Hoffmann fistelte zurück: „Ich habe aber mehr an eine Familie gedacht!“ „Wie groß ist denn Ihre Wohnung?“ „Dreieinhalb Zimmer.“
Abgang, Schulterzucken. Was es nicht alles gibt.
Der Fiat startet und fährt jetzt nach Friedenau, zur Lefèvrestraße 21. Ich steige aus und freue mich über ein kaum ramponiertes, mittelmäßig gepflegtes Haus, wohl aus der Gründerzeit stammend, mit Balkonen und heiler Haustür. Wieder erblicke ich ein Schild:
Erna Meckel Heilpraktikerin Sprechstunden nach Vereinbarung
Ich trete ein, die Tür ist offen. Ein paar Stufen, und ich klingele an der Wohnungstür. Frau Meckel öffnet. Es kommt eine zierliche, kleine Person, um die sechzig Jahre alt, die Haare zu einem unordentlichen Knoten gebunden. Alles an ihr erscheint zierlich, auch ihre Stimme.
„Wünschen Sie eine Behandlung?“
„Nein. Mein Name ist Lindtmeyer, ich will hier Zahnmedizin studieren und komme aus Westdeutschland. Ich habe durch Herrn Riebsam erfahren, dass Sie ein Zimmer vermieten.“
Frau Meckel schien erfreut.
„Das ist richtig, und das Zimmer ist auch noch frei. Wollen sie es sich anschauen?“ Ich will und betrete ein einigermaßen geräumiges Zimmer, ausgestattet mit ausrangierten Möbeln, aber hell und gemütlich. Die ausgelegene Matratze des Schlichtbettes würde wohl keine Schwierigkeiten bereiten, denn ich hatte mich seit meiner Zeit bei den katholischen Pfadfindern des heiligen Georg an weitaus unbequemere Bettstätten gewöhnt. Als Ess-, Schreib- und Studiertisch diente ein einfacher Vierbeiner mit Platte, doch wenigstens nicht mit wackligen Füßen.
Frau Meckel wies auf eine Besonderheit hin: „Sie haben sogar einen Kühlschrank!“ Der Kühlschrank erwies sich als ein radiogroßer Kasten mit Ölanstrich, vor dem Außenfenster angenagelt. Ich war irritiert: „Was soll ich denn im Sommer damit anfangen?“ Frau Meckel reagierte jetzt belehrend: „Im Sommer gibt es alles frisch. Dann brauchen wir keinen Kühlschrank!“ Irgendwo hatte sie Recht, denn es gab kurz vor der Haustür einen regelmäßigen Budenmarkt mit Lebensmitteln auf dem Gelände des noch nicht entstandenen Steglitzer Forums.
„Das Zimmer kostet achtzig Mark im Monat“, sagte Frau Meckel, und ihre Stimme wurde noch eine Spur zierlicher, „Damenbesuch ist natürlich nicht gestattet.“
Dabei wollte ich gar nicht, dass mich Damen besuchten, eher Mädchen, und damenhaftes Benehmen erwartete ich von diesen eigentlich gar nicht.
Ich sagte zu. Ich konnte sogar meinen Fiat vor der Haustür parken. Zwei Koffer auspacken, und ich verfügte wieder über eine Heimat. Den Phonokoffer von Telefunken mit meinen Schallplatten hatte ich separat auf den Rücksitz gelegt. Als ich die Sachen in das Zimmer brachte, legte ich die Platten kurzzeitig auf dem Autodach ab. Doch als ich sie wieder herunternahm, hatte ich eine Platte vergessen: Ausgerechnet meine Lieblingsplatte, das „Carnegie Hall Concert“ mit Benny Goodmann. Am nächsten Tag musste ich rückwärtsfahren, um aus der Parklücke zu kommen. Als es knirschte, stellte ich leider fest, dass mein Fiat das Carnegie Hall Concert überfahren und vernichtet hatte. Himmelkreuzdonnerwetternocheinmal.
Wo bin ich jetzt gelandet?
Als mir Frau Meckel die Schlüssel gegeben und ich mich eingerichtet hatte, war ich zu müde, um noch einmal vor die Tür zu gehen. Also bisschen Musik hören, die Post von der Freien Universität Berlin, genannt FU, noch einmal durchlesen und dann einschlafen.
Frau Meckel war wohl früh auf den Beinen, wie ich aus dem sturzbachhaften Geräusch des Spülwassers, dem Klokasten entstammend, entnehmen konnte, welches mich unsanft aufweckte. Sicher litt sie schon unter seniler Bettflucht. Aufgewacht und aufgestanden schaute ich mir die Gegend an. Um die Ecke der Walther-Schreiber-Platz mit U-Bahn, daneben Kaufhaus Held, zwischendurch brausender Verkehr auf der Schlossstraße – hast es nicht schlecht getroffen, dachte ich mir, bist wirklich in der Großstadt, wolltest doch dahin. Ein schöner Märztag, die Ostsonne beschien die alten Häuser von Friedenau. Leerflächen dazwischen, doch der Titania-Palast thronte über allem wie eine Burg. Während an ihm gehämmert und genagelt wurde, um Werbung an seine riesigen Fassadenflächen anzupappen, wirkte er auf mich wie ein müdes, altes Schloss. Er hatte wohl wenig Lust, noch lange zu leben, so richtig lebte er schon jetzt nicht mehr, das spürte ich.
Seine beste Zeit lag hinter ihm, die zwanziger Jahre mit ihren Uraufführungen der ersten abendfüllenden deutschen Spielfilme. Nach einem sündigen Exkurs in der Nazizeit als Volkspalast für die Propagandafilme der UFA unter Goebbels hatte er es – man hatte ihm wohl verziehen – sogar geschafft, Standort der ersten Berlinale zu werden. Später wurde er zum Aufführungsort von Musicals und Operetten, Künstler wie Louis Armstrong und Marlene Dietrich gaben hier Konzerte. Vorbei jetzt alles, diese Szene spielte nun am Kurfürstendamm. Die ehemals berühmte Steglitzer Burg brauchte man nicht mehr.
Nördlich der Lefèvrestraße, in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz, wurde es gemütlicher. Beidseitig enger Straßen drängten sich hohe Wohnhäuser, mit grauem Stuck verziert. Zwischendurch ein paar Läden, Kohlenhandlungen und Handwerksklitschen wie Glaserei und Polsterei, zum Teil in den Souterrain gedrängt. Doch die richtigen Farbflecke waren die Eckkneipen, meist gekrönt von dem neondurchleuchteten Emblem eines Altberliner Bierkutschers, genannt Schultheiss. Zaghaft versuchten andere Biersorten wie „Charlottenburger Pilsener“ oder „Berliner Kindl“ Fuß zu fassen, was ihnen nicht so richtig gelang. Besonders dümmlich fand ich die Werbung von „Kindl“ mit einem im Bierkrug sitzenden und verschämt über den Rand glotzenden Bengel. So ein blöder Name. Was hat ein bayerisches Kindl bloß mit einer Berliner Göre zu tun? Diese Biersorte hätte ich glatt „Görenpils“ genannt, wenn die Assoziation schon sein musste.
Langsam nahm die Helligkeit ab, ich überlegte, was ich sonst noch unternehmen konnte, denn der Fiat kannte sich in dieser großen Stadt noch nicht aus. Mit einer U-Bahn hatte ich erst ein einziges Mal Bekanntschaft gemacht; vor vier Jahren in London hatte ich eine bestaunt und befahren. Also hinein in die Station Friedrich-Wilhelm-Platz. Doch vorher musste ich am Wurstmaxe vorbei.
Dieser residierte, wie fast vor jeder Bahnstation in Berlin, in einem Miniwohnwagen, ausgestattet mit Grill und Spülmöglichkeit, gespeist durch einen Wassertank. Hinter dem resopalbeschichteten Standtresen befand sich auf der linken Seite die Vorratshaltung, rechts die Garzone mit gasbeheizter Grillplatte.
Die linke Seite erschien mir sehr unappetitlich. Bleiche Wurstobjekte ohne Haut harrten ihrer Bestimmung, wie enthäutete Wurstleichen. Zu Objekten des menschlichen Hungers wurden sie dann doch noch, nachdem sie der Wurstmaxe auf seinen Grill gelegt hatte, wo sie knusprige Bräune und einen appetitanregenden Geruch entwickelten. Nach derartiger Behandlung wurden sie einzeln auf einen tiefen Pappteller geschoben.
„Wollense scharf?“ Ich wollte, und Maxe holte zwei durchlöcherte Blechbüchsen hinter dem Tresen hervor und bepuderte meine gebräunte Wurst mit rotem und gelbem Staub. Zur Krönung des Ganzen quetschte er aus einer großen Plastikdose unter blubberndem Geräusch einen Streifen roter Tomatenschmiere, die er auf dem Wurstkörper verteilte. Zur Vollendung des Gerichtes legte er eine quer durchteilte weiche Toastscheibe über die Wurstsaucenmischung, reichte mir den Pappteller herüber und empfing sein Entgelt in Form von sechzig Pfennigen.
So kam ich in den Genuss meiner ersten Berliner Currywurst. Künstlich und trotzdem köstlich. Sie schmeckte mir.
Doch nun hinein in die Unterwelt. Nach ein paar Treppen erreichte ich die Bahnstation. Ein Luftzug umwehte mich, es roch nach einer Mischung aus Öl und Eisen, wie auf einem oberirdischen Bahnhof. Doch hier fühlte ich mich auf Anhieb viel wohler, denn dies war ein warmer Luftzug und kein frösteliger Durchzug, der mir deswegen merkwürdigerweise eine gewisse Heimeligkeit vermittelte. Das wog die Trostlosigkeit der schäbigen und nüchternen Umgebung auf, jedenfalls für mich. Seither bin ich immer gern mit der U-Bahn gefahren, fast war ich enttäuscht, wenn sie zeitweilig an der Oberfläche fuhr.
Rumpelnd und zischend näherte sich der Zug, wie ein Riesenwurm mit glühenden Augen, schoss durch sein dunkles Loch und hielt. Ich stieg ein.
Den Kurfürstendamm kannte ich zwar schon durch meine Zimmersuche, doch jetzt wollte ich zum Kranzler-Eck kommen, dem angesagten Zentrum der Stadt, dort, wo die Joachimstaler Straße den Kurfürstendamm kreuzt. Merkwürdig – es gab keine U-Bahn-Station an dieser Stelle. Die nächste Station, die ich auf meinem Stadtplan ausmachen konnte, war Spichernstraße; ich stieg aus und ging die Joachimstaler Straße hinauf, Richtung Bahnhof Zoo. Im gesichtslosen Straßenbild auf der rechten Seite ein paar graue, hochgeschossige Altgebäude, in denen sich offensichtlich Billigpensionen einquartiert hatten. Vor deren Türen standen angealterte Matronen mit dicken Handtaschen, die vorübergehende Passanten bei Blickkontakt dezent anmachten. Selbst ich, kaum der Provinz entlaufen, merkte, dass hier Damen des horizontalen Gewerbes am Werk waren, keine zweihundert Meter vom stolzen Mittelpunkt des Berliner Geschehens entfernt.
Ecke Augsburger Straße erschien ein barackenartiges Provisorium, eine Saufkneipe mit einem nach außen dringenden Mischgeruch von gebratenen und vergammelten Hähnchen, genannt „Weißer Mohr“, einen Steinwurf vom vornehmen Café Kranzler entfernt.
Schließlich das glänzende Berlin. Menschen, sehr viele, flanierten, huschten, kauften ein, zeigten sich. Am Breitscheidplatz stand die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, eine Doppelkirche mit Ruine und achteckigem Neubau, dessen blaue Glasfenster leuchteten. Weiter ging es die Tauentzienstraße entlang zu Fuß zum Wittenbergplatz, am Kaufhaus Defaka vorbei. Links grenzte eine Riesenbaustelle für das Europa-Center an das Lichthaus Mösch, den größten Lampenladen Berlins. Und nun der Wittenbergplatz, den das Kaufhaus des Westens, genannt KaDeWe, wie eine Festung überragte. Ich stieg wieder in die U-Bahn ein.
Ich beschloss jetzt, Berlin kreuz und quer zu durchfahren. Am Nollendorfplatz stieg die Bahn zur Oberfläche empor und wurde zur Hochbahn, welche sich mit ihren Trägern über den Landwehrkanal spannte. In Richtung Kreuzberg wurden die Fassaden der dichtgedrängten Häuser jetzt schäbiger, die Zahl der abgeräumten und noch nicht wieder aufgebauten Ruinengrundstücke nahm zu. Am Bahnhof Hallesches Tor wechselte ich zur Linie 6 Richtung Tegel. Nun kam wieder eine Fahrt durch die Dunkelheit, scheinbar endlos.
Doch plötzlich Lichter; Bahnhof Friedrichstraße, ich war wieder in der Parallelwelt des Ostens, wie ich an den Uniformen der auf dem Bahnsteig stehenden Grenzbeamten sehen konnte. Scheinbar teilnahmslos musterten sie die wenigen ein- und aussteigenden Passagiere. Der Zug ruckte an, wir verließen die Ostinsel und rumpelten eilig weiter nach Wedding. Ich stieg am Leopoldplatz aus. Kaufhäuser von Karstadt, Quelle und Woolworth umrahmten einen parkähnlichen Rasenplatz, in der Mitte eine Kirche. Unweit der Kirche konnte ich an der Müllerstraße das Rathaus Wedding ausmachen. Nanu, dachte ich, Kirche und Rathaus sozusagen in Sichtweite, sind wir denn in Berlin oder in Bayern? Das Gewimmel eilender Menschen erinnerte mich an die Lebhaftigkeit rund um die Gedächtniskirche. Doch hier gingen die Menschen schneller, kein Interesse, zu flanieren oder etwa sich zu zeigen; eher wirkten sie scheu, denn sie wollten hier nur ihre Einkäufe erledigen, und das so schnell und preiswert wie möglich, so kam es mir vor. Auch ihre Kleidung wirkte schäbiger, wie auch die Fassaden der paar alten, vom Krieg weniger versehrten Häuser. War die Gegend am Kurfürstendamm Fünfsterngebiet, so war sie hier Dreisterngebiet.
Ein Gang um den Platz mit kurzen Ausflügen in die Seitenstraßen überzeugte mich davon, dass der Bierkutscher von Schultheiss, angebracht in Etagenhöhe, wohl in stolzer Weise den größten Filialbetrieb Westberlins überwachte. In eine dieser Kneipen ging ich hinein. Nach einem Schritt durch die Tür musste ich anhalten, denn eine überaus dicke, graue und dazu noch nach Zigarrenrauch stinkende Wolldecke versperrte mir den Weg. Befestigt war sie mit Ringen an einem bogenförmigen Messingrohr über dem Eingang
„Komm rin, oder haste Blei unter die Schuhsohle?“ Eine dröhnende Bassstimme begrüßte mich. Ich schob den Vorhang zur Seite und trat ein. Ich sah in einen kleinen Gastraum, ausgestattet mit einfachen dunklen Tischen und Stühlen, rechts und links vom Eingang zwei Eckbänke. Alles wirkte etwas angestoßen. Nur zwei Tische waren besetzt, denn es war erst später Nachmittag. Sieben männliche Köpfe drehten sich zu mir um, drei davon gehörten zu einer Skatrunde, bestehend aus Grauhaarigen, offensichtlich Rentner. Die andere, jüngere Runde saß an einem anderen Tisch und genoss ihr Bier zum Feierabend, wie ich aus ihrer äußeren Erscheinung, befleckte dünne Hosen, Jacken und Overalls, ersehen konnte. Doch gegenüber der Tür erhob sich aus dem Dunkel des Gastraumes die hell erleuchtete Theke, als würde man hinter dem Vorraum eines Tempels zum Allerheiligsten vordringen. Sie bestand aus zwei Teilen. Der vordere, moderne Teil schien ein Fertigmöbel aus Holz zu sein. Die über den Rand gezogene Tischverkleidung bestand aus Edelstahl, in ihrer Mitte war sie zum Teil gelocht. Eingelassen waren eine Spüle mit Wasserhähnen und ein Sockel, über dem sich zwei Bierhähne erhoben. Über diesem Arrangement hing eine breite Neonleuchte mit Milchglasverkleidung, bedruckt mit dem Bierkutscher.
Der hintere Teil beeindruckte mich und hinterließ in mir eine Spur von angenehmem Erstaunen. Ein riesiges altes Büfett mit
Fächern, Schubladen, Ständern, Holzhaken und Bleiglasfenstern nahm den gesamten Wandraum ein, bis zu einer Höhe, die man nur mit einer Trittleiter erreichen konnte. Verziert war es mit einer Menge gedrechselter Knöpfchen und Türmchen, wirkte dadurch irgendwie schlossartig. In den Fächern standen unten Gläser und oben Flaschen; manchmal hingen Servietten mit ihren Spitzen aus den Regalen. Unten war alles noch einigermaßen sauber, doch nach oben hin nahm der Verstaubungsgrad der Flaschen und Gläser zu. Die annähernd schwarze Farbe des Büfetts führte dazu, dass es fast in der Dunkelheit verschwand.
Der Wirt stand, was die Theke betraf, zwischen vorne und hinten, neu und alt; eine stämmige, kantige Figur, der man ansah, dass sie in ihrer Jugend Sport betrieben hatte, vielleicht hatte er sogar geboxt, denn die Nase stand etwas schief in seinem Gesicht.
„Wat kann ick dir Jutes verabreichen, vielleich`n Pils?“, sprach er mich an. „Was haben Sie denn für Biersorten?“
„Kommst wohl aus Westdeutschland?“
An diese Frage war ich nun schon gewöhnt und dachte nicht mehr daran, sie zu beantworten.
„Kiek mal nach oben, oder haste Tomaten uff de Oogen? Bei uns jibt et Schultheiss.“
„Aber hier ist doch noch ein zweiter Zapfhahn!“ Jetzt hatte ich es zufällig geschafft, den Wirt verlegen zu machen.
„Det is für de Fassbrause.“ „Dann geben Sie mir bitte eine Fassbrause.“ Der Wirt zuckte mit den Schultern und schenkte mir ein Glas ein. Das Getränk sah aus wie Bier, schäumte auch und entwickelte sogar so etwas wie eine Blume. Ein Schluck davon, und ich hätte es gerne sofort ausgespuckt. Ein widerlicher Geschmack nach Apfel und Zitrone, aber künstlich und mit Kohlensäure, sorgte dafür, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Fassbrause getrunken habe. „Wer trinkt denn so was?“ „Anjeblich Sportler, de Brauerei möchte, det wa det Zeugs verkoofen. Möchste jetzt`n reellet Pils?“ Keine Frage.
Als ich nach einer Stunde herauskam, steuerte ich wieder den Leopoldplatz an, stieg in die Linie 9 ein und verließ sie am Friedrich-Wilhelm-Platz, meinem Ausgangspunkt. Ich musste noch ein paar Schritte gehen, im Kaufhaus Held Brot, Käse, Wurst, Milch und Bier einkaufen – das erste Mal für mich allein – um dann in die Gefilde von Frau Meckel einzutauchen. Sie war wohl noch immer damit beschäftigt, ihren Patienten in ihrem Wohnzimmer zuzuhören und ihnen die Vorteile homöopathischer Lebensweise zu erklären, wie ich durch die dünne Wand zu meinem möblierten Zimmer hören konnte. Mein Einkauf bescherte mir eine ruhige Abendmahlzeit, nach zwei Knubbelflaschen „Schultheiss“, gefüllt mit 0,33 Liter, schob ich die sagenhafte Scheibe von Count Basie, „Swingin the Blues“, auf den Plattenteller, Lautstärke auf leise. Ich hatte einen guten Schlaf in meinem Schlichtbett, ich war zufrieden.
BERLINER WERDEN
In den nächsten Tagen setzte ich meine Erkundungsfahrten mit der U-Bahn fort. An manchen Stationen stieg ich aus und schaute mich um. Meistens sah es so ähnlich aus wie in Friedenau: Hohe alte Mietshäuser, dicht gedrängt, mit schäbig aussehenden Fassaden, dazwischen kleine Läden und Kneipen.
Doch in Richtung Süden und Westen nahm die dichte Bebauung ab. Gärten und Einfamilienhäuser bestimmten das Bild; manchmal Villen, umgrenzt mit hohen Zäunen. Ein einziges Mal versuchte ich, S-Bahn zu fahren, nachdem ich, von der Station „Krumme Lanke“ kommend, zu Fuß den S-Bahnhof Mexikoplatz erreicht hatte. Kaum ging ich durch die Bahnhofstür, wurde ich auch schon angemacht.
„Wat fährste mit de S-Bahn?“, sprach mich ein bulliger kleiner Fünfzigjähriger an. “Willst dir wohl een Zwanziger sparen?“
Das stimmte, S-Bahn kostete 20 Pfennige, U-Bahn vierzig.
„Weeste nich, det de S-Bahn vom Osten unterhalten wird?“
Nein, das wusste ich nicht. „Kommst wohl aus Westdeutschland?“ Aha. „Dann merk dir det mal. Kann dir passieren, det de eenen in de Schnauze krichst, wennde S-Bahn fährst.“
Frau Meckel, meine Zimmerwirtin, homöopathisch, biologisch, ganzheitlich und heilpraktisch ausgerichtet, besaß auch eine dementsprechende Religion.
„Ich bin Mitglied einer Religionsgemeinschaft, die sich mit den Geheimnissen des heiligen Grals beschäftigt. Wir treffen uns am Freitagabend, könnten Sie mich vielleicht mit Ihrem Auto nach Schöneberg bringen?“
Sicher. Als ich an ihrer Tür klopfte, kam sie ausgehfertig heraus, hatte sich verkleidet mit einem knöchellangen weißen Kleid, unter dem zwei sockenlose Sandalenfüße hervorguckten. Wir setzten uns in den Fiat, und ich brachte sie nach Schöneberg. Zwischendurch unterhielten wir uns.
„Ich muss mich hier noch anmelden, wo ist denn das Rathaus?“ „Das ist in der Rheinstraße, im Übergang zur Hauptstraße. Aber in Berlin meldet man sich im Polizeirevier an.“
Die Rheinstraße trug einen der vielen Namen der großen Nord-Süd-Diagonale durch Berlin, identisch mit der Bundesstraße 1. Beim Austritt aus der „Zone“ hieß sie Potsdamer Chaussee, später Unter den Eichen, Schlossstraße, Rheinstraße, Hauptstraße und wieder Potsdamer Straße. Sie ging an der neu erbauten Philharmonie vorbei und traf am Kreisel bei der Siegessäule auf die „Straße des Siebzehnten Juni“, die große West-Ost-Diagonale durch Berlin. Ebenfalls die Zahnarztpraxis meines Vaters und meine elterliche Wohnung lagen an der Bundesstraße 1, die neben anderen Orten auch durch Hildesheim ging.
Also auf zum Polizeirevier am nächsten Tag.
„Ich möchte mich anmelden, ich bin umgezogen.“
„Kommen Sie aus Westdeutschland?“ Schon wieder. „Dann brauchen Sie auch einen neuen Personalausweis.“ Nanu? Ich füllte eine Seite Papier aus und ließ mich von dem Polizeibeamten messen – „Sie sind jetzt 19 Jahre alt, einen Meter fünfundachtzig groß und könnten noch gewachsen sein!“ – und empfing ein weiteres Schreiben, welches meine Wohnungsvermieterin unterschreiben musste, meinen Wohnsitz in der Lefèvrestraße 21 bestätigend. Frau Meckel tat mir den Gefallen.
Im Kaufhaus Held gab es einen Passbildautomaten, ich schmiss zwei Mark hinein, setzte mich auf einen Drehhocker, zog den Vorhang zu und machte ein teilnahmsloses Gesicht. Viermal blitzte es, nach ein paar Minuten kam ein Bildstreifen mit vier schwarzweißen Verbrecherfotos heraus.
Der Beamte war nun zufrieden. Er pappte mein Passbild mit zwei Ösen in einem funkelnagelneuen Personalausweis fest, der war grün, haute eine Gebührenmarke hinein und nahm mir meinen alten grauen Ausweis weg. „Alles klar, jetzt sind Sie Berliner!“
Ich schaute mir meinen Ausweis an. Darauf stand „Vorläufiger Personalausweis“.
„Wieso denn vorläufig?“
Der Polizist schaute ungnädig.
„Den haben alle Westberliner. Westberlin ist ein politisches Provisorium. Kennen Sie nicht das Grundgesetz? Darin steht, dass die beiden Teile Deutschlands und die Stadt Berlin so lange ein Provisorium bleiben, bis das Deutsche Volk in freier und geheimer Abstimmung eine Wiedervereinigung beschlossen hat.“
Diese Abstimmung steht allerdings immer noch aus.
Warum denn mein westdeutscher Personalausweis nicht auch provisorisch war, konnte er mir aber auch nicht erklären. Stattdessen mahnte er mich: „Sie müssen auch ihr Auto ummelden, sonst gibt es Schwierigkeiten an der Grenze!“
Also fuhr ich mit dem Fiat am nächsten Tag zur Zulassungsstelle für Personenkraftwagen nach Tempelhof. Alles klappte wie geplant. Sogar ein Schildermacher hatte sich neben dem kasernenartigen Gebäude niedergelassen, sodass mein Auto jetzt mit einem B-Schild statt eines HI-Schildes dekoriert werden konnte. Doch nachdem mir ein weiterer Beamter die neue Kfz-Zulassung in die Hand drückte, kam ein Hinweis.
„Haben Sie denn überhaupt einen Warenbegleitschein?“ „Was ist das?“
„Na ja, jede Ware, die von Westdeutschland nach Berlin eingeführt wird, muss als Zollware deklariert werden, also auch Ihr Fiat. Fiats werden in Berlin nicht hergestellt, wie Sie wissen.“
„Und was kostet das?“
„Zoll kostet das keinen, denn zwischen Westdeutschland und Berlin gibt es für Autos keine Zollvorschrift.“ „Und was soll dann das Ganze?“ „Kommt von der Zone. Ab und zu kassieren die an der Grenze ein Fahrzeug ein, wenn das keinen Warenbegleitschein mit sich führt und in Berlin gefahren wird. Meistens natürlich Porsche und Mercedes, weil die Devisen bringen.“
„Und wie komme ich zu einem Warenbegleitschein?“
„In Helmstedt, an der Grenze. Sie gehen in ein Büro, bekommen dann einen Warenbegleitschein in fünffacher Ausfertigung, der einmal im Westen, zweimal im Osten und einmal in Berlin abgestempelt werden muss.“
In Sorge um meinen Fiat habe ich mich dieser Prozedur bei der nächsten Westfahrt wirklich unterzogen. Tatsächlich, an der Grenze in Helmstedt fand sich ein tabakstinkendes Barackenbüro, in dem mir eine genervte Tippse gegen Gebühr einen fünffachen Warenbegleitschein ausstellte. An der Ausfahrt zum Osten musste ich noch einmal eine halbe Stunde warten, bis mir ein gelangweilter Zöllner viermal einen Stempel hinein haute und ein Exemplar einzog
In Marienborn stempelte mir ein Grenzwächter das Elaborat ab und kassierte eine weitere Durchschrift. Vor Berlin, Grenze Babelsberg, ein weiterer Stempel.
„Hobense noch einen waiteren Worenbeglaitschain? Gennse vleisch nochmol den Gofferraum uffmoche?“ Ich tat, und der Grenzwächter nahm mir eine weitere Durchschrift ab. An der Grenze Wannsee beim Zoll noch mal das Gleiche, genauso unfreundlich. Ein Exemplar des Vorganges konnte ich behalten, ich knüllte es zwischen die beiden Seiten der Autozulassung meines Fiat. Ja, und was kam dabei heraus? Gar nichts, die deutsche Bürokratie erzeugt und frisst unaufhörlich überflüssige Formulare, wie ein Pottwal, mit aufgerissenem Maul. Hinten heraus kommt überraschenderweise nichts. Sie ist offensichtlich das einzige Wesen, welches immerwährend frisst, Papier, Geld und sonst was, ohne es hinten auszuscheißen. Wahrscheinlich scheißt sie es von oben heraus, damit sie nicht so beschissen aussieht.
Anmelden hieß aber auch, sich an der Uni anzumelden. Gegenüber des supermodernen Henry-Ford-Baues in der Garystraße mit seiner Aula war ein dreiflügeliges Altgebäude übriggeblieben, „Quästur“ nach Universitätstradition genannt, in Wirklichkeit Sitz der Universitätsverwaltung. Mein Bestätigungsschreiben ebnete mir den Weg, ich empfing ein „Studienbuch“, diesmal braun. Man musste es vor dem ersten Ausbildungshalbjahr nach Semestern ordnen, führen und ausfüllen. Ausfüllen hieß, sich für Vorlesungen und Seminare „einzuschreiben“. Damit hatte man bewiesen, dass man sich zumindest für den Beruf interessiert hatte, mit dem man später sein Geld verdienen wollte, denn eine Anwesenheitskontrolle gab es nicht.
Das allein genügte beispielsweise für die Juristen, wie man mir später erzählte. Für sie galt, dass weniger ihr Vorlesungsbesuch für ihre Abschlüsse wichtig war, sondern vielmehr ihr Kontakt mit so genannten „Repetitoren“, freiberuflichen Rechtsanwälten außerhalb des Universitätsbetriebes, welche sie bei Bedarf in Kursen auf ihre Prüfungen vorbereiteten.
Bei den Medizinern und Zahnmedizinern war es anders. Es standen Kurse und Zwischenprüfungen an, die besucht und mit Erfolg bestanden werden mussten, sonst stolperte die Ausbildung und das Semester war eine Nullnummer. Vorlesungen und Kurse der Freien Universität Berlin bedeckten also als angeheftete Schreibmaschinenblätter die gesamten unteren Flure des Verwaltungsgebäudes. Doch die Wände waren einigermaßen alphabetisch angeordnet, so konnte ich „Zahnmedizin“ leicht am Ende der Flure orten. Da gab es aber nicht viel, zudem meist für die höheren Semester ausgeschrieben. Also zurück zum Eingang, einer Art Schalter, besetzt mit einem beamteten Verwaltungsfachmann der Freien Universität Berlin.
„Ich bin Student der Zahnmedizin im ersten Semester. Was muss ich denn nun in mein Studienbuch eintragen?
„Det weeß ick ooch nich. Ick habe hier ein Exemplar „Studienordnung für Zahnmediziner“, det kann ick Ihnen jeben.“ Er reichte mir ein paar Papierseiten. Ich schrieb in mein Studienbuch ein:
Stein, W. m. Hink: Experimentalphysik I
Honerjäger: Physikalisches Praktikum für Mediziner
Jahr: Anorganische Experimentalchemie
von Herrath: Systematische Anatomie I
von Herrath: Histologie mit Demonstrationen
Kirsten mit Hehring: Werkstoffkunde I
Eichner: Überblick über die Zahnheilkunde
Kirsten: Kursus der technischen Propädeutik.
Der Beamte nahm ein Lineal in die Hand, zog säuberlich einen Schlussstrich unter meinen Belegcocktail und schrieb darunter: Belegende. Sodann befeuchtete er eine Gebührenmarke, klebte sie ein und kassierte 207,60 Deutsche Mark Studiengebühr für das Semester.
Mit 200 Mark mussten die meisten Studenten im Monat mit allem, Unterkunft, Essen und anderem auskommen, mir ging es etwas besser. Erstaunlich auch, dass die meisten Vorlesungen und Vorgänge kaum etwas mit meiner späteren Berufsausübung zu tun hatten. Also auf, in die Aßmannshauser Straße, zu meinen Mitstudenten, Tacheles erfahren.
Ich stieg also an der U-Bahn-Station Heidelberger Platz aus, bewegte meine Beine in Richtung Rüdesheimer Platz, vorbei an dem Gebäude der alliierten Kommandantur, welches die Russen kurz nach dem Krieg unter Protest verlassen hatten. Doch die Fahnen der Amerikaner, Engländer und Franzosen hingen noch vor dem Eingang, sichtbare Zeichen dafür, dass man sich wohl keine Sorgen darüber machen musste, dass die Russen plötzlich den Eisernen Vorhang mit Gewalt nach Westen verschieben wollten.
In der Aßmannshauser Straße hob sich die Zahnklinik, meine Ausbildungsstätte für die nächsten Jahre, als moderner, weißer Baukörper nach Art des Bauhausstils hervor, zwischen kriegsbedingten Baulücken und ehemals noblen Althäusern gelegen. Toll, welche Ausbildungsstätte du hier hast, dachte ich mir.
Behindertengerecht war sie keinesfalls, denn ihr Inneres war nur über eine breite Freitreppe zu erreichen, also nicht barrierefrei für Rollstuhlfahrer und weitere Behinderte. Dieses Innere gestaltete sich jedoch wie ein Theaterfoyer mit breitem Schalter für Tickets (hier Krankenscheine und Überweisungen von und zu anderen Ärzten) und einer großzügigen Wartezone für Patienten, erhellt durch ein Lichtband von großen Fenstern. Dazwischen befand sich eine Garderobe mit Garderobenfrauen, welche meistens in eintöniger Weise Mulltupfer für die Chirurgie drehten
Ich ging nach hinten und erreichte den Vorlesungsbereich, zwei große Hörsäle, einer wie eine Schulaula ausgebaut. Im anderen, dem kleinen Hörsaal, fanden die meisten Vorlesungen und Vorführungen statt; seine Sitzreihen waren streng vertikal angeordnet, fast in übertriebener Weise – die Studenten sollten wohl auch visuell mitbekommen können, in welcher Weise ihnen ihr Professor ein fürchterliches Geschwür der Mundhöhle entweder als heilbare Entzündung oder unheilbaren Krebs deklarierte. Der kleinste Hörsaal, der „Kurssaal“, sah aus wie der Klassenraum einer Schule mit horizontal angeordneten Stühlen und Bänken, Schiefertafel und Pult, jedoch zusätzlich mit einem zahnärztlichen Untersuchungsstuhl ausgestattet, wie auch die beiden anderen Hörsäle. Alles tiptop, du hast es gut getroffen, dachte ich mir.
Die Architektur, außen wie innen, wirkte sehr amerikanisch auf mich und war es auch, denn die Amerikaner hatten die FU gebaut und mit Leben erfüllt. Die Humboldt-Universität lag nach der Zerschneidung Berlins durch die Mauer im Osten, sodass die alte Zahnklinik in der Invalidenstraße nicht mehr nutzbar war, und das Provisorium in einem Altbau in der Sybelstraße in Charlottenburg hatte vor wenigen Jahren ausgedient, wich dem Neubau in der Aßmannshauser Straße.
Vor den Hörsälen traf ich meinen ersten Mitstudenten, auch „Kommilitone“ genannt, auf einem Sessel innerhalb einer Wartezone vor den Hörsälen sitzend.
„Bist du auch ein Erstsemester?“ „Bin ich. Kommst wohl aus Westdeutschland?“
Schon wieder. Frustriertes Seufzen meinerseits. „Diese Frage habe ich in der letzten Zeit so oft gehört, dass sie mir zum Halse heraushängt. Natürlich komme ich aus Westdeutschland, genauer gesagt, aus Hildesheim.“
„Hab ich schon von jehört, bin aber noch nie dajewesen.“
Reginald Mühlke, so hieß der Kommilitone, sprach nur einen leichten Berliner Dialekt. Er klärte mich auf:
„Bei uns in der Medizin und Zahnmedizin jibt et nur wenige Westdeutsche. Das liegt daran, dass hier in Berlin“ – er sprach nicht von Westberlin – „wegen der Mauer viele Mediziner fehlen. Die FU versucht, das auszugleichen, indem sie Berliner vorrangig aufnimmt. Westdeutsche Ärzte nützen uns nichts, die jehen meistens nach dem Studium wieder weg. In den Jeisteswissenschaften ist et anders, besonders in Politologie, Volkswirtschaft und Jura, da kommense von überall her.“
„Und was müssen wir jetzt im ersten Semester machen? Was ist denn der Kurs der technischen Propädeutik?“
„Da haste ne jute Frage gestellt. Der Kurs ist das Wichtigste, was wir im Sommersemester zu machen haben. Die machen uns hier zu kleinen Zahntechnikern, wir fangen mit Schnitzen von Gipszähnen an, müssen die Verarbeitung von Werkstoffen lernen, Kunststoff härten, Metall gießen und zum Schluss Kronen und Prothesen hinferkeln. Alle Arbeitsgänge werden von den Assistenten jeprüft und testiert, am Schluss kommt olle Hehring und kiekt sich alles noch mal jenau an. Du kriegst dann einen Schein, wenn du den nicht hast, haste det Semester verjeigt!“ „Und wo findet das statt?“ „Hier natürlich, jeden Nachmittag.“ „Und wo?“
Reginald grinste. „Im Labor, in der Vorklinik, im Keller, also in die unteren Jefilden. Da warste bestimmt noch nicht.“ „Und was macht man am Vormittag?“ „Kannst ja dann zu den Vorlesungen gehen, wenn’s dir Spaß macht!“
Am Abend beschloss ich, mich für meine Tätigkeit an diesem Tag zu belohnen. Ich bestieg wieder die U-Bahn und stieg am Breitenbachplatz aus. Unweit der U-Bahn an einem schlichten Eckhaus stand eine Neonschrift: „Eierschale“. Hier also sollte die legendäre Jazzkneipe sein, einer der Eckpunkte der Berliner Szene.
Gleich hinter dem Eingang führte ein geisterbahnartiger Gang in den Keller – klar, denn Jazzkneipen sind meistens auch Jazzkeller, so will es die Flairvorschrift. Im Erdgeschoss gab es einen Raum mit Spielautomaten und Möglichkeit zum Happihappi mit Currywurst & Co.
Beim Abgang in die untere Etage konnte ich bereits den dröhnenden Ton des Hausposaunisten und Bandleaders der „Spree City Stompers“, Hans-Wolf Schneider, genannt „Hawe“, vernehmen. Ein gemütlicher, übersichtlicher Kellerraum mit mäßig hohen Decken, für nicht viel mehr als hundert Personen gedacht, begrüßte mich als Zentrum der Berliner Jazzwelt. Die Bühne erschien mir geschickt angeordnet, denn von jedem Platz aus konnte man die Musiker gut sehen.
„Hawe“ war ein exzellenter Posaunist, technisch versiert, für meinen Geschmack aber viel zu laut. Das machte in seinem Fall jedoch nichts aus, stand ihm doch mit Gerhard Vohwinkel ein ebenso erfahrener Leadtrompeter zur Seite, der einen solchen Strahl blies, dass er ihn lautstärkemäßig fast noch in den Schatten stellte. Lediglich die Klarinette tat mir leid: obwohl sie ihren Mitmusikern technisch gewachsen war, wirkte sie fast schüchtern gegenüber den zwei Volltönern, ihr Schicksal.
Piano gab es in meiner Erinnerung nicht; ein akustisches Piano hätte sich hier gegen die Bläser auch nicht durchgesetzt, und es gab nur eine kleine, primitive Akustikanlage in diesem Keller, den Rest erledigten die Kellerwände.
Doch eines gab mir zu denken: der Laden war nicht sehr gut besetzt. Innerhalb der Woche kann man wohl nichts anderes erwarten, aber hier kam noch etwas hinzu.
Die Spree City Stompers waren zwar bundesweit bekannt, hatten Scheiben, also Schallplatten gemacht, standen zeitweilig sogar in den Charts, aber reichte das aus, um über die Woche mit der immer fast gleichen Besetzung jeden Tag in ihrer Stammkneipe zu spielen?
Tat es nicht, nach kurzer Zeit verschwanden sie und es gab eine neue Art von „Eierschale“.
Aber die Atmosphäre gefiel mir auf Anhieb. Jazz war Mitte der sechziger Jahre eine überaus beliebte Musik. In die Eierschale gingen auch viele Mädchen, „Jazzerbräute“ genannt, unsere Sehnsucht, denn meistens waren sie hübsch und rochen gut.
Die typische Jazzerbraut hatte lange dunkle Haare, frisch gewaschen und seitlich herunterfallend. Über der Stirn ein sorgfältig gepflegter Pony, der die Augenbrauen verdeckte und den Blick auf die Augenpartie auf sich zog, deren schwarze Schminke die Augen optisch vergrößerte. Angezogen waren sie meistens figurbetont, Hauptfarbe schwarz. Alle rauchten, manche tranken zu viel. Doch es war schwer, an sie heranzukommen, denn sie wählten aus, waren schwierig, vielleicht die ersten Emanzipierten, viele hatten auch einen Freund. Aber der Geruch! Mädchenparfüm vermischte sich mit Zigarettenqualm und Bierdunst, die Musik und der Stimmenteppich gaben ihr Übriges dazu, ich genoss diese Jazzkelleratmosphäre. Noch viele Male sollte ich hierherkommen.
Um Viertel nach eins ging ich hinaus, erreichte die U-Bahn und stieg am Friedrich-Wilhelm-Platz aus.
Ein paar Schritte, und ich konnte mich in die Meckel`sche Heimstatt zurückziehen.
Berlin ist schön, und ich hatte einen schönen Tag.
MUSIK