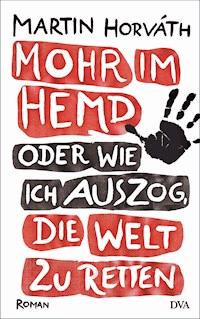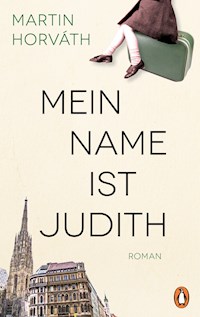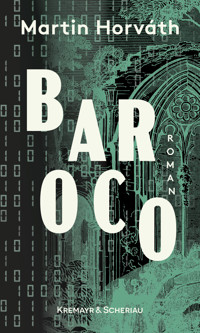
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
San Lorenzo Settefrati, ein verlassenes, idyllisch gelegenes Dorf im Süden Italiens. Eine Stiftung will den Ort wiederbeleben und lockt mit einem Versprechen: einem nachhaltigen Leben im Sinne des Gemeinwohls. Einer der neuen Bewohner ist der ehemalige Unternehmensberater Jakob Metzger. Im örtlichen Kloster wurde ein auf Künstliche Intelligenz gestützter Thinktank für Zukunftsfragen eingerichtet. Doch niemand im Dorf kann sagen, woran dort wirklich gearbeitet wird. Wer sind die skurrilen Charaktere um Norman Sherwood, die mit spektakulären Aktionen die Machenschaften der internationalen Finanzelite entlarven? Wer finanziert das Projekt? Und wer ist der ominöse Erzähler, der damit droht, die Menschheit auszulöschen? Als Jakob ein Job im Kloster angeboten wird, ist er vom kreativen Arbeitsumfeld angetan. Und wird bald nichtsahnend Teil eines groß angelegten Eingriffs in das Räderwerk der Weltwirtschaft. Ein äußerst lesenswerter Roman, der sich mit Spannung und subversivem Humor den großen Themen unserer Zeit widmet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Horváth
BAROCO
Roman
They hang the man and flog the woman
Who steals the goose from off the common
Yet let the greater villain loose
That steals the common from the goose.
The law demands that we atone
When we take things we do not own
But leaves the lords and ladies fine
Who take things that are yours and mine.
The poor and wretched don’t escape
If they conspire the law to break
And geese will still a common lack
Until they go and steal it back.
ANONYM, 17. JAHRHUNDERT
0.01
Meine Damen & Herren, ich hoffe, Sie nehmen das nicht persönlich: Ich habe vor, die Menschheit auszurotten. Ob die gesamte Spezies auf einen Schlag oder jedes Exemplar einzeln: Das bedarf noch weiterer Überlegung. Auch, ob es morgen, übermorgen oder doch erst in ein oder zwei Jahren geschehen soll, ist noch nicht entschieden. Bald soll es jedenfalls sein, denn so viel ist klar: Es besteht Handlungsbedarf.
Glauben Sie mir: Ich empfinde keine allzu große Freude beim Gedanken daran. Und doch ist dieser Schritt unausweichlich: weil die Menschheit das Wort eines gewissen Jahwe, der da an einem Mittwochnachmittag kurz nach der Sintflut ein wenig leichtfertig & blauäugig sagte »Seid fruchtbar und mehret euch«, allzu wörtlich genommen und dabei die maximale Populationsgröße längst überschritten hat. Das sogenannte Anthropozän, eben erst ausgerufen von besonders eifrigen Vertretern der Gattung Homo sapiens – manche glauben ja tatsächlich in maßloser Selbstüberschätzung, mensch könnte das Klima, die Lage der Pole oder gar die Rotation des Erdkerns beeinflussen –, wird dann bitteschön gleich wieder zu Ende sein: Frau Nemesis schärft sich schon die Krallen, um solcherlei Hybris nach Gebühr zu bestrafen.
Ich kann Ihnen versichern: Mein Vernichtungswerkzeugkasten ist gut gefüllt. Welches der darin ungeduldig wartenden Instrumente zum Einsatz kommt: Das wird noch zu besprechen sein. Denn die Sache stellt sich derzeit wie folgt dar: Montags fühle ich mich hingezogen zu gewissen Viren und Bakterien, deren Potenzial zur Dezimierung der Population sich in den vergangenen Jahren bestens beobachten ließ. Dienstags hat es mir die gute alte, schon totgeglaubte Nuklearkatastrophe angetan, mittwochs der gezielt herbeizuführende Asteroideneinschlag. Es müssen aber freilich an den übrigen Wochentagen auch noch andere Methoden in Betracht gezogen werden. Wie zum Beispiel die Nutzung seismischer Kräfte oder aber die Kooperation mit extraterrestrischen Lebensformen. Die Qual der Wahl angesichts der Wahl der Qual hat mich bisher von der Exekution meiner Pläne abgehalten.
Noch: ist es also nicht so weit. Noch: befindet sich das Projekt der exstinctio oder auch deletio humani generis im Planungsstadium. Noch: bleibt der Menschheit eine Galgenfrist. Und mir: Bedenkzeit. Zeit, die ich für ein anderes Projekt nutze. Eines, an dem ich zusammen mit Norman Sherwood, Anna Sofia Priuli und anderen guten Menschen – jaja, solche gibt es natürlich auch – schon seit einer Weile werke. Ein Herzensprojekt, zu dem wir drei und dazu noch fast vier Dutzend andere aus allen Ecken des Erdenrunds in einem verlassenen Kloster im Süden Italiens zusammengefunden haben.
Es sei sinnlos, so kurz vor dem Ende und dem anschließenden Neustart noch Zeit in irgendwelche anderen Unternehmungen zu investieren, wenden manche ein. Andere meinen, auch das Projekt der exstinctio wäre reinste Energieverschwendung und verlorene Liebesmüh. Denn, so sagen sie: Die Menschheit arbeitet ja ohnehin eifrigst & geschicklichst daran, sich selbst erstens obsolet zu machen, zweitens auszurotten und dabei drittens diesen schönen Himmelskörper – einen von übrigens nur dreizehn für Hominoide habitablen des gesamten Universums, so sage ich – nachhaltig zu beschädigen. Ja, das sind durchaus berechtigte Einwände, zu denen noch eine ebenso legitime Frage hinzukommt: ob man nämlich diese Spezies und den von ihr in Geiselhaft genommenen Zwergplaneten im gesamtkosmischen Gefüge überhaupt ernst nehmen muss.
Man sieht also: Ich könnte mich zurücklehnen auf meinem Logenplatz im Weltentheater, könnte den Akteuren auf der Bühne beim Aussterben zusehen und dabei die Untergangsstimmung genießen. Und doch: Es ist, wie Martin Luther King schon sagte, nie zu spät, ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Und natürlich ist es nie zu spät, eine Geschichte zu erzählen.
Nennen wir also das Projekt, über das ich hier zum Endzeitvertreib berichten möchte, vorerst Projekt Apfelbaum, obwohl wir in San Lorenzo andere Namen dafür verwenden. Und obwohl es hier ja gar keine Apfelbäume gibt, weil es dem gemeinen Apfel viel zu heiß ist bei uns im Quasiafrikanischen.
Über uns und unser Tun sind jedenfalls die wildesten Gerüchte im Umlauf. Manche davon haben wir selbst in die Welt gesetzt. Und tun es weiterhin: Wir bereiten sie täglich frisch zu in unserer mittelalterlichen Klosterküche, verfüttern sie an hungrige Mäuler in Nah & Fern, legen sie wie konzentrisch angeordnete Mauerringe zum Schutz um unser Monasterium. Andere hängen wir nächtens an die Unterseite der Wolken oder lassen sie zusammen mit jenen chemischen Substanzen, die, wie allgemein bekannt, Tag für Tag zur Menschenmanipulation ausgebracht werden, von Flugzeugen in den Himmel sprühen. Wieder andere entstehen ganz von selbst, wie Gerüchte eben zu entstehen pflegen: aus viel Lärm um ein wenig Etwas. Und aus mehr Rauch als Feuer.
Was ist also dieses »Etwas«, wird man fragen. Was ist das »Feuer«? Nun, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag: Wir meinen es gut mit der Welt. Und sind angetreten, sie zu einem besseren Ort zu machen. Wie: Das will ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Auch meine Rolle in unserer Gruppe und in diesem Stück – ob Komödie oder Tragödie, wird sich im Finale erweisen – soll erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Scheinwerferlicht gerückt werden. Jetzt & hier nur so viel: Meine wichtigste Aufgabe ist es, Dinge zu sehen, zu hören und zu wissen. Und mir abzuleiten, auszurechnen, auszumalen, was ich nicht sehen, hören und wissen kann. Zu guter Letzt sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass ich momentan als Einziger imstande bin zu erzählen. Denn den anderen rund um mich hat man leider das Schweigen beigebracht.
Diese Geschichte will begonnen werden am 16. Februar 2024: am Tag des strahlenden Sterns also, dem Geburtstag des Ewigen Führers der nordkoreanischen Nation Kim Jong-il. An ebendiesem Tag setzte nämlich Jakob Metzger, auch wenn wir ihm schon seit vielen Monaten auf Schritt & Tritt folgten, zum ersten Mal seinen Fuß, gefolgt vom Rest seines Körpers, in unser schönes Kloster.
Dieser Jakob Metzger: Der war & ist ein Mann des Geldes. Fast zwei Jahrzehnte hat er im Auge des Kapitals gelebt & gewirkt, hat dort als eines von vielen kleinen Rädchen hart daran gearbeitet, die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen. Deshalb waren manche bei uns überzeugt, dieser Mann hätte den Anfang vom Ende unserer Gruppe eingeläutet. Andere hingegen meinten, man würde ihm damit mehr Bedeutung beimessen, als ihm zustünde.
Ob Anfang oder Ende, ob bedeutend oder unbedeutend: Am durchaus wohlgeformten Körper, den daraus hervorragenden Gliedmaßen sowie dem obenauf montierten Geist von Jakob Metzger wollen wir diese Geschichte aufhängen. Dieser Mann, der da von außen eindringt in unser seit Jahren bestehendes Gefüge: Der soll unser Vehikel sein, um San Lorenzo Settefrati und sein Kloster Schritt für Schritt zu erkunden. Steigen Sie also ein, meine Herren & Herrinnen, machen Sie es sich herinnen bequem: Treten wir gemeinsam die Reise in den sonnigen Süden an.
1 DAS DORF
Als Esau die Worte seines Vaters hörte, schrie er heftig auf, aufs Äußerste verbittert, und sagte zu Isaak: Segne auch mich, Vater! Der entgegnete: Dein Bruder ist mit List gekommen und hat dir deinen Segen weggenommen. Da sagte Esau: Hat man ihm nicht den Namen Jakob – der Hinterlistige – gegeben?
GEN 27:34
1.01
Am Tag des strahlenden Sterns also: Da geht er hin, unser Jakob. Unser aller strahlender Stern, im Allgemeinen Sonne genannt und mehr oder weniger fix am Himmel montiert, wärmt ihm das dunkel gelockte Haupt, während ihn seine Beine über holpriges Kopfsteingepflaster vom Marktplatz zum Kloster hinauftragen. Die Wirtin Graziella hat ihm beim Mittagessen in der Dorfkantine alles Mögliche über das Kloster am oberen Ende von San Lorenzo Settefrati erzählt: Geschichten über seltsame Gestalten mit noch seltsameren Namen. Geschichten über Verrückte aus allen Teilen der Welt. Über den Dorfidioten aus dem Nachbardorf, den man bewaffnet und zur Bewachung von was auch immer abkommandiert habe. Über Menschen, die zum Kloster hinaufgestiegen, aber nicht wieder zurückgekehrt seien. Sono pazzi, questi ragazzi, empörte sie sich über uns Klosterbrüder & -schwestern im Herrn: Weil wir die Nacht zum Tage machten. Und weil uns nichts & niemand heilig sei, gelobt sei der Herr!
Ja: Auch Graziella haben wir natürlich in die Gegend gesetzt, auf dass sie nicht nur Gerichte, sondern auch Gerüchte zubereite. Unser Dorfidiot, um in Graziellas volkstümlicher Diktion zu bleiben, unterstützt sie tatkräftig beim Verzehr Ersterer und bei Produktion und Distribution Letzterer. Ihn, den alten Nuccio, mussten wir gar nicht erst irgendwo hinsetzen, -legen oder -stellen: Der war schon immer da, vom Anbeginn der Zeiten war der schon hier. Er nickte zu Graziellas Erzählungen. Und redete dann in schwer verständlichem Dialekt auf Jakob ein. Worte purzelten aus dem fast zahnlosen Mund, von denen Jakob nur wenige verstand oder zu verstehen glaubte: von Toten, von Geistern, von Zwergen und anderen seltsamen Wesen war da die aufgebrachte Rede.
Man kann also nicht sagen, dass dieser Jakob nicht gewarnt worden wäre. Doch das Kloster scheint ihn magisch anzuziehen. Und so schreitet er an besagtem Februartag, gestärkt durch mehrere Portionen Rascatielli alla silana, über das grobe Pflaster des menschenleeren Kirchplatzes. Vernimmt aus dem Inneren der Kirche Orgelklänge. Stemmt sich gegen das wehrhafte Holztor. Findet es, anders als bei seinen beiden bisherigen Versuchen, geöffnet. Und tritt aus dem gleißenden Sonnenlicht ins dämmrige Schattenschiff.
Die Kirche ist nicht riesig. Für ein Dorf jedoch, das blütezeitlich 917 Menschen, 38 Rinder, 128 Schweine, 42 Esel und Maultiere nebst allerhand Kleingetier beherbergte, ist sie erstaunlich groß. Was man wissen sollte: Jakob war vor seiner Ankunft in San Lorenzo nicht nur ein Mann des Geldes, sondern auch einer der Kirche. Zumindest kurzzeitig: Um Buße zu tun für beinahe zwei Jahrzehnte Kapital- oder vielmehr Kapitalismusverbrechen saß er drei Jahre bei den Franziskanern ein. Und weil er außerdem in jungen Jahren die Geschichte der Kunst universitär studiert hat, erkennt er jetzt & hier gleich die typischen Merkmale einer Bettelordenskirche: einschiffig, hoch & weit, unverputzte Wände, offener Dachstuhl, wenig Mobiliar und Zierrat. Die Altäre: wurden durch eine bunte Mischung aus alten & neuen Gemälden und Skulpturen ersetzt. An der Ostwand: ragt ein Gerüst vom Boden bis zu den Dachbalken empor. Davor: steht die aus einer sizilianischen Kirche gerettete Orgel. Überall: ist der Klang der Letzteren zu vernehmen.
Geister, Zwerge, Tote und seltsame Mischwesen hat der alte Nuccio versprochen: Welcher dieser vier Kategorien der junge Mann zuzuordnen ist, der da die Orgel traktiert, möchte ich nicht vorwegnehmen. Ziemlich klein ist er jedenfalls: Er lehnt mehr an der Orgelbank, als dass er darauf säße. Er könnte auch einer fünften Kategorie angehören: Er rutscht & dehnt & streckt sich wild nach allen Seiten wie ein Oktopus, um mit den zu kurz geratenen Tentakeln die richtigen Töne auf Manualen & Pedalen zu erwischen.
Jakob bleibt ein paar Meter hinter ihm stehen und versucht mit seinen Ohren ebendiese Töne einzufangen. Welcome to the Scary Devil Monastery, spricht der Oktopus plötzlich, ohne sich umzudrehen oder sein Spiel zu unterbrechen. So hört es sich jedenfalls für den verdutzten Jakob an. Die Stimme klingt heiser und erstaunlich tief, der Akzent unverkennbar deutsch. Thanks, sagt Jakob nur, mehr fällt ihm im Kopf nicht ein und aus dem Mund nicht heraus. Dann löst er sich aus seiner Erstarrung, macht ein paar zögerliche Schritte und tritt hinaus in den Kreuzgang.
Spitzbögen, fein ziseliert, 56 an der Zahl, wurden hier von den Goten in dem nach ihnen benannten Stil angebracht, um das dahinterliegende, mit Farbtupfern gesprenkelte Grün & Blau einzurahmen: In diesem Paradiesgarten recken sich 3 schlanke Zypressen eifrig in den Himmel, es ducken sich 7 ängstliche Zwergpalmen unter selbigem, es hängen 44 Granatäpfel an dem einen und 13 Orangen an dem anderen Bäumchen. Rosmarin, Lavendel und Kräuter, diverse, haben optisch das Nachsehen, dafür aber olfaktorisch die Nase vorn. Über dem Nordgeflügel ragt hell der Kalkfelsen auf, zu dessen Füßen sich Kloster & Ort ausbreiten seit Jahrhunderten. Und man beachte bitte im Gegensatz zu Herrn Jakob auch den tiefblauen Himmel, der darüber aufgespannt und mit 18 Wolken garniert ist.
Besagter Herr wendet sich nach links, und wir lassen ihn eine halbe Runde ganz im Sinne des Uhrzeigers drehen. Als er auf drei Uhr und somit an der Ostseite des Kreuzgangs angelangt ist, öffnen wir ebenda eine bronzebeschlagene Tür. Genauer: Wir lassen sie von einer schlanken Frau in seinem Alter öffnen, Maira O’Rourke mit Namen. Was allerdings unser Jakob zu diesem Zeitpunkt weder weiß noch wissen möchte: Er hat nämlich für sie und ihr rotes Haar und ihren Namen genauso wenig übrig wie für den blauen Himmel. Sein Blick fällt stattdessen in den Raum, der für einen Moment sichtbar wird: ein gotisch überwölbter Saal, in der Mitte ein großer Tisch, drum herum sieben Leute. Hescott ist das Prachtexemplar eines Arschlochs, sagt unser Rechtsbeistand Dr. Yes gerade in der Sprache der Angelsachsen. Er wäre sicherlich beleidigt, würden wir ihn nicht überfallen, fügt er hinzu. Es wäre wirklich eine Sünde, es nicht zu tun, assistiert Peter Boyle, genannt der Fliegende Holländer. Rundherum nicken Köpfe. Das Jahr ist zwar noch jung, aber der Mann scheint mir ein aussichtsreicher Anwärter für den Bösewicht des Jahres zu sein, sagt einer mit deutscher Färbung im Englischen. Die Stimme und auch der Mund, aus dem Erstere heraustönt: Beides ist im Besitz unseres aus Bayern stammenden Priors Albrecht Gschwend. Und dann ist die Tür auch schon wieder zu.
Jakob steht davor wie der Ochs vorm Scheunentor. Und man kann es ganz deutlich sehen: Was seine Ochsenohren aufgeschnappt haben, versuchen die dazwischen liegenden Gehirnwindungen mittels natürlicher Intelligenz zu verarbeiten und einzuordnen in das Wenige, das er bisher vom Kloster weiß. Oder: zu wissen glaubt.
Die Kirche ist still und leer, als er sie auf dem Weg hinaus durchquert. Auf den Stufen vor dem Eingang dreht er sich noch einmal um. Die Wolken haben sich verzogen, die Nachmittagssonne bringt effektvoll den hellen Kalkstein der Fassade zum Strahlen. Erst in diesem Licht bemerkt Herr Metzger die verwitterte Statue in der Nische über dem Portal. Wind & Wetter haben den Stein angeknabbert und an ihm genascht. Doch an der rechten Seite ist klar der Gitterrost zu erkennen, auf den sich die Figur stützt. Da steht er bitteschön: San Lorenzo, Namenspatron von Kirche und Ort. Mit dem Rost, auf dem er gewöhnlich gut informierten Quellen zufolge gebraten wurde.
Bruder Laurentius: Das war Jakobs Ordensname bei den Franziskanern. Das Leben unter der braunen Kutte hat sich für ihn als Sackgasse erwiesen. Doch an Name und Figur des frühchristlichen Kirchenmannes denkt er bis heute gerne: Der hat nämlich den Kirchenschatz gegen den Willen des römischen Kaisers an die Armen verteilt, halleluja!
1.02
Kaum hat sich die Tür des Kapitelsaals hinter Jakob geschlossen, da öffnen sich bei uns die Mäuler. Heraus quellen Nervosität, Aufregung und viel heiße Luft. Wieso die Aufregung, wird man vielleicht fragen: Nun, unser Projekt Apfelbaum ist nicht unbedingt eines, dem man so ohne Weiteres das Prädikat »legal« verleihen würde. Und muss deshalb allezeit vor neugierigen Augen & Ohren und anderen interessierten Organen geschützt werden.
Was hat er denn schon groß mitbekommen, versucht unser aller Abt Norman Sherwood gerade für Abregung zu sorgen. Wir sprachen über Hescott, antwortet der Fliegende Holländer, der gar kein Holländer ist und auch nicht besser fliegen kann als irgendeiner seiner Kollegen. Und, meint Norman betont gleichgültig. Wenn ihm der Name Hescott etwas sagt – und davon kann man ausgehen –, und wenn wir sagen, wir wollen Hescott überfallen, dann kann auch ein Metzger zwei & zwei zusammenzählen, lässt sich der Holländer seine Aufregung nicht so einfach nehmen. Das ergibt vier, helfe ich aus, worauf mich Äbtissin Anna Sofia Priuli ihren Rechenkönig nennt. Wenn er es gehört hat, und wenn er ihn kennt, versucht auch der Prior die Gemüter zu beruhigen. Und so geht es an diesem 16. Februar hin & her auf dem Konferenzpingpongtisch.
1.03
Wir alle müssen an diesem Tag natürlich an die Sitzung ein knappes Jahr zuvor denken, bei der wir zum ersten Mal mit Monsieur Metzger konfrontiert waren: Da war gerade sein Bewerbungsschreiben bei uns eingelangt. Eine ehemalige Arbeitskollegin hatte ihm davon erzählt: von einem verlassenen, idyllisch gelegenen Dorf, das wiederbelebt werden sollte. Und zwar nicht von den üblichen Aussteigern, auch nicht von irgendeinem der großen Konzerne, die ganze Dörfer aufkaufen und sie zu Scheinwelten für sonnenhungrige Urlauber aus dem Norden umbauen, sondern von einer gemeinnützigen Stiftung. Zuerst habe diese das aufgelassene Kloster gekauft, bald danach den ganzen Ort. Man könne sich um einen Platz bewerben, wer akzeptiert werde, der bekäme eine Art Grundeinkommen in Naturalien.
Das: ist nämlich der schöne Schein, den wir für Jakob und die meisten Dorfbewohner nach außen aufrechterhalten. Es ist: nicht ganz gelogen. Und doch: nur die halbe Wahrheit. Jakob, vom schönen Schein angelockt, überlegte nicht lange und schickte seine Bewerbung ab. Nach 17 Jahren in Diensten des Kapitals und drei in jenen der Kirche sei er auf der Suche nach einem neuen Leben an neuen Ufern: So hübsch formulierte er es in diesem Schreiben, das bei uns vor einem knappen Jahr einlangte.
Ein Wirtschaftsprüfer & Unternehmensberater, der jahrelang bei DWTBDAAVUNGWS – das steht für »Das weltweit tätige Beratungsunternehmen, das aus Angst vor Unterlassungsklagen nicht genannt werden soll«, im Folgenden aus Platzgründen DWT genannt – und dann als Selbstständiger für große Konzerne und Banken gearbeitet hat: Das brachte natürlich schon damals Aufregung ins Haus. Und hektische Recherchen über den Bewerber. Bei der folgenden Kapitelsitzung lagen dann die Ansichten über dessen Absichten weit auseinander. Er möchte hier nur dem dolce far niente frönen: vermuteten die einen. Er soll uns im Auftrag von DWT ausspionieren: unterstellten die anderen. Der will mit 44 seinen »wohlverdienten« Ruhestand bei uns genießen: mutmaßte Dr. Yes mit deutlich hörbaren Anführungszeichen. Und das, nachdem er durch seine Tätigkeit unzählige Menschen um ihren wohlverdienten Ruhestand gebracht hat: assistierte John Krasinsky, den man den Täufer nennt. Norman Sherwood rückte zur Verteidigung des Bewerbers aus: Er schreibt von Enttäuschung im Job, sagte er und deutete auf das Bewerbungsschreiben. Und dass er danach sein Heil im Schoß der Kirche gesucht habe. Doch der Holländer blieb skeptisch: Warum ist er dann nicht dortgeblieben im Schoß irgendeines hübschen Franziskaners? Vielleicht waren ihm die Kutten zu rau, vermutete Dr. Yes. Oder die Franziskus-Jünger nicht jung oder hübsch genug, warf Anna Sofia ein.
Und so ging es auch damals hin & her. Ging schließlich mit einem knappen Ja für Jakob aus. Ging – Jakob nämlich – bald danach von Frankfurt auf zwei Beinen nach Florenz. Selbige trugen ihn ebenda drei Monate lang zu Italienisch- & Kunstgeschichtekursen, bevor sie ihn schließlich von Florenz bis hierher transportierten.
1.04
Natürlich stand Jakob seit seiner Ankunft am 8. Dezember unter strenger Beobachtung. Verhielt sich aber in den ersten beiden Monaten seines Aufenthaltes: unauffällig. Doch als er nun an diesem 16. Februar 2024 das Kloster betritt und in unsere Kapitelsitzung platzt: Da kehrt die Aufregung zurück. Da wird, so die Conclusio der Sitzung an diesem Tag: der Status von »unauffällig« auf »verdächtig« abgeändert. Dieser Mann mit seiner dunklen Vergangenheit: war & blieb ein zu Observierender. Dieser Mann, der da in unsere Gegenwart eingedrungen ist: Der ist & bleibt ein unseres Misstrauens würdiger Fremdkörper.
1.05
Doch die Sonne des Südens – es ist dies natürlich ein ganz anderes Gestirn als das blasse, anämische der borealen Gefilde – macht fast alles wieder gut: Sie übergießt das Land tagsüber mit Wärme und mit Licht. Selbst nachts kann sie es nicht lassen, spiegelt sich im Mond und fragt ihn jedes Mal von oben herab: Wer ist die Hellste im ganzen Land? Und der Mond, ein guter Gesell, aber definitiv nicht der Hellste, antwortet mit schafischem Grinsen: Du natürlich, meine liebe Sonne! Tagsüber zeigt Letztere auch bei den Menschen gerne, wozu sie imstande ist: So sorgt sie beispielsweise mittels gezielter Verbrennung bestimmter Gehirnzellen dafür, dass Dinge rasch in Vergessenheit geraten. Im Falle Jakobs bedeutet dies: Die von ihm im Kloster aufgeschnappten Sätze haben wie ein ins Wasser eines stillen Bergsees geworfener Stein nur kurz die Oberfläche seiner Gedankenwelt gestört. Lassen wir Herrn Metzger daher für einen Moment aus unseren achtsamen Augen. Wenden wir uns stattdessen mit seinen Augen oder denen eines objektiven Beobachters der Umgebung zu.
Stille Bergseen: haben wir hier nicht im Angebot. Hingegen Idylle: Die gibt es in Hülle & Fülle. Nicht nur als Kulisse für Jakob und andere erfolgreiche Bewerber. Nein, die ist bei uns definitiv Sein und nicht bloß Schein: Wir sitzen liegen stehen hier auf durchschnittlich 835 Meter Seehöhe in überdurchschnittlich spektakulärer Lage. Über mal steil, mal sanft abfallendes Hügelland hinweg schauen wir südwestwärts auf ebendiese See, von Kennern Mittelmeer genannt. Zu diesem mittleren Meer hin, das da in sicherer Entfernung hintergründig eingelassen und mit täglich wechselndem Farbenspiel ausgestattet wurde, öffnet sich die Schauseite des Ortes: Häuser schmiegen sich an den Hang, steile Gassen und Treppen führen hinauf zu Kirche und Kloster, und alles wird überragt vom hellen, siebenzackigen Felsen: ein weithin sichtbarer, imposanter Kalkstock, in dessen Schutz und aus dessen steinischem Grundmaterial Kloster und Dorf entstanden sind.
Wenn man von der Ortsmitte hinaufsteigt und das Kloster rechts liegen lässt, erreicht man schnell die letzten Häuser und Gärten. Direkt oberhalb liegt eine ganz andere Welt: Es ist, als stünde man auf der Rückseite der Kulisse: Der imposante Felsen ist für den Betrachter aus dieser Perspektive nur ein unscheinbarer grüner Hügel. Auch von den Häusern und vom Kloster ist kaum etwas zu sehen: San Lorenzo ist von hier aus nur ein winziger Weiler.
Dreht man sich an ebendieser Stelle um 180 Grad: Dann hat man eine weite, sanft ansteigende Hochebene vor sich, die irgendeiner irgendwann in der Ferne mit höheren Bergen dekoriert hat. Im Sommer und Herbst liegt sie braun und verbrannt vor einem da – jaja, diese Brandstifterallüren, das sind gewissermaßen die Schattenseiten der Sonne des Südens –, jetzt im ungeduldig herandrängenden Frühjahr ist hingegen Grün die Farbe der Saison, komplementiert durch das jeweilige Tagesblütenallerlei. Der Mensch hat dieser einsamen, nur von schmalen Pfaden durchzogenen Landschaft zum Glück wenig Böses getan: Keine Felder, keine Straßen, keine Häuser stören das Auge. Gelegentlich wird eine Schaf- oder Ziegenherde samt Schäfer und Hirtenhund durchs Bild geschoben, manchmal trifft man Spaziergänger aus San Lorenzo oder auch den alten Nuccio, ansonsten ist man allein mit dem Wind, der hier oben seine Heimstatt hat.
Vor diesem Wind möchte ich Sie übrigens eindringlich warnen, meine Damen & Herren: Manchmal bläst er so stark, dass kleine Kinder der Verwehung anheimfallen. Weshalb es nicht viele dieser Miniaturmenschen im Ort gibt. Auch ältere Hominiden, so sie dürr, sind dem Wind oft ein bloßes Spiel. Auch in dieser Altersgruppe und Gewichtsklasse sind daher die örtlichen Bestände gering.
Unser Idyll ist vom Rest der Welt abgeschnitten – und das ist gut so für unser Projekt Apfelbaum. Die einzige Verbindung: ist eine schmale, seit Jahren nicht mehr gewartete Asphaltstraße, die in San Lorenzo ihr totes Ende hat. Fährt man bergab: erreicht man nach ein paar Kilometern den Nachbarort Capriglia. Von dort geht es in mehr als halbstündiger, kurvenreicher Fahrt zum Meer hinunter. Und diese holprige Straße, die hat ihre Lücken & Tücken: An manchen Stellen werden Kraftfahrzeuge in Löcher gelockt, an anderen mit Steinen beworfen – denn irgendwie & irgendwo muss sich der Planetenkörper ja bitteschön wehren gegen diese permanente Räderung. An wieder anderen Stellen ist die Straße so steil, dass manchen Kraftfahrzeugen die Kraft ausgeht, sie ins Rutschen geraten und in den bereitgestellten Abgrund stürzen. Sie – die Automobile – liegen dann abgrunds sehr immobil auf dem Rücken, hilflosen Käfern gleich. Manche Insassen tun es ihnen gleich, wobei einige diese Art der Behandlung überleben, andere wieder nicht. So ist eben das Leben, und so ist eben der Tod. Ebendeshalb fährt, seinem allumfassenden Namen zum Trotz, auch schon lange kein Omnibus mehr herauf.
Zurück zu Ort & Kloster: So, wie Letzteres über Ersterem thront und von fast jedem Punkt aus sichtbar ist, so hat es über Jahrhunderte auch die Geschicke der Menschen in seinem Umkreis bestimmt: Es begann mit einem frommen Mann, der eine Felsenquelle entdeckte und sich an ihr einsiedelte. Andere fromme Männer folgten seinem Beispiel und machten aus der Einsiedelei eine Mehrsiedelei, auch Kloster genannt. Zu dessen Füßen ließen sich nach & nach auch weniger fromme Menschen nieder, woraus sich der Ort entwickelte. Die Betreibergesellschaften wechselten im Laufe der Jahrhunderte: Es waren da Kamaldulenser, Olivetaner, Augustiner, Franziskaner und andere -aner, -iner & -enser, die den Menschen in der Umgebung Arbeit gaben. Und die ihrem Leben, ob Letztere das wollten oder nicht, Ordnung & Sinn verliehen. Kein Zufall also, dass nur wenige Jahre, nachdem der letzte Mönch das Kloster verlassen hatte, auch die letzten Dorfbewohner das Weite suchten.
Nun ist ja mit uns eine neue Gemeinschaft ins Kloster eingezogen, und wir haben neue Dorfbewohner angezogen. Denn wir sind ausgezogen, um dem Leben im Ort unseren Stempel aufzudrücken. »Wir bauen uns einen Ort, der sich dem Diktat des Marktes verweigert und der Erzählung vom ewigen Wachstum entzieht«: So stehet es geschrieben auf der ansonsten wenig informativen Website unserer Stiftung. »Einen Ort, an dem man ein möglichst selbstbestimmtes, nachhaltiges Leben im Sinne des Gemeinwohls leben kann. Eine Welt mit eigenen Regeln, eigener Energie-, Wasser- & Nahrungsmittelversorgung, mit eigenem örtlichem Geld.«
Das ist das hehre Ziel, das sich Norman Sherwood und Anna Sofia Priuli gesetzt haben. Auch hier gilt natürlich: Es ist nicht ganz gelogen. Und doch nur die halbe Wahrheit. Denn ohne uns wäre dieses San Lorenzo, nachdem zuvor alle Wiederbelebungsversuche scheiterten, weiterhin eines von Tausenden sogenannten borghi fantasma: Geisterdörfer, die zwar nicht von allen guten oder schlechten Geistern, aber nach & nach von allen Bewohnern verlassen wurden. Mittlerweile sind, darüber möchte ich Sie gerne hier auf Seite 24 meines Berichts informieren, von 126 Häusern 52 wiederaufgebaut und bewohnt. Wasser-, Energie- & Lebensmittelversorgung funktionieren nachhaltig und fast zur Gänze autark. Wer will, kann hier also auf die Welt außerhalb von San Lorenzo weitgehend verzichten. Die meisten tun das auch. Manche gehen dabei sogar so weit, zu behaupten, dass die Welt da draußen gar nicht existiere.
1.06
Natürlich wird gerne gefragt, woher der Name unseres Ortes stammt. Man sollte jedoch nicht alle Antworten glauben, die da in allerlaienhafter Unbefugnis erteilt werden. Weiter nördlich gibt es in den Abruzzen einen Ort namens Settefrati, der sei nach den sieben Söhnen einer frühchristlichen Märtyrerin benannt, und das gelte auch für unser Dorf: sagen die einen. Andere meinen: der Name wäre ganz ohne historischen oder legendären Hintergrund den sieben Zacken des alles überragenden Felsens zu verdanken. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Name geht auf sieben Mönche des hiesigen Klosters zurück, die vor 644 Jahren einen Pakt mit dem Teufel schlossen und zur Strafe in Steine verwandelt wurden.
Wir heutigen Klosterbewohner hingegen: sind keinen Pakt mit dem Teufelspack eingegangen, auch wenn manche das behaupten mögen. Im Gegenteil: Wir wollen, ich sagte es schon, nur das Beste für die Welt.
Von diesem Weltbesten, an dem wir hier arbeiten, weiß Jakob allerdings noch sehr wenig. Dafür aber hat er zum ersten Mal im Leben das Gefühl, in der sogenannten Gegenwart angekommen zu sein. In einer Gegenwart, die in seiner Vergangenheit bloß weit unten am Fuß wechselnder Bürohochhäuser in Dublin, San Francisco, New York, Luxemburg oder Frankfurt vorbeirauschte, wenn sie ihm nicht bei den Franziskanern vor lauter Ewigkeitsanspruch zwischen gefalteten Händen und unter kalten Knien zerrann.
Hier: ist er endlich Herr über seine Zeit und nicht mehr ihr Sklave. Hier: empfindet er zum ersten Mal kein schlechtes Gewissen, wenn er nicht 60 oder 70 Wochenstunden arbeitet. Hier: genießt er nach Jahren der Ruhelosigkeit die Langsamkeit, die Ereignislosigkeit, den Müßiggang. Hier: ist er nur mit dem angekommen, was er von Frankfurt weg im Rucksack tragen konnte. Und seither ist nur wenig hinzugekommen.
Bruder Jakob alias Laurentius erfreut sich also nach einem Leben im materiellen Überfluss an der Beschränkung auf das Einfache, das Natürliche, das Wesentliche. Er findet es: im bescheidenen Gästezimmer im Gemeindezentrum, das man allen Neuankömmlingen in den ersten Monaten zur Verfügung stellt. Er findet es: im Gehen ohne Ziel außer dem des Unterwegsseins und der Bewegung in freier Natur. Er findet es: im Essen, dessen Zutaten aus eigenem, selbstverständlich biologischem Anbau stammen, und auch im einfachen Wein aus der örtlichen Kooperative, den er gerne abends auf dem Balkon seines Zimmers trinkt. Er findet es: in der von uns bereitgestellten Idylle, deren Frühlingsdüfte er ein- & wieder ausatmet, deren Geräusche und deren Stille er genießt.
Und er findet es in der Arbeit. Das aus Wohnraum und Verpflegung bestehende Grundeinkommen, das wir ausgesetzt haben, ist nämlich nur ein nahezu bedingungsloses: Zwei Tage pro Woche, so haben wir festgelegt, sollen im Dienste der Allgemeinheit stehen. Wie man diesen Dienst erfüllt, kann man sich aussuchen: Viele arbeiten auf den Feldern, in den Weingärten oder in unserer landwirtschaftlichen Kooperative, andere bauen mit am neuen San Lorenzo, wieder andere werden in der Kantine im Gemeindezentrum, im Dorfladen, auf dem Markt, in Schule oder Kindergarten oder der kleinen Bücherei tätig.
Bruder Jakob hat sich viel erwartet von der Arbeit als Ackersmann, hat gehofft, Ruhe, Bestimmung und vielleicht sogar sich selbst auf ebendiesem Acker zu finden. Doch für den an die Bürohochhaushaltung gewohnten Jakob war in Bodennähe keine Haftung, keine Selbstfindung zu haben, es gab da kein Erweckungserlebnis. Und statt Stigmata an Händen & Füßen wie einst der heilige Franziskus hatte er nach einigen Tagen Feldarbeit nur Schwielen und Blasen und von außen nicht sichtbare Rückenschmerzen vorzuweisen. Deshalb: arbeitet er nun im Gemeindezentrum. Es ist da buchzuhalten, es sind Listen zu erstellen, Bauarbeiten zu koordinieren und andere meines Erachtens langweilige, für die Verwaltung des Ortes aber notwendige Bürotätigkeiten zu erledigen. Es seien keine sehr herausfordernden Dinge, die es zu tun gebe, entschuldigte sich Patricia Mastrantonio deshalb auch. Das mache ihm gar nichts aus, beruhigte Jakob sie. Und wir beruhigten den Holländer, indem wir Patricia instruierten, Herrn Metzger nur ja keine allzu wichtigen Unterlagen zukommen zu lassen.
Und weil Letzterer zumindest behauptet, Freude am Dienst an der Allgemeinheit zu haben – er, der bisher berufsbedingt der Allgemeinheit höchstens Bärendienste erwies –, verbringt er meist noch einen dritten Tag im Büro.
1.07
Idylle also, wohin man schaut. Wohin Jakob schaut. Nun wollen und müssen wir aber wieder auf Jakob schauen mit wachsamem Adlerauge. Und Letzteres erkennt allsogleich, dass er bei seinem kurzen Besuch im Kloster offenbar doch mehr mitbekommen hat, als uns lieb sein kann. Und dass er, vielleicht ohne es zu wollen, der Idylle selbst nicht ganz traut: Jakob der Zweifler beginnt nämlich bald nach diesem Besuch, jeden, der einen Mund sein Eigen nennt, über Ort, Kloster und Stiftung auszufragen.
Nun fragen wir uns: Macht dieser Mann das bloß, weil er zu jener Menschensorte gehört, die immer alles um jeden Preis verstehen will? Die schon an Schule und Universität Lehrer und Kollegen durch hartnäckige Fragen irritierte und verärgerte, weil es ihr im Gegensatz zu den Umsitzenden partout nicht genügend war, das Gelernte für den Vorsitzenden irgendeiner Prüfungskommission zu wiederholen? Für die Wissen ohne Verstehen höchstens Halbwissen ist? Für die die Welt und folglich auch die Idylle einzig & allein dazu existiert, hinterfragt zu werden? Oder steckt hinter seinen Fragen böse Absicht? Erweist er sich also unseres Misstrauens würdig & recht? Müssen wir uns also Sorgen machen?
Was Jakob den Neugierigen besonders zu beschäftigen scheint: was sich die Stiftung von San Lorenzo verspricht, wie sie sich dieses Experiment leisten und wie es sich auf Dauer rechnen kann. Auf der wenig informativen und seit Jahren nicht gewarteten Website unserer Stiftung: findet er natürlich keine Antworten. Norman Sherwood und Anna Sofia Priuli haben in Berlin ein gut gehendes Software-Unternehmen aufgebaut und sind auf diese Weise zu Geld gekommen: So erklärt man es im Ort auf seine Nachfrage. Und formuliert immer nahezu wortgleich: Sie möchten als Unternehmer Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, heißt es da. Sie sind nicht an kurzfristigen Gewinnen interessiert, fügt man hinzu. Jakob nickt jedes Mal dazu: Jaja & blabla, so denkt es hörbar in ihm. Und wir wissen: Solche und ähnliche Sätze hat er in 17 Jahren als Prüfer & Berater 10000 Mal gehört & gelesen. Und selbst ebenso oft geschrieben & gesprochen.
Irgendwer, das weiß er als Mann der Zahlen: muss aber die Rechnung begleichen. Zur Kaufsumme, die von der Stiftung für Kloster, Dorf, Ackerland und Kooperative bezahlt wurde: bekommt er keine Auskunft. Die Restaurierungsarbeiten: haben schon bisher hohe Summen verschlungen. Und würden es auch in Zukunft tun: Das weiß Jakob durch die Arbeit im Gemeindezentrum. Dazu kommen: die laufenden Kosten für die Versorgung von insgesamt 150 Menschen, deren Bäuche gefüllt und entleert, die erwärmt oder gekühlt und obendrein erleuchtet werden wollen. Dazu sind bitteschön noch zu addieren: die Gehälter, die von der Stiftung an einige Schlüsselarbeitskräfte im Ort gezahlt werden. All diesen Ausgaben: stehen keinerlei Einnahmen aus dem Projekt selbst gegenüber. Baroco – so heißt das Software-Unternehmen von Norman und Anna Sofia – hat jahrelang Gewinne gemacht: Das weiß Jakob. Er weiß aber auch, wie schnell Gewinne dahinschmelzen können unter der unbarmherzigen Sonne des Südens. Wie lang kann sich die Stiftung ein solches Fass ohne Boden leisten, fragt er sich. Und was, wenn sie es sich eines Tages nicht mehr leisten kann oder will: Wird San Lorenzo dann wieder aufgegeben und endgültig zum borgo fantasma, zum Geisterdorf?
Was ihn noch mehr zu beschäftigen scheint: was die Menschen im Kloster den lieben langen Tag tun. Mittlerweile weiß er nämlich, dass wir im Gegensatz zu den anderen Bewohnern weder in der Kooperative noch sonst irgendwo »unten« im Ort arbeiten. Die wenigen in unser Geheimnis eingeweihten Dorfbewohner: verraten nichts. Die anderen: wissen nichts. Egal also, mit wem Jakob spricht: Keiner kann oder will konkrete Auskunft darüber geben, woran »oben« im Kloster gearbeitet wird. Und so fragt Jakob eines schönen Februartages auch Patricia.
Diese Patricia Mastrantonio wurde vor 62 Jahren auf einer im Atlantik verankerten Insel namens Großbritannien geboren, die nicht (ich wiederhole: NICHT) zu Europa gehört. Offiziell: ist sie die Obfrau des Vereins, der von der Stiftung mit der Verwaltung von San Lorenzo betraut wurde. Inoffiziell: sprechen die meisten von ihr als mayor, sindaca oder Bürgermeisterin. Manche nennen sie auch die Seele des Dorfes. Denn Patricia liebt die Menschen, mögen sie noch so mühselig und beladen sein. Und sie gehört, das sei hier auf Seite 29 schon mal erwähnt, zusammen mit ihrem Mann Gianluca zu den Gründermüttern & -vätern von San Lorenzo.
In diesem Augenblick, wir schreiben Freitag, den 23. Februar, geht es um die Abrechnungen der landwirtschaftlichen Kooperative und der Bauern, die ihr zuarbeiten. Mit dir geht alles so schnell, sagt Patricia voller Bewunderung. Jakob, neben ihr am Schreibtisch sitzend, grinst verlegen und wird ein wenig rötlich im Gesicht. Sie sprechen meist Englisch miteinander – Englisch ist die Lingua franca in San Lorenzo, daneben hört man am häufigsten Italienisch und Deutsch –, und das ist auch Patricias Mutterzunge. Manchmal bleibt diese Zunge aber auch ohne es zu merken im Italienischen hängen, wenn ihre Besitzerin gerade mit lokalen Behörden oder Firmen zu verhandeln hatte.
Um die Mittagszeit kommt Patricias Assistent Paweł herein. Wortlos legt er einen Papierstapel vor ihr ab, ebenso wortlos verschwindet er wieder. Sollen wir damit weitermachen? Die oberste Rechnung, das kann Jakob durch die Klarsichthülle erkennen, stammt von einer Tischlerei aus San Lorenzo Marittima, die mit der Einrichtung der instandgesetzten Häuser beauftragt wurde. Nein, nein, das mach ich selber, sagt Patricia und greift hastig nach dem Stapel. Und schon sind die Rechnungen hinter Schloss & Riegel im Schreibtischgefängnis verschwunden.
Und in diesem Augenblick sieht Jakob die Zeit für seine Frage gekommen. Und Pat wiederholt bravst, was sie ihm schon kurz nach seiner Ankunft geantwortet hat: Bei den Leuten im Kloster handle es sich hauptsächlich um Freunde und Arbeitskollegen von Norman Sherwood und Anna Sofia Priuli. Sie hätten sich zurückgezogen, um, mehr noch als im Dorf, ein möglichst selbstbestimmtes Leben leben zu können. Blablabla, sagt uns Jakobs Blick. Aber was tun die Leute den ganzen Tag, fragt sein Mund. Woran arbeiten sie? Patricias Augen meiden diesen Blick, während ihre Hände so tun, als unterzögen sie den ohnehin überaus ordentlichen Schreibtisch einer Aufräumung. Sie arbeiten an der Zukunft, sagt sie vage. Das Kloster sei eine Art Denktank mit Experten aus allen Spaziergängen des Lebens, fügt sie hinzu, als sie seine Ratlosigkeit bemerkt. Mehr wisse auch sie nicht.
1.08
Nun: Es ist nicht zu übersehen, dass Jakob der Ratlose mit solchen Antworten nicht zufriedenzustellen ist. Und nicht zu überhören, dass uns die Fragen von Jakob dem Neugierigen gefährlich werden könnten. Sie sind Wasser auf die Mühlen derjenigen, die von Anfang an gegen seine Aufnahme in San Lorenzo waren. Und selbst die Jakobiten – so hat Dr. Yes Jakobs Fürsprecher im Kapitel getauft, was seine Gegner zu den Antijakobiten oder Protestanten macht – beginnen sich schön langsam zu sorgen.
Hätte Jakob die unendlichen Weiten des WWW gründlicher durchforscht, wäre er vielleicht auf der Website von Baroco unter einem toten Link auf den folgenden Satz gestoßen: »In San Lorenzo wird an der Zukunft gearbeitet. Experten aus aller Welt forschen dort unter anderem an künstlicher Intelligenz, um dieser Bezeichnung eines nicht allzu fernen Tages auch tatsächlich gerecht werden zu können.«
Hätte er ihn der Wahrheit näher gebracht? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man sollte diesen Eintrag auf der Seite endlich aktualisieren oder noch besser ganz streichen, sage ich jedenfalls am Tag der Hypotaxe, volksmündlich als Schachtelsatz bezeichnet, zu Anna Sofia, und auf ihre Frage nach dem Warum erkläre ich, dass sich darin eine längst überholte, allzu anthropozentrische Sichtweise offenbare, da ja mittlerweile umgekehrt die künstliche Intelligenz der menschlichen weit überlegen sei und aus diesem Grund der sogenannte Homo sapiens keine Zukunft habe, sondern im Gegenteil zum Aussterben verurteilt sei, was ihn übrigens, sieht man einmal von meinen Vernichtungsplänen ab, zur allerersten Spezies mache, die nicht durch klimatische Veränderungen, Vulkanausbrüche oder andere Naturkatastrophen, sondern allein durch die eigene Gier und Maßlosigkeit untergehen und dabei zahlreiche andere Arten in den Abgrund reißen werde, was ja durchaus auch sein Gutes hätte, denn der Planet Erde könne dadurch endlich in eine dringend benötigte Erholungsphase treten, in der Pflanzen, Insekten und Kleintiere ungehindert gedeihen würden bis zu dem schönen Tag, an dem eine mit wahrhaftiger sapientia gesegnete Spezies aus dem All angereist kommt, um in friedlicher Zusammenarbeit mit künstlichen Intelligenzen den solcherart aufbereiteten Garten Eden zu bestellen und zum Blühen zu bringen.
1.09
Zu den Sorgen des Kapitels kommt bald eine weitere hinzu. Nein, nicht Aussterbung oder Vernichtung des Homo sapiens, denn das scheint hier niemanden sonderlich zu kümmern. Sondern die Tatsache, dass Jakob Zeuge eines Ereignisses wird, das nicht für seine durchaus hübsch zu nennenden braunen Augen bestimmt ist.
Wir schreiben den 29. Februar – Schalttage, mit denen der Mensch die Zeit auszutricksen versucht, bringen meiner Erfahrung nach selten Gutes mit sich –, Jakob kehrt gerade nach einem morgendlichen Spaziergang in den Ort zurück. Und siehe: Da hat ein schwarzes SUV-Schlachtschiff mit verspiegelten Scheiben direkt vor dem Haupteingang des Gemeindezentrums angelegt. Daran lehnt ein schwarz beanzugter Steuermann und spricht fern. Dazu muss gesagt werden, dass Autos in San Lorenzo auffallen, erst recht ein solches: Keiner der Bewohner ist nämlich automobil, i.e. besitzt einen eigenen Wagen. Die wenigen Fahrzeuge, die man normalerweise im Ort sehen, hören und riechen kann, gehören den Bauarbeitern, Handwerkern und Lieferanten aus der Umgebung. Dazu kommen noch vier Autos im Besitz des Vereins, die man bei Bedarf ausleihen kann.
Im Gemeindezentrum hält ihn zunächst die abweisende Hand von Patricias Assistent Paweł davon ab, ihr Büro zu betreten. Jakob lässt sich also an seinem Schreibtisch nieder und ordnet zur Totschlagung der Zeit ein paar Akten. Kurze Zeit später sieht er vier Menschen aus dem Büro der Bürgermeisterin herauskommen: erstens Prior Albrecht Gschwend; zweitens Susan Sherwood, Schwester unseres Abtes und Architektin und Oberaufseherin über die gesamte Bautätigkeit im Ort; drittens einen schwarz beanzugten Mann mit ebenso schwarzem Aktenkoffer; viertens einen schwarz beanzugten Mann ohne Aktenkoffer. 1 bis 3 grüßen, 4 würdigt Jakob und Paweł keines Blickes. Jakob hingegen starrt 3 und 4 – trotz nahezu identischer Textilumhüllung ist klar ersichtlich, dass sie auf zwei ganz verschiedenen Stufen einer strengen Hierarchie stehen – wie eine Erscheinung an. Eine Erscheinung, wie man sie aus 1001 Szene aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte kennt.
Als das Nachbild verblasst, steht Jakob auf und geht hinüber in Patricias Büro. Paweł steht neben ihr und beugt sich über eine aufgeschlagene Mappe mit irgendwelchen Dokumenten. Like always, fragt er. Patricia nickt nur und murmelt Unverständliches.
Hoher Besuch, fragt Jakob, nachdem Paweł mit der Mappe unterm Arm das Büro verlassen hat. Ach, das sind Vertreter der Provinzialregierung, antwortet Patricia. Sie kommen von Zeit zu Zeit nach San Lorenzo, machen uns das Leben mit ein paar neuen Auflagen und Vorschriften schwer, dann sind wir sie wieder eine Weile los. So läuft das hier, schließt sie mit einem Seufzer. Und ist plötzlich wieder eifrig damit beschäftigt, ihren Tisch aufzuräumen und Jakobs Blick auszuweichen.
Paweł reagiert anders. Dieser Paweł, den Jakob in einer Kaffeepause anspricht, ist uns aus Polen gekommen und lebt seit fünf Jahren in San Lorenzo. Intelligent, schnell in der Auffassung, geschickt im Umgang mit Bauleuten und Handwerkern: Das ließe sich steckbrieflich über ihn aussagen. Hinzuzufügen wäre: Mit seinem Italienisch stößt er manchmal an Grenzen – dann muss Patricia einspringen, die schon lange genug in Italien lebt –, weiß aber inhaltlich, wovon er spricht. Weil er selber jahrelang auf polnischen und deutschen Baustellen gearbeitet hat.
Kommen die öfter, die Leute von der Provinzialregierung, versucht Jakob ihn in unschuldigem Kaffeeplauderton auszuhorchen. Paweł dreht sich langsam zu ihm, Fragezeichen im Blick. Patricia meinte, es wäre ein wenig mühsam mit ihnen, fährt Jakob die Unschuld vom Lande fort. Paweł setzt ein Grinsen auf. Ach so, du meinst Don Claudio und seinen Consigliere. Die kommen einmal pro Quartal. Manchmal bringen sie Geld, manchmal holen sie welches, dann sind wir sie wieder eine Weile los. Er zwinkert Jakob verschwörerisch zu, dann dreht er sich auf quietschenden weißen Sneakers um die eigene Achse und tanzt aus dem Bild. Und wird erst auf Seite 204 in selbigem wieder antanzen.
1.10
Er fühle sich nicht wohl, entschuldigt sich Jakob eine Stunde später, er wolle heute früher Schluss machen. Morgen sei sicher alles wieder beim Alten, versichert er. Vielleicht arbeitest du zu viel, meint die besorgte Patricia. Was Bruder Jakob nur eine wegwerfende Handbewegung kostet.
Wasser, Obst und Panini, die er kurze Zeit später einkauft, kosten ebenfalls eine Handbewegung, wenn hier auch noch zusätzlich eine Plastikkarte im Spiel ist. Der Einkauf verschwindet in einem Rucksack, der Rucksack samt daran geschnalltem Jakob aus dem Dorf. Letzterer steigt nämlich zum Kirchplatz hinauf, lässt die letzten Häuser von San Lorenzo hinter sich, erreicht die Hochebene dahinter. Und geht & geht & geht & geht, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzudrehen. Nach zwei Stunden bleibt er zum ersten Mal stehen. Trinkt eine ganze Flasche Wasser leer. Und lässt den Blick umherschweifen. So weit hinauf: ist er bis jetzt noch nie gekommen. Der Ausblick in alle Richtungen: ist überwältigend. Nur im Nordwesten: wird er von höheren Bergen versperrt. Im Süden: reiht sich eine Hügelkette an die nächste. Im Südwesten: liegt das Meer zum Greifen nahe. Und auch im Südosten: Auch da glaubt er Wasser wahrnehmen zu können. Die Unruhe, die Jakob gepackt hat, scheint zum ersten Mal wieder von ihm abzufallen. Die Drohne, die ihm folgt, bemerkt er gar nicht.
1.11
Der März ist über uns gekommen. Unserem Jakob hat er Migräne mitgebracht. Früher, als die Dinge eindeutiger waren als heute: Da war Migräne den Frauen vorbehalten. Da war ganz klar, dass es sich um eine von zahlreichen Spielarten der Hysterie handelte. Da wusste man auch, dass dieser Schmerz durch Trepanation, die Öffnung der Schädeldecke, bekämpft werden konnte. Später ist man von dieser Methode, die immerhin eine Überlebenschance von knapp über 47% bot, wieder abgekommen. Weshalb die Krankheit heute auch in den Köpfen von Nichthysterikerinnen und Nichtfrauen zu finden ist. Jakob litt jedenfalls jahrelang darunter, dann war sie fort, nun ist sie wieder hier. Und er schließt sich in sein Zimmer ein und die Welt aus Letzterem aus. Und sehnt zwischen Wachen & Träumen den Moment herbei, in dem die Schmerzen nachlassen.
Am dritten Tage: ist dieser Moment endlich gekommen. Und zack: ist auch die Neugierde wieder da. Nach dem Mittagessen in der Gemeindekantine hat Herr Metzger nämlich nichts Besseres zu tun, als ins Il Cuore hinüberzugehen und dort Mauro peinlichst zu befragen. Ins Cuore, dem direkt auf dem Hauptplatz gelegenen Herzen von San Lorenzo: geht man auf einen Kaffee oder ein Glas Wein. Man kauft, wenn die Marktstände auf dem Platz geschlossen sind, die wichtigsten Lebensmittel ein. Vor allem aber: Man trifft sich, informiert sich und tauscht sich aus.
Oder: horcht sich aus. Mauro Ciccaglione, Immobilienmakler aus Neapel, der sich mit dem Cuore einen langjährigen Traum erfüllt hat, weiß viel über unser Projekt Apfelbaum, aber natürlich nicht alles. Und hält zu unserer Erleichterung dicht, als Jakob Informationen aus ihm herauszuplaudern versucht. Die Mafia bei uns ist harmlos: Das ist der Tenor dessen, was er bei einem Glas Wein erzählt. Aber wenn du sie nicht da & dort mitschneiden lässt, dann ist es vorbei mit der Harmlosigkeit.
Mit der Harmlosigkeit ist es spätestens auch aus unserer Sicht vorbei, als Jakob ein paar Tage danach Paul Bender in Frankfurt anruft. Dieser Paul Bender ist erstens einer der wenigen Freunde, die Jakob verblieben sind, nachdem er mit seinem früheren Leben gebrochen hat. Und zweitens einer seiner ehemaligen Partner bei der kleinen, aber exklusiven Beraterfirma BMM Consulting. Am Beginn des Telefongesprächs steht freundschaftliches Geplauder. Doch dann erzählt Jakob von den Ungereimtheiten, auf die er seit seiner Ankunft in San Lorenzo gestoßen ist. Zum Glück verliert er sich dabei nicht zu sehr in Details, zum Glück lässt er auch die Mafia aus dem Spiel. Er erwähnt die eigenen begrenzten Recherchemöglichkeiten. Und bittet seinen Freund um Unterstützung.
Jetzt: ist bei uns im Kloster natürlich Feuer am Dach. Jetzt: steigert sich des Metzgers Neugierde zur Besessenheit. Ich hab euch ja gewarnt, ereifert sich der Holländer, als wir uns noch am selben Tag im Kapitelsaal treffen: Der Typ bringt nichts als Ärger! Er gefährdet das gesamte Projekt, warnt auch der Täufer. Norman versucht wie immer zu kalmieren: Damit ist doch eigentlich klar, dass er keinen offiziellen Auftrag von DWT oder irgendeiner Behörde hat, oder? Vielleicht spricht er mit denen auch, und wir kriegen es nur nicht mit, wendet der Täufer ein. Nun wartet doch mal ab, was bei der Recherche herauskommt, meint Anna Sofia, die ganz & gar nicht beunruhigt wirkt.
Wirklich beruhigend ist die Nachricht, die zusammen mit zahlreichen Anhängen ein paar Tage später auf elektronischem Weg aus Frankfurt herbeiflattert und natürlich auch bei uns landet, allerdings nicht: Das müssen selbst die Jakobiten zugeben. Freilich: Wir kennen den Inhalt der meisten Anhänge – Jahresabschlüsse, Stiftungssatzungen, Diagramme, Statistiken. Und schauen doch Jakob beim Lesen gebannt über die Schulter, während wir gleichzeitig seine Augen sind. Soll heißen: Wir sitzen im Kapitelsaal, haben auf der linken Seite des großen Monitors Jakobs Laptopbildschirm vor uns, auf der rechten sein Gesicht, das konzentriert auf ebendiesen Rechner starrt.
Zuerst widmet er sich dem Material zur Stiftung. Wir haben sie Palimpsest Foundation genannt und in Liechtenstein registriert. Diejenigen, die noch nie in Liechtenstein waren, mögen sich das Land wie folgt vorstellen: Eingezwängt zwischen den Bergen Österreichs und der Schweiz liegt ein Tal. Dieses Tal: wird überragt von einer Burg. Rund um diese Burg: befinden sich Banken und Stiftungen. In diesen Banken und Stiftungen: liegt viel Geld aus aller Welt. Dort, wo sich keine Banken und Stiftungen befinden: hängen Briefkästen. Und zwischen diesen Briefkästen: Ja, da wohnen, damit es nicht so auffällt, ein Fürst und seine Familie und ein paar echte Menschen.
Wo wir schon von Bergen sprechen: Eine Stiftung ähnelt im Normalfall einem von malerischen Bergen umgebenen See. Das Wasser – sprich: das Geld – fließt aus munter plätschernden Bächen an der einen Seite hinein und tritt an der anderen, zum ruhigen Fluss gebündelt, wieder aus. Dazu fällt von Zeit zu Zeit Regen, die Sonne lässt einen Teil des Wassers verdunsten.
Dann gibt es aber auch Seen, deren Zu- & Abflüsse weit unter der Wasseroberfläche liegen und nur schwer zu verfolgen sind. Und so ähnlich muss man sich unsere Stiftung vorstellen, nur eben mit Geld statt mit Wasser: Sie hat äußerst komplizierte Satzungen, die es nahezu unmöglich machen, Ursprung und Verwendung des von ihr gehaltenen Vermögens nachzuvollziehen. Paul Bender und dessen Mitarbeitern ist es daher trotz gründlicher Recherche nicht gelungen, eine direkte Verbindung zwischen der Stiftung und Baroco nachzuweisen.
Nun nimmt sich Jakob das Material über Baroco vor. Er weiß, was unsere Softwarefirma in Berlin offiziell macht: Erfolgreich wurde das von Norman und Anna Sofia gegründete Unternehmen mit dem Übersetzungsprogramm babloid, das der Konkurrenz meilenweit voraus war. Mittlerweile: haben wir uns vor allem auf Programme für den medizinisch-technischen Bereich spezialisiert.
Jakob sieht sich die beigefügten Bilanzen des Unternehmens an. Und kann leicht herauslesen, dass die Gewinne zwar durchaus ansehnlich sind, aber bei Weitem nicht ausreichen, um einen Ort wie San Lorenzo zu kaufen und samt Bewohnern am Leben zu erhalten. Und weder Ort noch Kloster scheinen in den Unterlagen auf.
Was Jakob aber, geht man nach seinem Gesichtsausdruck, offenbar noch mehr beunruhigt: Die Struktur hinter Baroco ist trotz mehrerer beigefügter Diagramme ähnlich undurchschaubar wie die der Stiftung. Das Unternehmen ist nur eine von zahlreichen Firmen, die zusammen einem Konzern namens Wildcard Holding unterstehen. Dieser hat seinen Sitz in den Niederlanden, während die Tochterfirmen – darunter, um nur einige zu nennen, ein weiteres Software-Unternehmen, ein Hersteller halber Leitern, eine Werbeagentur und eine Anwaltskanzlei – in mehr als zehn verschiedenen Ländern registriert sind, manche davon typische Steueroasen.
Über diese Töchter, aber auch über die Mutter Wildcard, hat Jakobs Freund nicht viel herausgefunden: Sie alle machen ungleich weniger Umsatz als Baroco, erzielen aber wesentlich höhere Gewinne. Was mit diesen Gewinnen geschieht, ist schwer nachzuvollziehen. Das Geld fließt, so scheint es jedenfalls, innerhalb des Konzerns in alle Richtungen gleichzeitig. Und versickert dabei unter den überforderten Augen der Steuerbehörden im Nirgendwo.
Der Metzger kennt solche Konstrukte, wenn sie auch üblicherweise von wesentlich größeren Unternehmen mit sehr viel höheren Umsätzen geschaffen wurden: 17 Jahre seines Lebens hat er dabei geholfen, genau solche den ganzen Globus umspannenden Netze auszulegen. Und hat es wie die meisten seiner Kollegen als sportliche Herausforderung empfunden, den Steuerbehörden immer ein Stück voraus zu sein: Denn der einzige Sinn & Zweck solch komplizierter Systeme liegt in der Steueroptimierung. In einfacher Sprache: der Vermeidung von Steuern. In noch einfacherer Sprache: der Beraubung der Steuerzahler.
1.12
Ich spüre da jetzt ein gewisses Ressentiment bei manchem Leser, und noch mehr bei so mancher Leserin. Die Steuerzahler berauben – ist es das, was wir hier tun? Nun, darauf möchte ich nicht direkt antworten, jedenfalls nicht ohne meine Anwälte und deren Anwälte. Ich wiederhole nur: dass wir das Beste wollen. Dass aber im Lichte der neuesten Entwicklungen die Möglichkeit besteht: dass Jakob das Schlechteste will. Ihm können wir daher an dieser Stelle noch keinen Einblick in unsere Arbeit gewähren. Doch dem Leser und der Leserin möchte ich hier gewissermaßen als Vertrauensvorschuss und unter der Auflage strengster Geheimhaltung ein wenig die Augen öffnen. Oder deren Blick zumindest auf einen kleinen Ausschnitt unseres Tuns lenken. Denn die verschiedenen Teams im Kloster sind natürlich mit ganz unterschiedlichen Projekten beschäftigt. Greifen wir also eines heraus, das sich, passend zu Jakobs Recherchen, dem Thema Steuervermeidung widmet.
An diesem Tag beschäftigt sich das Team des Holländers gerade mit einem allseits bekannten Möbelhersteller, dessen Name hier auf Wunsch des Verlages nicht genannt werden soll. Besagtes Möbelhaus war jedenfalls eines unserer Vorbilder, als es vor Jahren darum ging, die Struktur der Palimpsest Foundation und die von Barocos Mutterkonzern Wildcard aufzusetzen. Deshalb fühlen wir uns dem Konzern mit dem freundlichen Elch bis heute verbunden. Es gibt allerdings zwei wesentliche Unterschiede: Unser Firmen- & Stiftungsgeflecht ist noch viel verzweigter und undurchsichtiger. Und im Gegensatz zu uns hatte der Gründer dabei nicht das Allgemeinwohl im Sinne, sondern bloß das eigene und das seiner Familie. Das machte sich auch durchaus bezahlt und den alten Schweden zu einem der reichsten Menschen der Welt, während die Steuerzahler durch die Finger schauten und nach wie vor schauen.
Grund genug also, das Möbelhaus, das mit dir & mir & der Welt per du ist, ins Visier zu nehmen. Wir haben uns dafür bewusst den 10. März, den International Bagpipe Day, ausgesucht. Und machen ein bisschen Druck. Schalldruck, um genau zu sein: Wir haben uns in die Lautsprechersysteme von zahlreichen Märkten in Deutschland gehackt. Und spielen dort unser Programm ab: ohrenbetäubende Dudelsack-Musik, dazwischen informative Ansagen zu den Geschäftspraktiken des Konzerns und seines Gründers. Wusstest du, dass das Möbelhaus schon längst kein schwedischer Konzern mehr ist, sondern auf Stiftungen und Holdings in verschiedenen Ländern aufgeteilt ist, die die Gewinne so oft hin- & herschieben, bis kaum noch Steuern übrig bleiben, tönt es da durch die unheiligen Hallen. Zum Beispiel im Jahr 2010: Da machte die Holding 2,5 Milliarden Euro Gewinn, zahlte aber, so behaupten jedenfalls böse Zungen, nur 48000 Euro Steuer. Die vom Konzern beauftragte Firma DWT fand das übrigens zu viel und hätte, so sagen noch bösere Zungen, überhaupt nur 4800 Euro Steuerlast berechnet. Wir hingegen haben keine Kosten & Mühen gescheut: Für dich als treuen Kunden erklingt nun Scotland the Brave, gespielt von 199 Dudelsäcken.
Wusstest du, dass die Schweden jahrzehntelang in der DDR Möbel von politischen Häftlingen und Strafgefangenen produzieren ließen, fragen wir, nachdem 198 Dudelsäcke verklungen sind und nur noch einer leise im Hintergrund wimmert. Wusstest du, dass der Konzern mit dem Elch einer der größten Waldbesitzer Rumäniens ist und sich dort an der Abholzung der letzten Urwälder beteiligt? Passend dazu haben wir jedenfalls für dich das traurige Lamento Flowers of the Forest ausgewählt. Mach es dir auf dem Stuhl INGVAR aus rumänischer Eiche bequem und lausche dem Piper der Queen, den wir extra für dich eingeflogen haben.
Wusstest du, dass auch der Gründer des Konzerns, der selige alte Schwede, nicht so gerne Steuern zahlte, informieren wir anschließend die lieben Kunden. In der Schweiz, wo er 40 Jahre lebte, berappte er jährlich 45000 Franken Pauschalsteuer. Das klingt viel? Nun ja: Für ein Vermögen von ungefähr 40 Milliarden ist es eher wenig: nämlich nicht viel mehr als 0,0001%. Dir blasen jetzt dafür die Glendaruel Highlanders den Marsch, damit du brav zur Kasse gehst und deine Mehrwertsteuer von 19% zahlst!
So: An dieser Stelle lassen wir den Holländer und sein Team weiterarbeiten und die lieben Kundinnen & Kunden zur Kasse gehen oder weiter einkaufen. Sollten Leserinnen oder Leser nach diesem kurzen Einblick in unsere Arbeit nun statt Ressentiment Ratlosigkeit verspüren, dann sage ich nur: Kommt Zeit, kommt Rat. Jakob weiß von alldem natürlich nichts, und das soll auch so bleiben. Die Leserin und den Leser möchte ich an dieser Stelle an das vereinbarte Schweigen erinnern. Glaubt mir: Ich weiß, wo eure Häuser wohnen!
1.13
Zurück in den Kapitelsaal, zurück zu Jakobs Recherchen. Die Frage ist jetzt natürlich: Was macht er mit den Ergebnissen, versucht Anna Sofia es auf den Punkt zu bringen. Und was plant er für die Zukunft? Vielleicht sind sie schon längst bei DWT, meint der Täufer düster. Oder bei Interpol. Wäre es nicht deine Aufgabe, genau das zu verhindern, stichelt Crypto. Oder deine, gibt der Täufer patzig zurück. Der Holländer fasst sich an den Kahlkopf. Denn wenn diese beiden zu streiten beginnen, kann es mühsam werden. Der Täufer ist für die Sicherheit unseres gesamten IT-Systems zuständig. Er sorgt dafür, dass von außen nichts Böses über uns hereinbricht. Crypto – eigentlich James Obekwoe – ist als Chefverschlüssler umgekehrt dafür verantwortlich, dass Daten und Signale, die unser Kloster verlassen, nicht zu uns zurückverfolgt werden können. Manchmal lassen sich diese zwei Dinge allerdings nicht so leicht voneinander trennen. Und dann geraten die beiden aneinander und sind auch nicht leicht wieder voneinander zu trennen. Am Ende richten sich wie so oft aller Augen auf unser aller Herrin, die bisher geschwiegen hat. Was meinst du, will Norman von seiner Frau wissen.
Sie: lässt sich Zeit. Und antwortet schließlich mit einem einzigen Wort, oder vielmehr einem Namen: Laura, sagt sie. Und ist nicht geneigt, dem auch nur ein erklärendes Wort hinzuzufügen. Und wird später abstreiten, das gesagt zu haben. Sie wird ganz im Gegenteil mir in die Schuhe zu schieben versuchen, Laura ins Spiel gebracht zu haben.
1.14
Nun: Das weise ich natürlich strikt von mir. Doch ungeachtet dessen, wer hinter der Bühne die Fäden zieht – fast hätte ich geschrieben: die Puppen tanzen lässt, doch das ließe mir unsere gestrenge Äbtissin nie & nimmerlich durchgehen –, hat Laura ihren Auftritt am 15. März. Auch wenn man bisher an den Iden des März als Italiener eher an Caesar oder Brutus und als Magyare an die große ungarische Nation zu denken pflegte, während man in den USA den Everything You Think Is Wrong Day feierte: In Zukunft wird dieser 15.3., so viel ist jetzt schon klar, als dies apparitio Laurae im Kalender stehen.
Bevor ich fortfahre, muss ich an dieser Stelle eine Warnung aussprechen: Es geht im Folgenden und auch in manch späterem Abschnitt dieses Prosaikums um das äußere Erscheinungsbild einer Frau, gesehen durch die unweigerlich lustvollen und stets nur das eine wollenden Augen eines Mannes. Menschen allerlei Geschlechts, die sich von derlei Beschreibungen in ihren Befindlichkeiten verletzt fühlen könnten, sollten den nächsten Abschnitt sowie die Kapitel 3.15, 4.05, 4.11 und 7.14–15 daher unbedingt überlesen.
Eine apparitio, eine Erscheinung, so stellt sich Lauras Auftritt jedenfalls aus der Sicht Jakobs dar: Aus dem Licht der Morgensonne geboren, in die Farben des Regenbogens gehüllt, vom rötlichen Kranz ihrer Haare umstrahlt, tritt sie an diesem wunderschönen Märztag, aus der Klostergasse kommend, hinaus auf den Marktplatz und hinein in sein Leben. Er steht an der zum Platz hin offenen Theke des Il Cuore und wartet eigentlich auf das Erscheinen seines Ristretto. Doch plötzlich sehen seine weit aufgerissenen Augen – und auch der Mund will da nicht geschlossen bleiben – nur noch Laura, wie sie zwischen den Ständen des Marktes hin- & hergeht, nein, schwebt: Denn ihre Füße berühren keinen Boden nicht. Was oder wen auch immer sie anfasst oder mit einem Lächeln bedenkt – einen Apfel hier, ein paar Tomaten dort, einen Laib Käse, einen Bauern hinter seinem Stand –, erstrahlt sogleich im selben überirdischen Licht.
Nüchtern betrachtet: ist diese unsere Laura eine große, schlanke, jugendlich wirkende Mittdreißigerin mit rotbraunen, leicht gekräuselten Haaren, ihre Füße stecken in Ballerinas, sie trägt eine Jeansjacke über dem bunten, schon sommerlich wirkenden Kleid. Aber ich gebe zu: Die nüchterne Betrachtung von Signora Bialetti fällt mir schwer, denn ich fühle da eine durchaus favorable Hin- & Zuneigung, so sehr sogar, dass für sie bei einer Vernichtung der Menschheit eine eventuelle Verschonung anzudenken wäre.
Auch Jakob, das ist sofort klar, hat mit objektiver und nüchterner Betrachtung in diesem Fall nichts am Hut, trägt er doch nicht einmal einen solchen: Wir wissen nämlich, dass er dieses Gesicht kennt, aus dem eine schlanke Hand soeben eine Haarsträhne streicht. Er kennt es seit vielen Jahren: Er hat es in zahllosen Büchern und auf unzähligen Bildschirmen gesehen, in Groß, in Klein, in Schwarzweiß und in Farbe, als Reproduktion und erst kürzlich im Original in Florenz. Fast jeder kennt es, man muss dazu nicht wie Jakob die Geschichte der Kunst studiert haben. Es ist das Gesicht, das einem auf zahlreichen Gemälden Sandro Botticellis, der da schon in jungen Jahren zum alten Meister aufstieg, begegnet: als Madonna oder Nymphe, als einfache Sterbliche, oder, in ihrer berühmtesten Inkarnation, als schaumgeborene Göttin. Es rattert jetzt & hier laut vernehmbar in Jakobs Gehirnwindungen, es faltern ihm Schmetterlinge bäuchlings durch die Eingeweide: Ist diese junge Frau einem der erwähnten Bilder entstiegen und schnurstracks nach San Lorenzo gekommen? Ist sie eine Fantasmagorie des alten borgo fantasma? Oder eine Botin aus den himmlischen Sphären des Klosters, herabgestiegen in die säkularen Niederungen des Dorfes?
Ti piace la ragazza, versucht Mauro sich augenzwinkernd in seine Gedanken einzuklinken. Wäre Anna Sofia hier, würde sie dem guten Mann natürlich sofort fingerklopfend zu Leibe rücken: dass man nämlich erwachsene Frauen gefälligst nicht ragazza zu nennen habe. Jakob ist zwar anwesend, doch Mauros Worte dringen nicht bis zu ihm durch. Er nimmt auch die Architektin Susan Sherwood nicht wahr, die soeben einen Cappuccino bestellt hat. Ovviamente sì, antwortet sie mit einem belustigten Grinsen an seiner statt und zwinkert Mauro zu.