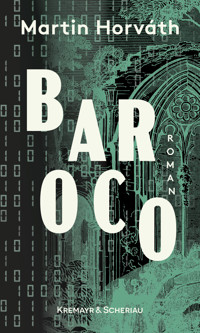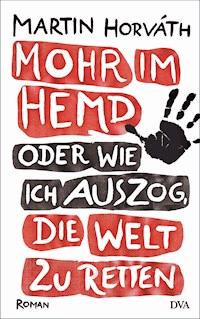
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Voller Fabulierlust und Tragikomik
Ali hat seine Augen und Ohren überall. Er ist – so behauptet er jedenfalls – fünfzehn Jahre alt und kommt irgendwo aus dem Westen Afrikas, spricht nach eigenen Angaben vierzig Sprachen und Deutsch am allerbesten und weiß genauestens Bescheid über das Leben und Sterben in den ärmeren Ländern der Welt. Ali kann alles, kennt alles und fristet sein Dasein nur aus einem Grund in einem Wiener Asylbewerberheim: Er, der Anwalt der Unterdrückten, der Beschützer aller Gedemütigten, hat es sich zur ehrenhaften Aufgabe gemacht, seine Mitinsassen von ihren Ängsten und Albträumen zu befreien. Seine Wunderwaffe: das Erzählen. Ali ist ein Erzählverführer, der mit beißendem Spott und subversivem Humor bewaffnet zur täglichen Weltrettung antritt.
Ein scharfsichtiger Roman, der wortmächtig und voller unerschöpflicher Fabulierlust unserer Welt den Spiegel vorhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Martin Horváth
Mohr im Hemd
oder Wie ich auszog, die Welt zu retten
Roman
Deutsche Verlags-Anstalt
Für Lily,
die in ihrem Haus und ihrem Herzen schon vielen eine neue Heimat geboten hat
Prolog
Damit Sie’s gleich wissen: Meine Haut ist braun. Dunkelbraun. Man könnte auch sagen kaffeebraun, was man natürlich in dieser Stadt der tausend Kaffeehäuser etwas präziser formulieren muss: Je nach Tageslicht und Laune zeigt sich mein schöner Teint nämlich einmal heller, einmal dunkler, schimmert morgens meist in feinem Melangebraun, gibt sich mittags kleiner- oder großerbraunerbraun, verfärbt sich nachmittags zu elegantem Einspännerbraun, um am Abend schließlich – Herr Ober, zahlen bitte – bei sattem Espresso- oder Mokkabraun zu landen.
In dieser Stadt der tausendundein Konditoreien kann man Kaffee natürlich nicht ohne Kuchen- oder Tortenstück genießen. Doch Linzer Torte will ich nicht, auch Apfelstrudel kommt mir keiner auf den Tisch, es steht mir der Sinn nicht nach Indianerkrapfen oder anderem Unfug für Bleichgesichter, nein, Herr Ober, ein Mohr im Hemd muss es sein, so viel ist klar. Mohr im Hemd will ich, sonst fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut, Mohr im Hemd krieg’ ich, sonst wähne ich mich nicht willkommen in diesem Land.
So. Nachdem wir das geklärt haben, können wir ja beginnen. Mein Name ist Ali und ich bin neu in dieser Stadt. Seit kurzer Zeit lebe ich in einem Heim unweit der Donau und kenne mittlerweile alle hundertdreißig Mitbewohnerinnen und -bewohner sowie alle Betreuerinnen und Betreuer beim Namen. Die wundern sich, wenn ich sie morgens und mittags und abends auf langen Gängen und engen Treppen begrüße: Wie kannst du dir die Namen so schnell merken, Du bist doch gerade erst angekommen, Du bist ja noch so jung, so staunen sie in vierzig Zungen. Das ist ja wirklich kein großes Kunststück, entgegne ich bescheiden, einem jeden in seiner Sprache. Erstaunlich, sagen sie und schütteln Köpfe mit schwarzen, weißen, gelben und braunen Gesichtern.
Gelb: Da gibt es zum Beispiel einen, der ist ein Sohn der mongolischen Steppe, er zieht ein Bein beim Gehen hinterher, Männer in Uniform haben es vor zwei Jahren zertrümmert, um ihn zum Reden zu bringen. Er trägt trotzdem die Sonne im Gemüt, doch sei gewarnt, Fremder, vor seinem Fahrtwind – die Eintöpfe, die seine Frau tagtäglich in der winzigen Kochnische ihres Zimmers zubereitet, er zieht ihren Nachhall hinter sich her wie eine Braut die Schleppe ihres Kleides. Weiß: Da ist ein anderer aus den Schluchten des Balkans zu erwähnen, bleichgesichtig schleicht er die schäbigen Gänge entlang, treppauf, treppab, den ganzen Tag über und nicht selten auch nachts, plötzlich ist er hinter dir, neben dir, den jungen Mädchen ist er nicht ganz heimlich, er spricht nicht viel, und man sagt, er habe Schreckliches erlebt, bevor er fliehen konnte aus den kargen Bergen seiner Heimat. Braun: Da haben wir einen, der floh aus Westafrika, das Ehepaar in der Wohnung darunter beschwert sich, weil er in seinem Zimmer stundenlang auf und ab und ihnen auf die Nerven geht. Außerdem haben wir ein Paar aus dem wilden Kurdistan, sie vermehren sich mit atemberaubender Geschwindigkeit, jede Woche gibt es ein blassbraunes Kind mehr, das ängstlich hinter der Tür hervorlugt. Und dann, dann ist da natürlich noch die Schwarze Köchin, der Meereswind, der wolkenschwere, hat sie von einer fernen Insel in trockenere Gefilde geweht. Man kann nicht sagen, dass sie mit Geist oder Anmut gesegnet wäre, aber, jedoch, obschon: Wenn sie kocht, wenn sie schnetzelt und hackt und knetet und rührt in ihrer Puppenküche, dann sprechen die Götter aus ihr mit tausend Stimmen. Der Reisgott Xamun, der von den Bewohnern Bhutans verehrt wird; der dreiköpfige Gomilo, dem die Köche Avusturiens Schreine errichtet haben in ihren Küchen; Myi-Xhi-Lin, die Sternenglänzende; Ibeorga, die Schöne, Ibeorga, die Schreckliche: Sie alle schweben über den Töpfen, sie schleichen wie Katzen um die Beine der Schwarzen Köchin, sie sitzen am Wackeltisch und klappern wie ungezogene Kinder mit billigem Blechbesteck und warten voller Ungeduld darauf, endlich, endlich ihre göttlichen Zähne in irdische Genüsse schlagen zu dürfen. Nicht zuletzt wären da meine unmittelbaren Mitbewohner im obersten Stock zu erwähnen, so jung, so unschuldig, ach, und dann müsste ich natürlich über Mira berichten – – – doch genug, genug! Nicht alle sollen sich hier in den Vordergrund drängen, es gibt ja ohnehin keinen, keinen Einzigen hier im Haus, der mir auch nur ein Glas Wasser reichen könnte.
Was all diese Menschen, seien es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, miteinander verbindet: Sie warten. Geduldig oder ungeduldig, ängstlich oder zuversichtlich, apathisch oder voller Tatendrang warten sie auf Papiere. Papiere mit Stempeln, Papiere, die ihnen erlauben, ihre Flucht zu beenden und anzukommen in diesem Land, Papiere zum Arbeiten, zum Leben, zum Hoffen, Papiere, auf denen ihr Menschsein amtlicherseits bestätigt wird: Eine Unterschrift hier und dann noch eine da, und nun der Nächste, aber dalli, dalli!
Warum sage ich »sie« und schließe mich nicht ein in ein »Wir«? Ich sitze ja auch in diesem Asylwerberheim genannten Wartesaal, in dieser Bahnhofshalle, von deren Gleisen ein Zug abfahren und die Wartenden an ihr Ziel bringen wird, vielleicht, irgendwann, man weiß nicht wann, man weiß nicht wirklich wohin, vielleicht geht es auch wieder zurück zum Ausgangsort. Ja, wir leben Tür an Tür, doch ansonsten habe ich nicht viel gemein mit den Menschen um mich herum. Es sind gute Menschen, ich liebe sie alle, ja, aber was habe ich mit Bauern und Hirten zu schaffen, die ihren verlorenen Hühnern und Schafen und Gänsen nachweinen? Ich, ich gebe nur vor zu warten, denn in Wahrheit gibt es nichts, auf das ich warten müsste. Ich brauche niemand, der meine Flucht für abgeschlossen erklärt, ich brauche keinen, der mir erlaubt, Mensch zu sein, der mir die Lizenz zum Leben, die Genehmigung zum Arbeiten erteilt. Ich bin Mensch, ich lebe, und Arbeit, Arbeit gibt es hier im Haus genug für mich.
Woher kommst du, Ali, fragen mich meine Mitbewohner. Ist das wirklich so wichtig, gebe ich mit gelangweilter Miene zurück. Doch dann antworte ich geduldig: Ich komme von dort, wo die Wüste, die endlose, sich ins Meer hinausschiebt mit gelbsamtenen Zungen, antworte ich dem einen, der seine Heimat an den Gestaden Westafrikas vermisst; ich bin da geboren, wo Palmblätter sich im Wind wiegen und das Himmelsblau nichts kennt als die Sonne. Ich auch, sagt er, mit Tränen in den Augen, ich auch! Ich bin da zu Hause, wo die Musik zu Hause ist, so lautet meine Antwort für die Götterköchin; auf jener Insel im Meer der sieben Farben bin ich zu Hause, wo die Musik auf den Straßen und Plätzen und in den Farben der Kleider wohnt, in den Bewegungen der Menschen und in ihrer Sprache, ja, sogar in den tanzenden Besen der Straßenkehrer. Ach, hör doch auf, sagt sie seufzend und schickt einen wasserblauen Blick in die Ferne. Bruder, sagt ein Dritter zu mir und umarmt mich, als ich ihm anvertraue, dass meine Heimat da ist, wo die Berge, die wolkenverhangenen, sich über feuchtgrünen Wäldern türmen. Bruder, fragt er, hast du was zum Rauchen mitgebracht?
Ali ist natürlich nicht mein richtiger Name. Man verstehe mich nicht falsch – es liegt mir fern, den Schwiegersohn des Propheten zu beleidigen. Aber Ali heißt heutzutage jeder zweite Taxifahrer, jeder Kebabverkäufer hört auf diesen Namen oder auch das jüngste von zweiundzwanzig Kindern, dessen Eltern das letzte bisschen Fantasie bei der Zeugung aus den aufgeregten Körpern geschwitzt haben. Mein richtiger Name, ein Name, wie ihn nur von der Natur begünstigte Erstgeborene verdienen, ist viel klangvoller, viel größer. Mein Name ist ein Sturm über der Wüste, in meinem Namen, da spiegeln sich nächtens die silbernen Sterne, und es singen die Vögel, die tausendbunten. Doch diesen Namen, meinen richtigen Namen, kennt nur meine Familie. Kannte nur meine Familie, muss ich sagen, denn ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, und von mir wird niemand diesen Namen erfahren. Ali, das merkt sich einfach jeder, selbst der dümmste Rassist, selbst der kleinkarierteste Spießer kann den Namen aussprechen, ohne dabei über die eigene Zunge zu stolpern, ja, sogar der zerstreute Professor, der dafür bezahlt wird, den Neuzugängen im Haus das Seelenstethoskop an den nachtschwarzen, steppengelben oder angstbleich pochenden Busen zu legen, sogar er hat sich den Namen gemerkt. Herr … äh … Herr Ali, sagt er, mein Nachname ist ihm dann doch zu kompliziert, Sie haben wirklich eine bemerkenswerte psychische Konstitution! Er blättert ein wenig in meiner Akte. Wirklich erstaunlich bei all dem, was Sie erlebt haben, fügt er hinzu. Sehr erfreut, Herr Doktor, danke, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Herr Doktor!
Bei all dem, was Sie erlebt haben. Man erwarte jetzt nicht von mir, dass ich im Detail über diese Erlebnisse berichte. Es gibt ja auch nicht allzu viel zu berichten: ein bisschen Folter hier, ein bisschen Einschüchterung da, meine Mutter und meine Geschwister hat man umgebracht, mein Vater ist verschollen, ich habe mich aus dem Staub gemacht, keine besonderen Vorkommnisse, nicht der Rede wert, das Übliche eben.
Wie kommt es, dass du so viele Sprachen sprichst, Ali, Und so völlig ohne Akzent, Und Fehler macht er auch keine, so wundern sich meine guten Mitbewohner. Meine Mutter hatte eine Sprachschule, lautet die Antwort des Bildungsbürgers in mir. Mein Vater war Diplomat, wir sind jedes Jahr in ein anderes Land übergesiedelt, so spricht der Weltbürger. Der Kleinbürger gibt zu Protokoll: Ich habe immer brav und fleißig gelernt. Und als Bewohner jenes weiten Landes namens Poesie nehme ich die Leier zur Hand und beginne zu singen: Von Babylon da komm’ ich her, dort stand ein großer Turm, ich wohnte unter seinem Dach, bevor er fiel im Sturm. Und es staunen die Bauern, und die Hirten verharren in schweigender Andacht. Wie alt bist du, Ali, fragen sie dann weiter. Euch erstaunt wohl meine Reife und mein großes Wissen, Ihr Lieben? So ist es, antworten sie im Chor und harren meiner Worte. Da, wo ich herkomme, zählt man nicht die Monate oder Jahre, erkläre ich geduldig. Aber was steht in deinen Papieren? Auf Papier steht geschrieben, dass ich zu alt bin, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Ratlos blicken sie mich an, die Lieben. Also gut, gebe ich mich geschlagen, wenn ihr darauf besteht, dann verrate ich es euch: Offiziell bin ich fünfzehn, inoffiziell einundfünfzig, was keinen Unterschied macht, denn Altersangaben sind, wie jeder weiß, kommutativ.
Melange- bis mokkabraun ist meine Haut, ich betone das noch einmal, damit es nachher nicht heißt, ich hätte es verschwiegen, Mohr im Hemd will ich, ich sagte es schon, und es wartet, auch das wurde schon erwähnt, viel Arbeit auf mich. Worin besteht diese Arbeit? Nun, meine Aufgabe ist es, den Geschichten meiner Mitbewohner hinterherzuspüren. Es sind Geschichten mit vielen exotischen Namen, die schwer zu merken sein mögen, Geschichten, so sei ausdrücklich gewarnt, in denen eindeutig die dunklen Kapitel überwiegen. Dunkel, weil viele Bewohner dieses Hauses Schlimmes erlebt haben; dunkel, weil manche nichts von sich preisgeben wollen; dunkel aber auch, weil nicht immer klar ist, ob sie die Wahrheit sagen oder sie zurechtbiegen und Dunkles erfinden, um sich zwecks Erlangung von Asyl in ein besseres Licht zu rücken. Ich, ich bin jedenfalls hier, um die Geschichten aufzuspüren, sie der Finsternis zu entreißen, um solcherart Licht ins Dunkel zu bringen, und zwar in jeder Hinsicht.
1
Manche Geschichten muss man nicht suchen, sie finden einen. Schon früh am Morgen herrscht Aufregung im Haus: Im dritten Stock haben sie Salva, einen Mitbewohner aus dem Sudan, abgeholt, haben ihn davongezerrt, seine Frau hat geschrien und sich auf die Männer in Uniform geworfen, doch es hat nichts geholfen. Habe ich etwas getan, um diese Abholung zu verhindern? Ich muss gestehen: Nein, habe ich nicht. Ich lag in der wohligen Wärme meines Bettes, Mira, meine Göttin, ruhte im Traum an meiner Seite, ich blickte in ihre tiefgrünen Augen, ich griff nach ihrer Hand, ich – – – und da ging schon das Geschrei los und riss nicht nur Salva fort von seiner Frau und den zwei Kindern, sondern auch mich von Miras Seite. Als ich aufstehe und bettschwer Richtung Bad wanke, ist es längst zu spät.
Man wirft Salva vor, mit Drogen gehandelt zu haben. Stimmt der Vorwurf, wird man nun fragen, ich muss jedoch gestehen, ich weiß es nicht. Zu kurz bin ich erst im Haus, zwar weiß ich vieles, doch leider noch nicht alles. Ich habe daher auch keinen Trost für Salvas Frau. Man wird ihn wahrscheinlich, ob die Anschuldigungen nun berechtigt sind oder nicht, bald in ein Flugzeug setzen, vielleicht sogar in die Passagierkabine, wenn er brav ist, man wird ihn an den Sessel binden, ihm vielleicht Mund und Nase zukleben, damit er die Urlaubsstimmung ringsum nicht durch seinen Atem verpestet, und wenn er Glück hat, dann wird er lebend dort ankommen, wo man ihn ein Jahr zuvor totzuprügeln versuchte. Das klingt hart? Oder zynisch? Nun, man soll die Dinge beim Namen nennen. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Schweinescheiße ist Schweinescheiße ist Schweinescheiße.
Offiziell – das habe ich bisher verschwiegen – gehöre ich ja zu den sogenannten UMFs, den Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen. Unsere betreute Wohngemeinschaft für derzeit zwölf Jugendliche liegt im vierten und letzten Stock des Hauses und nennt sich Leo, hierzulande die Bezeichnung für jenen Ort beim Fangenspielen, an dem man sicher ist und nicht abgeschlagen werden kann. Zwar haben wir nicht direkt mit den Erwachsenen in den anderen Stockwerken zu tun, und wenn wir etwas von »unten«, wie es heißt, erfahren, dann stammt es oft aus zweitem oder drittem Munde, wurde wiedergekäut in verschiedenen Sprachen, und was bei diesem mehrsprachigen Stille-Post-Spiel ankommt, ist mit Vorsicht zu genießen. Aber auch bei uns weiß man bereits über den Polizeieinsatz Bescheid, und am Frühstückstisch wird eifrig darüber diskutiert, ob Salva nun tatsächlich Drogen verkauft hat und ob man ihn wohl abschieben wird.
Ich will mich gerade vom Frühstückstisch erheben, um mich langsam auf den Weg zum Deutschkurs zu machen, als plötzlich Adolphe Mwenga aus dem zauberhaften Kongo in die Küche stürmt. Du musst putzen, Ali, stört er meine Kreise, du bist auf die Liste, Badezimmer und Klo. Erstens heißt es »auf der Liste«, korrigiere ich meinen schwarzen Bruder, und zweitens bin ich nicht in dieses Land gekommen, um Scheißhäuser zu putzen, es gibt andere, die das viel besser können als ich, die das gerne tun, weißt du. Alle müssen putzen, beharrt Adolphe, dann stürmt er aus dem Zimmer. Zwei Minuten später ist SIE da: Mira, mein Täubchen, begrüße ich sie.
Mira also. Mirela Obranović gehört, obwohl auch sie die Fremde in sich trägt, nicht zu den Wartenden im Haus. Sie ist einer von fünfundzwanzig Menschen, deren Aufgabe darin besteht, hundertdreißig anderen Menschen beim Warten zuzusehen. Was Miras konkreten Arbeitsbereich betrifft, gibt es gewisse Auffassungsunterschiede: Laut Heimleitung obliegt ihr zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen die Betreuung der UMFs; tatsächlich weilt sie natürlich einzig und allein für mich auf Erden, und sie ist, es gibt da gar keinen Zweifel, die schönste Frau auf diesem Planeten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!