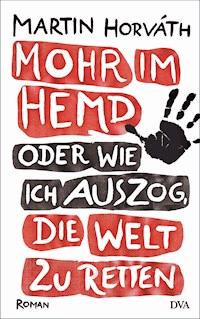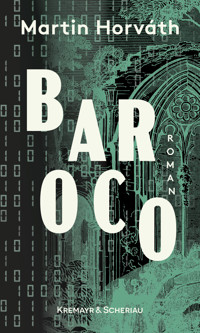2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn sich Geschichte wiederholt … ein hellsichtiger und sehr berührender Roman
Wien in der nahen Zukunft. Seit einem Attentat auf dem Hauptbahnhof ist der Ausnahmezustand zur Regel geworden. Auch die Welt des Autors León Kortner ist aus den Fugen geraten: Bei dem Anschlag sind Frau und Tochter umgekommen, seitdem führt er ein Leben unter Toten. Einsam versucht er einen Roman über die jüdische Familie Klein zu schreiben, die bis zur Flucht vor den Nazis eine Buchhandlung in dem Haus führte, in dem León wohnt. Eines Morgens sitzt ein fremdes Mädchen in einem altmodischen Mantel in seiner Küche. Wer ist diese Judith, die behauptet, dass ihrem Vater der Buchladen gehört?
Mit großem Feingefühl erzählt Martin Horváth von Verfolgung, Flucht und Exil einer jüdischen Wiener Familie und zieht Parallelen zu unserer Zeit – ein kluger, eindringlicher Roman über die Macht des Erzählens und das Vergessen, Vergessen-Wollen und Nicht-vergessen-Können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wenn sich Geschichte wiederholt … ein hellsichtiger und sehr berührender Roman
Wien in der nahen Zukunft. Seit einem Attentat auf den Hauptbahnhof ist der Ausnahmezustand zur Regel geworden. Auch die Welt des Autors León Kortner ist aus den Fugen geraten: Bei dem Anschlag sind Frau und Tochter umgekommen, seitdem führt er ein Leben unter Toten. Einsam versucht er ein Buch über die jüdische Familie Klein zu schreiben, die bis zur Flucht vor den Nazis eine Buchhandlung in dem Haus führte, in dem León wohnt. Eines Morgens sitzt ein fremdes Mädchen in einem altmodischen Mantel in seiner Küche. Wer ist diese Judith, die behauptet, dass ihrem Vater der Buchladen gehört?
Mit großem Feingefühl erzählt Martin Horváth von Verfolgung, Flucht und Exil einer jüdischen Wiener Familie und zieht Parallelen zu unserer Zeit – ein kluger, eindringlicher Roman über die Macht des Erzählens und das Vergessen, Vergessen-Wollen und Nicht-vergessen-Können.
Martin Horváth, Jahrgang 1967, studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, wo er als freischaffender Musiker und Autor lebt. Während eines mehrjährigen New-York-Aufenthalts arbeitete er am Leo Baeck Institute über die Geschichte der österreichisch-jüdischen Emigration in die USA. 2012 erschien sein Debüt Mohr im Hemd (DVA), für das er mit der AutorInnenprämie des österreichischen Kulturministeriums ausgezeichnet wurde. Mein Name ist Judith ist sein zweiter Roman.
Pressestimmen zum Debütroman Mohr im Hemd:
»Mohr im Hemd ist ein wahrer Glücksfall für die österreichische Literatur.« ORF, Ö1, Ex libris
»Ein literarisch mutiges Debüt, das einen genauen und frischen Blick auf jene Menschen wirft, die von der Mitte der Gesellschaft gerne übersehen werden.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung
»Martin Horváths Debüt überzeugt, weil man eine realistische Geschichte liest, die unangenehme Themen unverschleiert anspricht.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Selten ist das aktuelle Thema der Migration, des Fremdseins, des Geringachtens der an den Rand Gedrängten so scharfsichtig verpackt und mit unbändiger Formulierkunst dahergekommen.« Passauer Neue Presse
»Man darf diesen starken Roman ruhig als Simplizissimus-Geschichte aus dem 21. Jahrhundert lesen, als zornigen Aufschrei, als Menetekel. Jedenfalls ist dem Autor damit ein furioser Erstling gelungen, mit einem apokalyptischen Schluss, der nur zu gut für die Geschichte passt.« Buchkultur
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Martin Horváth
Mein Name ist Judith
Roman
Für Alexandra
Im Angedenken an meine Großeltern dies- und jenseits des Atlantiks
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei mir, und ich war das Wort.
Und alles, was ist, ist durch das Wort geworden.
Zuerst fügte ich Letter auf Letter, um die Mauern dieses Hauses zu errichten.
Ich reihte Wort an Wort und baute eine Stadt um das Haus herum.
Zeile für Zeile webte ich am Himmelszelt, um es über der Stadt und der Welt aufzuspannen.
Aus dem, was in meinem Setzkasten verblieb, schuf ich alsdann die Menschen, die unter diesem Himmel wohnen.
Und den Raum zwischen den Zeilen verwandelte ich in Zeit und schenkte sie den Menschen zum Leben und zum Sterben.
Prolog
Zu der Zeit, als diese Geschichte über mich hereinbrach, lebte ich ein Leben unter Geistern. Manche davon hatte ich selbst gerufen, andere waren ohne mein Zutun in mein Leben getreten. Wieder andere hatte ich aus Worten geformt und, so glaubte ich jedenfalls, auf Papier gebannt.
Zu der Zeit, als diese Geschichte ihren Ausgang nahm, hatte ich meinen Wohnsitz in der Vergangenheit. Ich flüchtete mich aus der Wirklichkeit, ich nährte mich von der Erinnerung, umgab mich mit Büchern statt mit Menschen, und meine Gefühle pendelten zwischen Trauer und Hass. Die Trauer galt den zwei liebsten Menschen, die mir das Leben geschenkt hatte. Der Hass denjenigen, die sie mir genommen hatten. Und manchmal auch mir selbst, weil ich zu den Überlebenden gehörte.
Von Toten und Geistern ist hier die Rede, aber auch von Träumen, die echtes Leben vorgaukeln. Es ist die Rede von der Erinnerung und von den Schwierigkeiten, mit ihr zu leben und sie zu bewahren. Vom Gedächtnis, das gern täuscht und trügt und einem mit geschönten Tatsachen zu schmeicheln versucht. Von der Vergangenheit und von den Spuren, die sie an Menschen, Gebäuden, Städten, Nationen hinterlässt. Und davon, wie sie manchmal an der Gegenwart zerrt und reißt wie ein hungriges Raubtier und sie ganz in ihre Gewalt zu bekommen versucht.
Wo beginne ich meine Geschichte? Vor mehr als hundert Jahren, als dieses Haus noch nach frischer Farbe roch und eine Familie im Erdgeschoss eine Buchhandlung und im letzten Stock eine Wohnung bezog? Vor fast fünfundzwanzig Jahren, als ich die Nachkommen ebendieser Familie in ihrer neuen Heimat kennenlernte? Vor drei Jahren, als eine Katastrophe mein Leben auf immer veränderte? Nein, ich möchte zur Weihnachtszeit vor einem Jahr beginnen, als eines Morgens plötzlich ein kleines, mir unbekanntes Mädchen in meiner Küche saß. Denn in den zwei langen Wochen, die auf diesen Tag folgten – zwei Wochen, in denen die Zeit verlangsamt oder angehalten schien, zwei Wochen, die sich in alle Richtungen dehnten und streckten, sich verbogen und verzerrten –, verbanden sich alle anderen, Jahre oder Jahrzehnte zurückliegenden oder noch zu geschehenden Ereignisse zu einer einzigen großen Geschichte. In diesen Wochen, in dieser Zeit zwischen den Jahren, durchlebte ich hundert Jahre. Und ich lebte nicht nur unter dem Himmel von Wien, sondern atmete auch die Luft von Paris, Marseille, Antananarivo, New York, Tel Aviv und anderen Orten.
Jetzt, da ich verändert und gestärkt von dieser Reise durch Zeiten und Kontinente zurückgekehrt bin, möchte ich darüber berichten und meine Geschichte erzählen. Doch beim Versuch, die Tage zu rekonstruieren, gerate ich in Schwierigkeiten. Kann ich meinen Erinnerungen trauen? Habe ich tatsächlich alles erlebt, was sie mir einflüstern? Und waren es wirklich nur zwei Wochen? Bis heute bin ich mir nämlich der Ereignisse und meiner Erinnerung daran nicht sicher. Und finde für vieles nach wie vor keine Erklärung. Ich versuche mich beim Schreiben über diese Zeit auf meine Notizen zu stützen, stoße aber auch da auf Widersprüche.
Doch allen Widersprüchen und Ungereimtheiten zum Trotz – heute weiß ich, dass mir erst die Begegnung mit den Toten die Rückkehr zu den Lebenden ermöglichte. Und es war die Reise in die Vergangenheit, die mir – zusammen mit allem, was in den Monaten danach entstehen würde – den Weg in die Zukunft wies. Die Welt rundherum mag in den vergangenen Jahren kein schönerer Ort geworden sein. Und doch: Jetzt, da auf mich neue Liebe und neue Hoffnung warten, fühle ich mich beflügelt zu neuen Worten und neuen Taten. Nun, da ich mich endlich aus dem Griff der Vergangenheit befreit habe, spüre ich das dringende Bedürfnis, mir neues Leben zu erschreiben.
I
Sie sind doch ein Poet ein Dichter
Schreiben Sie ein Gedicht
Nicht so engmaschig
benommen von der Zeit
Keinen Reim
Wort – Buchstabenkaskaden
Schreiben Sie ein Gedicht
damit ich überlebe
HERBERT WADSACK
1
Auf die ersten Spuren Judiths stieß ich, noch bevor sie selbst sich mir zeigte. Unter dem Bett im verwaisten Kinderzimmer fand ich eines Tages kurz vor Weihnachten ein kleines Lebensmittellager: Konservendosen, Gläser mit eingelegtem Gemüse, Knäckebrot und Kekse, aber auch mehr oder weniger frisches Obst, Gemüse, Eier und belegte Brote, alles sorgfältig aufgereiht auf dem Parkettboden. Manches davon stand oder lag wohl schon länger unter dem Bett: Brot und Wurst und Käse waren vertrocknet, das eine oder andere Stück Obst verschimmelt.
Ich schaltete den Staubsauger aus und ließ mich langsam auf den bunten Bettvorleger sinken. Ich verstand nicht, was hier vorging. Seit dem Tod meiner Frau Lydia und meiner Tochter Hanna lebte ich allein, kaum jemand hatte in den vergangenen Jahren die Wohnung, geschweige denn das Kinderzimmer, betreten. Wer also könnte und sollte hier ein Lebensmitteldepot anlegen? Und zu welchem Zweck? Oder waren die Lebensmittel nicht als Vorrat, sondern als eine Art Opfergabe gedacht? Doch wem sollte damit gehuldigt, wer milde gestimmt werden? Ich fand keine Antworten auf meine eigenen Fragen. Meine Finger strichen gedankenverloren über die bunten Igel auf dem Bettvorleger, den Hanna so geliebt hatte. Es dauerte ein paar Minuten, bevor ich mich dazu aufraffen konnte, die verdorbenen Speisen in den Müll und den Rest in die Küchenschränke zu schaffen.
Am selben Tag, an dem das Licht neu geboren wird – und an dem auch ich in diese Welt gekommen war –, waren abends zum ersten Mal die Polarlichter zu sehen. Ich stand lange am geöffneten Wohnzimmerfenster und konnte nicht genug kriegen vom Farbenspiel über den Dächern und dem Turm der nahen Leopoldskirche. Die Wissenschaft erklärt uns, was dabei vor sich geht. Aber ist nicht das, was wir glauben wollen, viel schöner als das, was wir wissen sollen? Sonnenstürme, ja, elektrisch geladene Teilchen, die in unsere Atmosphäre eindringen und auf Sauerstoff- und Stickstoffatome treffen, auch gut. Aber wem verdanken wir, dass sich die Reaktion in solcher Pracht vollzieht? Welche Kräfte, welche Götter sind da am Werk? Bilden die Lichter eine Brücke ins Jenseits, wie man bei den Inuit vermutete? Stammen sie von den Ahnen, die ihr Unwesen am Himmel treiben? Künden sie von herannahendem Unglück? Oder sind es die über den Himmel reitenden Walküren, in deren Rüstungen sich das Mondlicht spiegelt?
Ich zählte die Glockenschläge, die der Wind von der Leopoldskirche herüberwehte. Kurz danach ließen sich wie ein Echo die Glocken der Karmeliterkirche und die der Kirche der Barmherzigen Brüder vernehmen. War es wirklich schon Mitternacht – und damit der kürzeste Tag des Jahres zu Ende? Fröstelnd riss ich mich von dem verzauberten Anblick los. Und beschloss, mich in der Badewanne wieder aufzuwärmen. Mit einem Buch in der Hand ließ ich mich bald ins wohlig-feuchte Nass sinken.
2
Es schneite, als ich die Augen aufschlug. Vom Bett aus waren die Dächer und Kamine der gegenüberliegenden Häuser zu sehen. Der Schnee hatte sie ihrer Farben beraubt und ihnen seine kühle Farbpalette aus Weiß- und Grautönen aufgezwungen. Als ich mich auf die andere Seite drehte, um einen Blick auf den Wecker zu werfen, hatte ich plötzlich ein Negativbild vor Augen: Schwarze Flocken tanzten vor einem hellen Hintergrund, gleichzeitig spürte ich einen pochenden Schmerz in den Schläfen. Ich schloss die Augen. Das schwarze Schneegestöber tobte weiter.
Ich versuchte aufzustehen, doch ein starkes Schwindelgefühl warf mich zurück aufs Bett. Als ich nach dem zweiten Versuch endlich stand, blickte ich an mir herunter. Meine Füße schienen so weit weg, als gehörten sie zu einem fremden, seltsam in die Länge gezogenen Körper. Warum hatte ich in der Nacht meinen Bademantel anbehalten? Wieso lag auf dem Boden vor dem Bett ein Badetuch? Hatte ich getrunken? Die Kopfschmerzen, die Sehstörungen, der Schwindel, alles sprach dafür. Und mir fehlte jegliche Erinnerung an den Abend davor.
Es war kalt in der Wohnung. Fröstelnd und mit seltsam staksigen Schritten setzte ich mich in Bewegung. Als hätten meine Beine über Nacht das Gehen verlernt. Als müssten sie oder ich bei jedem Schritt nachdenken, was als Nächstes zu tun sei.
Der erste Blick auf Judith war ein Blick in den Spiegel. In den Spiegel im Vorraum, an dem ich auf meinem Weg Richtung Badezimmer vorbeikam. Sie saß da an meinem Küchentisch, mit einem grauen Wintermantel bekleidet, einen dicken Schal um den Hals, eine rote Wollmütze auf dem Kopf. Ein kleines, schmales, vielleicht zehnjähriges Mädchen, dessen Namen ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, wer sie war und wie sie in meine Wohnung gekommen war. Und noch weniger ahnte ich, wie sehr sie mein Leben verändern würde.
Ich blieb an der Schwelle stehen. Mein Herz klopfte. Was sie hier mache, wollte ich wissen. Doch sie war schneller. Warum hast du mir mein Essen weggenommen? fragte sie mit Trotz und Vorwurf in Blick und Stimme. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Der Schmerz in meinem Kopf war von den Schläfen zur Stirn gewandert und pochte unvermindert weiter. Was tust du hier? Wie bist du hereingekommen? Was willst du von mir? Beinahe gleichzeitig brachen die Fragen aus mir hervor.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Ich hab zuerst gefragt: Warum hast du mir meine Vorräte weggenommen? Ich wusste noch immer nicht, wovon sie sprach, ich wusste auch nicht, ob ich es wissen sollte. Im Haus lebten seit einiger Zeit Asylwerber, vielleicht gehörte Judith zu einer der häufig wechselnden Familien. Vielleicht hatte sie Hunger, vielleicht hatte sie das Gefühl, jeder, der nicht in prekären Verhältnissen lebte, nahm ihr etwas weg. Andererseits: Ihr Deutsch verriet keinerlei Akzent. Im selben Augenblick packte mich ein Schwindelanfall, ich erwischte gerade noch mit einer Hand die Lehne der Küchenbank, auf der ich mich vorsichtig niederließ.
Erst jetzt fiel mir das seltsam diffuse, grobkörnige Licht auf: Draußen schneite es heftig, drinnen tanzten Staubkörner in den Sonnenstrahlen. Oder waren Schneeflocken und Staubkörner nur meinen Sehstörungen zu verdanken? Und das Licht und das Mädchen gleich dazu?
Ich ließ meinen Blick auf Judith ruhen. Oder versuchte es jedenfalls, denn ich hatte Schwierigkeiten beim Fokussieren. Irgendwie kam mir dieses Gesicht bekannt vor. Die klugen, fragenden Augen, aus denen eine große Neugierde am Leben sprach, aber auch viel mehr Erfahrung, als sie an Jahren haben konnte. Das energische Kinn, das Charakter und gleichzeitig eine gewisse Sturheit verriet. Die vielen Löckchen, zu denen sich ihre dunklen Haare kringelten, als wären sie sichtbarer Ausdruck von Eigensinn und verspielter Fantasie. Vielleicht lag es nur an meinem beeinträchtigten Sehvermögen oder meinem erbärmlichen Allgemeinzustand, aber ich fand in Judiths Augen und in ihrer Mundpartie eine gewisse Ähnlichkeit mit meiner Tochter. Andererseits: Seit Hannas Tod glaubte ich an vielen Acht- oder Zehnjährigen Ähnlichkeiten mit ihr zu bemerken.
Hast du Hunger? fragte ich, um zumindest irgendwie auf ihre Frage nach Essen einzugehen. Ich zählte auf, was ich zu Hause hatte. Sie sagte nichts. Ich stand auf, vorsichtig, um nicht gleich wieder vom Schwindel aus der Bahn geworfen zu werden. Zuerst mach ich uns Tee, sagte ich geschäftig. Oder magst du lieber Kakao?
Sie gab weiter keine Antwort. Ich befüllte den Wasserkocher und merkte dabei, dass meine Hände zitterten. Judith sagte etwas, ich verstand aber nicht, was, weil ich auf einem Ohr schlecht hörte. Wie bitte? Meine Eltern haben mich fortgeschickt, wiederholte sie. Aus ihrem Blick war der Trotz gewichen. Ich wusste nicht, wie ernst ich ihr Problem nehmen sollte. Oder musste. Warum denn das? Sie schaute zu Boden und zuckte mit den Schultern. Mir fiel die jüdisch-orthodoxe Familie im zweiten Stock mit ihrer stetig wachsenden Kinderschar ein. Motaev, so stand es unten am Haustor. War Judith eine der Töchter? Wo wohnst du denn? fragte ich. Sie blickte mich mit großen Augen an. Hier, sagte sie, als hätte ich eine dumme Frage gestellt. Das Pochen in meinem Kopf wurde stärker, es fiel mir schwer, mich auf das Gespräch zu konzentrieren. Aber auf welcher Nummer? wollte ich wissen. Hier natürlich, auf Tür 16, lautete ihre Antwort.
Natürlich. 16 war meine Wohnung. Ich versuchte mir ein Lächeln abzuringen. Sie macht sich einen Spaß mit mir. Ihr ist langweilig, sie streift durchs Haus auf der Suche nach Abwechslung und ein wenig Abenteuer. Sie spielt ein Spiel, eine Rolle, genauso, wie sich Hanna schon mit sechs oder sieben Jahren Fantasiegestalten ausgedacht hatte und mit verstellter Stimme in verschiedene Rollen geschlüpft war.
Im selben Augenblick hörte ich irgendwo in der Wohnung mein Telefon läuten. Ich wusste nicht, wo ich es hingelegt hatte. Geh nicht weg, sagte ich, ich bin gleich wieder da. Als ich es nach einigem Suchen in meinem Arbeitszimmer fand, hatte das Läuten aufgehört. Auf dem Display stand keine Nummer. Jetzt, da ich diese Zeilen niederschreibe, weiß ich, dass mich damals in diesen Tagen rund um Weihnachten sowohl mein ältester Freund Philipp als auch Lydias Schwester Katja vergeblich zu erreichen versuchten und sich deshalb Sorgen um mich machten.
Ich kam mit dem Telefon in der Hand zurück. Das Schwindelgefühl war von den paar schnellen Schritten durch die Wohnung stärker geworden, ich hatte Schweißperlen auf der Stirn, als hätte ich einen Berg bestiegen. Ich blieb an der Schwelle stehen. Der Wasserkocher schaltete sich gerade mit einem kurzen Pfeifton aus. Die Küche war leer.
Ich ging zur Eingangstür. Der Schlüssel hing auf dem bunten, von Hanna bemalten Brett. Offensichtlich hatte ich am Vorabend vergessen abzusperren. Der rechte Türflügel war verzogen und ließ sich zumindest in der kalten Jahreszeit von außen aufdrücken. Ich öffnete einen Spalt und horchte hinaus. Aus der Nachbarwohnung drangen gedämpfte Geräusche. Weiter unten waren Schritte zu vernehmen, jemand flüsterte ein paar Worte. Dann wurde es still.
Vielleicht spielt sie ja ihr Spiel weiter, dachte ich, vielleicht hat sie sich hier in der Wohnung versteckt. Ich sperrte ab, ging von Zimmer zu Zimmer, rief hinein, ließ meinen Blick folgen. Ich öffnete Schränke und schaute unter Betten. Von Zeit zu Zeit musste ich mich setzen und kurz verschnaufen.
Als ich die Tür zum Badezimmer öffnete, schlug mir eiskalte Luft entgegen. Und im selben Augenblick, als hätte ich beim Überschreiten der Schwelle einen Schritt in die unmittelbare Vergangenheit gemacht, war die Erinnerung an den Vorabend zumindest in Bruchstücken wieder da: Ich erinnerte mich an das Schaumbad, das ich mir eingelassen hatte. An die bleierne Müdigkeit, die mich bald überfiel. An ein Buch, das ins Wasser plumpste und mich hochschrecken ließ.
Und tatsächlich, da hing das Buch über dem Heizkörper: Arthur Schnitzlers Der Weg ins Freie. Das Wasser stand immer noch in der Badewanne. Ich zögerte, blieb unschlüssig stehen. Dann schloss ich das Fenster, ließ das Wasser ablaufen und setzte mich an den Wannenrand. Meine Hände begannen wieder zu zittern. War also der Kamin blockiert? Oder das Abzugsrohr der Heizungs- und Warmwassertherme? Waren das Zittern, die Kopfschmerzen, der Schwindel, die Sehstörungen demnach die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung?
Nach einigen vergeblichen Anrufen erreichte ich einen Notdienst, bei dem man mir versprach, Sonntagnachmittag jemanden vorbeizuschicken. Die Aussicht auf ein eisiges Wochenende in den eigenen vier Wänden behagte mir nicht, und so griff ich zur Selbsthilfe. Unter Mühen und Schmerzen holte ich Werkzeug und Leiter und rückte der Therme zu Leibe. Das Abzugsrohr wehrte sich eine Weile, bevor ich es aus der Wand bekam. Ich zündete ein Stück Papier an und hielt es in den Kamin. Gierig saugte das schwarze Loch die Flammen auf und wirbelte auch die Papierreste nach oben. Am Kamin lag es also nicht. Ich stieg auf die oberste Stufe und stellte mich auf Zehenspitzen, um von oben einen Blick in den Abzug der Therme zu werfen. Es gab nichts zu sehen, doch die Leiter hätte mich dabei beinahe abgeworfen.
Warum ich auch das Kamintürchen öffnete, das sich direkt unterhalb der Therme befand, weiß ich nicht mehr. Ich zuckte jedenfalls zurück und stieß einen unwillkürlichen Schrei aus, als mir ein schwarzes Etwas entgegenfiel und zusammen mit Ruß und Schamott vor meinen Füßen liegen blieb. Das Etwas war ein Vogel, stellte ich fest, nachdem der erste Schock sich mit der Rußwolke gelegt hatte. Zuerst dachte ich an eine Krähe oder Dohle. Doch nachdem ich den Körper vorsichtig mit dem Schraubenzieher gewendet hatte, entdeckte ich die weiße Unterseite und die langen blauschwarzen Schwanzfedern. Eine Elster also. Ich wusste wenig über Elstern außer die üblichen Gemeinplätze. Und ich glaubte zu wissen, dass sie selten mitten in der Stadt zu finden waren. Wollte sie im Kamin ein Nest bauen? Oder hatte sie sich einfach aus Neugierde in das schwarze Loch gestürzt und dann in der Enge des Kamins nicht mehr aufsteigen können?
Ich schaltete die Therme wieder ein, ließ aber zur Vorsicht das Badezimmerfenster geöffnet und dichtete die Tür von außen mit einem Badetuch ab. Bis zum Besuch des Installateurs am nächsten Tag musste das reichen. Die Entsorgung der Elster verschob ich auf später und steuerte mit Laptop und einer Kanne Tee das Sofa im Wohnzimmer an.
Zuerst las ich über Kohlenmonoxidvergiftungen nach. Nachdem es mir aus eigener Kraft gelungen war, aus dem Badezimmer zu entkommen und ich die diversen Artikel lesen und verstehen konnte, beschloss ich, zumindest vorerst auf einen Arztbesuch zu verzichten. Dann wollte ich mehr über den komischen Vogel wissen, der mich beinahe mit ins Jenseits genommen hätte. Ich hielt mich nicht lange mit den Fakten auf, die Mythen zogen mich dafür umso mehr in ihren Bann: die Geschichten darüber, dass der schwarz-weiße Vogel als diebisch verschrien war und als Todesbote galt. Dass er bei den Germanen mit der Totengöttin Hel in Verbindung stand. Dass die Elster mit Unheil und Tod assoziiert wurde, dass sie als Hexentier galt und als Seelenräuberin, die mit dem Teufel im Bunde steht. Dass sie mit einem Fluch belegt war, weil sie als einziger Vogel nach der Kreuzigung von Gottes einzigem Sohn keine Klagelieder angestimmt hatte. Sie besaß, so glaubten manche, die Fähigkeit, sich in einen Menschen zu verwandeln. Und dann war da natürlich noch die Geschichte des Pieros und seiner neun Töchter, die es gewagt hatten, die Musen zum Wettstreit herauszufordern und zur Strafe für diesen Frevel in Elstern verwandelt wurden.
Bald danach überkamen mich nicht die Musen, sondern Morpheus, und ich spann im Traum meine eigenen Mythen weiter.
Es schneite noch immer, als ich ein paar Stunden später mit der toten Elster im Gepäck aus dem Haus trat. Ich ging vor zum Donaukanal, und unter einem schneebedeckten Fliederbusch fand der geräucherte Vogel schließlich seine letzte Ruhestätte. Würmer, Insekten, Ratten und andere Tiere würden ein Festmahl abhalten, und wenn im Frühjahr der Strauch sein Blätterkleid mit duftenden Blüten zu schmücken begann, würden höchstens noch Knochenreste an sie erinnern. Komischer Vogel du, erwartest du nun eine Grabrede von mir? Du Fluchbelastete, Diebin, Seelenräuberin du! Was hab ich dir getan, dass du mir nach Leib und Seele trachtest? Was lässt du dich mit dem Pferdefüßigen ein? Was versprichst du dir von der Gunst verstaubter Göttinnen? Was forderst du die Musen heraus? Und warum singst du keine Klagelieder, wenn man es von dir erwartet? Jetzt siehst du, wo dich das hingebracht hat. Amen.
Ich fegte mir den Schnee vom Mantel und ging langsam ein Stück am Ufer entlang. Mit jedem Atemzug versuchte ich, so viel Sauerstoff wie möglich in meine Lungen zu pumpen. Bei der nächsten Brücke verließ ich den Uferweg und stapfte über die tief verschneite Treppe zur Straße hinauf. Oben angekommen, wurde ich von einem Soldaten angehalten, der nach meinem Ausweis verlangte. Seit dem Anschlag auf den Hauptbahnhof glaubte man, die Stadt durch Straßensperren und Polizeikontrollen schützen zu können. Nach einem missglückten Attentat auf den Weihnachtsmarkt Anfang Dezember hatte man Polizei- und Militärpräsenz nochmals verstärkt, und der Ausnahmezustand, der bis heute, da ich diese Zeilen schreibe, nicht aufgehoben wurde, begann sich langsam auf den Straßen und in den Köpfen einzunisten.
In der Mitte der Marienbrücke stand ein Panzer, der Schnee nahm ihm etwas von seinem kriegerischen Gehabe. Das Geschützrohr zeigte auf diese Seite des Flusses und damit auch auf mich – offensichtlich war klar, von wo der Feind kommen würde. »Mit Sicherheit für unsere Freiheit«, versprach ein Schild an der Sperre. Der Soldat, die linke Hand am Gewehrlauf, hielt meinen Führerschein in der rechten. Was haben Sie am Ufer gemacht? wollte er wissen. Ein zweiter stand unbeteiligt neben ihm und starrte an mir vorbei ins Feindesland. Sollte ich den beiden beichten, dass ich eine Leiche losgeworden war? Oder ihnen sagen, dass es sie nichts anginge? Einen Spaziergang, sagte ich. Er ließ noch ein paar Blicke zwischen meinem Ausweis und mir hin- und hergleiten, bevor er ihn mir wortlos mitsamt meiner Freiheit wieder aushändigte.
Ich ließ das Flussufer hinter mir. Wahrscheinlich machte ich irgendetwas falsch, denn mit Gewehr und Panzer im Rücken fühlte ich mich weder frei noch sicher.
Linde winkte mir zu, als ich an einem der Schaufenster des Diwan vorbeiging. Sie stand beim Obstregal und unterhielt sich gerade mit einer Kundin. Sie und ihr Mann Marwan hatten den Diwan, einen auch an Wochenenden und Feiertagen geöffneten Lebensmittelladen mit kleinem Café, vor gut zwanzig Jahren im Erdgeschoss unseres Hauses gegründet. Die beiden waren mittlerweile die einzigen Menschen, mit denen ich regelmäßig Kontakt hatte.
Linde war noch immer ins Gespräch vertieft und schickte nur ein Lächeln herüber, Marwan war nicht zu sehen. Ich kaufte Brot und Käse und Oliven und eine Packung Butterkekse und trat an die Kasse. Als ich letztere vor Marwans Neffen Karim auf den Ladentisch legte, zögerte ich. Hatte ich nicht erst am Tag davor welche gekauft? Meine Hände begannen wieder zu zittern. Und dann fiel es mir ein: Ich hatte die gleichen Kekse tags davor unter Hannas Bett hervorgeholt, zusammen mit all den anderen dort verstauten Lebensmitteln. Und im selben Augenblick, als ich dieses Bild vor meinem geistigen Auge sah, verstand ich Judiths Frage: Warum hast du mir mein Essen weggenommen? Sie musste also schon vorher in der Wohnung gewesen sein und, aus welchem Grund auch immer, die Essensvorräte in Hannas Zimmer angelegt haben. Ich bezahlte und verabschiedete mich mit dem beunruhigenden Gefühl, dass jemand, auch wenn es nur ein Kind war, sich heimlich Zugang zu meiner Wohnung verschafft hatte.
Auf halbem Weg in den letzten Stock fiel das Licht im Treppenhaus aus. Ich tastete mich vorsichtig ein paar Stufen weiter und drückte auf den nächsten Lichtschalter. Vergeblich. Die Leitungen im Haus waren veraltet, vielleicht war der Strom aber auch wegen der Sonnenstürme oder der starken Schneefälle der vergangenen Tage ausgefallen.
Auch in der Wohnung gab es kein Licht. Nachdem ich Schuhe und Jacke ausgezogen hatte, ging ich langsam in der Dunkelheit Richtung Küche.
Und dann hörte ich plötzlich Geräusche. Mein Herz, das vom Aufstieg ohnehin schneller schlug, begann zu rasen. Da war ein leises Rascheln, man hörte das gedämpfte Schließen einer Tür, dann wieder Rascheln. Ich tastete mich langsam in Richtung der Geräusche weiter. Sie schienen aus dem Kinderzimmer zu kommen. Als ich die Türschwelle erreichte, sah ich vor dem Fenster eine Silhouette vorbeihuschen. Ich wich unwillkürlich zurück. Ich zog das Telefon aus der Westentasche und schaltete die Taschenlampen-Funktion ein. Dann trat ich vor, streckte den Arm aus und richtete das Licht ins Kinderzimmer. Und im Lampenschein stand Judith vor dem Kleiderschrank und hielt sich geblendet die Hände vor die Augen.
Was … was … was machst du hier? stammelte ich entgeistert. Wie bist du hereingekommen? Was soll das? Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen vibrierte. Du wiederholst dich, sagte Judith trocken. Du hast mir mein Essen weggenommen. Und du blendest mich. Ich richtete den Lichtstrahl zu Boden. Diesmal wusste ich mit Sicherheit, dass ich die Wohnungstür abgeschlossen hatte. Aber vielleicht hatte Judith die Wohnung am Morgen gar nicht verlassen, vielleicht hatte sie sich doch irgendwo versteckt. Aber warum sollte sie das tun? Die Schmerzen in meinem Kopf waren wieder stärker geworden, die Vibrationen aus dem Boden – ein tiefes Brummen, mehr zu spüren als zu hören, als werkte irgendwo in den Tiefen des Hauses eine große Maschine – erfassten meinen ganzen Körper. Noch mal: Was tust du hier? Und was willst du von mir? Judith wich ein Stück zurück und kam direkt vor dem Kleiderschrank zu stehen. Nichts, sagte sie. Sie sah plötzlich verändert aus. Tiefe Furchen und bedrohlich wirkende Schatten hatten sich in ihr Kindergesicht gegraben und ließen es älter erscheinen. War es nur das Licht von unten? Spielten mir wieder meine Augen einen Streich?
Mir kam ein Verdacht. Was ist in dem Schrank hinter dir? Judith wich noch einen Schritt zurück und presste sich an die Tür. Nichts, antwortete sie. Ich streckte die Hand nach dem Türgriff aus. Als ich daran zog, stemmte sie sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen. Ich musste an Hanna denken. Genau an dieser Stelle hatte ich mit meiner Tochter kurz vor ihrem Tod gerauft: Sie hatte im Streit ihrer besten Freundin ein Plüschtier weggenommen und es – wie ich richtig vermutete – im Schrank versteckt. Auch sie hatte sich verzweifelt gewehrt und ungeahnte Kräfte entwickelt, sie hatte mich sogar gebissen, bevor sie schließlich weinend zusammengebrochen war. Lass ab, warnte ich nun mich selbst. Ich hatte Hanna damals zu hart angefasst, ein paar Tage später war sie tot. Und das schlechte Gewissen, ihr so kurz vor ihrem Tod irgendetwas anderes als die größtmögliche Liebe geschenkt zu haben, plagt mich bis heute. Lass ab, sagte ich mir wieder, doch irgendetwas an Judiths Gesichtsausdruck forderte mich genauso heraus, wie es meine Tochter damals getan hatte. Mit einem Ruck riss ich schließlich die Schranktür auf.
Im schwachen Licht der Telefonlampe entdeckte ich einige von den Lebensmitteln, die am Tag davor unter dem Bett gewesen waren. Judith musste sie wieder aus der Küche geholt und zwischen Hannas Kleidern versteckt haben. Irgendetwas Zähflüssiges tropfte aus einem der Fächer. Ich erkannte ein Glas Honig, das auf einem T-Shirt lag und offenbar nicht ganz dicht verschlossen war.
Ich stellte es auf, dann ließ ich die Tür langsam zugleiten. Ich bin ein freundlicher und geduldiger Mensch, sagte ich zu Judith, die am Boden vor dem Schrank saß, und ich liebe Kinder. Aber was zum Teufel soll das? Was sind das für seltsame Spiele?
Im Licht der Taschenlampe sah ich plötzlich Tränen auf ihren Wangen aufblitzen. Mein Zorn war, kaum aufgestiegen, schon wieder verflogen. Ich hockte mich vor sie hin, strich ihr über den Kopf und sprach beruhigend auf sie ein. Hast du Hunger? Sie schüttelte den Kopf. Durst? Sie nickte. Komm, sagte ich und streckte ihr die Hand hin. Nach kurzem Zögern griff sie danach und ließ sich von mir aufhelfen und aus dem Zimmer führen. Seit Hannas Tod hatte ich keine Kinderhand mehr in der meinen gespürt. Es fühlte sich schmerzhaft und großartig zugleich an.
Willst du nicht den Mantel ausziehen? fragte ich an der Schwelle zur Küche. Ich ließ ihre Hand los und streckte die meine helfend nach dem Kragen aus, als sie so plötzlich zur Seite wich, dass ich erschrak. Sie blickte mich an, als hätte ich sie zu schlagen versucht, und hielt die Arme fest vor der Brust verschränkt.
Zumindest die rote Mütze nahm sie ab, als wir dann bei Kerzenschein am Küchentisch saßen und Tee tranken. Draußen tanzten die Schneeflocken durch die Lüfte, drinnen die Schatten über die Wände. Bist du sicher, dass du nichts essen möchtest? Sie schüttelte erneut den Kopf. Natürlich hätte ich gern gewusst, warum sie dann Essen beiseiteschaffte, doch ich wollte an dieser Stelle nicht weiter in sie dringen.
Ich heiße León, stellte ich mich vor. Und du? Das ist ein komischer Name, meinte Judith, ohne meine Frage zu beantworten. Ich nickte. Meine Mutter nannte mich so, weil ich in León in Spanien geboren wurde. Und das noch dazu kurz vor Weihnachten. Das heißt auf Französisch noël, also León rückwärts gelesen. Aber ich hatte noch Glück. Ich hätte auch in Valladolid oder Zaragoza zur Welt kommen können, versuchte ich sie aufzuheitern. Oder in Wanne-Eickel oder Dnepropetrowsk. Klingt noch komischer, oder? Sie nickte mit ernstem Gesicht. Mein Name ist …, sagte sie so leise, dass ich sie nicht verstand. Du musst ein bisschen lauter sprechen, bat ich. Ich höre leider schlecht auf dem linken Ohr. Als sie den Namen wiederholte, hallte er dafür umso lauter in meinem Kopf wider wie ein mehrfach am Fels gebrochenes Echo. Judith. Judith. Judith. Das Echo vermischte sich mit dem tiefen Dröhnen, das noch immer zu hören und zu spüren war. Der Name wollte mir, so kam es mir jedenfalls vor, irgendetwas sagen. Mich auf etwas hinweisen. Doch ich verstand nicht, worauf. Sie wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht, in dem noch immer die Tränen standen. Meine Hände tasteten in den Hosentaschen vergeblich nach einem Taschentuch.
Ist alles wieder in Ordnung mit deinen Eltern? Sie blickte zu Boden. Haben sie … du hast gemeint, sie hätten dich weggeschickt? Sie nickte. Aber warum bist du dann hier und sie sind weg? Sie zuckte mit den Schultern. Täuschten mich meine Augen erneut – oder ahmten die Schatten an der Wand ihre Bewegung erst mit einiger Verzögerung nach? Sie sind auch fort, antwortete sie. Und warum haben sie dich weggeschickt? Ich war schlimm, sagte sie, ohne mich anzuschauen. Vielleicht kann ich mit ihnen reden, wenn sie zurückkommen, schlug ich vor. Möchtest du das? Sie zuckte erneut mit den Schultern und ihr träger Schatten mit ihr. Und murmelte etwas, das ich nicht verstand. Ich dachte an die Asylwerber im Haus. Und an die Zeitungsberichte über Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht ihre Eltern verloren hatten oder selbst als vermisst galten. Aber vielleicht waren Judiths Eltern einfach nur zur Arbeit oder einkaufen gegangen. Oder sie hatten Amtswege oder Arztbesuche zu erledigen. Sie kommen sicher bald zurück, versuchte ich sie zu trösten. Sie blickte auf und hing plötzlich an meinen Lippen. Glaubst du? Bestimmt, versicherte ich. Aber in der Buchhandlung sind sie auch nicht. Nun hing ich an ihren Lippen. In welcher Buchhandlung denn? Na in der Buchhandlung von meinem Papa und meinem Opa. Unten im Erdgeschoss.
Buchhandlung. Das Wort hallte in mir nach wie zuvor der Name Judith. Ich wusste, dass es da, wo sich heute der Diwan befindet, früher eine Buchhandlung gegeben hatte. Aber die gibt es doch schon seit mehr als fünfundzwanzig Jahren nicht mehr, wandte ich ein. Meine Stimme klang wie abgeschnürt. Judith schwieg.
Etwas in mir – mein Herz vielleicht oder auch meine Seele – verstand in diesem Augenblick, was mein Verstand nicht verstehen wollte. Er setzte sich mit aller Macht zur Wehr und tut es auch heute noch, da ich über diese Ereignisse berichte. Judith, so überlegte ich, war wahrscheinlich eine Enkelin des letzten Besitzers der Buchhandlung. Ich erinnerte mich an den großen, wortkargen Mann, ich erinnerte mich an seine dicke Brille und das Knarren seiner Beinprothese, wenn er auf der Suche nach einem bestimmten Buch zwischen den Regalen verschwand. Als Jugendlicher hatte ich mich ein wenig vor ihm gefürchtet, bis mir klar wurde, dass er meist sehr genau wusste, was ich lesen wollte, konnte und sollte. Ich kramte in meinen Erinnerungen auf der Suche nach seinem Namen, doch mein Kopf war offenbar zu sehr in Unordnung geraten und spielte das Spiel nicht mit. Ich erinnerte mich auch an den Tag, an dem er die ausgeräumte Buchhandlung abgesperrt hatte und ohne sich umzudrehen in sein Rentnerdasein davongehinkt war. Benedikt, platzte es plötzlich aus mir heraus. Heißt du Benedikt mit Familiennamen? Judith zog die Augenbrauen zusammen. Wie kommst du denn auf die Idee? Hieß dein Großvater Benedikt? Oder dein Urgroßvater? Sie schüttelte den Kopf. Die Kerzen auf dem Tisch flackerten stärker und ließen ihren Schatten mit noch mehr Verzögerung über die Wände huschen. Du stellst komische Fragen, sagte sie. Wie heißt du denn dann? fragte ich ungeduldig. Klein natürlich, antwortete sie.
Klein. Natürlich. Klein, so wusste ich, hießen Vater und Sohn, die die Buchhandlung kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und viele Jahre geführt hatten. Klein, so hieß auch die Familie, die einst in meiner Wohnung zu Hause gewesen war. Klein, so hießen Max und seine Schwester Lena, die ich vor mehr als zwanzig Jahren in ihrer neuen Heimat kennengelernt hatte. Erlaubte sich jemand einen schlechten Scherz mit mir? Oder schickte jemand sein Kind mit bösen Absichten vor? Aber welche Absichten – auch wenn man tagtäglich vergiftet wird mit Geschichten über Menschen, die nur das Schlechteste von einem wollen – sollten das sein? Klar, es konnte auch eine zufällige Namensgleichheit sein, denn der Name Klein war ja kein seltener Name. Doch ich wusste, dass es auch eine Judith Klein gegeben hatte: Max und Lena hatten mir Fotos von ihrer jüngsten Schwester gezeigt. Und natürlich gab es da auch noch die andere Judith, die nicht nur Max’ Enkelin, sondern auch meine erste große Liebe gewesen war. Vielleicht war die Judith, die nun vor mir saß, eine Urenkelin von Max oder Lena. Das war der letzte, wenn auch halbherzige Versuch meines Verstandes, sich aufzubäumen wider besseres Wissen. Sich verzweifelt an den Rettungsring zu klammern, um nicht in die bodenlose Tiefe gezogen zu werden. Denn ich wusste, dass es eine solche Urenkelin nicht gab. Jedenfalls nicht mit diesem Namen.
Ich stand auf. Komm, sagte ich, ich muss dir etwas zeigen. Judith ließ sich bereitwillig an der Hand nehmen. Im selben Augenblick, als wir ins Arbeitszimmer traten, ging im Haus gegenüber in einigen Fenstern das Licht an. Ich drückte auf den Schalter, auch hier gab es wieder Strom.
Judith setzte sich auf den Drehstuhl vor meinem Schreibtisch. Sie folgte mir mit ihren Blicken, als ich eine Trittleiter an ein Regal rückte, um zwei Pappkartons aus dem obersten Fach zu holen. Du hast viele Bücher, stellte sie fest, während sie sich langsam hin- und herschwingen ließ. Fast so viele wie mein Papa und mein Opa. Ich nickte. Ich stellte die Kartons auf dem Schreibtisch ab und setzte mich auf die Tischkante. Wie heißen deine Eltern? fragte ich, während ich in dem einen Karton zu kramen begann. Sie heißen natürlich auch Klein, sagte sie. Der Blick, den sie mir von der Seite zuwarf, ließ Zweifel an meiner Intelligenz erkennen. Ich meine die Vornamen. Sie drehte sich mit dem Bürostuhl einmal um die eigene Achse. Friedrich, antwortete sie. Noch eine Drehung. Und Elisabeth. Und du hattest … du hast einen Bruder und eine Schwester, beide viel älter, stimmt’s? Sie hielt in ihrer Bewegung inne und fixierte mich. Woher weißt du das? Sie heißen Max und Lena, oder? Ihre Augen wurden riesengroß. Und zum ersten Mal war Freude darin zu entdecken. Hoffnung. Ein Lächeln. Glückseligkeit. Wie in Hannas Gesicht, als Lydia und ich ihr sagten, dass sie bald einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommen würde, die sie sich so sehr gewünscht hatte. Du kennst sie? Sie sprang auf. Du kennst sie? fragte sie noch einmal und hängte sich so plötzlich an meinen Arm, dass mir die Fotos, die ich endlich gefunden hatte, aus der Hand fielen.
Statt einer Antwort las ich die Bilder vom Boden auf und legte sie auf den Schreibtisch. Es waren ein paar Jugendfotos von Max und Lena, zwei Bilder, die Judiths Eltern vor der Buchhandlung zeigten, und ein Foto, auf dem Judith als Dreieinhalb- oder Vierjährige mit kokettem Blick ins Kameraauge schaute. Judith war einen Moment lang still, während ihre Augen flink zwischen den Fotos hin und her sprangen und das Gesehene aufsogen wie ein Verdurstender den rettenden Schluck Wasser. Dann überschlugen sich ihre Worte: Woher hast du diese Fotos? Du kennst meine Eltern? Meine Familie? Wo sind sie? Wann kommen sie wieder? Bringst du mich zu ihnen?
Statt einer Antwort legte ich ihr weitere Fotos vor. Sie zeigten lächelnde Menschen vor Bergen oder Bücherwänden, Seen oder Schlössern, Momentaufnahmen eines glücklichen oder einfach nur normalen Familienlebens, in kleine Papierrechtecke gezwängte Beschwörungen des Augenblicks, vergilbt, an den Rändern gezackt, schwarz-weiß oder sepiafarben, manche davon mit Eselsohren und Flecken, Erinnerungen an das, was war und nie mehr sein wird.
Judith bestürmte mich erneut. Ich wich ihren Fragen aus, erklärte mit wenigen Worten, dass ich ihre Familie vor langer Zeit kennengelernt, aber den Kontakt verloren hätte. Ich sprach in ganzen Sätzen, gab aber höchstens halbe Wahrheiten von mir. Weil ich Judith die ganze ersparen wollte. Weil ich sie vor der Wahrheit schützen wollte. Aber du weißt, wo sie sind? hakte sie nach. Ich weiß, wo sie damals wohnten, antwortete ich vorsichtig. Wo denn? Auf einer Insel, sagte ich. Wieder so eine Halbwahrheit. Kannst du mich zu ihnen bringen? Das ist schwierig. Wieso? Die Insel ist Tausende Kilometer entfernt. Enttäuschung machte sich auf ihrem Gesicht breit. Doch dann sprang sie auf. Wir können sie anrufen, schlug sie begeistert vor. Dann, ein wenig ängstlich: Du hast doch ihre Nummer, oder? Ich schüttelte den Kopf. Die meisten Menschen auf der Insel haben kein Telefon, sagte ich. Das war nicht einmal eine halbe Wahrheit, sondern eine ganze Lüge. Dann schreiben wir einen Brief, ließ sie nicht locker. Vielleicht, versuchte ich sie zu bremsen.
Doch was ich auch tat, um ihre Begeisterung zu dämpfen, ihre Erwartungen im Zaum zu halten: Sie strahlte, sie schaute ein ums andere Mal die Fotos an, küsste sie, hängte sich an meinen Arm und tanzte übermütig durchs Zimmer.
In Gedanken trat ich ein paar Schritte zurück und aus mir heraus. Ich stand plötzlich an der Tür, ich sah mich selbst an der Schreibtischkante sitzen, sah das Lächeln, das mir Judiths ausgelassenes Treiben ins Gesicht geschrieben hatte. Ich freute mich über dieses Glück, das aus ihren Bewegungen und ihren Augen sprühte und sich in meinen eigenen spiegelte. Aber wohin brachte mich das? Was bedeutete es für mich?
Du und deine Geister. So hatte mich von Zeit zu Zeit, meist liebevoll spöttisch, manchmal aber auch mit durchaus verärgertem Stirnrunzeln, meine Frau ermahnt. Die Geister, auf die Lydia anspielte, kennt jeder, der sich dem Wort verschrieben hat: Als Schriftsteller ist man schließlich ständig von Wesen umgeben, die nicht aus Fleisch und Blut geschaffen sind. Von Wesen, die, dem Narrenturm der eigenen Fantasie entsprungen, über Monate und manchmal Jahre ihren Spuk treiben. Die, bevor sie nicht endgültig zwischen zwei Buchdeckeln ihre Wohnung bezogen haben, nur für den einen und einzigen sichtbar sind, der sie rief.
Man erschafft etwas, wo vorher nichts war. Man verleiht diesem Etwas Gestalt – das Skelett aus Gedanken, das Fleisch aus Worten gewebt, für die Adern spendet man reichlich vom eigenen Herzblut –, man gibt den neuen Wesen ein Gesicht. Man leiht ihnen eine Stimme, stattet sie mit Gedanken und Gefühlen, mit Schwächen und Stärken aus. Haucht ihnen zur Krönung eine Seele ein. Bangt mit ihnen mit, wenn sie, Kindern gleich, die ersten Schritte in die Welt tun. Und steht mit einer Mischung aus Freude und Stolz und Ehrfurcht und auch ein wenig Angst daneben, wenn sie ein Eigenleben zu entwickeln beginnen.
Zu diesem Personal, dieser Entourage, mit der jeder Schriftsteller gewissermaßen zu ebener Erde und im ersten Stock lebt – und jeder leben muss, der mit ihm Tisch und Bett und Herz und Seele teilen will –, kamen bei mir noch andere Wesen hinzu, die ich weder gerufen noch geschaffen hatte: Max Klein und seine Familie, Menschen aus Fleisch und Blut, die vor mehr als zwanzig Jahren in mein Leben getreten waren.
Ich war Mitte zwanzig, als ich zum ersten Mal auf ihre Namen stieß, und es war Linde, die den Anstoß dazu gegeben hatte. Sie hatte im Jahr davor zusammen mit ihrem Mann ein leer stehendes Geschäftslokal im Erdgeschoss unseres Hauses übernommen und darin den Diwan – Dietlinde und Marwan ergab Diwan – eingerichtet. Lindes Eltern hatten ähnlich wie meine Großeltern nie eine größere Zeit erlebt als die sieben Jahre des Tausendjährigen Reiches. Sie selbst hingegen wollte dafür sorgen, dass die Verbrechen dieser großen Zeit nicht verdrängt und vergessen wurden. Im Haus, so wurde ihr bald nach der Eröffnung des Diwan klar, boten sich genügend Gelegenheiten dazu: Drei Wohnungen, das Haus selbst und auch die Buchhandlung, die sich jahrzehntelang an der Stelle des Diwan befunden hatte, waren einst arisiert worden.
Ich studierte damals Geschichte, ich hatte die Buchhandlung als Jugendlicher gekannt und Walter Benedikt, den letzten Besitzer, sehr geschätzt. Als Linde mir von diesen Begebenheiten erzählte, war mein Interesse sofort geweckt. Als ich dann auch noch herausfand, dass die Buchhändlerfamilie bis zu ihrer Vertreibung in meiner Wohnung gelebt hatte, wurde ich euphorisch. Die Recherchen gestalteten sich langwieriger und komplizierter als gedacht, die Euphorie war durch allzu viele Misserfolge beinahe schon verflogen. Aber eines heißen Sommertages im Jahr 1999 saß ich nach einem langen Flug schließlich Max Klein gegenüber.
Max, seine Schwester und seine Enkelin wurden zu einem wichtigen Teil meines Lebens und gaben den Anstoß dazu, dass ich zu schreiben begann. Max’ Geschichte hat mich auch nach seinem Tod nicht losgelassen; er und seine Familie waren also ebenso gemeint, wenn Lydia von »meinen Geistern« sprach.
Lydia wird mich allerdings nie wieder, ob nun liebevoll oder verärgert, darauf ansprechen: Denn vor etwas mehr als drei Jahren – verflucht sei der Tag und bis in alle Ewigkeit und noch lange darüber hinaus aus dem Kalender getilgt – wurde sie schließlich selbst zum Geist. Und das Kind, das sie vier Monate später zur Welt gebracht hätte, und unsere Tochter Hanna, die schon acht Jahre in dieser Welt war, mit ihr.
Dieser verfluchte Tag wurde zur Zeitenwende in meinem Leben und teilte es in zwei Epochen: vor der Katastrophe. Und nach der Katastrophe. Schon nach wenigen Wochen in der neuen Zeitrechnung hatte ich das Gefühl, dass Lydia und Hanna zu mir in die Wohnung zurückgekehrt waren. Damals hätte ich das nie zugegeben, um nicht als abergläubisch oder hysterisch zu gelten; doch ich sprach ja ohnehin mit kaum jemandem. Und ließ selbst die nicht an mich heran, die mir – wie mein Freund Philipp oder Lydias Schwester Katja – eigentlich nahestanden.
Es gab Tage, an denen ich glaubte, Lydia und Hanna hören, spüren, sehen und sogar riechen zu können. Es gab Nächte, an denen sie mit mir bei Tisch saßen, im Bett lagen, mit mir kochten, spielten, stritten und lachten. Tage oder Nächte, in denen ich Hanna vorlas und für Lydia verliebte Gedichte schrieb. Und beide schienen mir realer als die Lebenden, die es angeblich irgendwo da draußen gab.
In der ersten Zeit nach ihrem Tod waren alle anderen Geister plötzlich verschwunden. Eifersüchtig wachten Lydia und Hanna darüber, dass sie, und nur sie, in meinem Leben eine Rolle spielten. Du sollst neben mir keine anderen Geister haben, lautete ihr Gebot, das mir zum Mantra wurde und mir in Fleisch und Blut überging.
Doch eines Tages meldeten sich die verdrängten Geister zurück. Die von Max Klein und seiner Familie, aber auch die, die ich gerade erst für meinen neuen Kurzgeschichtenband aus der Flasche gezaubert hatte. Sie saßen auf Schränken und unter Tischen, sie sprangen mich aus den Büchern anderer Autoren an, sie lugten aus Fotografien hervor und winkten mir fröhlich zu. Wir haben noch eine Rechnung offen, sagten sie mit diesem gewissen Augenzwinkern. Und pochten sanft, aber bestimmt auf ihre älteren Rechte. Allen Versuchen Lydias und Hannas und meinem eigenen schlechten Gewissen zum Trotz spukten auch sie nun wieder durch meine Gedanken von morgens bis abends. Und besuchten mich nachts in meinen Träumen, wo sie sich manchmal mit Hanna und Lydia gegen mich verbündeten.
Heute, da ich an meinem Schreibtisch sitze und über diese Ereignisse schreibe, bin ich zu den Lebenden zurückgekehrt. Aber damals, zwei Jahre nach der Katastrophe, war ich noch nicht bereit dazu, die Toten gehen zu lassen. Und sie mich ebenso wenig. Ich lebte mit ihnen und sie mit mir, wir hatten es uns durchaus wohnlich eingerichtet, und so erstaunte mich Judiths Auftauchen nicht besonders. Ich hieß sie also willkommen in meinem Geisterhaus.
3
Was machst du da? fragte Judith. Ich zuckte zusammen, als sie plötzlich im Arbeitszimmer neben mir stand. Sie war am Tag davor verschwunden, während ich auf der Toilette war. Auch jetzt hatte ich sie nicht kommen gehört. Ich schreibe, sagte ich. Was denn? Ich schloss das Dokument, in dem ich mir gerade ein paar Gedanken zu Judith und ihrer Familie notiert hatte. Bücher, antwortete ich. Sie hob, offenbar beeindruckt, eine Augenbraue. Auch ich war beeindruckt: Als Dreizehn- oder Vierzehnjähriger hatte ich Stunden vor dem Spiegel verbracht, bis es mir endlich gelungen war, die rechte Augenbraue zu heben, ohne dabei das ganze Gesicht zu verziehen. Mein Bruder ist auch ein Schriftsteller, sagte sie. War auch, müsste es natürlich heißen, doch ich hütete mich, Judith zu verbessern. Max war vor zehn Jahren gestorben, die wenigen Erzählungen, die er verfasst hatte, hatte ich alle gelesen, und sie waren von großem Einfluss auf meine eigenen gewesen. Ich weiß, antwortete ich. Er hat Geschichten für mich geschrieben, fuhr Judith fort. Nur für mich. Diesmal hob ich eine Augenbraue. Davon hat er mir nie erzählt, sagte ich.
Sie begann, mit dem rechten Fuß Halbkreise auf den Parkettboden zu zeichnen, mit einer Hand stützte sie sich dabei auf dem Tisch ab. Erfindest du auch Geschichten für Kinder? Ich zögerte mit meiner Antwort. Ich hatte mit einem Buch für Hanna begonnen, es aber nach ihrem Tod zur Seite gelegt. Nein, bis jetzt nicht, antwortete ich mit gesenktem Blick.
Und dann wollte sie noch einmal die Fotos sehen. Mit den Fotos tauchten natürlich neue Fragen zu ihren Eltern auf. Und sie fragte so lange, bis ich ihr nicht nur das Versprechen gab, einen Brief aufzusetzen, sondern auch tatsächlich begann, Papier mit Schriftzeichen zu füllen. Hätte ich ihr die Bitte abschlagen und ihr sagen sollen, dass ihre Eltern und Geschwister längst tot waren? Hätte ich das Glück, in dem sie sich gerade sonnte, gleich wieder zerstören sollen? Nein, ich entschied mich in diesem Moment spontan dazu, diese zarte Pflanze zu nähren und zu pflegen und damit der Ewigkeit des Todes ein wenn auch noch so vergängliches Stück Leben abzutrotzen.
Du musst schreiben, hatte sie bestimmt. Ich hatte gehorcht. Und ließ aus dem Herzen in die Feder fließen, was ich als Vater gern lesen würde, wäre mein Kind plötzlich am anderen Ende der Welt von den Toten auferstanden: dass Judith bei mir aufgetaucht, dass sie gesund und wohlauf sei, dass sie bei mir bleiben und ich für sie in jeder nur erdenklichen Weise sorgen könne, solange es sich als nötig erweisen sollte. Und nachdem ich darauf bestand, dass Judith zumindest ein paar eigene Worte hinzufügen müsse, schrieb sie darunter: Bitte kommt mich bald holen. Oder ich komme zu euch. Ich verspreche, ich werde nie, nie, nie wieder schlimm sein! Und León schreibt Bücher, aber leider nur für Erwachsene. In innigster Liebe, eure Tochter Judith.
So, und jetzt gehen wir zur Post, schlug ich vor, nachdem sie ihre zierliche Unterschrift unter den Brief gesetzt hatte. In ihrem Blick, in dem gerade noch Hoffnung und Freude gelegen waren, stand so plötzlich das Entsetzen, dass ich erschrak. Bist du verrückt! Wir können doch nicht einfach auf die Straße gehen! rief sie aus. Warum denn nicht? reagierte ich bestürzt. Warum nicht? Weil wir Juden sind, darum!
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Mit beschwichtigenden Worten versuchte ich ihr die Angst zu nehmen, aber sie hielt sich daran fest, als läge in der Angst die Rettung. Ich stand auf. Komm, sagte ich und streckte ihr die Hand hin. Doch sie sprang auf und rannte aus der Küche.
Ich blieb sitzen. Ein Zittern lief durch meinen Körper, mein Mund war trocken, obwohl ich viel Tee getrunken hatte. Als ich schließlich aufstand, fühlte ich mich, als wäre ich ein paar Stockwerke hochgerannt. Ich fand Judith unter Hannas Bett. Ich ließ mich langsam auf den bunten Bettvorleger sinken und lehnte mich an den Nachttisch. Genauso war ich früher hier gesessen, wenn Hanna sich nach einem Streit aus Verzweiflung oder Zorn oder Scham oder Angst unter dem Bett verkrochen hatte. Und ich sprach auf Judith ein wie einst auf Hanna. Sie drehte sich von mir weg und hielt sich die Ohren zu.
Mein Blick schweifte durch den Raum. Ich hatte nichts verändert seit Hannas Tod, hatte nichts weggeräumt. Nicht einmal das unfertige Puzzle oder die Schachtel mit ihren Lieblingsbuntstiften. Und schon gar nicht ihre Igel-Sammlung. Von Zeit zu Zeit überlegte ich, das Zimmer zu vermieten oder an einen Flüchtling zu vergeben. Irgendwann würde ich wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen darauf angewiesen sein, aber noch konnte ich mich nicht dazu aufraffen. Auch Kleider und Bücher und Spielsachen müsste man verkaufen oder verschenken, doch jedes Mal, wenn ich daran dachte, hatte ich das Gefühl, mein eigenes Kind zu verraten.
Dann kam mir eine Idee. Weißt du, welcher Tag morgen ist? Judith gab keine Antwort, nahm aber die Hände von den Ohren. Morgen ist Weihnachten. Sie reagierte nicht. War ihr Weihnachten nicht wichtig? Doch ich wusste aus Erzählungen und von Fotos, dass die Kleins genauso wie viele andere Wiener jüdische Familien Weihnachten gefeiert hatten. Sie drehte sich langsam zu mir und betrachtete mich prüfend. Wirklich? fragte sie dann. Ja, wirklich, sagte ich ernst. Plötzlich war da freudige Erwartung in ihrem Blick. Und erlosch so schnell, wie sie gekommen war. Aber ich bin nicht bei Mama und Papa und Max und Lena und Oma und Opa, stellte sie enttäuscht fest. Du kannst mit mir feiern, versuchte ich sie zu trösten. Sie sagte nichts. Du kannst überhaupt hierbleiben, solange du möchtest. So, wie ich es deinen Eltern versprochen habe. Die Wohnung ist groß genug und es gibt genug zu essen für uns beide. Sie schien mich nicht zu verstehen. Aber ich bin doch hier, sagte sie verunsichert. Jetzt bist du da, sagte ich, aber ich meine, du … du kannst die ganze Zeit hierbleiben, hier schlafen, hier wohnen, du musst nicht weggehen. Aber ich wohne doch hier, sagte sie, immer noch Unverständnis im Blick.
Dann unternahm ich einen letzten Versuch. Ich muss einkaufen gehen, sagte ich. Wenn du möchtest, könnten wir gemeinsam einen Weihnachtsbaum aussuchen. Sie sah mich an, doch ihr Blick verlor sich im Nirgendwo. Wir könnten auch einen Schneemann bauen. Oder eine Schneefrau, wenn dir das lieber ist. Oder wir machen eine Schneeballschlacht. Was meinst du? Sie schaute durch mich hindurch und schüttelte nur fast unmerklich den Kopf.
Obwohl ich bewusst langsam aufstand, überfiel mich trotzdem starker Schwindel. Gerade noch rechtzeitig fand ich Halt am Türgriff des Kleiderschranks. Geh bitte nicht weg, bat ich sie, ich bin bald wieder da. Sie hatte die Augen geschlossen und gab keine Antwort.
Ich betrat den Diwan durch den Hintereingang, der das Geschäftslokal direkt mit der Hauseinfahrt verband. Hallo León, grüßte Linde. Hast du schon unsere Weihnachtsüberraschung gesehen? Sie deutete mit gequältem Lächeln auf die Schaufenster. Nun trat ich doch durch den Haupteingang auf die verschneite Straße hinaus. »Deutsche, verteidigt eure deutsche Werte und kauft nicht beim Kanaken«, so stand es in riesigen Lettern über drei Schaufenster und die dazwischen liegende Hausfassade hinweg. Wenn diese Leute wenigstens Rechtschreibung und Grammatik beherrschten, war mein erster Gedanke. Aber andererseits: Wäre es dann wirklich weniger schlimm?
Ich ging wieder hinein und versuchte Linde zu trösten. Du siehst fürchterlich aus, stellte sie schließlich besorgt fest. Anscheinend hab ich mir irgendeinen Virus eingefangen, log ich. Linde warf mir einen prüfenden Blick zu. Obwohl sie nur ein paar Jahre älter war als ich, hatten ihre Blicke seit Lydias und Hannas Tod immer etwas Mütterlich-Besorgtes. Pass auf dich auf, sagte sie zum Abschied, und es klang fast beschwörend.
Ich stellte meine Einkäufe in der Küche ab, dann ging ich ins Kinderzimmer. Judith lag nicht mehr unter Hannas Bett. Und sie war auch sonst nirgendwo zu finden. Wo war sie eigentlich, wenn sie sich nicht bei mir in der Wohnung aufhielt? Oder war sie immer noch hier, aber für mich nicht mehr sichtbar? Der Gedanke hatte etwas Beklemmendes, ich weiß nicht, warum. Zum Glück läutete es in diesem Augenblick am Haustor, der Installateur meldete sich an. Zwanzig Minuten später bestätigte er mir schwarz auf weiß, was ich ohnehin vermutet hatte: dass Therme und Kamin einwandfrei funktionierten.
Mit einer Kanne Grüntee setzte ich mich an den Schreibtisch. Doch ich war unentschlossen, woran ich arbeiten sollte: am lange geplanten und immer wieder unterbrochenen Roman über Max Klein. Oder am Kurzgeschichtenband, den ich nach der Katastrophe begonnen hatte. Für den Letzteren hatte ich einen Verlagsvertrag. Doch für den Roman waren mir gerade erst ein paar neue Ideen gekommen. Ich war nämlich einige Wochen vor Judiths Auftauchen auf ein ganz bestimmtes Buch gestoßen – oder das Buch vielleicht auch auf mich –, und zwar in einem jener offenen Bücherschränke, in die Bücher zur freien Entnahme gestellt werden. Es war ein Band von Arthur Schnitzler, eine antiquarische und, wie ich enttäuscht hatte feststellen müssen, nicht besonders gut erhaltene Ausgabe von Der Weg ins Freie. Doch dann war mir der vergilbte Zettel auf der Innenseite des Umschlags aufgefallen: »Fröhliche Festtage wünscht Ihnen Ihr Buchhändler Anton Jakob Klein.«
Ich hatte es als Zeichen gesehen, dass dieses Buch in meine Hände gelangt war. Es hatte mich mit neuen Ideen zum Roman über die Familiengeschichte der Kleins erfüllt, und die versuchte ich seither neben der Arbeit an den Kurzgeschichten festzuhalten. Die Tatsache, dass das Buch mir nun sogar das Leben gerettet hatte. Die Tatsache – wenn es denn eine war –, dass Judith aufgetaucht war: Waren das nicht weitere, noch viel deutlichere Zeichen, die ich unmöglich ignorieren konnte und durfte? Waren es die Geister, die mich nötigten, ihre Geschichte aufzuschreiben, bevor es endgültig zu spät war? Bevor sich ihre Geschichte wiederholte? Oder: damit sie sich nicht wiederholte?
An diesem Abend vor Weihnachten entschied ich mich für den Roman. Und dafür, die Kurzgeschichten vorerst ruhen zu lassen. Zuerst notierte ich mir ein paar Gedanken, die mir während des Tages gekommen waren. Dann griff ich nach dem Stapel Notizbücher, die ich ein paar Tage zuvor aus dem Regal geholt hatte. Es waren sechs Stück, alle sahen gleich aus – schwarzer Kunstledereinband, Format A5, glattes Papier –, alle stammten aus den Jahren 1999 und 2000, und ich hatte darin mit akribischer Genauigkeit meine Gedanken über die ersten Begegnungen mit Max Klein und seiner Familie festgehalten.
Natürlich hatte ich sie auch bei meinen früheren Anläufen für den Roman zurate gezogen, doch seither war eine Weile vergangen. Nun stürzte ich mich also erneut in die Lektüre und exzerpierte Stellen, die mir wichtig erschienen. Bald aber überfielen mich Kopfschmerzen und Schwindelgefühle, sodass ich die Arbeit unterbrechen musste.
Ich ging früh zu Bett, und es war kurz nach zwei Uhr morgens, als ich mit klopfendem Herzen aus einem Traum hochschreckte. Lydia und Philipp hatten sich darin gegen mich verbündet, mehr war mir nicht in Erinnerung geblieben. Nachdem ich nicht wieder einschlafen konnte, stand ich auf und holte mir ein Glas Wasser. Von der Küche aus beobachtete ich das Treiben der Schneeflocken vor dem Fenster. Und musste wieder an meinen Traum denken.
Philipp Hensel war mein ältester und engster Freund. Wir kannten uns von den zwei Semestern Kunstgeschichte, die wir beide studiert hatten, bevor ich zur Geschichte und er zur Architektur gewechselt hatte. Er war als Mitbewohner eingezogen, nachdem meine Mutter ihrem neuen Lebensgefährten nach München gefolgt war. Und erst ausgezogen, als Lydia, im zweiten oder dritten Monat schwanger mit Hanna, ihre eigene Wohnung aufgab und endgültig hierher übersiedelte.
Wir waren Freunde geblieben, und er und seine Frau Lina hatten mich nach der Katastrophe zu unterstützen versucht, wo sie nur konnten, auch jetzt, wo sie für zwei Semester in Edinburgh lebten und nur selten nach Wien kamen. Doch es lag an mir, dass ich auf ihre Versuche nicht eingegangen war. Dass ich zwar am Telefon mit den beiden sprach, mich aber nicht dazu überwinden konnte, sie zu sehen. Etwas in mir wehrte sich dagegen – und nicht nur bei den beiden –, ich wusste selbst nicht, was. Wollte der Traum mir sagen, dass ich meinen Widerstand endlich aufgeben sollte?
Ich nahm noch einen Schluck Wasser. Ich war zu munter, um wieder zu Bett zu gehen. Die Katastrophe hatte neben vielen anderen Dingen auch meine Schlafgewohnheiten verändert. Ich wollte nichts von der Welt da draußen und die Welt noch weniger von mir. Und so legte ich mich oft bei Tageslicht hin und stand nachts auf, um zu lesen, fernzusehen oder zu arbeiten. Manchmal schlief ich drei oder vier Stunden, dann wieder zehn oder zwölf. Und gerade in den Wintermonaten fiel es mir schwer, Tag und Nacht auseinanderzuhalten.
Zuerst machte ich mir Notizen zum Roman, dann zu einer Geschichte, deren Idee mir ein paar Tage zuvor gekommen war. Schließlich spürte ich, wie die Müdigkeit von mir Besitz ergriff. Ich legte mich ins Bett und schaltete den Fernseher ein.
Ich hatte das Gerät kurz nach der Katastrophe gekauft, weil ich mir einredete, mich informieren zu müssen. Weil ich glaubte, die Einsamkeit und Stille in der Wohnung bekämpfen zu können. Und weil ich, wenn ich schon nicht in die Welt hinausging, dann die Welt wenigstens zu mir holen wollte. Wenn Hanna mich jetzt sehen könnte, wäre sie wahrscheinlich beleidigt, weil Lydia und ich uns immer geweigert hatten, einen Fernseher zu kaufen. Lydia würde wohl nur ein liebevoll spöttisches Lächeln aufsetzen. Aber vielleicht wussten die beiden ohnehin längst davon, vielleicht saßen oder lagen sie, ohne es mich merken zu lassen, neben mir und starrten mit mir gemeinsam durch dieses seltsame Fenster in die Welt hinaus.
Das Bild, das sich mir – oder uns dreien – vor diesem Fenster bot, erschien mir allerdings immer unwirklicher. Nicht nur die bizarre Wirklichkeit der »Reality«-Shows. Nicht nur die leeren Versprechen der Werbung. Nicht nur die falschen Hoffnungen der Castingshows. Sondern auch die so genannten Fakten in Nachrichten, Reportagen und Dokumentationen. Die Berichte über blutige Kriege in weiter Ferne. Über heimtückische Anschläge in allzu großer Nähe. Über drakonische Maßnahmen zur Verhinderung solcher Attentate. Über die schleichende Aushöhlung demokratischer Errungenschaften. Über Zäune, Mauern, Sperrbauten und waffenstarrende Patrouillen vor den Toren Europas. Sollte und konnte das in seiner Schrecklichkeit alles wahr sein? Oder bildete ich mir diese Ereignisse – und die Berichterstattung darüber – nur ein? So, wie ich mir vielleicht auch Judiths Auftauchen nur einbildete?