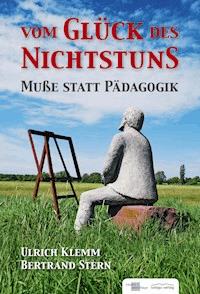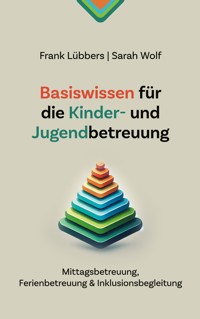
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt einen guten Einblick für Quereinsteiger, die sich um einen Arbeitsplatz im sozialen Bereich in der Kinder- und Jugendbetreuung bemühen. Schwerpunkte sind die Vermittlung von Basiswissen in den Bereichen Mittagsbetreuung, Ferienbetreuung und Inklusionsbegleitung. Die wichtigsten praktischen Themen rund um den Alltag in einer Betreuung und theoretisches Wissen erleichtern den Einstieg ins Berufsleben. Dieses Buch gibt einen guten Einblick für Quereinsteiger, die sich im sozialen Bereich der Mittags-/Ferienbetreuung und Inklusionsbegleitung engagieren möchten. Schwerpunkte sind die Vermittlung von theoretischem Basiswissen, um den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Kinderbetreuung, ein Job der beiden Seiten Spaß macht und bereichernd ist.
Warum erwähnen wir das so besonders?
Heutzutage ist der Bereich der Kinderbetreuung ein breit gefächertes Arbeitsfeld mit vielen Aufgaben und Herausforderungen.
Jeder Tag ist anders und jeden Tag gibt es neue Situationen, die es zu meistern gilt.
Es gibt 3 große Themenblöcke:
Die Mittagsbetreuung, in der die Kinder vielleicht müde, aufgebracht oder neugierig nach der Schule zu uns stoßen.
Die Integrationsbegleitung, die geprägt von einem engen Kontakt und der Vermittlung von sozialen Kompetenzen/ Lernstoff ist.
Die Ferienbetreuung, in der man viele Ideen gemeinsam erarbeiten und umsetzen kann.
Für »Neulinge« und Quereinsteiger ist es dann hilfreich, bereits über viele verschiedene Situationen, Rechtslagen und
Vorgehensweisen gehört zu haben.
Wir haben selbst als Quereinsteiger in der Kinderbetreuung angefangen und waren lange auf der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten, mit praxisnahen Infos zur Bewältigung unseres Alltags.
Leider sind wir dabei nur auf sehr komplexe und langwierige Ausbildungen gestoßen, die uns selbst abgeschreckt haben und uns nicht »auf die Schnelle« helfen konnten. Vermittlung von praxisnahem Grundwissen auf kurzem Wege, Einblicke in die verschiedenen Elemente der Kinderbetreuung, gab es einfach nicht.
Aus diesem Grund haben wir uns selbst auf den Weg gemacht und angefangen viele Themen zu sammeln. Daraus wurden dann im Laufe eines halben Jahres immer mehr, so dass es ein komplettes Schulungskonzept wurde, das euch ohne Stress flexibel Grundwissen näherbringt.
Wir freuen uns, euch ein Stück weit dabei begleiten zu dürfen.
»AUF« – in eine Betreuung voller Spaß und gegenseitiger Bereicherung.
Frank und Sarah
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Die Mittagsbetreuung in der Praxis
3. Ferienbetreuung
4. Schulbegleitung – Anforderungen, Herausforderungen und Perspektiven
5. Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern
6. Die vier Säulen der „Pfadfinderischen Methode“
7. Konflikte, Grenzen und Mobbing in der Jugendbetreuung
8. Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit
9. Die Bedürfnisse von Kindern und ihre Betreuung
10. Erziehungsstile
11. Gewaltfreie Kommunikation – Ein Weg zu Empathie und Verständnis
12. Kinderrechte – Eine Einführung
13. Kindeswohlgefährdung – erkennen, verstehen und handeln
14. Verhalten im öffentlichen Verkehr
15. Datenschutz, Urheberrecht und Bildrechte in der Kinder- und Jugendarbeit
16. Erfolgreiche Hausaufgabenbetreuung
17. Inklusion und die UN-Behindertenrechtskonvention
18. Umgang mit Gewalt und Deeskalation
19. Essensausgabe und Hygiene
20. Interkulturelle Kompetenz in der Arbeit mit Kindern
21. Das Sexualstrafrecht in Deutschland
22. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit in der Kinderbetreuung
23. Queer – Vielfalt der Geschlechter und sexuelle Orientierung
24. Führungsstile und ihre Auswirkungen
25. Hygiene und Sicherheit bei der Essensausgabe in Kinderbetreuungseinrichtungen
26. Das Jugendschutzgesetz in Deutschland
27. Das Verbandsbuch – Dokumentation, Rechtliches und Praxisleitfaden
28. Entwicklungspsychologische Grundlagen
29. Grundlagen der Spielpädagogik
30. Spiele für die Ferienbetreuung
31. Formulare im Kontext von Bildung und Betreuung
32. Handynutzung in Schulen und Ferienbetreuungen
33. Versicherungen in der Kinder- und Jugendbetreuung
34. Arbeits- und Anstellungsarten in Deutschland
35. Nachwort
36. Quellenangaben
Die Mittagsbetreuung in der Praxis
Einleitung
Die Mittagsbetreuung ist ein zentraler Bestandteil der Ganztagsbetreuung von Kindern. Sie bietet nicht nur eine sichere Umgebung nach dem Schulunterricht, sondern fördert auch die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder. In diesem Kapitel werden die Ziele, die Tagesstruktur, die verschiedenen Betreuungsbereiche sowie Verhaltensrichtlinien für Kinder und Betreuer behandelt.
Ziele der Mittagsbetreuung
Die Mittagsbetreuung verfolgt mehrere zentrale Ziele:
Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung:
Kinder lernen, in Gruppen zu interagieren, Konflikte zu lösen und Rücksicht auf andere zu nehmen.
Hausaufgabenunterstützung:
Strukturierte Zeitfenster und gezielte Unterstützung fördern selbstständiges Lernen.
Gesunde und hygienische Mittagsmahlzeiten:
Vermittlung gesunder Essgewohnheiten und Förderung von Tischmanieren.
Förderung kreativer und sportlicher Aktivitäten:
Abwechslungsreiche Angebote unterstützen die motorische und kreative Entwicklung.
Tagesstruktur
Ein Beispiel für eine strukturierte Tagesplanung:
11:00 – 12:00 Uhr:
Freies Spiel
12:00 – 13:00 Uhr:
Mittagessen
13:00 – 14:00 Uhr:
Hausaufgabenbetreuung
14:00 – 16:00 Uhr:
Aktivitäten (kreativ oder sportlich)
Es ist zu beachten, dass sich die Zeiten je nach Unterrichtsende und Abholzeiten der Kinder flexibel gestalten lassen.
Essen in der Mittagsbetreuung
Ein angenehmes Umfeld und strukturierte Abläufe fördern ein harmonisches Miteinander:
Förderung gesunder Essgewohnheiten und Tischmanieren
Berücksichtigung von Allergien und besonderen Ernährungsbedürfnissen
Einhaltung von Regeln (z.B. Händewaschen, kein Rennen oder lautes Schreien)
Kinder zur Übernahme von Verantwortung anregen (z.B. Tische abräumen)
Spielzeit
Die Spielzeit ist entscheidend für die ganzheitliche Entwicklung:
Freies Spiel:
Förderung von Kreativität und sozialem Lernen
Geplante Aktivitäten:
Bastelangebote, Themennachmittage
Balance von Indoor- und Outdoor-Spielen: Kreativstationen, Leseecken, sportliche Aktivitäten im Freien
Spielmaterialien, Bastelmaterial bereitstellen
Konfliktlösung während des Spiels
Hausaufgabenbetreuung
Ziel ist eine ruhige Lernatmosphäre, die eigenständiges Arbeiten fördert:
strukturierte Zeitfenster
Unterstützung bei Schwierigkeiten
Förderung von Eigenverantwortung und Frustrationstoleranz
Soziales Verhalten
Kinder untereinander:
Respekt, Rücksichtnahme, gewaltfreie Kommunikation, Teamarbeit
Erzieher gegenüber Kindern:
Vorbildfunktion, klare Grenzen setzen, positives Feedback, konstruktive Kritik
Evaluation und Feedback
Ein kontinuierlicher Austausch sichert die Qualität der Betreuung:
teaminterne Reflexion
Gespräche mit Eltern und Lehrern
Feedback von Kindern
schriftliche Dokumentation unter Beachtung des Datenschutzes
Schlussfolgerung
Die Mittagsbetreuung ist mehr als nur eine Betreuungsmöglichkeit. Sie bietet Raum für ganzheitliche Förderung durch eine ausgewogene Mischung aus Lernen, Spielen und sozialen Erfahrungen. Sie ist eine ganzheitliche Förderung der Kinder durch eine Kombination aus strukturiertem Lernen, kreativen Aktivitäten und freiem Spiel.
Mittagsbetreuung vs. Offene Ganztagsschule (OGTS)
Ein Vergleich zeigt die Unterschiede in Struktur, Angeboten und Kosten:
Mittagsbetreuung
Zielgruppe: meist Grundschüler
Betreuungszeiten: meist bis ca. 14:00 oder 16:00 Uhr
Angebote: Freizeitaktivitäten, Hausaufgabenbetreuung
Kosten: meist kostenpflichtig
Offene Ganztagsschule (OGTS)
Zielgruppe: Grund- und weiterführende Schüler
Betreuungszeiten: Nachmittags bis ca. 16:00 Uhr
Angebote: Strukturierte Freizeit, verpflichtende Lern- und Förderzeiten
Organisation: an der Schule angebunden, festgelegte Tage
Kosten: kostenpflichtig (abhängig von Bundesland), Zusatzkosten für Mittagessen möglich
Offener vs. Gebundener Ganztag
offene Ganztagsschule:
freiwillige Teilnahme, flexibel in den Tagen
Betreuung offene Form am Nachmittag.
gebundene Ganztagsschule: verpflichtende Teilnahme, fest in den Schultag integriert, über den ganzen Tag verteilt
Struktur: Gebundene Ganztagsschule ist stärker strukturiert und integriert Freizeitaktivitäten im Stundenplan
Reflexion
Was sind die Unterschiede zwischen offenem und gebundenem Ganztag?
Welche der Betreuungsarten ist kostenpflichtig?
Nenne drei Punkte für das Verhalten von Betreuern/innen gegenüber Kindern.
Ferienbetreuung
Einleitung
Ferienbetreuung für Kinder ist ein essenzieller Bestandteil moderner Kinderbetreuung. Sie bietet eine strukturierte und abwechslungsreiche Tagesgestaltung, die den individuellen Bedürfnissen von Kindern gerecht wird. Dieses Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über die Planung, Struktur, Outdoor-Aktivitäten, Verpflegung und den Umgang mit Unfällen und Verletzungen in der Ferienbetreuung.
Überblick Ferienbetreuung
Ziel der Ferienbetreuung:
Spaß und Freude,
Erlebnisse in einer sicheren und interessanten Umgebung.
Tagesstruktur:
Gibt Sicherheit für Kinder und Personal.
Flexible Pläne:
Anpassung an Wetter, Stimmung und Bedürfnisse.
Programmgestaltung durch Themenwochen auch wochenweise möglich z.B. Natur erleben, Kreativwerkstatt, Workshops, Sport
Planung und Struktur des Tagesablaufs
Ein klar strukturierter Tagesablauf bietet Kindern Sicherheit und Orientierung. Die Planung sollte flexibel genug sein, um spontane Bedürfnisse zu berücksichtigen, aber auch feste Ankerpunkte enthalten.
Beispielhafter Tagesplan
08:00 – 09:00 Uhr
Begrüßung und Freispiel
09:00 – 10:00 Uhr
gemeinsames Frühstück
10:00 – 12:00 Uhr
Outdoor-Aktivitäten (z. B. Bewegungsspiele, Naturerkundung)
12:00 – 13:00 Uhr
Mittagessen
13:00 – 15:00 Uhr
Kreative Workshops (Basteln, Malen)
15:00 – 16:00 Uhr
Freispiel und Abholung.
Outdoor-Aktivitäten: Bewegung und Natur erleben
Outdoor-Aktivitäten sind für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern unverzichtbar. Sie fördern nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch soziale Kompetenzen.
Beispiele für Outdoor-Aktivitäten
Naturerkundung
Waldspaziergänge und Beobachtungen von Tieren
Bewegungsspiele
Gruppenspiele wie »Fangen« oder »Verstecken«
Bauprojekte
Bau eines kleinen Unterschlupfs mit Ästen und Blättern
Tierische Begegnungen
Bauernhof, Streichelzoo, Tierpark
Tiere und Natur erleben
Verpflegung: Warmes Mittagessen vs. Brotzeit
Eine ausgewogene Ernährung ist für Kinder von zentraler Bedeutung. Die Entscheidung zwischen einem warmen Mittagessen oder einer Brotzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Verfügbarkeit und Vorlieben der Kinder.
Vor- und Nachteile
Warmes Mittagessen
Vorteil: Ausgewogene Mahlzeit mit wichtigen Nährstoffen.
Nachteil: Aufwendige Organisation und ggf. Kosten, abhängig vom Zeitpunkt der Lieferung
Brotzeit
Vorteil: Flexibel und einfach vorzubereiten.
Nachteil: Begrenzte Möglichkeit, warme Speisen anzubieten.
Empfehlung:
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, bei warmen Mahlzeiten auf eine hohe Vielfalt an Gemüse, Vollkornprodukten und proteinreichen Lebensmitteln zu achten.
Allgemeine Hinweise zu Essen und Hygiene
Essen allgemein
kindgerecht
Snacks aus Obst und Gemüse
Allergien und Unverträglichkeiten beachten
besondere Ernährungsweisen
Hygiene allgemein
Hände waschen sowohl Kinder als auch Betreuer
Desinfektion der Hände und Oberflächen
Sauberkeit der Küche, Geschirr, Gläser, Besteck, Kühlschrank usw.
Räume lüften und reinigen, Müll entsorgen und trennen
Hygienekonzept gemäß Vorgaben einhalten
Allgemeine Hinweise im Umgang mit Unfällen und Verletzungen
Prävention und Aufsicht:
Verhaltensregeln erklären und Aufsichtspflicht beachten.
Erste Hilfe leisten: Sofortmaßnahmen wie Desinfektion, Pflaster.
Notfälle erkennen: Schwerere Verletzungen erfordern den Notruf (112).
Kinder beruhigen: Wichtig für schnelle Genesung.
Kinder sind beim Spielen und Entdecken oftmals unvorsichtig, was zu kleineren Verletzungen führen kann. Ein klarer Notfallplan ist daher essenziell.
Erste Schritte bei einem Unfall:
Ruhe bewahren
und die Situation einschätzen.
Wundversorgung
Reinigung kleiner Wunden und Auftragen eines Pflasters.
Dokumentation
Alle Vorfälle müssen im Verbandsbuch festgehalten werden.
Alle Betreuer sollten mit dem Verbandsbuch vertraut sein.
Wichtige Informationen zum Verbandsbuch
Laut den Richtlinien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) muss ein Verbandsbuch folgende Angaben enthalten:
Datum und Uhrzeit des Unfalls.
Name des Kindes.
Art der Verletzung.
Ergriffene Maßnahmen.
Zusatzhinweis
Bei schwereren Verletzungen ist sofort medizinische Hilfe einzuleiten.
Kosten und Organisation
Die Ferienbetreuung muss finanzierbar sein und dennoch eine hohe Qualität bieten.
Der Jugendhilfeausschuss sowie Landesjugendämter können evtl. unterstützende Ressourcen bereitstellen.
Die Kosten sind variabel und nach Anbieter/Träger/Leistung verschieden.
Finanzierungsquellen
Beiträge der Eltern
Zuschüsse von Kommunen
Fördermittel durch Bildungs- und Freizeitprogramme
Reflexion
Wie könnte eine Tagesstruktur aussehen?
Was sind die Vor-/Nachteile zwischen warmen Mittagessen und Brotzeit?
Was sind die Pflichtangaben eines Verbandsbuchs?
Schulbegleitung – Anforderungen, Herausforderungen und Perspektiven
Einleitung
Die Schulbegleitung spielt eine zentrale Rolle in der Inklusion von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen. Sie fördert Chancengleichheit, unterstützt die schulische Leistung sowie die soziale Integration und trägt maßgeblich zur Entwicklung von Selbstständigkeit bei.
Ziel der Schulbegleitung
Das primäre Ziel der Schulbegleitung ist die gleichberechtigte Teilhabe von Schüler*innen mit körperlichen, geistigen, emotionalen oder sozialen Beeinträchtigungen am schulischen Alltag. Dies umfasst:
Integration:
Unterstützung bei der Einbindung in den Klassenverband.
Förderung der Selbstständigkeit:
Entwicklung von Alltagskompetenzen.
Individuelle Unterstützung:
Maßgeschneiderte Hilfestellung je nach Bedarf.
Ablauf der Schulbegleitung
Der Ablauf der Schulbegleitung gestaltet sich individuell und orientiert sich an den Bedürfnissen des jeweiligen Schülers/der jeweiligen Schülerin. Er umfasst:
Bedarfsanalyse
Feststellung des Unterstützungsbedarfs mit Eltern und Lehrern
Auswahl der Schulbegleitung
Geeignetes Personal wird eingestellt und geschult
Integration
Unterstützung im Unterricht in den Pausen und bei schulischen Aktivitäten
Evaluation
Regelmäßige Überprüfung des Fortschritts und Anpassung der Maßnahmen
Anforderungen an Schulbegleiter*innen
Fachliche Anforderungen
Grundwissen
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen
im besten Fall pädagogische Ausbildung
Persönliche Anforderungen
Empathie und Geduld
Flexibilität und Belastbarkeit
Anpassung an wechselnde Schülerbedürfnisse
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Zuverlässigkeit
Fähigkeit zur Selbstreflexion
Material eines Schulbegleiters
Für eine effektive Unterstützung benötigen Schulbegleiter*innen folgendes Material:
Ordner für Arbeitsblätter
wenn möglich Workbooks, Arbeitshefte pro Fach
Block und Stifte, Lineal, Geodreieck
eigenes Hausaufgabenheft zur Übersicht der Hausaufgaben, Terminen, Material welches mitzubringen ist
Sportsachen und Verpflegung
Herausforderungen
emotionale Belastung, Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen
Rollenkonflikte, Abgrenzung zwischen Unterstützung und Übernahme von Aufgaben
Kommunikation, Abstimmung mit Lehrkräften, Eltern und weiteren Fachkräften
begrenzte Ressourcen (Personal und Zeit)
unterschiedliche Schülerbedürfnisse erfordern Flexibilität.
Praktische Tipps
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Schüler/ zur Schülerin (professionelle Distanz bewahren)
klare Absprachen mit Lehrkräften, aktiv den Kontakt zu Lehrern suchen, fragen, wie sie sich die Begleitung wünschen
bei Hausaufgaben förden, nicht vorsagen
Kladde, Ordner mit Unterrichtsmaterial anlegen Eigenes Hausaufgabenheft führen (Hausis, Prüfungen, Test, Material…)
sich bewusst sein, dass es gute und schlechte Tage gibt (z.B.Medikamenteneinfluss)
Vorbildfunktion und Verhalten
Schulbegleiter*innen übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion. Ihr Verhalten sollte geprägt sein von:
Respekt und Wertschätzung
Geduld und Verständnis
Professionalität im Umgang mit Herausforderungen
soziales Verhalten vorleben (Respekt, Höflichkeit)
Konfliktlösung und Empathie zeigen
Ruhe und Gelassenheit bei Stresssituationen
Fehler als Lernchance vermitteln
Sicherheit durch Beständigkeit geben
Rollenklarheit und Abgrenzung
Professionelle Distanz bewahren
Kosten und Träger der Schulbegleitung
Die Finanzierung der Schulbegleitung erfolgt in der Regel durch öffentliche Träger wie das Jugendamt, Krankenkasse oder die Schule. Träger können sein:
Kommunale Einrichtungen
Freie Träger der Jugendhilfe
Private Dienstleister
Preisspanne brutto:
18 bis 28 Euro pro Stunde.
Lohn:
bei ca. 20 Stunden pro Woche ca. 1400 bis 1600 Euro pro Monat, netto
Individualität in der Schulbegleitung, Förderung
Die Schulbegleitung zielt darauf ab,
die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zu unterstützen.
individueller Lernansatz und Förderpläne.
zielgerichtete Förderung von motorischen, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten.
Autonomieförderung durch Unterstützung bei Selbstständigkeit.
Arbeitszeiten der Schulbegleiter
Die Arbeitszeiten variieren je nach Institution und Förderbedarf:
Förderschule:
i.d.R. während der Unterrichtszeit (ca. 7:30 – 13:30)
Heilpädagogische Tagesstätten (HPT): ganztägige Betreuung möglich
Kindergärten:
flexible Arbeitszeiten je nach Betreuungsbedarf
Klassenfahrten und Nachmittagsbetreuung
Die Teilnahme an Ausflügen und der Nachmittagsbetreuung ist mit Schulbegleitung möglich.
Planung und Durchführung von Klassenfahrten unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.
Unterstützung auch im Nachmittagsunterricht und bei Freizeitaktivitäten.
Herausforderungen und Zusammenarbeit
Die Herausforderungen der Schulbegleitung umfassen:
Kommunikation mit Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen.
Emotionale Belastung durch soziale und emotionale Probleme der Kinder.
Enger Austausch mit Lehrern und Eltern zur Anpassung der Fördermaßnahmen.
Vergleich:
Schulbegleitung in einer Regelschule gegenüber einer Förderschule mit HPT
Ein Überblick über die Unterschiede in der Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung
Soziale Integration
Regelschule mit Schulbegleitung:
Integration in den Klassenverband, gemeinsames Lernen mit Kindern
ohne Beeinträchtigung
Unterstützung bei sozialen Interaktionen durch die Schulbegleitung
individuelle Unterstützung durch eine Schulbegleitung im Regelunterricht
Unterstützung bei Alltagsbewältigung und sozialer Integration
Förderschule mit HPT:
lernen in kleineren Klassen mit anderen Kindern mit Beeinträchtigungen
weniger Kontakt zu Kindern ohne Beeinträchtigungen
maßgeschneiderte Förderung durch Fachpersonal (Sonderpädagogen, Therapeuten)
zusätzliche Förderung in heilpädagogischer Tagesstätte
Pädagogischer Ansatz
Regelschule
Allgemeiner Lehrplan mit individueller Anpassung.
Förderschule
spezieller Lehrplan, angepasst an die Bedürfnisse der Schüler*innen.
Strukturelle Bedingungen
Regelschule mit Schulbegleitung:
externe Finanzierung und Organisation der Schulbegleitung
Regelschulen oft nicht auf spezielle Bedürfnisse ausgerichtet
Förderschule mit HPT:
barrierefreie Schulen und spezialisierte Ausstattung
umfassende Betreuung durch Fachkräfte
Fazit
Schulbegleitung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der inklusiven Bildung. Sie fördert die individuelle Entwicklung von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen und trägt zur Chancengleichheit im Bildungssystem bei. Der Erfolg hängt maßgeblich von der Qualität der Begleitung und der Zusammenarbeit aller Beteiligten ab.
Reflexion
Welche Anforderungen werden an Schulbegleiter*innen gestellt?