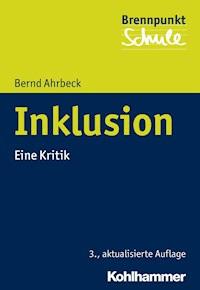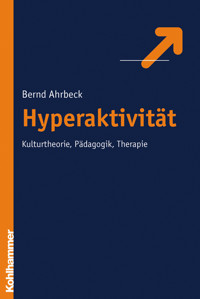Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die kulturellen und gesellschaftlichen Konflikte in den westlichen Demokratien verschärfen sich zusehends. Befeuert wird diese Entwicklung dadurch, dass im Namen einer höheren Moral zentrale Errungenschaften der Aufklärung in Frage gestellt werden. Das persönliche Erleben gerät zum entscheidenden Orientierungspunkt. Gesammelte Wissensbestände und historisch gewachsene Erkenntnisse hingegen gelten als Relikte einer unaufgeklärten und schuldbeladenen Gesellschaft. Wer hätte noch vor einigen Jahren vorhergesehen, dass nur noch identitätspolitisch ausgewiesene Personengruppen zu bestimmten Themen Stellung beziehen dürften; dass die Wissenschaftsfreiheit in Frage gestellt, die Bereitschaft zum Widerspruch in besorgniserregendem Ausmaß sinken würde? Nicht die Verbesserung des Bestehenden, sondern eine radikale Umorientierung wird seitens »woker« Vordenker angestrebt. Biologische und lebensweltliche Tatsachen gelten als bloße Zuschreibung, unbeschränkte Selbstbestimmung wird zum Gebot der Stunde. Auf welcher Grundlage sich der Mensch, der sich aller natürlichen Beschränkungen enthoben glaubt und aller Konventionen und Traditionen entledigt hat, selbst und beständig neu erschaffen soll, bleibt allerdings im Dunkeln. Bernd Ahrbeck zeigt die Gefahren auf, die von der Utopie einer grenzenlosen Machbarkeit ausgehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERND AHRBECK
Basteln am Ich
Zu Risiken und Nebenwirkungen grenzenloser Selbstbestimmung
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Bernd Ahrbeck,
geboren 1949, ist Erziehungswissenschaftler,Diplom-Psychologe
und Psychoanalytiker. Er lehrt als
Professor für Psychoanalytische Pädagogikan der Internationalen PsychoanalytischenUniversität (IPU Berlin).
Von 1994 bis 2016 hatte er einen Lehrstuhlam Institut für Rehabilitationswissenschaftender Humboldt-Universität zu Berlin inne. Bei zu Klampen
ist zuletzt erschienen »Jahrmarkt der
Befindlichkeiten. Von der Zivilgesellschaftzur Opfergemeinschaft«(2022).
Inhalt
Cover
Titel
Einleitung
Erlösungsphantasien
Binarität
Offenbarungsverbot
Leihmutterschaft
Wissenschaftsfreiheit
Cui bono?
Literatur
Impressum
Einleitung
Die kulturellen und gesellschaftlichen Konflikte in den westlichen Demokratien verschärfen sich zusehends. Im Namen einer höheren Moral werden zentrale Errungenschaften der Aufklärung in Frage gestellt, ausgelöst von einzelnen Identitätsgruppen, unterstützt und umgesetzt von einem politischen und medialen Meinungsstrom, der sich als »woke«, links, grün, klima- und gendersensibel versteht. Wer sich nicht in dieses Schema pressen lässt, wird schnell zum Feind erklärt, gecancelt, als rechts, rassistisch oder reaktionär abgeschrieben.
Das Erleben wird zum entscheidenden Orientierungspunkt. Allerdings nur, solange es ausgewählte marginalisierte Gruppen betrifft, und um so mehr, je stärker sie sich auf einen Opferstatus berufen. Vernunft, gesammelte Wissensbestände und historisch gewachsene Erkenntnisse sollen hinter der persönlichen Betroffenheit zurücktreten. Sie gelten, wenn es zu Interessenkonflikten kommt, als Ausdruck einer unaufgeklärten und schuldbeladenen Gesellschaft, die von bürgerlichen Männern und Frauen repräsentiert wird. Oder intellektuell nicht weniger schlicht: vom alten, weißen, europäischen Mann. Entscheidend wird dann, wer etwas vertritt, und nicht mehr, ob das Ausgesprochene zutreffend und wahr ist.
Wer hätte es vor einigen Jahren für möglich gehalten, dass ernsthaft gefordert wird, nur noch identitätspolitisch ausgewiesene Personengruppen dürften sich zu bestimmten Themen äußern. Wer hätte sich vorstellen können, dass weiße Musiker wegen kultureller Aneignung verurteilt werden, nur weil Blues-, Soul- oder Reggaetitel zu ihrem Repertoire gehören. Oder dass Bücher, Theaterstücke und Filme nicht mehr geduldet werden, weil sie aus einer Zeit stammen, die andere Wert- und Moralvorstellungen hatte. Auch die Möglichkeit, die Schönheitskönigin eines Landes könne eine Transsexuelle sein, wäre noch vor kurzem als reichlich lebensfern erschienen. Wer hätte ahnen können, dass die Wissenschaftsfreiheit dermaßen ausgehöhlt wird, wie es zur Zeit geschieht, mit der Begründung, unerwünschten Kräften müsse Einhalt geboten werden. Die Bereitschaft zum Widerspruch sinkt, vor allem in Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, in den Medien, im Kulturbetrieb und in der evangelischen Kirche, den Hauptträgern »woker« Weltanschauungen. Die öffentlich geäußerte Weltsicht wird immer homogener.
Dahinter steht die Vorstellung, unsere Gesellschaft müsse sich grundlegend wandeln, gerechter werden, toleranter, offener, vielfältiger. Nicht durch eine Verbesserung des Bestehenden, unter Anerkennung des Erreichten, sondern durch eine radikale Umorientierung, die auf einer neuen moralischen Ordnung beruht. Davon zeugen die heftigen Vorwürfe, die erhoben werden: gegen das Patriarchat, die Heteronormativität, die toxische Männlichkeit, den alltäglichen Rassismus, den Kapitalismus und die westliche Lebensform. Erst wenn sie überwunden sind, das versprechen die »woken« Befreiungsvisionen, sei ein unbeschwertes Leben vorstellbar. Diese Erlösungsphantasien werden so kompromisslos in Anschlag gebracht, dass sie mitunter an die Frömmigkeitsbewegungen vergangener Jahrhunderte erinnern. Auf welcher Grundlage sich der Mensch, der sich aller Konventionen und Traditionen entledigt hat, selbst erschaffen soll, bleibt allerdings im Dunkeln. Häufig erscheint es so, als sollte ein vermeintlich idealer Urzustand wiederhergestellt werden.
Zu einem herausragenden Thema der letzten Zeit ist die Transsexualität oder Transidentität geworden. Eigentlich ein überschaubares Phänomen, denn die Anzahl der unmittelbar Betroffenen ist nach wie vor gering. Die riesige Aufmerksamkeit, die die Transsexualität erfährt, muss deshalb andere Gründe haben. Mit ihrer Hilfe sollen Koordinaten des Lebens erschüttert werden, die über Jahrtausende als selbstverständlich galten. Im Mittelpunkt steht die Vision, der Mensch könne sich seiner biologischen Wurzeln entledigen. Das biologische Geschlecht sei nur die Folge einer sozialen Konstruktion, nichts als eine sprachliche Zuschreibung. Wer hingegen an der Binarität festhält, einer biologischen Tatsache, macht sich umgehend verdächtig, andere herabzusetzen und zu demütigen. Eine humane Grundhaltung soll demnach an die Verleugnung der Realität gebunden sein. Aber es stimmt wohl: »Nichts ist provokanter als die Wirklichkeit. Und Gnade Gott all jenen, die es wagen, die Wirklichkeit gegen mächtige Illusionen aufzubieten.«1
Ein juristisch fixiertes Offenbarungsverbot soll Transsexuelle davor schützen, gegen ihren Willen öffentlich auf ihr Ursprungsgeschlecht hingewiesen zu werden. Dass hier ein Schutzbedürfnis besteht, wird niemand bestreiten. Die Frage ist nur, wie ihm Rechnung getragen wird. Nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz reicht bereits eine Selbstdeklaration aus, um standesamtlich den Geschlechtseintrag und Vornamen zu wechseln, als reiner Sprachakt also, der zur Folge hat, dass alle amtlich relevanten Unterlagen mit dem ursprünglichen Ausstellungsdatum verändert werden. Ein Mensch hat demnach schon immer das Geschlecht gehabt, zu dem er sich später bekennt. Damit wird eine fiktionale Biographie erzeugt, die möglichst viele Spuren der Vergangenheit tilgen soll. Die Lebensgeschichte ordnet sich dem gegenwärtigen Empfinden unter, das nicht nur über die Biologie, sondern auch über die soziale Realität triumphiert. Aber das ist noch nicht alles: Auch kulturelle Produkte und historische Ereignisse werden inzwischen nach heutigen Maßstäben umgeschrieben. Von Verlagen beauftragte »Sensitivity Reader« durchforsten Bücher nach Anstößigem, Bilder werden aus Museen entfernt oder besonders kommentiert, Denkmäler beschmiert oder gestürzt.
Die Verfügbarkeit über das Leben soll auch dadurch erweitert werden, dass in den Reproduktionsprozess eingegriffen wird. Dazu gehört eine äußerst weitreichende Maßnahme, die Leihmutterschaft. Neben heterosexuellen Paaren können sich auch gleichgeschlechtliche Paare durch Leihmütter einen Kinderwunsch erfüllen, der ihnen aufgrund ihrer biologischen Ausstattung verwehrt ist. Mit der »Ehe für alle« und der Akzeptanz vielfältiger Lebensformen wird das in Deutschland geltende Verbot der Leihmutterschaft zunehmend in Frage gestellt. Von bereits existierenden Grauzonen ganz abgesehen: Auf Kinderwunschtagen wird offen für eine Leihmutterschaft geworben, die im Ausland erfolgt. Die kommerzielle Leihmutterschaft ist zu einem stark expandierenden, lukrativen Wirtschaftszweig geworden. Sie degradiert Frauen, die in materieller Not und vornehmlich in armen Ländern leben, zu Gebärmaschinen, Kinder werden zu Objekten eines Kaufvertrages. Leihmütter haben nur eine Aufgabe, sie sollen ein gesundes Kind zur Welt bringen, ohne dass es zu einer inneren Bindung an das Kind kommt. Alles andere interessiert nicht. Bemerkenswert ist, wie vermeidend, wenn nicht gar gleichgültig mit ihrer leidvollen Situation umgegangen wird. So, als möchte sich niemand dieser bedrückenden Tatsache annehmen.
An den Universitäten hat sich die Atmosphäre in den vergangenen Jahren merklich verändert, eine eigentümliche Beklommenheit greift immer stärker um sich. Die Wissenschaftsfreiheit ist durch direkte Angriffe bedroht. Vorträge werden verhindert, Kongresse gestört, Wissenschaftler persönlich diffamiert, Publikationen abgelehnt. Aus Angst vor sozialen und beruflichen Konsequenzen setzt eine innere Zensur ein. Forschungsfragen, die als anstößig gelten könnten, werden gemieden, fachliche Auseinandersetzungen unterbleiben, auch in der Lehre. Die Bedrohung der Lehr- und Forschungsfreiheit erfolgt nur in seltenen Fällen durch äußere Eingriffe. Es sind die Akteure des Wissenschaftssystems selbst, die diese Entwicklung an den Universitäten und Hochschulen forcieren. Schreitet sie weiter voran, so wird Wissenschaftsfreiheit womöglich am Ende nur noch für jene Auserwählte gelten, die nicht durch das Raster der Cancel-Culture gefallen sind.
In den Vereinigten Staaten, wo diese Entwicklung sich bereits seit längerem abzeichnet, stellt sich die Lage in einem wichtigen Punkt anders dar. Neben den verbreiteten, überaus einflussreichen Cancel-Aktionen der »woken« Bewegung, existieren dort auch Freiheitseinschränkungen, die auf rechte, zumeist christlich fundamentalistische Überzeugungen und Haltungen zurückgehen. Sie erfolgen in erster Linie aufgrund bundesstaatlicher Verfügungen und entsprechender Gesetzgebungen. Vor allem mit außeruniversitären Folgen: So greifen zum Beispiel einige Bundesstaaten in den schulischen Lehrkanon ein, Themen wie Rassismus oder sexuelle Vielfalt erscheinen dann nur noch am Rande oder gar nicht mehr, unliebsame Bücher werden aus den Bibliotheken entfernt. Eine vergleichbare Entwicklung findet sich in Europa kaum, die nationalen Ausgangslagen sind zu unterschiedlich, religiöse Verpflichtungen spielen keine wesentliche Rolle.
Im hiesigen Kulturkampf geht es inzwischen nur noch am Rande darum, Ungerechtigkeiten zu überwinden, Diskriminierungen zu bekämpfen und Rechte von Minderheiten zu wahren. Über diese ursprünglichen Ziele besteht kein grundlegender gesellschaftlicher Dissens. Gegen die Entwertung und Herabsetzung einzelner Personen und Gruppen muss vorgegangen werden, das ist eine Selbstverständlichkeit. Befindlichkeiten werden jedoch längst zu anderen Zwecken eingesetzt. Sie dienen als Mittel, um eine kulturelle Deutungshoheit zu erringen, die Machtpositionen ausbaut und sichert. Und dies durchaus mit Erfolg.
Einer vermeintlich überaus bedrückenden Gegenwart wird eine Befreiungsphantasie gegenübergestellt, die einige Faszination ausübt. Sie verheißt das Leben in einer Welt, die von allem Bösen gereinigt ist, ohne historische und kulturelle Last, ohne Schuld und Verfehlungen, in freier Selbstbestimmung, nur an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtet. Dazu bedarf es einer »richtigen« Haltung, die demonstrativ in vielen Medien und Bildungseinrichtungen, dem Kulturbetrieb und in politischen Deklarationen zur Schau gestellt wird. Selbst große Unternehmen haben sich mittlerweile »woken« Prinzipien verpflichtet, zelebrieren Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion, werbewirksam und auf der Höhe der Zeit, ohne ihre ökonomischen Interessen zu vernachlässigen. Die Androhung von Sanktionen steht auch dort im Raum, sollte es jemand wagen, offen zu widersprechen.
Warum sich diese Weltanschauung so einflussreich durchsetzen konnte, darüber kann nur spekuliert werden. Viele einzelne Faktoren kommen zusammen. Die von Jonathan Haidt2 beschriebenen Veränderungen im Erziehungsgeschehen tragen sicher dazu bei, dass persönliche Empfindungen einen immer größeren Raum einnehmen, vor allem, wenn sie sich zu einer Hypersensibilität steigern. Das Störende und Irritierende wird dann nur noch im Außen gesehen. Eine Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich selbst und anderen unterbleibt, apodiktische Setzungen verhindern den Dialog, Verbote werden verfügt. Tatkräftige Unterstützung erhält die »woke« Bewegung im akademischen Kontext überwiegend durch die Gesellschaftswissenschaften. Der Dekonstruktivismus diente als Wegbereiter für Gender Studies, Queer-Theorie, Postcolonial, Critical Race und Critical Whiteness Studies, die sich in den Wissenschaften seit etwa 1990 etabliert haben. Kriterien wie Vernunft, Wahrheit und Wissen sind gründlich diskreditiert worden und treten somit hinter den persönlichen Erfahrungshorizont zurück; Gefühle und Betroffenheiten dominieren die Weltsicht. Die Analyse von Machtstrukturen und sprachlicher Deutungshoheit ist zum zentralen Thema geworden, Erkenntnissuche erfolgt im Auftrag des politischen Aktivismus. Zudem geht es um einen Machtgewinn, der persönliche Gratifikationen und Privilegien verspricht und den Zugriff auf Gelder und begehrte Posten ermöglicht.
Diese Entwicklung wird oft achselzuckend hingenommen, als eine nicht ernstzunehmende Mode, die schnell wieder vergeht. Selbst diejenigen, die es besser wissen können, stellen sich, wenn es sich um Politische Korrektheit, Cancel-Culture und Identitätspolitik handelt, ahnungslos. Damit leugnen und verkennen sie die fundamentale Gefahr, die von den gegenwärtigen kulturellen und politischen Umbrüchen ausgeht.
Schwer wiegt in dieser Situation der zunehmende Mangel an Überzeugung, dass es sich überhaupt lohnt, für die kulturellen und politischen Errungenschaften einzutreten, die einst mühsam erkämpft wurden. Viele davon gelten inzwischen als allzu selbstverständlich, manche nur noch mit Einschränkungen wichtig, etwa die Rede- und Wissenschaftsfreiheit. Eine gewisse Gleichgültigkeit hat sich ausgebreitet, auch gegenüber demokratischen Grundwerten, die in ihrer Bedeutung verkannt werden. In einer Zeit, in der biologische und lebensweltliche Fakten beliebig zur Disposition gestellt werden, in der das Simulacrum die Realität verdrängt, Machbarkeit die allgegenwärtige Losung ist, schwindet die Achtung vor dem Erreichten. »Vor der Aufklärung fühlte sich der Mensch selbstverständlich in Gottes Hand. Im säkulären 21. Jahrhundert ist diese Geborgenheit dahin. Es wäre nicht falsch, wenn wir wenigstens eine Schwundform des alten Gottvertrauens behielten: Demut und Bescheidenheit in dem Wissen, dass der Mensch eben doch nicht der Meister des Universums ist; und Skepsis gegenüber einem Machbarkeitswahn, der für alle Übel eine schnelle Lösung verspricht.«3
1 Köppel 2022, S. 3.
2 Haidt/Lukianoff 2018.
3 Guyer 2022, S. 1.
Erlösungsphantasien
Die Sehnsucht nach einer von Kränkungen, Ungemach und Schuld befreiten Welt ist uralt, sie zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Eine Erlösung von allen Übeln, von äußeren Belastungen und inneren Widersprüchen, das ist eine Hoffnung, die von unterschiedlichen Seiten genährt wurde und wird. Außerhalb der Religion findet sie sich in den großen Befreiungsvisionen, die eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft anstreben, um den »neuen« Menschen zu erschaffen. Auch wenn alle diese Experimente grausam gescheitert sind, Millionen Opfer gekostet haben, verlieren sie nicht an Faszination. Irgendwie soll es doch möglich sein, dass der Mensch in ein Reich der Freiheit eintritt, in eine gerechte Welt, die von allem Bösen gereinigt ist. Es scheint um fast paradiesähnliche Zustände auf Erden zu gehen.
Die Identitätspolitik hat die alte Linke, die auf das Wohl breiter Bevölkerungsschichten schaute, einschneidend geschwächt. Nunmehr sind es die Interessen einzelner voneinander separierter Gruppierungen, die in der ersten Reihe stehen: moralisch hoch gerüstet und medial gut vernetzt, einflussreich bis in hohe Regierungsämter hinein. Die identitätspolitische Bewegung ist zu einer mächtigen Kraft geworden, die, von den Vereinigten Staaten ausgehend, nun auch Europa erfasst hat. Sie strebt einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel an. Zunächst klingt ihr Ansinnen harmlos: Es geht um Gerechtigkeit und Gleichheit, den Kampf gegen Diskriminierung, die Anerkennung unterschiedlicher Lebensformen und sexueller Identitäten. Also um ein Anliegen, dem grundsätzlich niemand widersprechen dürfte.
Dahinter steht, sehr häufig jedenfalls, die Sehnsucht nach einer Erlösung von allen gesellschaftlichen Zwängen, zurück zu einem ungetrübten Naturzustand, in ein von Harmonie geprägtes Dasein, das keine bedrohlichen Einflüsse kennt. Als Bezugspunkt dienen indigene Gemeinschaften, die dieses ideale Leben repräsentieren sollen. In deren Welt scheint es keine Unstimmigkeiten zu geben, keine Spannungen und Widersprüche, weder einengende soziale Strukturen noch individuell einschränkende Verpflichtungen. Es herrschen Respekt, Umsicht, gegenseitige Hilfe und Geborgenheit. Man lebt in Übereinstimmung mit der Natur, der realen äußeren wie auch der inneren.
Das Unrecht, das viele indigene Gruppen erlitten haben, wurde über lange Zeit nicht thematisiert, teils bagatellisiert, zum Teil auch geleugnet. Zum Beispiel das, was den Indianern (inzwischen auch »Native Americans« genannt) in Nordamerika oder den Aborigines in Australien angetan wurde. Gleiches gilt, mit noch mehr Aufmerksamkeit versehen, für die Sklaverei und den Kolonialismus. Von nun an jedoch soll dieses Leid anerkannt werden, nicht zuletzt durch materielle Wiedergutmachung, die sich als schwierig erweist, weil die Mehrzahl der Ereignisse Jahrhunderte zurückliegt und die Empfänger einer solchen finanziellen Entschädigung häufig gar nicht mehr auszumachen sind.
Ähnlich wie für die indigene Bevölkerung, fordert man auch im Falle der Opfer von Sklaverei, Rassismus und jeglicher Form von Diskriminierung, dass das historische Unrecht eingestanden wird. Immer wieder erfolgt der Hinweis auf marginalisierte Gruppen, seien es Homosexuelle, Transsexuelle, Sinti und Roma oder Behinderte. In der Tat gibt es vieles zu beklagen. Man denke nur an die prekäre Lage, in der sich Homosexuelle auch hierzulande noch vor einigen Jahrzehnten befanden. Sie waren sozial geächtet und konnten strafrechtlich verfolgt werden. Behinderte Menschen standen lange Zeit am Rande der Gesellschaft. Im Nationalsozialismus wurde ihnen zum Teil das Lebensrecht abgesprochen. Der Umgang mit Sinti und Roma war, bis in Amtsblätter der 1950er und 1960er Jahre hinein, äußerst grob und abwertend. Erst 1998 wurden sie als nationale Minderheit anerkannt.
Ins Auge springt allerdings, dass die identitätspolitischen Anklagen mit einer Vehemenz vorgebracht werden, als bestünden die alten Verhältnisse noch heute. Die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit zerfließen. Beide scheinen untrennbar miteinander verbunden. Mitunter wird sogar – darüber hinausgehend – der Eindruck erweckt, als lebten wir gegenwärtig in ganz besonders repressiven Zeiten – voller Homosexuellen- und Transfeindlichkeit, voller Ablehnung unterschiedlicher Lebensformen, voller Hass auf Minderheiten. Geschützt sei nur die sogenannte Mehrheitsgesellschaft. Eine Anerkennung all dessen, was außerhalb der bürgerlich-patriarchalen Norm liegt, gebe es heute ebenso wenig wie früher. Zumindest nicht in einem auch nur annähernd akzeptablen Maße.