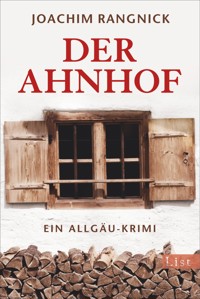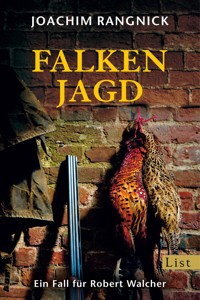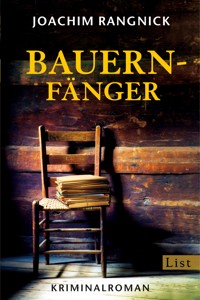
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In einer verlassenen Villa stößt Journalist Robert Walcher auf die Leiche eines Mannes. Neben dem Toten: Unterlagen über eine Lotto-Firma, die Millionen unterschlägt und dabei über Leichen geht. Walcher hat Lunte gerochen und stellt eigene Ermittlungen an. Mit der für ihn typischen Sturheit und viel Geschick kommt er einem Komplott auf die Spur, das weit über die Grenzen des Allgäus hinauszeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Sein Faible für Architekturfotografie führt Journalist Robert Walcher in eine Jugendstilvilla nahe Wasserburg am Bodensee. Von den Bewohnern ist nichts zu sehen.
Walcher betritt von Neugier getrieben und mit der Kamera im Anschlag das Haus – und stößt auf einen Toten. Unter dem Körper ragt ein aufgeschlagener Aktenordner hervor. Der Journalist in Walcher zögert nicht und nimmt den Ordner mit der Aufschrift »Die Company« an sich.
Was Walcher zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: In seinen Händen hält er Informationen über einen Komplott, der den deutschen Staat Millionen kostet und Menschen das Leben. Auch Walcher gerät in das Visier der Company und setzt damit nicht nur sein eigenes Leben aufs Spiel, sondern auch das der Frau, die er liebt …
Der Autor
Joachim Rangnick, geboren 1947, ist studierter Grafiker und lebt in Weingarten.
Mittlerweile kann er sich ganz dem Schreiben von seinen beliebten Kriminalromanen um den Journalisten Robert Walcher widmen. Bauernfänger ist der erste Fall in der Serie.
Von Joachim Rangnick ist in unserem Hause bereits erschienen:Der Ahnhof
(Robert Walchers sechster Fall)
Joachim Rangnick
Bauernfänger
Kriminalroman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:www.list-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie
etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder
Übertragung können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
Überarbeitete Neuausgabe im List Taschenbuch
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
1. Auflage Juli 2011
© Joachim Rangnick
Originaltitel: Die Lotto-Company
Konzeption: semper smile Werbeagentur GmbH, München
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: GettyImages, © Panoramic Images
Satz und eBook:
Rituale
Walcher liebte Rituale. Sie waren die Eckpfeiler seines Wohlbefindens. Eines dieser Rituale hieß Frau Zehner, die Eigentümerin des letzten kleinen Gemischtwarenladens in Weiler, einem überschaubar großen Touristenort im Allgäu.
Jeden Samstagvormittag besuchte Walcher Frau Zehner in ihrem Ladengeschäft, das sich mitten in Weiler befand, im Parterre eines zunehmend renovierungsbedürftigen Patrizierhauses, das aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende stammte.
Neben dem Kauf von Lebensmitteln und sonstigen Dingen, die man zum Leben brauchte, kam der Besuch bei Frau Zehner dem kulturellen Erlebnis eines Museumsbesuchs mit angeschlossener Informationsbörse gleich. Das Warenangebot auf ihrer knapp zwanzig Quadratmeter großen Ladenfläche, die Nebenräume wie Keller, Dachboden oder den Schuppen im Hinterhof nicht mitgerechnet, entsprach einem mittelgroßen Supermarkt. Wer die Ladentür geöffnet und angesichts des gewaltigen Glockengeläuts über seinem Kopf nicht in Panik die Flucht ergriffen hatte, sondern mutig weiter in den halbdunklen Raum schritt, bekam die Chance, eine längst vergangen geglaubte Welt zu entdecken.
Der Fußboden aus roh behauenen Dielen knarrte, und die gewaltige Duftmischung aus Bohnerwachs, Kernseife, Vanillepulver, Melkfett, Haarwasser, essigsaurer Tonerde, schwarzem Tee, Kaffeeersatz, Heublumenmischungen, Kautabak und manch anderen Gerüchen erstickte den zaghaften Orientierungsversuch einer durchschnittlichen Nase im Keim.
Der Besucher wurde gleichsam aufgesogen von den Düften und bewegte sich schüchtern im spärlichen Raum zwischen den Waren. Die türmten sich auf dem Boden, quollen aus überfüllten Regalen und hingen teilweise an Schnüren von der Decke wie die Gewinne in Jahrmarktsbuden: Lederschuhe, Gummistiefel, graue und blaue Arbeitsmäntel, schwere Grobkordhosen, wollene Unterwäsche oder Filzhüte mit und ohne Gamsbärte.
Dieses wundersame Durcheinander im geheimnisvollen Halbdunkel des kleinen Ladens erregte bei jedem Besuch aufs Neue Walchers altmodische Seele und zwang ihn zur Verlangsamung. Ruhe breitete sich in ihm aus. Manchmal mischte sich auch Trauer darunter, denn in absehbarer Zeit drohte die Schließung dieses zauberhaften Fensters in die Vergangenheit. Frau Zehner ging auf die neunzig zu, und im gegenüberliegenden Supermarkt des Ortes, einem von drei weiteren modernen Einkaufstempeln, lag im Büro des Geschäftsführers schon ein Grabkranz mit Schleife bereit – nur das Datum fehlte noch. Entgegen allen Prognosen der Marketingberater machte Frau Zehner nämlich einen beachtlichen Umsatz. Diesen förderten vor allem die treuen älteren Kunden, aber auch neugierige Touristen kauften in dem kleinen Geschäft ein.
»Ja, der Herr Walcher. Grüß Gott.« Frau Zehner nahm Walchers Lottoschein und ließ ihn durch die Scannerkasse laufen, die in scharfem Kontrast zur sonstigen Ladeneinrichtung und auch zu Frau Zehners Alter stand. Diese bediente das Gerät mit absoluter Selbstverständlichkeit und bekam deshalb von ähnlich alten Kunden zu hören: »Also wie duu dees kansch.«
Die Scannerkasse, die mittlerweile schon seit drei Jahren in Betrieb war, verweigerte jedoch die Annahme des inzwischen durch häufigen Gebrauch zerfaserten Lottoscheins. Trotzdem steckte Frau Zehner ihn kommentarlos in die ebenfalls abgegriffene Schutzhülle, gab Walcher das etwas schmuddelig wirkende Ensemble wieder zurück und nahm von ihm zwölf Euro entgegen. Dabei lächelte Frau Zehner ihren Kunden geradezu liebevoll an und wünschte: »Also viel Glück auch, diesmal klappt’s sicher, gell.« Walcher antwortete mit einem knappen »Wird auch Zeit«, und lächelte ebenfalls.
Ein uneingeweihter Beobachter hätte sich sicherlich gewundert, dass Walchers Spielgebühr nicht in die Lottokasse, sondern in eine verschrammte Blechbüchse gesteckt wurde, die wieder unter dem Ladentisch verschwand. Es handelte sich aber nicht etwa um das Spiel zweier Landdeppen, sondern um ein abgesprochenes und liebgewonnenes Ritual zwischen zwei Menschen, die beide davon profitierten. Seit Walcher zu rauchen aufgehört hatte, spielte er auch nicht mehr Lotto, denn auf einen Lottogewinn zu hoffen fand er ebenso blödsinnig, wie sich zu belügen, eine tägliche Rauchvergiftung durch über zwanzig Zigaretten würde keine Gesundheitsschäden verursachen. Abschreckende Beispiele von Menschen, die sich vor jeder Lottoziehung der Vision hingaben, bald Millionär zu sein, kannte Walcher zur Genüge. Bei manchen hatte sich die Hoffnung so sehr in den Köpfen eingebrannt, dass sie bis ins hohe Alter überzeugt waren, das nächste Mal, bei der nächsten Ziehung, endlich ein Millionär zu sein. Dostojewskis Spielsucht in abgeschwächter Form. Nichts anderes trieb unzählige Menschen zu teilweise abenteuerlichen wöchentlichen Geldausgaben.
Auch sein Vater war so ein Lottospieler gewesen, der seine Finanzen nie im Griff hatte, sondern seine Hoffnung auf ein besseres Leben von Samstag zu Samstag verschob. »Wenn wir im Lotto gewinnen«, war einer seiner Standardsätze zu seiner Frau, »dann erfüll ich dir jeden Wunsch.« Lotto, Toto, Zusatzwetten, alle angebotenen Systeme spielte er regelmäßig, jedoch ohne jemals groß gewonnen zu haben. In höchster Anspannung und aggressiv auf jede kleinste Störung reagierend, hatte er die Ziehungen samstags im Fernsehen verfolgt, um dann den restlichen Abend stocksauer und nicht mehr ansprechbar seinen Frust in einigen Gläsern Wein zu ertränken. Mehr, als er vertrug.
Auf diese Weise verspielte er nicht nur seine Einsätze, sondern auch die Sympathie und Achtung seiner Frau, bis nichts mehr davon übrig war. Eines Tages war die Mutter mit Walchers Schwester, dem jüngsten der drei Kinder, verschwunden. Einen Zettel, mit nur wenigen dürren Worten drauf, hatte sie dem Vater in die Schublade gesteckt, bezeichnenderweise dort, wo er seine Lottoscheine aufbewahrte.
Das war für den Vater zu viel gewesen. Drei Samstagsziehungen später sprang er in Köln-Deutz vom Bahnsteig eins vor den durchrasenden Schnellzug Lohengrin, Innsbruck–München–Hamburg.
Ein Grund mehr für Walcher, das Lottospiel sein zu lassen. Allerdings fehlte ihm nach seiner Entscheidung der liebgewonnene Kontakt mit Frau Zehner. Den versuchte er durch gelegentliche Einkäufe zu pflegen, aber bald stapelten sich mehrfach Kernseifen, Nagelbürsten, Kehrbesen, Lederfette, Schuhcremes und dergleichen nützliche Dinge in seiner Garage, bis Frau Zehner ihm eines Tages von ihrer privaten Hilfskasse erzählte. Sie unterstützte heimlich einige Bauersfrauen, die von besonders geizigen Ehemännern wie Sklavinnen gehalten wurden.
Walcher und Frau Zehner vereinbarten daraufhin das besagte Ritual: Er kam einmal in der Woche und tat so, als spiele er Lotto und Frau Zehner tat so, als würde sie den Lottoschein registrieren. Sein Spielgeld verschwand jedoch nicht in der Lottokasse, sondern in der Spendenbüchse. Dafür brauchte Walcher dann nicht mehr »unnützes Zeug« zu kaufen, wie Frau Zehner durchaus scharfsinnig bemerkt hatte.
Nach dem Lotto-Ritual eröffnete Frau Zehner dann jeweils mit einem »Ham’S schon g’hört?« den zweiten Teil des Rituals, die Informationsbörse. Nachdem Walcher verneinte, erfuhr er das Neueste aus Dorf und Landkreis.
»Ham’S schon g’hört«, flüsterte Frau Zehner auch an diesem Samstag mit verschwörerisch klingender Stimme und sah dabei über ihre linke Schulter, als drohe aus der Dunkelheit des Nebenraums das Tratschmonster. Oder hatte Frau Zehner auch eine Vaterstimme im Kopf, die sie schalt: »Tratsch’st schon wieder?!«
Drei Affen
Wasserperlen tropften von den kühlen Flaschen und sammelten sich in kleinen Pfützen auf dem Dielenboden. Die blaue Bierkiste stand an der offenen Küchentür und hinderte sie daran, ins Schloss zu fallen. An der Bierkiste lehnte die erste von sechs prall gefüllten Einkaufstüten. Sie standen in einer Linie zur Küchenmitte hin, ausgerichtet wie die Beutestrecke einer Treibjagd.
Obwohl er kein Jäger war, kam Walcher genau dieses Bild in den Sinn. Vermutlich der Jagdgesellschaft wegen, die auf dem Parkplatz des Supermarktes lärmend eine Schnapsflasche hatte kreisen lassen, während er seinen Einkauf verstaut hatte. Nach dem Besuch bei Frau Zehner war Walcher nämlich zurück in die Jetztzeit gesprungen und hatte im neuen Bio-Allgäu-Markt am Ortsrand all das eingekauft, was es bei Frau Zehner nicht gab, und das war leider einiges.
Zufrieden musterte Walcher seine Beute. Lebensmittel einzukaufen und sie in seinem Haus, in seinem Vorratskeller zu horten gab ihm das unverschämt gute Gefühl der Versorgtheit. Sonst eher sparsam, liebte er bei Nahrungsmitteln die Verschwendung. Allein vom Eingelagerten in seinem Keller hätte er sich problemlos ein halbes Jahr ernähren können: Oliven- und Nussöle, Essige, geräucherte Würste, in luftdichte Gläser abgefüllte Mehlsorten unterschiedlicher Feinheitsgrade, vakuumverpackter Reis, Körner, Nüsse, Nudeln, eingelegte Tomaten, Früchte, Sauerkraut, saure Gurken, Gummibärchen, Schokolade, etliche Weinkisten und einige Brände in Flaschen, ein Fässchen Sherry, eines mit Calvados – ein Hamster hätte seinen Vorrat nicht umsichtiger anlegen können oder, unter psychologischen Gesichtspunkten betrachtet: Walcher lebte eine Mischung aus steinzeitlichem Sammlertrieb und einer abgeschwächten Form des Nachkriegs-Mangel-Traumas aus, unbewusst übertragen von seinen Eltern.
Das alte, heruntergekommene und abbruchreife Bauernhaus hatte er seiner herrlichen Aussichtslage auf die Alpen und gleichermaßen des Kellergewölbes wegen gekauft. Als wären die ungewöhnlich burgdicken Mauern des Hofes einzig zum Schutz des Gewölbes gebaut, hatte er ein Glücksgefühl besonderer Art empfunden, als er zum ersten Mal das einsturzgefährdete Haus betrat und in den Keller hinunter gestiegen war. Er hatte sich geborgen gefühlt wie in seiner elternumarmten frühen Kindheit.
Mit großem Aufwand renovierte er das Haus und widmete dabei speziell dem Kellergewölbe – seinem Gewölbe – viel Zeit. Tage verbrachte er mit dem Konzept für eine ausgeklügelte Be- und Entlüftung, die ohne elektronische Regeltechnik, sondern allein durch die Schwankungen der Tag- und Nachttemperaturen funktionierte. Aberl Meinhardt, ein Maurer aus dem nächsten Dorf und spezialisiert auf den Bau von Käskellern, wie sie heute nur noch wenige bauen können, versorgte ihn dabei mit derart viel Wissen, dass die Bauzeit einer Kurzlehre glich. Wie viele Stunden er in seinem Gewölbe verbracht hatte, wusste er nicht mehr. Oft hatte er nur in einer der Ecken gesessen und das extrem flache, statisch vermutlich im Grenzbereich liegende, optisch jedoch makellose Kreuzgratgewölbe bewundert. Ein wahrer Künstler, der dieses Meisterwerk von einem Keller unter dem einfachen Bauernhaus geplant und gebaut hatte.
Walcher nahm eine Bierflasche aus dem Kasten und kühlte mit ihr kurz seine Stirn, bevor er den Bügelverschluss ploppen ließ. Er liebte den Geruch von Süße, Hopfen und Hefe, der aus einer frisch geöffneten Flasche Bier duftete. Das Bier hatte er sich verdient und eine kleine Pause ging auch in Ordnung. Der Tag war heiß und schwül. Früh aufgestanden war er außerdem. Walcher stellte die Flasche auf die Arbeitsplatte neben der Spüle und schleuderte schwungvoll mit dem Fuß den alten Bandelteppich zur Seite. Dann griff er nach dem vertieft liegenden, handtellergroßen Metallring und zog die Bodentür auf. Sie war so konstruiert, dass sie senkrecht stehend arretierte.
Mit der ersten der Einkaufstüten, deren Boden er vorsichtshalber mit der zweiten Hand sicherte, trat Walcher auf die erste, dann auf die zweite Holzstufe. Auf der dritten blieb er stehen und schnupperte in die kühle Kellerluft, die ihm entgegenströmte. Es stank bestialisch. Ruckartig drehte er sich um, sprang die Treppenstufen wieder hinauf, stellte die Einkaufstüte achtlos auf dem Küchenboden ab, trat mit dem Fuß heftig auf den Arretierriegel und beschleunigte mit der Hand den Fallvorgang der schweren Bodentür derart, dass sie mit einem dumpfen Wummern in den Rahmen rammte.
Der Fußboden bebte. Die Erschütterung hatte feinen Staub aus den Ritzen gepresst, der sich wabernd ausbreitete und kniehoch über den Dielen schwebte, Morgennebel über den Wiesen gleich.
Breitbeinig wie ein Ringer stand Walcher vor der Bodentür und starrte sie an. Der Gestank aus dem Keller hatte sich in der Küche ausgebreitet. Es roch schwer, süßlich und faulig, wie eine schlecht versorgte Wunde. Walcher kämpfte gegen den Würgereiz in seinem Hals, gleichzeitig explodierte eine Hitzewelle in seinem Kopf. Diesen Gestank kannte er, hatte ihn in seinem Geruchsarchiv gespeichert, nein, er war dort eingebrannt. Bevor Walcher aus der Küche in den Hof hetzte, riss er das Fenster auf und schleuderte die Bierkiste wie einen Eisstock auf die Bodentür. Er kniete dann am Brunnen, spritzte sich mit fahrigen Bewegungen kaltes Wasser ins Gesicht und schnäuzte sich die Nase, um den Gestank herauszublasen.
1996, ein Kiefernwald in der Nähe eines zerschossenen Zehnhäuserdörfchens, unweit von Jasenica, im damaligen Jugoslawien. Eine Reportage über die Arbeit der Blauhelme sollte er, der junge Journalist, schreiben. An das Dorf konnte er sich nicht mehr groß erinnern, aber an den bestialischen Gestank, als die Blauhelme das Massengrab öffneten. Arbeiter, Soldaten, die Journalisten und Fotografen, internationale Militärbeobachter, Einheimische, alle hatten sie Mühe, nicht einfach wegzurennen. Einige kotzten, andere weinten still oder starrten dumpf vor sich hin. Einer drehte durch und schrie im Krampf. Bilder, wie Walcher sie hauptsächlich aus Büchern über die Konzentrationslager der Nazis kannte, erweiterten sich an diesem Grab in Jugoslawien um eine neue Dimension: den Gestank von verwesenden Leichen. Und nun war ihm dieser entsetzliche Gestank aus seinem eigenen Keller entgegengeströmt, hatte ihn angefallen wie ein Wesen aus der Unterwelt.
Angst. Wahnsinnige Angst galoppierte durch seine Blutbahnen, krampfte den Bauch und hämmerte hinter den Schläfen. Was war da im Keller? Warum stank es so bestialisch nach Verwesung? Er lagerte nichts da unten, was auf solch unverwechselbare Art stinken konnte.
Allmählich beruhigte er sich und versuchte wieder klar zu denken. Noch etwas unsicher schlurfte er ins Haus zurück und ging zum Barschrank im Wohnzimmer. Die Mühe, sich ein Glas zu nehmen, sparte er sich. Er trank den Calvados – ein guter, alter Tropfen – direkt aus der Flasche. Es hätte auch einer der Schwarzbrände aus der Nachbarschaft sein können, in diesem Moment wäre ihm alles recht gewesen.
Der Magen krampfte noch einmal kurz, entspannte sich dann aber merklich. Walcher nahm die Flasche mit zum Telefon und rief Josef an, seinen Schnapsnachbarn, wie er ihn nannte. Mit Josef verband ihn, seit dessen Einzug in den Nachbarhof, eine wohlwollende, kumpelhafte Nähe. Es gab keinen wirklich treffenden Begriff für den Grad dieses Verhältnisses. Halbfreund oder Nachbarfreund vielleicht, mehr als eine Bekanntschaft, aber weniger als eine Freundschaft, irgendwo dazwischen.
Walcher brauchte jetzt Beistand, denn allein würde er sich nicht in den Keller trauen, das war ihm klar; er hatte sich immer nur als Held aus der zweiten Reihe gefühlt.
Zehn Minuten später wummerte Josef mit seinem alten, höllisch lärmenden Bulldog auf den Hof, als drehe er eine Trainingsrunde in Monza. Durch den aufwallenden Staub ging Walcher ihm entgegen und wiederholte, was er bereits am Telefon erklärt hatte, nämlich, dass es im Keller furchtbar nach Verwesung stinken würde. Vielleicht wäre es ja ein Gas, von dem man ohnmächtig werden könne – und das ganz allein im Keller! Walcher reichte Josef erst einmal die Flasche.
»Kamalau«, kommentierte Josef den Calvados, was mit »ist trinkbar« übersetzt werden kann, und nahm noch einen Schluck. Josef spielte gern den einfachen Eingeborenen und ließ keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass er durch Verwandtschaft quasi ein Hiesiger wäre.
Walcher schätzte Josefs Alter auf Ende vierzig, gefragt hatte er ihn noch nicht. Den vom Onkel geerbten Hartrigelhof bewohnte Josef mit einem unglaublich verschlafenen Hund, einer Mischung aus Panther und Schildkröte. So jedenfalls beschrieb Josef ihn, wurde er nach der Rasse des schwarzen Phlegmas auf vier Beinen gefragt. Mit 12 Hühnern, einem Hahn und genau 31 Schafen erfüllte der Nachbar die Mindestmenge, um steuerlich als Schafzüchter anerkannt zu werden. Im Austragshaus seines Hofes lebte ein älteres Ehepaar, mietfrei, wie Josef betonte. Er verschwieg dabei, dass die beiden den ganzen Hof in Schuss hielten, als seien sie dafür angestellt. Eigentlich war Josef ein hohes Tier bei einer Baugesellschaft in München und deshalb viel unterwegs und selten auf seinem Hof, wo er sofort und übergangslos in Kleidung, Gang, Haltung, Gestik und Sprache zu einem Landwirt mutierte und dabei sogar den typischen Stallgeruch annahm. Vielleicht lag das auch nur an seinem Arbeitsgewand, das im Schafstall hing und intensiv nach den blökenden Bewohnern stank.
In der Küche schob Walcher den Bierkasten zur Seite. Josef blieb still. Seine Mimik verbarg sich unlesbar unter seinem Mehrtagebart. Langsamer als das vorige Mal zog Walcher die Bodentür auf, ließ sie aber auf halber Höhe wieder zufallen und stöhnte auf. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, er wischte sie weg und meinte zu Josef: »Wir sollten uns Tücher vor die Nase halten.«
Josef, der sich vorgebeugt und ebenfalls den Gestank wahrgenommen hatte, nickte eifrig.
Mit feuchten Küchentüchern auf Mund und Nase gepresst – Walcher hatte etwas Calvados darauf getröpfelt, bevor er sie unter den Wasserstrahl hielt –, öffnete er erneut die Bodentür. Langsam stieg er die Treppen hinunter. Josef folgte ihm, die rechte Hand auf Walchers rechte Schulter gelegt. Walcher drückte den Lichtschalter, der in die Türfassung eingearbeitet war, duckte sich und verschwand unter der Kellerdecke.
Da hing es: Keine vier Wochen alt. Das kleine Maul war mit einer groben, roten Paketschnur zugenäht. Zickzackstich. Das hätte dem Köpfchen Ähnlichkeit mit einem Krokodil aus dem Kasperletheater gegeben, wären da nicht die gespenstisch leeren Augenhöhlen gewesen, die den Betrachter aus jedem Winkel scheinbar drohend fixierten. Die Vorstellung, dass die Schlächter die Augen mit Absicht brutal eingedrückt hatten, ließ Walcher frösteln. Das verkrustete Blut, dort, wo die Ohren gewesen waren, vervollständigte das Bild von den drei Affen, die nicht hören, nicht sehen und nicht sprechen sollten. Eine ebenso ekelhafte wie beängstigende Botschaft. Die aufgedunsene Tierleiche drehte sich langsam mit dem Fleischerhaken, der in einem Metallring an der Decke hing und malte, angestrahlt vom Kellerlicht dahinter, einen riesigen Schatten auf Wand und Decke, der seine Form veränderte, als sei er lebendig.
Ein Blick auf die Pfütze unter dem Schwein verstärkten Ekel und aufkeimende Panik, die in Wellen anrollte und Walcher aus dem Keller trieb. Josef folgte ihm dicht auf den Fersen.
Wieder rammte die Bodenklappe mit voller Wucht in ihren Rahmen und wieder vibrierten die Dielen. Die Ursache des bestialischen Gestanks war gefunden und nicht nur von ihnen. Fliegen tanzten einen schwarzen Kreis. Nicht zwei oder zehn, da kreisten Hunderte. Es waren keine normalen kleinen Stubenfliegen, sondern fette, grün und blau schillernde Schmeiß- und Aasfliegen. Sie warteten hektisch darauf, die lockende Geruchsquelle endlich sichten und anlanden zu können.
Würgereiz krampfte erneut in Walchers Bauch. Wieder flimmerten in seinem Kopf die Bilder aus Jugoslawien. Von fetten Fliegen, die als schwarze Schwärme in der Luft brummten, sich auf den Tüchern, den Leichen, den Ausgräbern niederließen. Die rannten wild fuchtelnd davon und waren erst zur Weiterarbeit bereit, als sie Schutzkleidung bekamen, wie Imker sie tragen. Unwillkürlich fuchtelte auch Walcher mit den Armen, als er eine Fliege auf seiner Stirn fühlte.
Das Haus am See
Am Abend saß Walcher an seinem Schreibtisch, vor sich einen Leitz-Ordner, in dem der Inhalt aus dem anderen Ordner eingeheftet war. Er hatte ihn schon einmal durchgeblättert und den Inhalt als das Werk eines Spinners abgetan. Aber nun, nach der unheimlichen Botschaft im Keller, würde er seine Meinung wohl ändern müssen. Das Schwein bedeutete auch, dass jemand offensichtlich problemlos und unerkannt in sein Haus eingedrungen und in den Keller spaziert war. Ein grässliches Gefühl. Er musste bei seiner Foto-Tour beobachtet worden sein, eine andere Alternative gab es nicht, sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, seinen Wohnsitz derart schnell ausfindig zu machen. Der Leitz-Ordner, beziehungsweise dessen Inhalt, den er in dem Haus am See eingesteckt hatte, musste demnach so wichtig sein, dass dieser Jemand derart drastische Mittel anwendete und womöglich statt des Schweins lieber ihn aufgehängt hätte.
Am Montag vor genau vier Tagen war Walcher an den Bodensee gefahren. Nicht dass er hoffte, mit dem lang geplanten Bildband Geld zu verdienen, es war neben seinem Broterwerb als Journalist mehr ein Hobby, die wundervollen alten Häuser am See zu fotografieren. Sie faszinierten ihn, diese stilvollen Zeugen aus vergangenen Zeiten, in denen vor Zweckdienlichkeit, Isolierung und Kostenminimierung noch das Lebensgefühl der Menschen an oberster Stelle stand. Es gab nicht mehr viele im Original erhaltene Häuser der vorletzten Jahrhundertwende, die meisten hatten Neubauten weichen müssen oder waren modernisiert, um- und ausgebaut worden. Ohnehin hatten sich nur Wohlhabende wirklich sehenswerte Häuser bauen können. Ein Haus am See musste man sich leisten können. Obwohl der See unseren Vorfahren den Vorzug kurzer Wege zum anderen Ufer bot, sie mit Fisch als Nahrung und mit Schilf oder Binsen als Baumaterial für Dächer und Körbe versorgte, wurden die Fischer, Schiffer, Dachdecker oder Korbflechter von ihren Handwerken nicht reich. Eine Binsenweisheit, dass sie davon leben konnten, aber den Nachkommen großartige Grundstücke oder Häuser vererben, das konnten sie nicht. Das gelang nur den Blaublütigen und in deren Windschatten dem aufsteigenden Wirtschaftsadel. Zwar standen zwischen den schlossähnlichen Anlagen mit Park, Mehrfachgaragen und eigenen Hafenanlagen noch das eine oder andere kleine Fischerhäuschen mit angebautem Kleinviehstall, aber auch der war längst zur Ferien-Zweitwohnung umgebaut und im Besitz kaufkräftiger Großstädter. Die Nachfrage nach naturnahen Domizilen in respektabler Seelage schien ungebrochen. Verständlich, denn auch für Walcher war jeder Besuch am See eine Art Kurzurlaub und das, obwohl er im Allgäu lebte.
An klaren Sonnentagen, bei guten Lichtverhältnissen setzte er sich morgens ins Auto und fuhr die halbe Stunde von seinem Hof hinunter an den See. Mit der Kamera auf Bilderjagd, spazierte er dann durch die Randgebiete der kleinen Dörfer und der Handvoll, um den See verteilten Kleinstädte, in deren Außenbezirken meist die schönsten Häuser standen. Manchmal waren es nur Feldwege, die zu abgelegenen Grundstücken führten, deren bevorzugte Lage kein Bebauungsplan, sondern Beziehungen geregelt hatten. Dichte, ungepflegte Grünhecken und alte, verfallene Mauern regten seine Neugier und Phantasie besonders an.
Auch am vergangenen Montag war er unterwegs gewesen, am Ortsrand von Wasserburg, eine der letzten Ortschaften auf bayerischem Gebiet hinter Lindau. Lange Zeit entdeckte er kein lohnendes Motiv und so steckte die Kamera noch immer im Rucksack. Deshalb nahm er sich vor, nur noch diesen einen Feldweg vor ihm bis zum Ende zu schlendern und dann umzukehren, zumal der Weg an dem vor ihm liegenden Wäldchen zu enden schien.
Auf der rechten Seite, zum See hin, standen neue Häuser, die ihn nicht interessierten. Vielleicht würden deren modernistische Hässlichkeiten in hundert Jahren zu einem beliebten Fotomotiv werden. Nach dem letzten Haus folgte eine Schilfbucht mit einem eingezäunten Streifen Wiese, auf der sechs Kühe lagen, die ihn anglotzten und nur kurz ihre wiederkäuenden Mäuler anhielten. Nachdem ihre Neugier befriedigt war, kauten sie weiter, schlugen mit den Schwänzen nach Fliegen und hatten ihn vermutlich vergessen, noch ehe er aus ihrem Blickfeld gewandert war.
Die Wiese links am Weg, ohne Kühe, grenzte an ein Neubaugebiet, auf dem frische Hausfundamente und bereits gepflanzte Hecken die künftige Idylle erahnen ließ. Bevor er zu seinem Auto zurückging, das er auf dem Parkplatz eines Strandhotels im Ort abgestellt hatte, musste Walcher noch dringend seine Blase leeren. Er beschleunigte deshalb sein Tempo. Kurz vor dem Wäldchen, hinter einer Gruppe Holderbüsche, hoffte er einen ungestörten Platz zu finden.
Es war ihm etwas peinlich, als er sich erst hinterher umsah und feststellen musste, dass er vor eine Toreinfahrt gepinkelt hatte. Mit einem raschen Rundblick vergewisserte er sich, dass es keine Augenzeugen gab. »Ein anständiger Mensch uriniert nicht vor dem Haus eines anderen anständigen Menschen«, erinnerte er sich an einen von Vaters Erziehersprüchen, die anscheinend für ein ganzes Leben reichten.
Der Feldweg führte hinter den Holderbüschen in einer fast rechtwinkligen Kurve direkt auf zwei mit Efeu bewachsene Torpfosten zu. Kurz hinter dem Tor musste die Zufahrt erneut abknicken oder an der hohen, dichten grünen Wand aus unterschiedlichen Buscharten enden. Schwache Reifenspuren verrieten, dass dieser Weg zwar selten, aber doch vor kurzem befahren worden war.
Walcher holte seine Kamera aus dem Rucksack und ging auf den linken Torpfosten zu, angezogen von einem sauber frei geschnittenen Rechteck in den ansonsten wuchernden Efeu. A. L. Mayer stand auf der massiven Kupferplatte, eingraviert in einer typisch floralen Jugendstilschrift.
Beinahe zärtlich betastete Walcher die tiefe Gravur mit dem Zeigefinger. Das edle Graubraun der Kupferpatina erinnerte ihn an sein eigenes Namensschild, ebenfalls aus Kupfer. Mit einer Lötlampe hatte er es so lange erhitzt, bis es endlich alt wirkte, ohne auch nur annähernd mit diesem prachtvollen Exemplar konkurrieren zu können.
Walcher hatte bei seinen Bilderspaziergängen, wie er sie nannte, selten Skrupel gehabt, fremde Grundstücke zu betreten und bat nicht um Erlaubnis, sondern handelte mit einer überzeugenden Selbstverständlichkeit. Ohnehin präsentierten die geschmeichelten Besitzer meist gerne ihr Haus, und schon einige Male hatte er Führungen erhalten, bei denen ihm sogar besonders wertvolle Möbelstücke oder Gemälde gezeigt wurden.
Walcher fotografierte das Namensschild, trat dann ein paar Schritte zurück, um die gesamte Einfahrt aufzunehmen. Vielleicht versteckte sich hinter dieser romantischen Einfahrt ein interessantes Foto-Objekt und seine Fahrt an den See hätte sich doch noch gelohnt. Das offene Tor, auch wenn es nur noch erahnt werden konnte, derart wuchernd hatten Efeu und wilder Wein es umschlungen, betrachtete Walcher als Einladung.
Die Einfahrt, vermutlich früher sauber mit Kies bedeckt, längst aber von Moosen und Gräsern aller Art zurückerobert, bog, wie er vermutet hatte, scharf nach links ab und schien nach etwa zehn Metern erneut an einer grünen Mauer zu enden. Walcher fiel spontan der Begriff Labyrinth ein, wenngleich die Hecken wahrscheinlich so verschachtelt angelegt worden waren, um neugierigen Menschen den Blick aufs Grundstück zu verwehren. Nach einer weiteren, extrem engen Wegbiegung, dieses Mal nach rechts, öffnete sich nicht etwa der Blick auf das Grundstück, sondern auf eine Garage, auch sie vollständig von Efeu und Wein überwuchert. Rechts davon befand sich ein beinahe zugewachsener Durchgang, bei dem Walcher vorsichtig den Vorhang herabhängender Ranken teilte, denn zwischen Efeu und Wein versteckte sich auch tückisches Brombeergeäst. Nachdem Walcher hindurchgeschlüpft war, stand er überrascht und zugleich fasziniert vor einem paradiesischen Garten. Sogar das Fotografieren vergaß er.
Ein riesiges Grundstück lag vor ihm, sicher über fünftausend Quadratmeter groß. Zwischen den unterschiedlichsten Baumarten, die jedem botanischen Garten zu Besucherrekorden verholfen hätten, stand ein Traum von einem Haus. Früher Jugendstil, bewachsen mit Efeu, Wein und Zierlinde. Buntglasfenster über zwei Stockwerke hoch.
Ein kurz gemähter Weg führte in einem leichten Bogen zum Hauseingang. Die Ebenholztür, mit Schnitzereien von Lilienblüten und Lianen verziert, würde eine prächtige Titelabbildung abgeben. Die Oberlichter, traurig blickenden Augen nachgeformt, gaben der dunklen Tür einen eigenen, verträumten, ja mystischen Ausdruck, so als verberge sich in ihr der Schutzgeist des Hauses.
Obwohl die Villa zum Teil im Schatten der riesigen Bäume stand und die Lichtverhältnisse deshalb nicht besonders gut waren, hatte Walcher sich auf den Grund seines Eindringens besonnen und einige Aufnahmen gemacht. Dabei hatte er sich dem Haus genähert und dank des dadurch erweiterten Blickwinkels, links von ihm, an der Rückwand der Garage, ein Gewächshaus entdeckt.
Das Gegenlicht der späten Morgensonne überblendete die filigrane, Liliengewächsen nachempfundene, hoch aufragende Metallkonstruktion derart intensiv, dass Walcher geblendet die Augen schließen musste. In solch einem Gewächshaus hatte Dornröschen auf den erlösenden Kuss gewartet, da war er sich absolut sicher. Nach einigen Aufnahmen brannte das flirrende Licht noch sekundenlang auf seiner Netzhaut, weshalb er sich wieder dem Haus zuwandte und sich ihm in einem Bogen zum See hin näherte. Das ganze Ensemble wirkte bilderbuchartig traumhaft und strahlte Gelassenheit und Wohlstand aus, liebevoll gepflegt von der Hand des Hausherrn.
Der schien Walcher noch nicht entdeckt zu haben, ansonsten hätte er vielleicht den Hund auf ihn gehetzt, denn dass es einen gab, davon zeugten die vereinzelten Kotspuren im Gras.
Auf der Ufermauer befand sich Walcher dann in direkter Verlängerung der dem See zugewandten Seite der Villa. Die beiden weißen Flügel der Verandatür standen einladend offen. Mit einem freundlichen »Hallo« und leicht an den Türrahmen klopfend, überschritt Walcher die Trennlinie zwischen draußen und drinnen und übertrat damit genau jene Persönlichkeitsrechte, die er für sich selbst vehement reklamiert hätte. Er fühlte sich deswegen auch nicht besonders wohl dabei, aber wie hätte er gute Fotos machen können, wenn er dabei nicht notgedrungen anderen Menschen etwas auf die Füße trat?
Nach diesem kleinen, aber bedeutungsvollen Schritt stand er in einem hellen, großen, hohen Zimmer, das offensichtlich in vier Bereiche unterteilt war: Kaminecke, Couchecke mit Fernseher sowie dem Büro, mit einem einfachen Schreibtisch aus dunkel gefärbten Holz, der die Dimensionen eines Billardtisches besaß. Der Terrassenseite gegenüber war die Wand mit einer durchgängigen Regalfront zugebaut und vom Boden bis unter die Decke mit einer beachtlichen Anzahl Bücher vollgestopft, die dank einer rollbaren Holzleiter in jeder Höhe erreichbar waren: die Bibliothek. Dieser vierte Bereich des Wohnsalons entsprach insgesamt gut und gerne der Fläche einer großzügig geschnittenen Zweizimmerwohnung. Neben der Bibliothekswand verband eine Flügeltür, gleicher Machart wie die Verandatür, nur etwas feiner und leichter gearbeitet, den Salon mit dem Rest des Hauses. Von der stuckverzierten Decke hing ein mächtiger Leuchter, dem umgedrehten Strauß unterschiedlicher Blütenkelchen nachempfunden. Es musste faszinierend sein, dieses Kunstwerk des Jugendstils aus Lilien, Tulpen, Krokussen und Blattranken am Abend in Funktion bewundern zu können.
Walcher hatte die Kamera am Auge und wollte eines der schlanken, gut zwei Meter hohen Buntglasfenster fotografieren, die ihn, von der Sonne angestrahlt, mit einer unglaublichen Leuchtkraft blendeten. Diese Lichtquelle tauchte den Raum in ein unwirklich-warmes Kunstlicht, nur vergleichbar mit der Wirkung eines Kirchenfensters. Auf den Bildausschnitt im Sucher achtend, hatte sich Walcher, mit der freien Hand über die lackierte Holzleiste auf der wuchtigen Rückenlehne eines massigen Ohrensessels tastend, seitlich bewegt, um auch die links vom Fenster stehende Fächerpalme mit aufs Bild zu bekommen. Ein Jugendstilfenster ohne Palme zu fotografieren, zumal sie parat stand, das hätte er sich nicht verziehen. Konzentriert auf das Motiv, hatte er unter dem rechten Fuß eine Erhöhung gespürt und war, als er instinktiv das Bein anhob, an etwas Weiches gestoßen. Mit einem leichten Schauder machte er hektisch einen Schritt zur Seite und blickte zu Boden. Was er dabei entdeckte, ließ seinen Adrenalinpegel hochschnellen. Zu seinen Füßen lag ein Mann. Und bei der Erhöhung neben dem Sesselfuß, auf die er getreten war, handelte es sich um dessen linke Hand. Walcher musste tief durchatmen, bevor er den Liegenden genauer betrachten konnte. Ein älterer Mann, an dessen spärlichen weißen Haarkranz etwas klebte, was dort nicht hingehörte: Blut, schwarz und angetrocknet.
Walcher umrundete den Toten und konnte, als er sich bückte, in dessen Gesicht sehen. Ein müdes, trauriges Gesicht, die Augen geschlossen. Von dieser Seite aus war deutlich eine Vertiefung mitten auf der Stirn sichtbar. Walcher kniete sich vor den Toten und berührte ihn mit dem Zeigefinger an der Wange. Kalt fühlte sie sich an, was bedeutete: Der Mann musste schon einige Zeit tot sein.
Auf dem Boden kniend, machte er eine Nahaufnahme vom Gesicht des Toten und entdeckte dabei die Ecke eines offenen Ordners, der unter dem Oberkörper hervorlugte. Unbequem, auf den harten Metallbügeln liegen zu müssen, dachte er, erteilte sich aber gleich eine Vaterphrase als Strafe für seinen Zynismus: »Du sollst die Toten ehren«.
Als würde sich der Tote dagegen sträuben, musste Walcher kräftig ziehen, um den Ordner, einen normalen Leitz-Ordner, hervor zu ziehen. Warum er das tat, hätte er nur mit dem ausgeprägten Instinkt eines Journalisten begründen können. Genau wie die Tatsache, dass er den Ordner zusammenklappte und versuchte, ihn in seinen Rucksack zu stecken. Dessen Öffnung erwies sich als zu eng, weshalb er die Blätter in drei Packen aus dem Ordner nehmen musste. Etwas unschlüssig, mit dem leeren Ordner in der Hand, stand Walcher auf, ging zum Bücherregal und schob ihn waagerecht in einen Spalt zwischen Büchern und Regalbrett. Dabei fielen ihm die Blockbuchstaben auf dem Ordnerrücken auf: Die Company.
Er machte noch eine Aufnahme des Toten aus größerer Distanz, hängte seinen Rucksack um und verließ das Haus, sehr viel schneller, als er hineingegangen war. Bei dem Gedanken, dass plötzlich Menschen oder gar Polizisten durch die Tür stürmen könnten, erfasste ihn eine leichte Panikwelle, die ihn durch den Garten trieb, ohne dass er sich einen letzten Blick auf die architektonischen und botanischen Schönheiten erlaubt hätte. Stattdessen überlegte er, welchen Rückweg er zu seinem Auto nehmen sollte, um möglichst nicht in der Nähe des Grundstücks gesehen zu werden.
Mit jedem Meter, den er sich der Gartengrenze näherte, wuchs seine Unruhe. Nur nicht auf den letzten Metern noch überrascht und angehalten werden, hoffte er. Immerhin hätte er einige Mühe gehabt, seine Anwesenheit sowie das Diebesgut zu erklären. Egal, wie lang der Mann da drin schon tot war, er, Walcher, hätte ja bereits zum zweiten Mal diese Tour machen können. Nein, der Tag hatte zu schön begonnen, um in einer Zelle zu enden.
Walcher wählte deshalb die entgegengesetzte Richtung zum Auto, die durchs Wäldchen, wodurch er sich einem möglichen Beobachter erst recht auffällig und verdächtig gemacht hätte. Als er sich nämlich durch das Wäldchen kämpfte, das eher einem Dschungel glich, verwandelte er sich in einen heruntergekommenen Stadtstreicher und stank wie eine aufgelassene Latrine. Die Hose klebte bis zu den Knien hinauf an den Beinen und war mit einer schwarzen Pampe aus stinkendem Morast beschichtet. Zudem verletzte er sich an messerharten Dornen des dichten, teilweise schon seit Jahren abgestorbenen und trocken-harten Brombeergestrüpps, in das er geraten war. So konnte er nicht zu seinem Auto spazieren, ohne dass halb Wasserburg ihn später als den vermutlichen Mörder identifizieren würde.
Aus dem Wäldchen kommend, stapfte Walcher mit schmatzenden Schuhen zum See und bis über die Morastlinie seiner Hosenbeine hinein ins Wasser. Der schwarze Dreck ließ sich aber nicht abwaschen und mit seiner nun auch noch vollkommen nassen Hose sah er erst recht verdächtig aus. Ein kurzer Blick auf drei festgezurrte Ruderboote an einem, keine zehn Meter entfernten Steg, und sein Rückzugsplan nahm Gestalt an. Minuten später schwamm er in seiner schwarzen Unterhose, die auch als Badebekleidung durchgehen konnte, in Richtung Parkplatz, auch wenn er auf dieser Route am Grundstück vorbeimusste. Hinter sich an kurzer Leine das kleinste der Kunststoffboote ziehend, ohne Ruder die einzige Möglichkeit, seine Kamera trocken durch den See zu transportieren. Die lag, samt seiner verschlammten Hose und dem Rest seiner Habe auf der Sitzbank im Heck.
Das Grundstück samt Villa des A. L. Mayer machte auch von der Seeseite Eindruck. Kein Mensch war zu sehen, deshalb entschloss sich Walcher für ein paar letzte Aufnahmen. Zwei Trauerweiden auf Ufermauer im seitlichen Morgenlicht, gegen neun Uhr, mit altem Haus im Hintergrund – ein perfektes Motiv. Er konnte nur auf gut Glück abdrücken, denn für die hohe Mauer war sein Standpunkt zu tief gewesen. Deshalb hielt er die Kamera hoch über seinen Kopf, so wie Fotografen in den hinteren Reihen stehend umlagerte VIPs fotografieren mussten.
Eigentlich hatte er erwartet, dass auf dem Anwesen inzwischen die Mordkommission durcheinanderwuselte, aber im Haus und auf dem Grundstück herrschte immer noch Stille, Totenstille.
Das Boot am Band ziehend, watete Walcher einige Meter hinaus in den See, um eine bessere Perspektive auf das Haus zu bekommen. Als er den Bereich von der kleinen Anlegetreppe in der Ufermauer bis hin zu den Terrassentüren im Sucher hatte, glaubte er, eine Bewegung hinter einem Fenster im ersten Stock wahrzunehmen. Instinktiv veränderte er den Kamerawinkel und drückte zweimal hintereinander auf den Auslöser. Es mochte ein Vorhang im Wind gewesen sein, vielleicht bewegte sich auch nur der Weidenzweig im Vordergrund, doch es reichte aus, um Walchers Puls hochschnellen zu lassen und ihn selbst hinaus in tieferes Wasser zu treiben.
In seiner Vorstellung sah er sich schon halbnackt im Wasser stehend, ein geklautes Boot am Bändel hinter sich her ziehend, schutzlos und verletzlich im Sucher eines Zielfernrohrs. Deshalb brachte er das Boot zwischen sich und das Haus und ging in die Knie. Die hässliche Vision einer im Wasser schwimmenden Journalisten-Leiche spornte ihn zur Eile an, bis ihm die Bäume des Nachbargrundstücks Deckung boten. Dass sich sein überschüssiges Adrenalin rasch abbaute, dafür sorgte die Wassertemperatur.
»Mami, ist das ein Fischer?«, hörte Walcher einen kleinen Jungen seine Mutter fragen, als er am Strandbad vorbeiwatete. »Nein, Thorsten, das ist kein Fischer. Sonst säße er im Boot und hätte Ruder und Fischernetze dabei«, war die Antwort der attraktiven Mutter. Gute Beobachtungsgabe, dachte Walcher und erwiderte ihren Blick, in dem er ein leicht spöttisches Lächeln zu entdecken glaubte. Gern hätte Walcher zurück gelächelt, aber die Wassertemperatur lähmte seine Wangenmuskulatur. Zudem wanderte seine Gänsehaut von den Beinen hinauf zum Bauch und musste die gefühlte Qualität eines Reibeisens erreicht haben, von der Waschfrauenhaut an den Füßen überhaupt nicht zu reden. Ihn trieb nur die Hoffnung auf eine warme Badewanne an und das verbissene Ziel, seine Rolle als schrulliger Schatztaucher bis zum Ende zu spielen. Alle fünf Meter angelte er sich mit langen Fingern einen Stein vom Seegrund und warf ihn ins Boot, das er lässig hinter sich her zog, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. So schaffte er es bis auf die Höhe des Hotels, auf dessen Parkplatz sein Auto stand. Dort zog er das Boot ein Stück auf den steinigen Strand, raffte sein Bündel zusammen und stakste mit unterkühlter Beinmuskulatur wie auf Stelzen zu seinem Auto.
Tycoon oder Schizophrener
Gegen Mittag war Walcher, noch immer nur in Unterhose bekleidet, zu Hause aus dem Auto gestiegen und mit seinem verdreckten Bündel im Haus verschwunden. Walcher brauchte keine Beobachter befürchten, außer ihm und Bärendreck, dem schwarzen Kater, der eines Tages beschlossen hatte, auf dem Hof zu bleiben, lebte niemand in diesem abgelegenen Allgäuer Paradies. Dass er dennoch nah vor der Haustür geparkt hatte, lag an den spitzen Hofkieseln. Bereits beim Einsteigen in Wasserburg hatte er den Verlust seiner Turnschuhe feststellen müssen. Wahrscheinlich lagen sie beim Steg, an dem er sich das Boot »ausgeliehen« hatte.
Nach einem ausgiebigen heißen Bad wieder halbwegs normal temperiert, einer anschließenden Brotzeit und einem kurzen Mittagsschlaf, hatte Walcher einen Roten aus der Franciacorta geöffnet und sich an den Tisch in seiner Küche gesetzt, einem Platz, den er besonders mochte. Vor sich das Diebesgut und daneben einen neuen Leitz-Ordner, in den er die Loseblattsammlung abheften wollte, sollte es Sinn machen. Bevor er die ersten Blätter in die Hände nahm, trank er von dem Wein, lehnte sich zurück und schloss die Augen.
Ein Genießer bei der Weinprobe, so hätte ein Betrachter wohl vermutet – aber weit gefehlt. Walcher dachte nicht an den Wein, sondern an den toten Mann in seiner wunderschönen Villa am See, entschuldigte sich in Gedanken bei ihm und nahm sich vor, die Unterlagen an die Kripo zu schicken … nachdem er sie durchgesehen hatte.
Die Company stand auf dem ersten Blatt, wie er es auch auf dem Ordnerrücken gelesen hatte. Allerdings hier mit einer Schreibmaschine getippt und unterstrichen. Das zweite Blatt war zur Hälfte mit Namen beschrieben und scheinbar sehr häufig in eine Schreibmaschine gespannt worden, denn es sah strapaziert aus und die Namen tanzten auf unterschiedlichen Zeilenhöhen über die Seite. Wahrscheinlich hatte es der Verfasser im letzten Drittel sattgehabt, die neu hinzukommenden Namen mit der Maschine zu ergänzen und hatte sie deshalb mit der Hand geschrieben, in einer Schrift aus präzisen, leicht nach links kippenden Buchstaben und deutlich herausragenden Oberlängen. Einige Namen waren unterstrichen, andere durchgestrichen.
Klaus Münzer, Klaus-Jürgen Klaasen, Rainer Barth, Eugen Leptschik, Manfred Büchle, Gerold Meinhardt, Jens Rau, Walter Geberich, Josef Mühlschlegel, Franco Bertoli, Mike Heelingstöm, Wilhelm Wochnau …
Manche Namen kamen ihm bekannt vor, einer konkreten Person zuordnen konnte er sie jedoch nicht. Er nahm sich vor, im Internet zu suchen, trank einen Schluck Wein und las die nächste Seite. Eine Liste mit Firmennamen samt Adressen, Telefonnummern und jeweils einigen Namen. Zwischen den Zeilen waren die Abstände unterschiedlich groß und es gab keine einheitliche Anfangslinie. Auch dieses Blatt sah ziemlich strapaziert aus. Vermutlich war die Liste nach und nach erweitert worden, getippt in unterschiedlichen Schreibmaschinen. Die fühlbaren Eindrücke und die bei Rundformen teilweise sogar ausgestanzten Löcher kannte Walcher aus alten Manuskripten. Er hörte förmlich das Tack-Tack der hart auftreffenden, metallenen Buchstabenfinger, die das Papier perforierten und die Gummiwalze darunter malträtierten. Gute alte Zeit. Walcher dachte an die Mercedes auf dem Dachboden, eine unglaublich schwere, schwarze, Gold verzierte Schreibmaschine mit einem halbrunden Typenkranz, angeordnet wie die Sitzreihen eines antiken Amphitheaters.
Nach einem weiteren Schluck Wein widmete er sich wieder den Aufzeichnungen. Hinter den Firmennamen standen unterschiedlich lange Zahlenreihen, deren jeweils erste Zahl mit der Maschine getippt war. Die daran anschließenden hatte der Verfasser mit Hand geschrieben und bis auf die letzte wieder durchgestrichen. Da es sich durchweg um Aktiengesellschaften handelte, konnten eigentlich nur Stückangaben von Aktien gemeint sein. Aktien, die der Company gehörten.
Nestlé 10000/70000/140000/150000/190000/250000/500000/80 000 000
Dow Chemical 300800/520000/700000/1200000/1780000
Coca-Cola 15000/22360/53000/80000/200400/230600/300500/465000
Eisenbahnbauer und Eisenbahngesellschaften, Schiffsbaugesellschaften und Schifffahrtsunternehmen, Flugzeugbauer und Fluggesellschaften, Stahlwerke, Baufirmen, Autokonzerne, Schwertransportgewerbe, Transportunternehmen, Ölfördergesellschaften, Chemiekonzerne, Nahrungsmittelunternehmen, Handelsketten, Banken und Versicherungen, Zeitungs- und Buchverlage, Radio- und Fernsehsender, Kaufhäuser, Textil- und Bekleidungsunternehmen, Wohnungseinrichter, Sportkonzerne, Konzerne der Unterhaltungsbranche, Brauereien und Getränkeproduzenten, Hotelketten, Telefonkonzerne, Pharmazeutische Unternehmen, Reaktorbauer und Rüstungsbetriebe, Stromerzeuger, Elektronikunternehmen, Gerätebauer …
Die Unternehmensnamen lasen sich, als stammten sie aus einem Lehrbuch über Weltwirtschaft, Produkt- und Marktsegmente.
Auf die Listen der Aktiengesellschaften folgten Blätter mit Aufzeichnungen von weniger bekannten Firmen, die nicht an der Börse notiert waren. Penibel aufgeführt, mit Namen und Positionen der Verantwortlichen sowie deren Privatanschriften und Telefonnummern. Danach folgten Blätter mit Städten, hinter denen Straßennamen und Quadratmeterangaben standen. Die halbe Welt schien in dieses Verzeichnis aufgenommen worden zu sein, alphabetisch nach Ländern geordnet. Selbst exotische Länder waren aufgeführt, winzige Staaten, deren Namen Walcher zwar etwas sagten, deren genaue Lage er nur raten konnte. Wenn sich dahinter Grundstücks- oder Immobilienbesitz verbarg, dann kam da die Fläche eines Kleinstaates zusammen.
Es ging Seite für Seite so weiter. Walcher ordnete die Blätter zu unterschiedlichen Stapeln, nach Aktienbesitz, Beteiligungen, Eigenbesitz, Grundstücken und Immobilien. Was den vermuteten Aktienbesitz dieser Company betraf, so hatte ihn der Ehrgeiz gepackt. Mit einem Blatt ging er hinauf in sein Büro, setzte sich an den PC und rief die aktuellen Börsennotierungen auf.
Allein die 15 Firmennamen auf diesem einen Blatt ergaben ein Aktiendepot im Wert von unglaublichen 4,6 Milliarden Dollar.
Walcher dachte an sein kleines Aktiendepot – er betrachtete es als eine Alternative zu Spielbanken –, das derzeit zirka einem Wert von 7000 Euro entsprach, ihn aber gut das Doppelte gekostet hatte. Kopfschüttelnd ging Walcher wieder an den Küchentisch, zählte die Blätter des Aktienstapels und trank noch einen tiefen Schluck konzentrierter Franciacorta.
Es musste sich um das Hobby eines schrulligen alten Mannes handeln, der den globalen Großunternehmer spielte, denn allein die Blätter mit den börsennotierten Aktiengesellschaften – Walcher hatte 65 Blätter gezählt – ergaben um die 260 Milliarden Dollar, wenn er mit einem durchschnittlichen Wert der Aktienbeteiligungen pro Blatt von 4 Milliarden rechnete. Oder waren das schon Billionen? Wer bewegte sich schon in solchen Bereichen? Selbst die Anzeige des Taschenrechners streikt angesichts solcher Summen. Walcher war ohnehin kein Zahlenmensch und musste überlegen, wie viele Nullen 260 Milliarden hatten. Schon begann er, an das Werk eines größenwahnsinnigen Psychopathen zu glauben, der sich nach seiner Pensionierung in seine eigene Welt zurückgezogen hatte, fiktive Aktienpakete anhäufte, sie ständig vergrößerte, Grundstücke und Firmen kaufte … alles nur auf dem Papier.
Irritierend daran erschien Walcher die eine oder andere Jahreszahl, die auf einigen Blättern vermerkt war. Wenn dieser Mann nicht normal war, dann war er das schon seit 1948 nicht mehr. Persönlichkeitsspaltung, eine Art von Schizophrenie vielleicht? Tagsüber ein unauffälliger Mitbürger, der sich abends als der große Finanzmagnat gab?
War der Mann normal, dann verbarg sich hinter diesen Aufzeichnungen vielleicht doch eine große Geschichte. Walcher dachte an die Mafia, einen geheimen gigantischen Konzernverbund … oder hielt er das Manuskript eines Wirtschaftsfachbuchs in der Hand?
Walcher hatte mehr Fragen als Antworten und beschloss, erst einmal herauszufinden, wer dieser Tote war, der vermutlich Mayer hieß, und was es mit den Namen auf der Company-Liste auf sich hatte. Vielleicht sollte er den ganzen Packen kopieren und an Michael schicken, einen befreundeten Wirtschaftsjournalisten, der in Hamburg lebte. Der konnte sicher Sinn oder Unsinn der Aufzeichnungen erkennen, ohne sich das Hirn zu zermartern und haltlose Hypothesen aufzustellen.
In seinem Arbeitszimmer kopierte Walcher die ersten Seiten und steckte sie in einen Umschlag. Er schrieb einige Zeilen mit einer vage gehaltenen Information für den Wirtschaftsfachmann dazu und legte den Umschlag an die Haustüre, um nicht zu vergessen, ihn auch abzuschicken.
Wieder in der Küche, heftete er nun alle Blätter in den neuen Ordner, nahm ihn mit hinauf ins Büro und stellte ihn dort ins Regal. Zwar hätte er liebend gerne im Internet über A. L. Mayer recherchiert, aber Walcher hatte beschlossen, erst den dringlichen Artikel – die gekürzte Fassung eines Dossiers über Forschungsgelder der Zigarettenindustrie, das er im vergangenen Monat abgeliefert hatte – zu beenden. Ohnehin war er mit der Abgabe bereits zwei Tage in Verzug.
Guter Nachbar
Das alles war vor vier Tagen geschehen. Und nun hatte ihm jemand ein totes Schwein in den Keller gehängt. Eines, das offenbar vorher schon einige Tage in der Sonne gelegen hatte. Er nahm sich vor, einen Veterinär zu befragen, ab welchem Tag ein Tierkadaver so entsetzlich zu stinken begann.
Ein grausam zugerichtetes Schwein, eine ziemlich eindeutige Botschaft. Legte nicht die Mafia als Warnung Tierleichen vor die Tür? Also handelte es sich bei dem Ordner wohl nicht um die Spielerei eines verschrobenen Spinners, die Company musste es wirklich geben. Und sie wollte im Dunkeln bleiben, sonst hätte sie sich ja bei ihm melden können. Sie wussten, wer er war und wo er wohnte. Was war die Story wert? Lohnte sich eine Recherche? Diese Frage stand immer am Anfang, aber wie immer konnte sie ihm niemand beantworten. Walcher würde nichts anderes übrigbleiben, als an den Fäden zu ziehen, deren Enden er bereits in der Hand hielt – und das waren einige. Ein Mensch namens A. L. Mayer, im Besitz eines Ordners mit Firmendaten, war umgebracht worden. Die aufgeführten Werte ließen auf ein gewaltiges Firmenimperium schließen. Dann war da noch ein Schwein massakriert worden und als ganz persönliches Geschenk einem neugierigen Journalisten übergeben worden.
Walcher saß in seinem Arbeitszimmer und skizzierte die ersten Schritte seiner Vorgehensweise, brach aber ab und ging hinunter, denn die Luft begann vom wuchtigen Wummern von Josefs Traktor zu vibrieren, der auf den Hof gefahren kam.
»Hab sie gefunden, als ich die alte Kühltruhe im Stadel leer g’macht hab. Man kann’s noch trinken.« Dabei hielt er eine graue Steingutflasche hoch, die gut zwei Liter fasste. »Dafür liegt jetzt deine Sau darin!«
Seine forsche Fröhlichkeit ließ vermuten, dass er den überraschenden Fund bereits mehrmals probiert hatte. Aber nach einem solchen Erlebnis ging das auch in Ordnung, dachte Walcher, ergriff die hingehaltene Flasche, nahm einen Schluck und stellte überrascht fest, dass er, statt des erwarteten billigen Fusels, einen außergewöhnlich guten Cognac auf der Zunge hatte.
»Danke dir nochmals, dass du das Tierchen mitgenommen hast, ich hätte es sonst vergraben. Guter Tropfen«, deutete Walcher auf die Flasche.
»Muss noch von meinem Onkel sein«, die Antwort war schwer verständlich, weil Josef gleichzeitig einen Schluck nahm, »sind noch paar Flaschen da, er hatte sie wohl vor der Tante versteckt. Bin ein bisschen gerührt, ist wie ein Gruß von ihm. Ohne dein Schweinderl wär ich sicher nicht so bald an die Truhe gegangen. Und deswegen bin ich noch mal gekommen. Allein trinken macht keinen Spaß. Hol mal zwei Gläser, wir können doch nicht immer aus der Flasche trinken. Wenn uns jemand beobachtet, was könnt der alles denken.«
Josef setzte sich auf die Hausbank, während Walcher ging, um Gläser zu holen. Beobachten, das war das Stichwort. Jemand musste ihn auf dem Grundstück beobachtet haben. Vielleicht wurde er auch gerade in diesem Moment beobachtet, durchs Fernrohr oder durch das Visier eines Gewehrs. Bei dem Gedanken daran fröstelte es ihn wieder genauso wie vor ein paar Tagen im See vor der Villa. Walcher drehte sich in der Haustür um und sah rundum. Nichts. Der Mond schien, aber weder sein Schein noch das spärliche Hoflicht erhellte die Dunkelheit. Hätte vielleicht doch eine Flutlichtanlage installieren sollen, ging es ihm durch den Kopf.
»Gläser!«
Josefs Befehl trieb Walcher ins Haus.
Sonntagsausflug
Gegen sieben Uhr wachte Walcher mit einem furchtbaren Brummschädel auf. Sein erster Gedanke galt Josef: »Ich verfluche dich und deinen Cognac-Onkel«, murmelte er, dann kehrte trotz Restalkohol die Erinnerung an den Grund des Cognac-Gelages zurück und sofort keimte Unbehagen auf. Der Begriff »Schutz« kam ihm in den Sinn. Schutzlos fühlte er sich. Sein Haus, seine Burg, sein über alles geliebter Vorratskeller, missbraucht! Ungebeten und unerkannt waren Fremde eingedrungen und hatten diese malträtierte Sau aufgehängt. Es mussten mindestens zwei Eindringlinge gewesen sein. Was ihn da so sicher machte, konnte er nicht sagen. Er meinte nur, dass eine solche Aktion für eine Person allein ein viel zu hohes Risiko darstellte. Fremde in seinem Haus! Und vielleicht hatten sie sogar einen Schluck aus einer seiner Flaschen genommen, von einem Landjäger abgebissen, in seine Toilette uriniert, seinen Rasierapparat benutzt oder, schlimmer noch, ihre Mörderzähne mit seiner Zahnbürste geschrubbt. Vielleicht stammte der trockene Zwetschgenkern in seinem Sherryglas gar nicht von ihm, sondern von einem der Schweineschlächter. Vielleicht hatte einer der Kerle mit dem ungestillten Bildungshunger eines Gossenkillers sogar in seinen Büchern auf dem Nachtkasten geblättert. Langsam, aber stetig wuchs seine Wut auf diese Dreckskerle, wahrscheinlich angeheuerte und bezahlte Killer oder sonst irgendwelche skrupellosen Widerlinge.
Zu seinem Bedauern empfand er gleichzeitig eine große Hilflosigkeit, die seine Wut wieder verdrängte. Er, als Einzelkämpfer gegen diese Company. Er, der Wehrdienstverweigerer, der Pazifist, gegen die Profikiller. Nun, auch David hatte seinerzeit eine Chance gegen den übermächtigen Goliath gehabt, beendete Walcher seine fruchtlose Betrachtung und quälte sich aus dem Bett.
In Bewegung, unberechenbar bleiben ist hier wohl die beste Strategie, überlegte er sich, während das Wasser aus der senkrechten und den beiden waagerecht installierten Intervalldüsen der Dusche seine Haut massierte. Spontan entschloss er sich zu einer Landpartie. Nur dem Anschein nach, für eventuelle Beobachter. In Wirklichkeit würde er Lisa besuchen. Zum einen, weil er es ohnehin vorgehabt hatte, zum anderen, weil es ihn immer dann zu Lisa trieb, wenn er Probleme hatte.
Er packte ein kleines Fernrohr, die handliche Kamera mit dem leistungsstarken, aber sehr leichten Teleobjektiv, Handy, Wasserflasche und Anorak ein. Der Rest schien längst Teil des Tourenrucksacks geworden zu sein, weil Walcher ihn so gut wie nie ausräumte. Der Salzstreuer zum Beispiel, bei dem jeder Benutzer nach vergeblichem Klopfen, Schütteln und Pusten versuchte, die Löcher der Streukappe mit dem dazu gebotenen Zahnstocher aufzubohren oder die Metallkappe ganz aufzudrehen. Was regelmäßig zu einem Scheitern führte, weshalb die Salzmenge seit Jahren dieselbe geblieben war. Der Beutel mit Verbandszeug fristete ebenfalls seit Jahren sein Dasein im Rucksack.