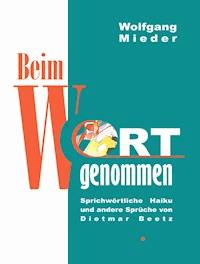
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Mieder, University Distinguished Professor of German and Folklore” an der University of Vermont, Burlington; zahlreiche Auszeichnungen, zwei Ehrendoktor-Titel, über 100 wissenschaftliche Bücher, international führender Parömiologe (Sprichwortforscher) hat 31 Bücher mit jeweils rund 800 „Haiku und anderen Sprüchen” analysiert. Sie halten Interessierte für eine „angemessen anstößige“ Dokumentation zum Dasein hierzulande sowie global während der jüngsten dreieinhalb Jahrzehnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhalt und Quellenverzeichnis
Vorspann
Dies‘ änd dat – von A bis Zet
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Weitere Werke von Prof. Wolfgang Mieder (deutschsprachige Titel)
Impressum
Wolfgang Mieder
Beim Wort genommen
Sprichwörtliche Haiku und andere Sprüche von Dietmar Beetz
ISBN 978-3-95655-900-6 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: book-design Sabine Beck
Das Buch erschien erstmals 2016 bei Edition D.B.
© 2018 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected]
http://www.edition-digital.de
Inhalt und Quellenverzeichnis
Dieser Auswahl-Band enthält Haiku, also 17-silbige Texte, und andere ähnlich kurze Sprüche, die auf Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten, Idiomen und geflügelten Worten beruhen. Sie entstammen 31 Buchpublikationen von Dietmar Beetz, die jeweils 798 solche Texte auf 120 Seiten enthalten. Von diesen rund 25 000 Belegen wurden etwa 1 600 (also 6,4 %) ausgewählt und im vorliegenden Band abgedruckt - einige zwecks Illustration des von Professor Wolfgang Mieder verfassten „Vorspanns“, die Mehrzahl, alphabetisch geordnet, im Hauptteil des Buches.
Hier die Titel der zwischen 2000 und 2014 in der Edition D.B. - Erfurt erschienenen Bücher, denen unsere Auswahl entstammt, chronologisch aufgelistet und mit Nummern versehen. Die Zahlen in Klammem nach jedem der zitierten Haiku bzw. sonstigen Sprüche beziehen sich jeweils auf die Buch-Nummer und die Seite, wo dieser Text nachlesbar ist.
1. Experten für Sex
Haiku und andere Sprüche. Teil 1. Erfurt: Edition D.B., 2000
2. Urwaldparfüm
Haiku und andere Sprüche. Teil 2. Erfurt: Edition D.B., 2000
3. Subtiler Quark
Haiku und andere Sprüche. Teil 3. Erfurt: Edition D.B., 2000
4. Humani-tätärätä
Haiku und andere Sprüche. Teil 4. Erfurt: Edition D.B., 2003
5. 2/3 - Dummheit
Haiku und andere Sprüche. Teil 5. Erfurt: Edition D.B., 2003
6. Süßes Geheimnis
Haiku und andere Sprüche. Teil 6. Erfurt: Edition D.B., 2004
7. Reform-Dracula
Haiku und andere Sprüche. Teil 7. Erfurt: Edition D.B., 2004
8. Kuscheltier-Gruß
Haiku und andere Sprüche. Teil 8. Erfurt: Edition D.B., 2005
9. Vor Gottvaters Bürotür
Haiku und andere Sprüche. Teil 9. Erfurt: Edition D.B., 2005
10. Frust-Frucht
Haiku und andere Sprüche. Teil 10. Erfurt: Edition D.B., 2006
11. E-Mail in Keilschrift
Haiku und andere Sprüche. Teil 11. Erfurt: Edition D.B., 2006
12. Ball-Kunst und Spiel-Datsch
Haiku und andere Sprüche. Teil 12. Erfurt: Edition D.B., 2007
13. ... und mählich weltkriegsreif
Haiku und andere Sprüche. Teil 13. Erfurt: Edition D.B., 2007
14. Am Zwerchfell-Äquator
Haiku und andere Sprüche. Teil 14. Erfurt: Edition D.B., 2008
15. Matscho vom Feinsten
Haiku und andere Sprüche. Teil 15. Erfurt: Edition D.B., 2008
16. Body-Markt-Index
Haiku und andere Sprüche. Teil 16. Erfurt: Edition D.B., 2009
17. Mindestens monströs
Haiku und andere Sprüche. Teil 17. Erfurt: Edition D.B., 2009
18. Im Guiness-Buch der Retorte
Haiku und andere Sprüche. Teil 18. Erfurt: Edition D.B., 2009
19. Pfeifen im Euro-Keller
Haiku und andere Sprüche. Teil 19. Erfurt: Edition D.B., 2010
20. Jubel-Mumien-Katzentisch
Haiku und andere Sprüche. Teil 20. Erfurt: Edition D.B., 2010
21. Ährfort’s Hälden-Schrey
Haiku und andere Sprüche. Teil 21. Erfurt: Edition D.B.,2010
22. Alters-Trampolin
Haiku und andere Sprüche. Teil 22. Erfurt: Edition D.B., 2011
23. Herzschlag Global-Zorn
Haiku und andere Sprüche. Teil 23. Erfurt: Edition D.B., 2011
24. Cosa Nostra-Impf-Zock-Deal
Haiku und andere Sprüche. Teil 24. Erfurt: Edition D.B., 2011
25. Stiefel auf ‘nem Regenbogen
Haiku und andere Sprüche. Teil 25. Erfurt: Edition D.B., 2012
26. Bank-Ganoven-Rettungsschirm
Haiku und andere Sprüche. Teil 26. Erfurt: Edition D.B., 2012
27. Zwischen Zahnfleisch und Hutschnur
Haiku und andere Sprüche. Teil 27. Erfurt: Edition D.B., 2013
28. Glas-Sarg Burn-Out
Haiku und andere Sprüche. Teil 28. Erfurt: Edition D.B., 2013
29. Ehrensold-Afghanistan
Haiku und andere Sprüche. Teil 29. Erfurt: Edition D.B., 2014
30. Die Sau im Dorf
Haiku und andere Sprüche. Teil 30. Erfurt: Edition D.B., 2014
31. Beidseits der Job-Front
Haiku und andere Sprüche. Teil 31. Erfurt: Edition D.B., 2014
Vorspann
Es gibt offenbar noch Wunder in der Literaturwissenschaft. Für mich jedenfalls war es ein unvergessliches Ereignis, als ich vor Jahren die ersten sieben Bände Haiku und andere Sprüche von Dietmar Beetz, erschienen zwischen 2000 und 2004, in den Händen hielt, geliefert von der renommierten Sortimentsbuchhandlung Otto Harrassowitz, Wiesbaden, die mir seit Jahrzehnten deutschsprachige Literatur besorgt. Nun lagen jene Bücher vor mir in Burlington, Vermont, dem nordöstlichen U.S.-Bundesstaat, und bald bestätigte sich: Die jeweils 800 aphoristischen Texte, die jeder dieser Bände enthält, sind in der Tat etwas Einmaliges in der umfangreichen deutschsprachigen Aphoristik.
Selbstverständlich fragte ich mich, wer dieser Beetz, Dietmar, sei und musste feststellen, dass er in den gängigen Literaturlexika nicht verzeichnet ist, ja selbst in maßgeblichen Werken zum deutschen Aphorismus, so denen von Friedemann Spicker, nicht erwähnt wird. Seine Sprüchebücher enthalten nur knappe Angaben zur Bio- und Bibliografie, und erst im Internet konnte ich mehr erfahren über diesen erstaunlich produktiven Schriftsteller. Zu seinem 75. Geburtstag am 6. Dezember 2014 war in der UNZ (Unsere Neue Zeitung), Erfurt, ein Bericht - sogar mit einem Bild - erschienen, dem ich entnehmen konnte, dass es sich bei Dietmar Beetz um einen (wie er später korrigierte: seines Erachtens nicht „bedeutenden“, wohl aber beflissenen) Arzt, Schriftsteller und Verleger handelt, dessen literarische Produktion über fünfzig (de facto derzeit siebzig publizierte) Titel mit vormals hohen Auflagen und ein Halbdutzend „in Vorbereitung“ befindlicher Bücher aufweist, u.a. Kriminalromane, Kinder- und Jugendbücher, Gedichtbände, die meisten erschienen im Verlag Neues Leben (Berlin), in anderen Verlagen der DDR und seit der Jahrtausendwende in der von ihm betriebenen „Edition D.B.“.
Erstaunlich für mich, wie dieser 1939 in Neustadt am Rennsteig geborene Thüringer und bis heute praktizierende Arzt die Zeit für ein derart umfangreiches literarisches Werk hat finden können. Schaffenskraft gehört offenbar zu seinem Wesen, und das vermutlich seit schriftstellerischen Anfängen während der Studentenzeit (Studium der Medizin von 1957 bis 1963 an der Universität Leipzig und an der Medizinischen Akademie Erfurt). Examen, Promotion, später Ausbildung zum Facharzt für Dermatologie und Spezialisierung für Betriebsmedizin, vorher Arbeit als Arzt auf Fang- und Verarbeitungsschiffen der Hochseefischer und im Indien-Liniendienst sowie '73 in befreiten, noch umkämpften Gebieten der eben proklamierten Republik Guinea-Bissau, auch kurze, jeweils mit Buchlesungen verknüpfte Studienaufenthalte in Litauen, Jugoslawien, Syrien, Angola, China, Vietnam, Namibia - stets ging es Dietmar Beetz, seinen Worten nach, „auch um Einblick in Welt-Geschehnisse und in menschliche Existenzbedingungen, also um literarische Belange“.
Als Märchenforscher möchte ich ergänzend die beiden von ihm publizierten Bücher „Der Schakal im Feigenbaum und andere Märchen aus Guinea-Bissau“ (1977) und „Der fliegende Löwe und andere Märchen der Nama - nach alten Quellen neu erzählt“ (1986) erwähnen.
Der Werdegang von Dietmar Beetz ist aufzeichnet in „Kaleidoskop in b. Splitter einer -biografie“ (2008) - eines der Bücher in einem, wie ich es in einem Brief vom 21. Mai 2015 nannte, „sommerlichen Weihnachtspaket“, das auch vierzundzwanzig weitere „Sprüche“-Bände enthielt. Ich hatte nach langem Suchen endlich seine Adresse ausfindig gemacht und um Lieferung dieser für meine Arbeit wichtigen Bücher gebeten.
Mit folgendem Schreiben vom 27. April 2014, dem siebzigsten Geburtstag meiner lieben Frau, begann unser epistolarer Kontakt, der sich mittlerweile zu einer auf Seelenverwandtschaft beruhenden Freundschaft entwickelt hat:
Lieber Dietmar Beetz!
Nur ganz kurz für heute: ich stamme aus Leipzig (Jahrgang 1944), bin ab 1949 in Lübeck aufgewachsen und 1960 als sechzehnjähriger Jüngling allein nach Amerika gegangen (Sie sind ja auch weit in der Welt herumgekommen). Seit 1971 bin ich als Professor für Germanistik und Folkloristik an der University of Vermont im Bundesstaat Vermont tätig. Mein Hauptforschungsgebiet ist die Volksliteratur, also Märchen, Sagen, Volkslieder, Motivstudien und vor allem Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten ...
Meine Sprichwörterforschung hat mich natürlich auch zu geflügelten Worten, Sentenzen, Aphorismen usw. geführt, und wie Sie aus meinem angehängten „curriculum vitae“ erkennen können, habe ich etliche Bücher und Aufsätze gerade zu sprichwörtlichen Aphorismen verfaßt: über Georg Christoph Lichtenberg, Marie von Ebner-Eschenbach, Phia Rilke, Karl Kraus, Felix Renner, Werner Mitsch, Hans Leopold Davi, Gabriel Laub, André Brie, Zarko Petan, Elias Canetti, Felix Pollak, Hans-Horst Skupy, Horst Drescher (Leipzig!), Erwin Chargaff, Elazar Benyoetz und natürlich auch über Gerhard Uhlenbruck - einer meiner besten Freunde und Arzt wie Sie. Das gilt auch für Klaus D. Koch aus Rostock (vgl. mein Buch „Sprichwörtliche Aphorismen. Von Georg Christoph Lichtenberg bis Elazar Benyoetz“ [1999]). Ich könnte mir vorstellen, dass Sie die beiden kennen.
Natürlich bin ich bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten auch auf Ihre „Haiku und andere Sprüche“ gestoßen und kann Ihnen heute berichten, dass ich folgende Bücher von Ihnen besitze, durchgearbeitet und daraus den einen oder anderen Text in meinen Studien zitiert habe:
Urwaldparfüm
Subtiler Quark
Experten für Sex
2/3-Dummheit
Humani-tätärätä
Reform-Dracula
Süßes Geheimnis
Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie mindestens 31 Bände dieser Art veröffentlicht, und ich möchte sie ALLE (ohne die 7, die ich schon habe) auf meine Kosten bei Ihnen bestellen. Bitte auch „Kurzschluß im Hirnkasten“ [1996, eine „Sprüche“-Auswahl] und falls „Kaleidoskop in b“ eine Art Autobiografie ist, dann dieses Buch bitte auch. Ich hoffe, dass Sie von allen oder fast allen Bänden noch Exemplare haben. Wenn dann alle Bände vorliegen, möchte ich gerne eine längere Arbeit über die Haiku und Sprüche verfassen, die von einem Sprichwort, einer Redensart oder einem Zitat ausgehen. Vielleicht sind Sie auch gewillt, etwas zu diesem Thema zu sagen - das wäre natürlich von großem Interesse!
Meine Adresse finden Sie hier am Ende meiner Zeilen. Die Rechnung - auch für das teure Porto - können Sie an meine gute Schwester schicken, die Ihnen das Geld sofort überweisen wird. Für das Paket bitte einen stabilen Karton benutzen - oft kommen Pakete hier stark beschädigt an.
Für heute danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Mühe und Hilfe und verbleibe mit den besten Grüßen,
Ihr Wolfgang Mieder
Mit großer Freude erhielt ich dann bereits am 5. Mai 2015 per E-Mail folgende Nachricht von Dietmar Beetz:
Dank, sehr geehrter Herr Professor,
für Ihr Schreiben vom 27. April und für Ihr Interesse an meinen Aphorismen.
Da wir morgen einen Kurzurlaub antreten werden und ich danach wieder im Beruf und am Schreibtisch voll aktiv sein möchte, habe ich kurzerhand an Ihre Adresse geschickt: jeweils ein Exemplar von meinen
- Haiku-Bändchen Nr. 7 bis 31, meiner
- Autobiografie „Kaleidoskop in b“ und vom
- Aphorismen-Bändchen „Kurzschluß im Hirnkasten“.
Beigefügt ist auch ein - leider blattweise unsauberer - Ausdruck des Vermächtnis-Sammelsuriums, das ich baldmöglichst abschließen möchte - die Kapitel 1-5 halbwegs satzreif, die Kapitel 6-10 samt „Nachsatz“ noch arg ergänzungs- und korrekturbedürftig. Wenn’s recht ist, teile ich Ihnen per E-Mail mit, auf welchen Seiten welchen Kapitels ich etwas zu (meinen) Aphorismen festgehalten habe; und falls Sie Zeit und Lust haben, mir wegen des einen oder anderen Zungenschlags die Leviten zu lesen, wär’ ich dankbar.
Im übrigen habe ich u.a. vier weitere Haiku-Bändchen im Roh-Script parat [inzwischen sind es sechs!]; doch die kann ich erst für die Publikation „befummeln“, sobald der leidige „Scripte-Friedhof ‘ [das Vermächtnis-Sammelsurium] archiv-reif ist.
Mit freundlichem Gruß
Dietmar Beetz
Das also war der mich so beglückende Anfang unserer Korrespondenz, wobei zu betonen ist, dass Dietmar Beetz, wenn nicht in Eile wie bei diesem erstem Schreiben, längere Briefe schreibt, die sich durch außergewöhnliches Sprachvermögen und sein gesellschaftskritisches Engagement auszeichnen. Am 27. Juni 2015 erhielt ich einen solchen ausführlichen Brief, der zu meinen „Sprachschätzen“ gehört und den ich meinen Studentinnen und Studenten vermittelt habe, um den jungen Leuten zu veranschaulichen, dass Briefe auch in der Moderne noch etwas Besonderes sein können. Daraus möchte ich jedoch hier nur diese beiden Paragrafen zitieren, die folgendes „Bekenntnis“ von Beetz zu seinem „Verhältnis zu Spruchweisheiten und dergleichen“ enthalten:
„Vorbilder“ - speziell beim Sprüche-Klopfen - habe ich nicht, ist doch selbst Lichtenberg, dessen gesammelte „Sudel“-Texte ehrenvoll in einem unserer [einschließlich seiner Frau Karin Beetz] Regale steh’n, mir lieb und vertraut fast ausschließlich dank des wunderbaren Romans „Die kleine Stechardin“ von Gert Holmann; aber „Sprachliches“, Sprachen überhaupt, also die „Form“ im weitesten Sinn gehört - bei aller Bedeutsamkeit des Inhalts - unbedingt und tief verwurzelt zu ‘nem Terrain, ja zum beinah einzigen Areal, wo ich als Sterblicher und Staub-Geweihter mich wohlfühle, wohl, frei und daheim.
Sachlicher betrachtet sind Worte ja für jeden Schreiber das übliche, wenn nicht einzige Arbeitsmaterial. Kommt hinzu, dass unsere Mutter- mein „Mütterchen“-Sprache überreich an Vorzügen ist, dabei offen und empfänglich für Mancherlei; ohne Latein lägen wir - nicht nur sprachlich - noch auf dem Bärenfell, „Denglisch“ - z.B. - kann durchaus eine Bereicherung sein, und dass Mutter Deutsch mitsamt ihrer Vielzahl Dialekt-Wechselbälger noch über ‘ne ansehnliche Kinderschar verfügt, ist ein Segen, der es sowohl erlaubt wie gebietet, tolerant zu sein und mitzuwirken im herrlichen Global-Sprachen-Chor.
Ja, das Wort „herrlich“ passt in der Tat zu den so mannigfaltigen Haiku und Sprüchen von Dietmar Beetz, die alle Register der deutschen Sprache und mehr durchspielen und inhaltlich zu einer Fülle von Themen teils bissig satirisch und dann wieder mitfühlend ironisch oder gar humorvoll, doch meist kritisch Stellung nehmen. Wie es bei all seiner beruflichen Tätigkeit zu diesen Tausenden von Kurzprosatexten, die zuweilen Minigedichten gleichen, gekommen ist, geht aus folgender Aussage aus demselben Brief hervor:
Ein volles Jahrzwölft lang [inzwischen mehr] hab’ ich beinah täglich sechs, sieben und mehr Sprüche geklopft, zuletzt aller drei, vier Monate 798 für jeweils ein Bändchen, die Mehrzahl frühmorgens ab spätestens 6.00 Uhr daheim sowie während der Fahrt zu betriebsärztlichen Untersuchungen in Nord- oder West-Thüringen, oftmals weitere heimwärts bis 17.00/18.00 Uhr (mit Pausen unterwegs zum Auf-Kritzeln in Park-Nischen am Straßenrand).
Dass unsere Korrespondenz sowie unser gegenseitiges Interesse an unseren Schreibarbeiten sogar dazu geführt hat, dass Dietmar Beetz seine vielseitigen Sprüche mit Freude und Gewinn fortsetzt, beglückt und ehrt mich ungemein. Hier nur dieser Paragraf aus einem Schreiben von Beetz vom 16. Februar 2016:
Dass Arbeit Lebenselixier ist, wissen Sie vermutlich besser als sonstwer; und dass Sie aus meinen Sprüche-Sedimenten was Wesentliches in der Nachbarschaft Ihres Werkes zu Spruchweisheiten von Willy Brandt [Bezug auf das von Andreas Nolte und mir verfasste Buch „Kleine Schritte sind besser als große Worte“. Willy Brandts politische Sprichwortrhetorik [2015]) herausdestillieren wollen - das ist und bleibt für mich, was man „Zeichen und Wunder“ nennt. Falls irgendetwas dazwischenkommen sollte - auch dann haben Sie mir, dessen Schreiber-Echo seit Jahr und Tag bei Null-Komm-kaum-was oszilliert, Beihilfe geleistet, klopfe ich doch seit jenem Tag im Mai, als Ihre Buchbestellung - ein Brief aus Vermont! - im Kasten lag, wieder Sprüche, sporadischer zwar als im Jahrzwölft zuvor, meist auch bissiger, aber ausgesöhnt mit dem Fakt, dass es zu packender, raffiniert gedrechselter Prosa bei mir nicht reicht [das stimmt nicht ganz!] und dass Bemühen um Wohlklang, Rhythmus und dergl. kritische 17 Silb’ner [sprich Haiku] leider gefällig macht und gewissermaßen kastriert.
Nun gut, wie das nun vorliegende Buch zeigt, ist nichts „dazwischengekommen“, und was ich da aus dem aphoristischen Werk von Dietmar Beetz „herausdestilliert“ habe, kann zwar auf eigenen redensartlichen Beinen stehen, wird aber hoffentlich auch ein Auffakt dazu sein, dass das schriftstellerische Gesamtwerk von Dietmar Beetz endlich in der Form von Aufsätzen, Dissertationen und Büchern die ihm gebührende Aufmerksamkeit und Anerkennung erfährt. Er ist und bleibt ein sprachbewusster und gesellschaftskritischer Zeitzeuge der deutschen Geschichte vor und nach der Wende, der Zeugnis ablegt, wie dies Victor Klemperer jahrzehntelang in seinen Tagebüchern getan hat (vgl. dazu mein Buch „In lingua veritas“. Sprichwörtliche Rhetorik in Victor Klemperers „Tagebüchern 1933-1945“ [2000]). So kann sich folgender Text auf Klemperer sowie Beetz beziehen (die Zahlen in Klammem bezeichnen jeweils die Band- und Seitenzahl):
Weiterschreiben - und sei’s nur, das Ver-
löschen zu
dokumentieren. (31, 95)
Liest man seine bislang veröffentlichten 25 000 Haiku und Sprüche aufmerksam, so lassen sich einige Texte finden, die die Arbeitsweise, wenn auch indirekt oder eben zwischen den redensartlichen Zeilen, aufzeigen. Dazu hier gleich ein Beispiel aus meiner vorliegenden „Beetz“-Sammlung:
Steht nichts
zwischen den Zeilen, gibt’s
auch im Text kaum was
zu entdecken. (25, 96)
Es stimmt schon, dass man bei vielen dieser Kurztexte zwischen den Zeilen lesen, das heißt nachdenken muss, um die tiefere Bedeutung zu entdecken. Auf Anhieb gelingt dies nicht immer sogleich bei den oft sprachlich sowie gehaltlich komplexen Aussagen.
Von meinem Blickwinkel als Folklorist aus, zu dessen Aufgabe stets das Sammeln von Belegen jeglicher Art gehört, ist folgende Aussage von erheblicher Bedeutung:
Das Sammelsurium -
vielleicht ein neues lite-
rarisches Genre. (14, 102)
Ganz so neu ist dieses Verfahren der Anhäufung von Texten in der Form von Aphorismen, Epigrammen, Fragmenten usw. nicht - man denke nur an Lichtenbergs bereits erwähnte Sudelbücher, an die Fragmente von Novalis und Friedrich Schlegel sowie vor allem die Kurzprosatexte von Friedrich Nietzsche und Karl Kraus. Diese sind selbstverständlich wiederholt erforscht worden, aber es sollten solche „Sammelsuria“ ebenso von weniger bekannten Schriftstellern als Prosagattung erschlossen werden. Völlig richtig schreibt Beetz dazu, dass es sich selbstverständlich nicht nur um das Sammeln handeln kann. Zur Identifikation einzelner Texte gehört halt immer die auslegende Interpretation - nicht nur in der Literaturwissenschaft, sondern ebenso in der Folkloristik:
Nichts gegen Zettelkästen, doch
wichtiger wohl, was
im Kopf notiert. (24, 83)
Zum Arbeitsvorgang von Beetz seien folgende Haiku und Sprüche zitiert, wobei es sich meistens keineswegs nur um „Quickies“ (englische Wörter lassen sich wiederholt finden) bei den siebzehn Silben der Haiku handelt. Zu meisterhaften und gehaltvollen Kurztexten dieser Art gehört schon eine beachtliche sprachliche und zerebrale Akribie dazu, die auch ein Understatement des Autors nicht zur Seite schieben kann:
Nach all den Quickies
fünf-sieben-fünf: bald mal ‘ne
Langstrophen-Orgie! (10, 40)
Solche Sprüche, um
festzupinnen: alles, was
die Nadel erreicht. (11, 119)
Nie vermag ein Spruch,
berechtigt lauerndem Einspruch
auszuweichen. (12, 73)
Zehn- oder fünfzehn-
tausend Sprüche: leider-gottlob!
längst nicht genug. (13, 83)
Spruch 16.000 -
Punkt im Haiku-Wald, der paar
Leitlinien verlangt. (20, 120)
Man spürt an solchen Aussagen, dass Dietmar Beetz zuweilen mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat - wann ist das Maß solcher Sprüche voll? Nach 16 000 oder nach 25 000 Texten oder gar nicht? Die Antwort heißt, wie bereits zitiert, schlicht und fest: „Weiterschreiben!“ Und dass es zuweilen zu Einsprüchen kommen kann, ist bei der Vielzahl der Sprüche und ihrer Kürze nicht zu vermeiden. Wer vor den Kopf stoßen, wer den Star stechen will oder wer ein Dorn im Fleische seiner Zeitgenossen sein möchte, wird auf Widerspruch stoßen, aber dennoch hoffentlich zum Nachdenken und möglicherweise gar zur Veränderung etablierter Normen führen.
Auch betreffs der Aphoristik hat sich Beetz theoretische Gedanken gemacht, wie dies eigentlich alle Aphoristiker in ihren Texten tun (vgl. mein Buch „ln der Kürze liegt die Würze“. Sprichwörtliches und Spruchhaftes als Basis für Aphoristisches [2002]). Um „verdichtete“, also kurze und bündige sowie aussagekräftige Texte dreht es sich bei guten Aphorismen allemal.
Aphorismen sind
verdichtete Gedichte. (1, 66)
Aphorismen sind
Dachschindeln keiner bestimmten
Philosophie. (1, 72)
Aphorismen sind auch ‘ne Art
Literatur - steckbrief-
silben-dicht. (26, 38)
Ein Aphorismus ist
keine Definition. (1, 14)
Wer denkt bei der so gewichtigen Aussage, dass ein Sammelsurium an Aphorismen „keiner bestimmten Philosophie“ fristet, nicht sogleich an Nietzsche, dessen Kurzprosatexte kein philosophisches System ergeben und gerade durch ihre Widersprüchlichkeit ihre Aussagekraft erhalten (vgl. mein zusammen mit Andreas Nolte verfasstes Buch „Zu meiner Hölle will ich den Weg mit guten Sprüchen pflastern“. Friedrich Nietzsches sprichwörtliche Sprache [2012]). Beachtet man, dass sich Aphoristiker wiederholt mit gesellschaftlichen und menschlichen Missständen auseinandersetzen, so können zahlreiche Aphorismen als kurze Krankheitsberichte oder als „Krankheitszeichen“ verstanden werden. Dass Dietmar Beetz immer wieder solche anklagenden oder bloßstellenden Texte verfasst, deutet daraufhin, dass er zwar Kritik üben will, aber ohne als Besserwisser oder Lehrmeister erscheinen zu wollen. Das lässt sich bestens an einigen Texten zeigen, die er betreffs der Gefahr von Schlagworten verfasst hat. Das sind Warnungen ohne Patentrezept, die aber dennoch Augen und Gedanken öffnen sollen:
Fängt an mit Schlagworten und
endet mit Totschlag. (1, 23)
Schlagworte sorgen für
Kahlschlag. (1, 23)
Mit Stich- und
Schlagworten
fängt’s an. (1, 53)
Man denke diesbezüglich nur an die Parole „Führer, befiehl! Wir folgen.“ - ein Schlagwort der Nazizeit, an das Beetz im Nachhinein, „Landser“-Jargon aufgreifend, erinnert und auf die Art zugleich benennt, dass und weshalb Deutschland weiterhin an seinen Schandtaten zu tragen hat:
Führer, befiehl! Wir
tragen die Folgen. (2, 69)
Beetz nimmt sich auch ein neueres, ein aus Amerika stammendes Schlagwort vor, das im Deutschen in der direkten Übersetzung „Null Toleranz“ umläuft. Die darin enthaltene Idee ist gut gemeint bei Bezug auf Drogen, Rassismus, Fremdenhass und Aggressivität verschiedenster Art, doch schließt der Slogan auch minimales Verständnis für menschliches Versagen aus:
„Null Toleranz“ – das
ist halt wort-haargenau die
Toleranz ‘ner Null. (5, 66)
Der eine kennt Null
Toleranz, sein buhlender
Vasall: Null Spielraum. (5, 67)
Hin und wieder braucht es schon ein wenig Spielraum und Verständnis, damit ein möglicherweise unbewusst verursachter Fehler ohne absolute Verdammnis gesühnt werden kann. Das heißt selbstverständlich nicht, dass es zum Beispiel im Falle von Vergewaltigung nicht absolute Null Toleranz geben sollte.
Wenngleich nicht ganz so krass, gehört hierher auch der Slogan von der sogenannten „political correctness“, der besagt, dass man gewisse Dinge nicht bei ihren Namen nennen darf. Als ob man sich nicht mal verplappern könnte, ohne gleich Rassist oder Frauenfeind zu sein! Einmaliges sprachliches Versagen rechtfertigt jedenfalls keine generelle Anklage. Geahndet werden sollte erst wiederholtes, beabsichtigtes, aggressives Sprachverhalten - und das Schlagwort „political correctness“ - so Dietmar Beetz im folgenden Haiku - nicht missbraucht werden zur Einschüchterung mündiger Bürger.
Obwohl’s zum Himmel
stinkt, wagt Correctneß nicht
mal ein Naserümpfen. (7, 64)
„Geschweige denn eine Wortmeldung“ - könnte man hinzufügen.
Solche Sprachbeobachtung erinnert an Victor Klemperers einmaliges Sprachzeugnis mit dem Titel LTI [Lingua Tertii Imperii], Notizbuch eines Philologen (1947), das den Sprachmissbrauch und Sprachverfall der Nazizeit dokumentiert. Klemperer, der Auschwitz gerade noch entkam, als Dresden unterm Bombenhagel versank - er liebte die deutschen Sprache, obwohl auch sie zur Vernichtung des europäischen Judentums beigetragen hat. Mit seinem Buch LTI, das Germanistikstudenten hier in Nordamerika wieder und wieder erschüttert, wollte er unter anderem zeigen, was Hitler, Goebbels und deren Gefolgsleute gemacht haben aus der Sprache der „Dichter und Denker“. Auch das - eine Art Schlagwort, das Karl Kraus bereits 1908 umformuliert hatte zur leider nur allzu wahren Wendung „Richter und Henker“. Beetz verarbeitet ebenfalls, wenngleich nicht so krass wie Kraus, in einigen Texten die wohl ursprünglich (1779) auf Johann Karl August Musäus zurückgehende, später (nach 1813) unter Bezug auf Madame de Stael popularisierte Wortverbindung „Volk der Dichter und Denker“:
Das Volk der Dichter
und Denker denkt, hört’s „Dichtung“,
an ‘nen Wasserhahn. (2, 16)
Dichter und Denker? -
Nun, zumindest wird der Verkehr
immer dichter. (7, 25)
Derart dünn-pfiffig Gestänker
tut’s nicht unter
„Dichter & Denker“. (20, 36)
Edel-Lit-Fledderei
zahlt sich aus im Land der
Richter & Henker. (23, 104)
„Fledderei“ bezieht sich hier wohl auch auf Erfahrungen, die Beetz als Schriftsteller nach der Wende und mit Verlegern gemacht hat, dies mit dem Ergebnis, einen eigenen Verlag zu betreiben, die „Edition D.B. - Erfurt“, wo - unabhängig von Vermarktungszwängen und Profiterzielungspflicht - außer seinen eigenen Texten Bücher anderer Autoren erscheinen.
Bei all dem geht es ihm um die Sprache, die ihm am Herzen liegt und die er als sein wichtigstes Werkzeug betrachtet. Dazu ein präzisierendes Bekenntnis:
Weil ich dich liebe,
Muttersprache, bin ich ein
Fan von Babylon. (9, 23)
Der Bezug auf die biblische Sprachverwirrung belegt dabei nicht nur, dass Beetz lateinische Sprachformeln - wie übrigens auch englische Ausdrücke - in seine Texte aufnimmt. Seine Haiku bringen landläufige Begriffe oftmals in Widerspruch zu Erwartungshaltungen, verwirren also, lassen stutzen und regen so eventuell zum Nachdenken an.
Solcher Umgang mit der Sprache kann mehr als beeindruckend sein. Ich erinnere in dem Zusammenhang gern an den Aphoristiker Elazar Benyoetz, der 1939 als zweijähriges Kind mit seinen Eltern in später Stunde nach Palästina entkam und von 1963 bis 1968 in Berlin tätig war, wo er das Archiv Bibliographica Judaica gründete und sich dem Sammeln deutsch-jüdischer Literatur widmete. Diese Tätigkeit führte ihn zurück zur deutschen Sprache, und obwohl er seit 1969 in Jerusalem lebt und auf Hebräisch Texte verfasst, hat er ein Aphorismenwerk in deutscher Sprache hervorgebracht, das hauptsächlich im Münchener Carl Hanser Verlag erscheint. Oft betont er, was die deutsche Sprache ihm trotz Hitler-Deutschland und trotz Verfolgung der Juden bedeutet. Sein Herz hängt zweifelsohne an der deutschen Sprache, die er meisterhaft und dankbar zu benutzen weiß.
Dem verwandt, wenngleich vor weitaus milderem Hintergrund, ein Haiku von Beetz:
Dank dir, Sprache, für
all die Worte, und dir, Hand –
glücklich auf Papier! (21, 33)
Anders interessant und aussageträchtig ist folgende Liebeserklärung, zumal Sprache, wie zwischen den Zeilen ablesbar ist, in der Politik nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, eher manipuliert wirkt.
Staatsterrain, wo meine Geliebte,
die deutsche Sprache,
benutzt wird. (22, 16)
Betont sei aber, um auf die babylonische Sprachverwirrung noch einmal zurückzukommen, dass Dietmar Beetz keineswegs nur die „gehobene“, die Hochsprache für literaturfähig hält. Ganz im Gegenteil gehört seine Liebe erklärtermaßen auch der Umgangssprache, dem Dialekt, dem Jargon.
Umgangssprache ist
Norm-Teil-Mundwerk, tunlichst mit
Sinn für Jargon-Zier. (16, 60)
Unter Verwendung der Redensart „reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist“ hat er das in zwei Sprüchen veranschaulicht.
Jeglichem nach seines Schnabels
Wuchs, mithin auch mir nach
meinigem! (28, 102)
„Wie der Schnabel gewachsen“, klar. –
Was aber, hat der ‘nen
fremden Dreh? (30, 90)
Ohne Rücksicht auf Verluste oder Einsprüche, besteht der grundehrliche Beetz darauf, seine Beobachtungen und Gedanken, wie es ihm passt, zum Ausdruck zu bringen. So nimmt er alle und alles beim redensartlichen Wort.
Wie sie beim Wort
nehmen? Und wennschon:
bei welchem? (3, 25)
Nimm niemand beim Wort
ohne Schutz-Handschuh und ohne
Klarsicht-Visier! (8, 11)
Beim Wort nehmen, beim Akzent und
achten auf das
zwischen den Silben! (26, 69)
Nimm beim Wort und, wenn’s glitscht,
bei ‘ner Silbe und beim linken
Zungen-Zahn! (29, 26)
Beim Wort genommen und nun - sorry –
erst mal die
Hände gewaschen. (29, 38)
Wie man sieht, gehört zuweilen Mut dazu, die Menschen und die Dinge „beim Wort zu nehmen“. Doch die Sprache mit ihren Wörtern ist zweifelsohne der Schlüssel zu einer verantwortlichen „Bewusstseinserweiterung“, die ohne vordergründige Belehrung zu einem besseren Dasein verhelfen kann. Da Dietmar Beetz das moderne Menschendasein für seine Haiku und Sprüche „beim Wort genommen“ hat, ist diese Redensart der passendste Titel für das vorliegende Buch, das aus rund 1 700 Texten besteht, die von Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten und geflügelten Worten (Zitaten) ausgehen.
Bevor ich mich nun der Charakterisierung der hier vorgelegten „sprichwörtlichen“ Haiku und Sprüche zuwende, sei es mir als Literaturwissenschaftler und Folklorist gestattet, einige Bemerkungen zu Texten anzuschließen, die sich auf Volkslieder und Märchen sowie auf das Nibelungenlied und auf Walther von der Vogelweide beziehen. Hinzu kommen noch Zitate von Goethe, Eichendorff und Gottfried Keller, die ich ebenfalls nicht in dieses Buch aufgenommen habe. Sie alle gehören jedoch zum Bestand der allgemeinen Kulturmündigkeit, die Dietmar Beetz mit seinen zuweilen äußerst anspruchsvollen Texten voraussetzt. Dabei ist er sich bewusst, dass Lesern manches verschlossen bleibt, denn das sogenannte Bildungsbürgertum, das vormals recht zitatenfest war, schwindet leider mehr und mehr. Schon deshalb müssten Georg Büchmanns „Geflügelte Worte“ (1864,43. Aufl. 2007) unbedingt erweitert werden und mehr moderne Zitate registrieren.





























