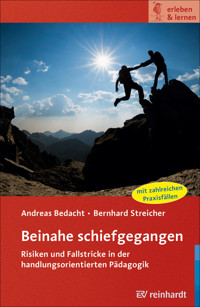
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: erleben & lernen
- Sprache: Deutsch
"Aus Fehlern kann man lernen" - auch beim Leiten von Gruppen. In der erlebnispädagogischen Praxis kann es zu kritischen Situationen und Dynamiken kommen, deren Eintreten unvorhersehbar oder schwer einschätzbar sind. Anhand zahlreicher realer Fallbeispiele zeigen Andreas Bedacht und Bernhard Streicher, beide erfahrene Erlebnispädagogen, wie sich die eigene pädagogische und führungstechnische Leitungskompetenz verbessern lässt. Eingebunden und ergänzt werden die Fallbeispiele mit grundlegenden Erkenntnissen aus der Risikoforschung, Überlegungen zu Risikokultur, klassischen Lernvorstellungen und einem belastungs- und traumasensiblen Leitungsstil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Bedacht • Bernhard Streicher
Beinahe schiefgegangen
Risiken und Fallstricke in der handlungsorientierten Pädagogik
Mit 6 Abbildungen und 2 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Bedacht, Andreas, Dipl. Sozialpädagoge, Traumaberater, ist nach langjähriger Leitung einer außerschulischen Bildungseinrichtung als freiberuflicher Referent im Bereich Erlebnis- und Umweltpädagogik, politische und kulturelle Bildung und in der Hochschullehre tätig. Homepage: https://abedacht.de
Streicher, Bernhard, Dr. habil., Dipl.-Psychologe, war als Universitätsprofessor mit Forschungsschwerpunkt Risiko und in der ZQ Erlebnispädagogik tätig. Er ist wissenschaftlicher Berater, Autor und Forscher mit Fokus auf Risikokultur sowie Mitglied der Sicherheitskommission des Deutschen Alpenvereins. Homepage: https://bernhardstreicher.de
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Streicher, B., Hader, H., Netzer, H. (Hg.): Erlebnispädagogik in den Bergen (2. Aufl. 2024; ISBN 978-3-497-03229-7)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03323-2 (Print)
ISBN 978-3-497-62006-7 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-62007-4 (EPUB)
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von © iStock/VAWiley (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Satz: Die Top Partner – Jörg Kalies, Unterumbach
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639
München Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Prolog
1Vom Wert der Risikokompetenz
2Risikokultur als Rahmenmodell handlungsorientierter Pädagogik
2.1Das Risikokulturmodell
Struktur des Modells
Anwendung des Risikokulturmodells
2.2Risiko- versus Sicherheits- und Eventkultur
3Belastungs- und traumasensible Erlebnispädagogik
3.1Die Teilnehmenden im Blick
3.2Lernvorstellungen im Wandel
3.3Nur die Krise ist wirklich sicher
3.4Das richtige Maß der Herausforderung
Leitgedanken
Die Fürsorge der Veranstalter
3.5Belastungssymptome rechtzeitig erkennen
3.6Interventionen in belastenden Situationen
Ein Ereignis, zahlreiche Beteiligte
Externe Unterstützung
Individuelle Hilfen
Mitbetroffen: Die Gruppe
Wieder arbeitsfähig werden – reflexive Leitungskultur
4Von der Idee zum Plan
4.1Planungsgrundsätze
4.2Planung nach dem Zwiebelprinzip
5Fallstricke und Fälle
5.1Wahrnehmung
5.2Fälle mit Wahrnehmungsfallen
Orientierungsprobleme
Keine Spuren im Schnee
Der Berg spricht nicht immer für sich selbst
Es lockt der falsche Weg
Steinschlag beim Pinkeln
Gewitter am Kletterturm
In die Kamera gelaufen
Warum steigt sie nicht aus? Kenterung am oberen Tarn
Plötzlich ungesichert
Kinder im Vorstieg: Was tun, wenn das Seil blockiert?
Flashback beim Gurtanziehen
Flussfahrt mit Nachwirkung
5.3Entscheidung
5.4Fälle mit Entscheidungsfallen
Hingesetzt: Pause oder Notfall?
Gefangen in der Redundanz: Eine Expressschlinge als Knotenöffner
Vom Reflex Richtung Abgrund gezogen
5.5Situations- und Gruppendynamik
5.6Fälle mit Eskalationsdynamiken
Absturz nach Höhlenbefahrung: Der tückische Abstieg vom Angerlloch
Höhle mit Tiefgang
Versteckte Gefahr beim Bogenschießen
Drei verlorene Teilnehmer:innen auf einer Höhlentour
Leinen los und schnell weg
Vom Wind einmal umgelegt
Eine Kennenlernfahrt entgleist
Wasserspiele bei Gewitter
Ich kann nicht schwimmen
Sturz im Hochseilgarten
Biwak bei Gewitter am Grat
5.7Eine Ermutigung zum Schluss
Unser Dank
Literatur
Sachregister
Online-Zusatzmaterial
Den im Buch beschriebenen medizinischen Selbstauskunftsbogen finden Sie auf unserer Website www.reinhardt-verlag.de zum Download. Auf der Homepage geben Sie den Buchtitel oder die ISBN in der Suchleiste ein. Hier finden Sie das Online-Material unter den Produktanhängen.
Prolog
Neugier als Triebfeder des Lernens und der menschlichen Entwicklung ist ein vielbeschriebenes Motiv in Geistes- und Sozialwissenschaften. Der Mut zu Irr- und Abwegen, Experiment und Ungewissheit, hilft uns, das eigene Leben zu unserer Mitwelt in Beziehung zu setzen, im besten Fall ein Leben lang. Jeder neugierige Aufbruch und jede Exploration beinhalten allerdings neben Erkenntnisgewinn und der grenzenlosen Freude am Entdecken auch die Möglichkeit des Irrens, des sich Verirrens und des Scheiterns. Jedem Einzelnen ist zu wünschen, dass die persönlichen Misserfolge eher niederschwelliger Natur sind und keine bleibenden Spuren und demotivierenden Nachwirkungen hinterlassen. Glücklicherweise müssen wir nicht jede unangenehme oder schmerzhafte Begebenheit selbst nachvollziehen. Als soziale und zu Empathie fähige Wesen lernen wir im Dialog mit unserer Umwelt und aus den Erfahrungen anderer.
Mit dem vorliegenden Buch wird die Idee des voneinander Lernens aufgegriffen. Die Reflexion des eigenen Verhaltens, der Gruppendynamik und der kollegiale Austausch darüber sind für uns ein unverzichtbarer Teil professioneller Pädagogik. Die gesammelten Fallberichte sollen diesen Austausch anregen. Das vorliegende Buch richtet sich gleichermaßen an Studierende, an ein Fachpublikum in Institutionen, Unternehmen, Aus- und Weiterbildung oder an freiberuflich Tätige. Handlungsorientierte und erlebnispädagogische Methoden finden mittlerweile neben den klassischen pädagogischen Disziplinen auch in berufsbegleitenden, schulischen und therapieunterstützenden Angeboten Anwendung. Entsprechend sind auch die Fallberichte aus unterschiedlichen Feldern gewählt. Je nach Arbeitsfeld oder Interesse, lassen sie sich selektiv studieren. Die Teaser zu Beginn jedes Fallberichts erleichtern dabei den Zugang, die Kommentierung und Systematisierung führt zur theoretischen Einordnung. Der umgekehrte Weg – über die Grundlagen zur Praxis – ist ebenso sinnvoll: In den theoretischen Ausführungen zu Beginn des Buches dienen die Fälle dann im Querverweis der Verdeutlichung.
Aus den gesellschaftlichen Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte nehmen wir gerade mit der Darstellung von Fallberichten einen erweiterten Auftrag wahr, der uns das Buch nicht als reine Fallsammlung schreiben ließ: Die drei M´s „Material, Methoden und Manuale“ haben in den zurückliegenden Jahren pädagogische Outdooraktionen deutlich sicherer, aber auch formalisierter und reglementierter werden lassen. Die Grundidee handlungsorientierter Pädagogik lebt aber vom Sich-Einlassen, Ausprobieren, von Improvisation und Unsicherheit. Gesellschaftliche Sicherheitsvorstellungen haben Konsequenzen auf das Leitungsverständnis und damit auf den pädagogischen Wirkungsspielraum. Wir beginnen das Buch daher mit einem Plädoyer, Risikokompetenz (Kap. 1) zu erlernen und sich mit echten Risiken und Gefahren auseinanderzusetzen. Eine Einordnung unserer Vorstellungen darüber, was denn eigentlich ein Risiko ist und wer auf welche Art eines eingehen kann, beschreibt das Kapitel Risikokultur (Kap. 2). Dort legen wir Grundlagen zu Entscheidungsprozessen und Verhalten in Risikosituationen dar, um die Tücken der Fallberichte besser verstehen zu können. Lehrmeinungen, Sicherheitskreise und Normen haben kontinuierlich zu einer Optimierung des verwendeten Materials und seiner korrekten Handhabung beigetragen. Dieses Wissen kann in Qualifikationen und fachsportlichen Lehrbüchern erlernt und vertieft werden. Unser Fokus liegt eher auf dem psychischen Wohlergehen der Teilnehmenden, gerade auch mit den Überlegungen zu einer trauma- und belastungssensiblen Pädagogik (Kap. 3). Als Handwerkszeug schlagen wir ein Planungsmodell nach dem Zwiebelprinzip vor (Kap. 4). Die ausgewählten Fallberichte sind – nicht immer trennscharf – nach den Themenbereichen Wahrnehmung, Entscheidung und Situations- bzw. Gruppendynamik gegliedert (Kap. 5). Einführungen zu den drei Themenbereichen erklären die zentralen Fallstricke. Aufgrund der vielfältigen Bereiche, aus denen die Fallberichte stammen, wird nicht jeder Fachbegriff allen Leser:innen bekannt sein. Wir haben dennoch auf ein Glossar verzichtet, da die Kenntnis spezieller Fachbegriffe für das Verständnis der Situation in der Regel nicht erforderlich ist und diese auch leicht nachgeschlagen werden können.
Bei den Fällen haben wir versucht, möglichst wertfrei zu beschreiben. Begriffe wie „richtig“ oder „falsch“ wird man – hoffentlich – vergeblich suchen. Im Nachhinein, mit dem Wissen über die komplexe Entwicklung und den Ausgang der Ereignisse, lassen sich immer Momente problematischer Entscheidungen herausarbeiten und den Verantwortlichen entgegenhalten: „Wie konnten die sich nur so entscheiden!“ Vorwürfe sind mühelos formuliert. Sie schützen aber allenfalls das eigene Selbstbild nach dem Motto „Das wäre mir nie passiert!“ Eine wertende, schuldzuweisende Haltung wird oft vorschnell eingenommen. Kritische Ereignisse und Unfälle lassen sich ja scheinbar leicht damit erklären, dass die Verantwortlichen fehlerhaft gehandelt hätten und eben nicht ausreichend kompetent waren. Der Realität wird diese Bewertung selten gerecht: Nicht alle möglichen Gefahren können vollständig eliminiert werden. Absolute Sicherheit ist eine trügerische Illusion, kritische Ereignisse treten auch bei bestmöglicher Leitung auf. Daraus folgt, dass jede:r Verantwortliche, insbesondere im Nachhinein betrachtet, Fehler machen kann. Die Einsicht „Dies kann nicht nur anderen, sondern auch mir passieren“, ist ein wichtiger, aber manchmal mühsamer Schritt. Sie kann am eigenen Selbstbild nagen, eben nicht unfehlbar zu sein, aber sie fördert die Offenheit für die Erfahrungen anderer. Diese Einstellung fragt nicht nach Schuld, sondern ist neugierig nach der Dynamik der Ereignisse: „Was hat sich wann ereignet?“, „Welches menschliche Handeln war hilfreich oder eben nicht?“, „Gab es Umweltfaktoren, die eine Rolle spielten?“, „Welche Möglichkeiten gäbe es, die problematische Dynamik in der Situation zu erkennen?“, „Was kann ich daraus für meine Entscheidungen lernen?“
Diese Haltung geht einher mit Demut gegenüber den Gefahren in der Natur und der Wertschätzung gegenüber all jenen, die sie verantwortungs- und respektvoll als pädagogisches Handlungsfeld nutzen. Diese Haltung ist auch die unsere.
1 Vom Wert der Risikokompetenz
Jugendliche, aber nicht nur sie, lassen manchmal in ihren Einschätzungen und ihrem Verhalten ein angemessenes Gefahrenbewusstsein vermissen. In den Medien häufig genannte Beispiele jugendlicher Fehleinschätzung von Risiken sind Drogenkonsum und/oder Regelverstöße im Straßenverkehr. Bei genauerer Betrachtung durchziehen Irrtümer und Denkfehler und das daraus resultierende risikoreiche Verhalten aber unser aller Leben, sie sind mitnichten ein „Privileg“ Heranwachsender. Manche Gefahren wie Luftverschmutzung, Sonnenstrahlung oder unsichtbare Bedrohungen werden häufig unterschätzt, andere, wie die Strahlung elektronischer Geräte, dagegen überschätzt (Bundesamt für Strahlenschutz 2024). Wir fürchten uns paradoxerweise davor, durch andere ums Leben zu kommen, die empirisch größere Gefahr für unser Leben, beispielsweise eine Selbsttötung, übersehen wir (Renn 2014). Unser Leben ist voller großer und kleiner Bedrohungen, der Versuch, jede Gefahr zu vermeiden, unsinnig. Vielmehr geht es darum, einen kompetenten, also informierten und bewusst (eigen-)verantwortlichen Umgang damit zu erlernen, mit dem Ziel, das Leben ohne die ständige Anleitung durch andere meistern zu können (Gigerenzer 2022). Diese Fähigkeit wird allgemein als Risikokompetenz (Gigerenzer 2013) benannt.
Die menschliche Evolution kann grundsätzlich als kontinuierliche Anpassung an sich verändernde Lebensgrundlagen verstanden werden. Als Hominiden haben wir uns erfolgreich mit wechselnden Umweltbedingungen arrangiert, haben gelernt, welche Pflanzen genießbar, welche giftig sind, wie wir aggressiven Tieren begegnen und wie wir soziale Konflikte austragen. Auch der Umgang mit den neuzeitlichen Gefahren muss immer wieder eingeübt und erprobt werden. Die Wahrnehmung der Umwelt, des eigenen Körpers und der eigenen Befindlichkeit versetzt uns wie unsere Vorfahren überhaupt erst in die Lage, das Gesehene, Gehörte, Gefühlte und Verspürte zu interpretieren. Durch die Einordnung in einen bestehenden Erfahrungshorizont erlangen wir in einem weiteren Schritt die Urteilsfähigkeit, Wahrnehmungen qualitativ zu bewerten, um dann entsprechend zu agieren. Unser Erfahrungshorizont wächst in der Regel lebenslang, wir erlangen gleichsam eine unverzichtbare eigene Entscheidungs- und Handlungsbiografie. Unsere Selbstwirksamkeit, unsere intrinsische Motivation und unsere Intelligenz sind ohne diese Prozesse und die persönliche Entscheidungs- und Handlungsbiografie schwer denkbar. Wer wenig angemessene Urteilsfähigkeit ausbildet, bleibt auf die Expertise anderer angewiesen.
Risikokompetenz muss erworben werden. Dafür benötigen Menschen geeignete Lernfelder, um den Umgang mit Gefahren einzuüben, sie einzuordnen, sie zu verstehen, sie zu beurteilen und entsprechend eigenständig handeln zu können. Dazu braucht es wiederum die Freiheit, Risiken überhaupt eingehen zu dürfen. Dieser Spielraum dient nur vordergründig dem individuellen Abenteuer, bedeutsamer ist seine entwicklungspsychologische und gesellschaftliche Funktion. Kinder lernen, wenn sie altersangemessenen Herausforderungen begegnen dürfen. Das Misslingen und Gelingen eines Staudammbaus oder die Besteigung eines Baumes lehren eine ganze Bandbreite nützlicher Kompetenzen und Fähigkeiten: Körper- und Objektwahrnehmung, Motorik, Frustrationstoleranz, Selbstwahrnehmung und -wirksamkeit, Achtsamkeit (weil ein Sturz vom Baum weh tun würde), Emotionsregulation, soziale Kompetenz, Zielsetzung und -verfolgung, intrinsische Motivation und (Eigen-)Verantwortung. Sterile, auf Sicherheitsmaximierung getrimmte Spielplätze, abgesägte Äste in Bodennähe bei Parkbäumen und überbordende Dauerbeaufsichtigung hemmen das Erlernen von Risikokompetenz. In den letzten zwanzig Jahren haben sich die ambulanten und stationären Krankenhausaufenthalte aufgrund von Verletzungen, Vergiftungen und anderen Folgen äußerer Ursachen in den Altersgruppen der fünf- bis 14-Jährigen und der 15- bis 24-Jährigen um ungefähr die Hälfte verringert (Statistisches Bundesamt 2024a). Dies ist erfreulich, weil weniger Heranwachsende körperlich zu Schaden kommen. Im gleichen Zeitraum haben sich allerdings in den beiden Altersgruppen die stationären Aufenthalte aufgrund psychischer Störungen ungefähr verdoppelt. Die Gründe für diese Entwicklungen sind multifaktoriell und komplex, aber sie geben Anlass, die Bedingungen, unter denen Kinder aufwachsen, kritisch zu hinterfragen. Einiges deutet darauf hin, dass sich Kinder heute weniger in der Natur, auf dem Spielplatz, im Kindergarten und im Freundeskreis ausprobieren. Sie erwerben weniger unmittelbare, eigene Erfahrungen und verbringen mehr Zeit an digitalen Geräten und in virtuellen Welten (Haidt 2024, Louv 2005).
Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Fähigkeit, selbstständig und verantwortlich entscheiden zu können, eng mit unseren Vorstellungen von Freiheit verbunden. In diesem Sinne forderte der Schweizer Bergführer und Lawinenexperte Werner Munter in seiner bekannt pointierten Art, das Eingehen von Risiken als Menschenrecht zu verankern (Munter 2015). Die zugrunde liegende Überzeugung ist, dass es eine freiheitliche Gesellschaft nur mit autonomen, souverän handlungsfähigen und risikokompetenten Bürgern geben kann. Ohne sie sind Gemeinwesen und Demokratie weniger resilient gegenüber totalitären Strukturen, in denen Regeln ohne Widerspruchsduldung Entscheidungs- und Handlungsfreiräume beschränken. Die Freiheit des Einzelnen wird dann nicht erst durch die Freiheiten der anderen begrenzt und untereinander verhandelt. Stattdessen haben sich Verhalten, Gewissen und ethische Vorstellungen den normativen Vorgaben einer wie auch immer gearteten Ideologie unterzuordnen. Geschichte und Gegenwart liefern dazu aussagekräftige Beispiele.
Wir teilen das Bekenntnis zu einer freien Gesellschaft. Die individuelle Handlungsverantwortung in einem gesellschaftlichen Rahmen ist für uns auch ein zutiefst erziehungs- und bildungswissenschaftliches Anliegen. In diesem Buch schwingen für uns Autoren daher immer die Fragen mit: Wie, in welchen Lebenslagen und unter welchen Umständen eignet sich der Mensch erfolgreich Risikokompetenz an? Wie gelingt es Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, altersgerecht Einschätzungen und Einstellungen zu generieren, zu korrigieren und realistische Entscheidungen zu treffen? Erinnern wir uns an insbesondere bei TikTok verbreitete Challenges der letzten Jahre: Z.B. Selbststrangulierungsversuche oder das Einatmen von Deosprays bis zur Ohnmacht. Ein Zusammenhang zwischen fehlender niederschwelliger Misserfolgserfahrung beim Sich-ausprobieren, dem noch spielerischen Austesten der Grenzen und unrealistischen, lebensgefährlichen Mutproben liegt für uns auf der Hand. Gleichzeitig liegt es uns fern, sinnstiftende Planspiele, kognitive Übungen und digitale Gadgets abzuwerten, zumindest wenn sie nicht den Pfad in eine einsame interaktionslose und autistische Spielwiese weisen. Unser Plädoyer gilt in Ergänzung zu medialen Skills den nichtalltäglichen realen Situationen als Lernfeld mit ernsthaften Herausforderungen und unmittelbaren Konsequenzen. Handlungsorientierte Pädagogik und pädagogische Outdoortrainings bieten solche Lernfelder. Die Folgen unseres persönlichen Handelns zu erleben, ist ein zentraler Lernmechanismus (Borg-Laufs 2020,Kanfer/Saslow 1965). Auch wenn künstliche Intelligenz zunehmend Entscheidungen abnimmt, verbleibt die Verantwortung für das eigene Glück und das im größeren Rahmen gelingende Zusammenleben menschlicher Zivilisationen bei jedem Einzelnen. Informationstechnologien helfen, weitreichende Entscheidungen vorzubereiten. Doch nicht jede Information ist am richtigen Ort zur richtigen Zeit präzise und überprüfbar verfügbar, auch wenn es so zu sein scheint. Der Mensch bleibt hoffentlich das gestaltende Korrektiv – trotz aller Fehlerhaftigkeit. Nicht jede Situation ist kontrollierbar, auch wenn wir es uns wünschen. Unsicherheit auszuhalten und damit umzugehen, bleibt eine individuelle und kollektive Aufgabe der Risikoabschätzung, belastend und inspirierend lebendig zugleich. Risikokompetenz ist erlernbar.
2 Risikokultur als Rahmenmodell handlungsorientierter Pädagogik
Pädagogisches Handeln im Allgemeinen und das Leiten von Outdooraktivitäten im Besonderen erfordern kontinuierliche Entscheidungen. Leiter:innen entscheiden sich für eine bestimmte Methode oder Aktion, sie suchen das Material und den Ort aus, wählen eine Art des Aufbaus und der Anleitung, legen Regeln fest, überwachen Teilnehmer:innen enger, oder lassen ihnen größere Handlungsfreiräume. Bei Outdoormaßnahmen muss das Leitungsverhalten neben der pädagogischen immer auch die sicherheitstechnische Qualität der Durchführung umfassen. Anspruch ist, dass alle Gruppenmitglieder physisch und psychisch unversehrt bleiben. Geht alles gut und kommen alle heil zurück, scheinen die Entscheidungen der Leitung aus sicherheitstechnischer Sicht gepasst zu haben; geht etwas schief, war die Qualität scheinbar nicht so gut. Die relevante Grundlage für die sichere Durchführung von pädagogischen Outdoormaßnahmen sind unsere Entscheidungen.
In allen Fallberichten und -beispielen dieses Buches lassen sich im Nachhinein und oft nur rückblickend Momente finden, in denen eine oder mehrere andere Weichenstellungen das Missgeschick verhindert hätten. Dies bedeutet aber nicht, dass die jeweiligen Leitungen unvorsichtig oder gar fahrlässig gehandelt hätten. Vielmehr zeigt sich, dass oft besonders umsichtig geplant und in den Situationen agiert wurde und es dennoch zu einer kritischen Situation kam. Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, lässt sich dadurch erklären, dass Outdooraktivitäten immer auch eine Unsicherheit bezüglich der möglichen Gefahren beinhalten. Die Frage, welche Unwägbarkeiten tatsächlich auftreten können, ist auch durch ein mehr an Wissen, Können oder Sicherheitsvorkehrungen nicht vollständig beantwortbar. Es kann von den Verantwortlichen vernünftigerweise nicht erwartet werden, sehr seltene Ereignisse, die daher auch nicht durch Lehrmeinungen oder ein Standardhandeln erfasst wurden, vorherzusehen. Das zeigt folgendes Fallbeispiel:
Ein erfahrener Erlebnispädagoge führt mit einer Gruppe im Klettergarten eine Abseilaktion durch. Die Abseilstelle ist weder senkrecht noch besonders hoch und vollständig einsehbar. Der Leiter könnte also bei einem Problem jederzeit intervenieren. Dennoch baut er ein sogenanntes nachlassbares System auf, um das schnelle Ablassen einer sich abseilenden Person zu ermöglichen. Während der Aktion fällt buchstäblich aus heiterem Himmel ein Hund auf einen der oben am Beginn der Abseilstrecke wartenden Teilnehmer. Durch den gewählten Aufbau kann der Abseilende rasch zu Boden gebracht und der an der Schulter verletzte Teilnehmer versorgt werden. Der Hund streunte wohl oberhalb der Wand und stürzte aus gut 20 m Höhe ab. Alle haben Glück im Unglück: Der Teilnehmer ist nicht schwerer verletzt, und die Schulter federte für den Hund den Aufprall ab – zumindest ist er nach dem ersten Schrecken bereits wieder verschwunden.
Bei dieser Begebenheit war unvorhersehbar, dass ein Teilnehmer durch „Hundeschlag“ verletzt werden könnte. Lediglich seine Erfahrung, dass sich auch Unvorhersehbares ereignet und es dann hilfreich ist, Handlungsoptionen zu haben, hatte den Leiter zum Aufbau eines nachlassbaren Systems bewogen (s. Streicher et al. 2024a).
Unsicherheiten und die damit verbundenen Gefahren sind nicht gänzlich vermeidbar, aber sie lassen sich sowohl reduzieren als auch in ihren Folgen abmildern. Dabei hilft sowohl das Wissen über menschliche Entscheidungsprozesse und mögliche Fallstricke als auch die Kenntnis von unerwarteten, teilweise absurden Begebenheiten, mit denen man selbst auch nicht gerechnet hätte. Beides schärft den eigenen Blick und hilft, mögliche kritische Dynamiken vorherzusehen. Über letztere, die ungewöhnlichen Ereignisse, erzählen die Fallberichte in diesem Buch. Um erstere, die menschlichen Entscheidungsprozesse, geht es in diesem und den folgenden Kapiteln.
2.1 Das Risikokulturmodell
Struktur des Modells
Die Gefahren, denen wir uns und unsere Teilnehmer:innen bei pädagogischen Maßnahmen außerhalb geschützter Seminar- oder Klassenräume aussetzen, sind real. Wir können ausrutschen, hinfallen, abstürzen, unter Wasser geraten und vieles mehr. Was wir aber als Risiko wahrnehmen und einschätzen, kann ausgesprochen subjektiv sein (Slovic 1992). So mag die Begehung eines hohen Seilelements sicher sein, aber für den Einzelnen ausgesprochen riskant erscheinen. Ebenso kann die Mitteilung der eigenen Bedürfnisse oder das Eingeständnis vermeintlicher Schwäche während einer Gebietsdurchquerung in der Vorstellung für den Einzelnen ein subjektiv großes soziales Risiko darstellen, aber eine reale Gefahr ist es nicht. Zur echten Gefahr kann es für die Person werden, wenn sie ihre Grenzen ignoriert und beispielsweise völlig erschöpft ist. Risiko ist immer ein gedankliches Konzept und das, was wir als Risiko betrachten, kann auch konträr zu realen Gefahren sein. Wie also entstehen unsere Einschätzungen davon, was ein Risiko ist?
Menschliches Erleben und Verhalten ist eingebettet in einen kulturellen Kontext. Die Art und Weise, wie wir Gefahren wahrnehmen, beurteilen und wie wir uns dann verhalten, wird beeinflusst von einem weithin geteilten Verständnis darüber, was überhaupt unter Risiken zu verstehen ist, wie mit ihnen umgegangen wird und wer in welcher Situation welches Risiko eingehen kann oder muss. In diesem Sinne ist Risiko nicht allein das Produkt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit eines negativen Ereignisses und dem potenziellen Schadensausmaß, sondern immer auch eine subjektive Konstruktion. Dies wird mit dem Begriff der Risikokultur bezeichnet.
Als Gesellschaft haben wir uns mehr oder weniger an Todes- und Verletzungsfälle im Straßenverkehr gewöhnt, wären aber wenig bereit, Vergleichbares bei pädagogischen Maßnahmen zu akzeptieren. Aber nicht nur hinsichtlich verschiedener Risiken gibt es eine unterschiedliche Akzeptanz, auch innerhalb eines spezifischen Lebensbereiches kann sich unsere Vorstellung darüber, was überhaupt ein Risiko ist und wer welche Risiken eingehen sollte, mit der Zeit verändern: Im Straßenverkehr war es in den 1960er Jahren üblich, unangeschnallt zu fahren. Heute liegen die Anschnallquoten nahe 100% (Steptoe et al. 2002). Der Schaden, der früher durch Nicht-Anschnallen entstand, würde heute keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr finden.
Die innerhalb einer sozialen Einheit (z.B. der Gemeinschaft der Veranstalter:innen und Leiter:innen von pädagogischen Outdoormaßnahmen) geteilten Vorstellungen über Risiken bilden eine Art Beurteilungshorizont für unsere Wahrnehmungen und unser Verhalten. Ein solcher Bezugsrahmen für erlebnispädagogische Maßnahmen sind Qualitätsstandards wie beispielsweise die des Bayerischen Jugendrings (2025). Neben solchen mehr oder weniger normativen Empfehlungen existieren zahlreiche weitere Faktoren auf der individuellen bzw. sozialen Ebene und auf der Seite der Risikosituationen selbst, die unser Erleben und Verhalten beeinflussen. Hierzu gehören die physiologischen Bedingungen unseres Wahrnehmungsapparates, unsere Motivationen und Bedürfnisse, emotionale Zustände, Ziele, Einstellungen, Gruppeneinflüsse, Lernerfahrungen und die Vertrautheit oder Komplexität der Risikosituationen. Die relevanten Faktoren lassen sich mit Hilfe der 3x3-Matrix des Risikokulturmodells (Streicher et al. 2023) darstellen. Das Modell wurde zur Erfassung der verschiedenen Aspekte von Risikokultur entwickelt und hat sich in der Praxis als ausgesprochen hilfreich für die Bestimmung der zu berücksichtigenden Einflussfaktoren erwiesen (Streicher et al. 2018). Es liefert eine übersichtliche Struktur relevanter Aspekte zum Erleben und zum Verhalten in Risikosituationen. Die Struktur des Modells ist empirisch bestätigt (Bielefeld et al. 2023). Die Begriffe der einzelnen Zellen sind nicht so trennscharf, wie die grafische Darstellung glauben lässt. Die Übergänge sind eher fließend, die einzelnen Betrachtungskategorien beeinflussen sich gegenseitig, sind beispielhaft und nicht abschließend (Tab. 1).
Tab. 1: Das 3x3-Risikokulturmodell (Streicher et al. 2023)
Einflussbereiche
Kulturebenen
Merkmale der Person
Merkmale des (sozialen) Kontexts
Merkmale der Risikosituation
beobachtbar:
auch für Außenstehende bzw. außerhalb der Situation bestimmbar
Ausbildung, Vorbereitung, Ausrüstung, Anwendung von Standards.
Gruppengröße, Gruppenstruktur, Ausrüstung, formale Richtlinien, offizieller Auftrag des Veranstalters.
offensichtliche Gefahren, geringe Unsicherheit & Komplexität, Zusammenhänge zwischen Faktoren sind eindeutig und treten regelmäßig auf, bestimmbare Konsequenzen, relevante Informationen sind offensichtlich.
nicht von außen beobachtbar:
den Beteiligten bekannt oder in der Situation bestimmbar
Ziele, bewusstes Wissen und aktuelle Informationen, Erfahrungen, Ausdauer, Wohlbefinden, Nachdenken & Einstellungen.
gemeinsame Werte und Normen, Leitung, geteiltes Wissen und Informationen, Gruppenaustausch & -entscheidung.
Bekanntheit und Vertrautheit der Situation, wahrnehmbare Komplexität der Situation, relevante Informationen sind bestimmbar.
implizit:
auch Beteiligten meist nicht bekannt oder auch in der Situation nicht eindeutig bestimmbar
Ablenkung, implizite Vorstellungen & Erfahrungen, innere Zustände.
Lernerfahrungen oder Überzeugungen; Bewährtheit, Gruppendynamik, „Hidden Agenda“ und implizite Aufträge.
hohe Komplexität, unbekannte oder nicht bestimmbare Gefahren, Ausmaß der Gefahren nimmt nicht-linear zu, hohe und nicht eindeutig bestimmbare Komplexität und Unsicherheit, Zusammenhänge zwischen Faktoren sind uneindeutig und selten, relevante Informationen schwer bestimmbar.
Anmerkung: Die 3x3-Matrix des Modells dient als Orientierungs- und Strukturierungshilfe für die zu bedenkenden Aspekte des Erlebens und Verhaltens in Risikosituationen. Die einzelnen angeführten Aspekte sind beispielhaft gewählt für eine erlebnispädagogische Outdoormaßnahme.
Das Modell unterscheidet zwischen drei Einflussbereichen auf der horizontalen Ebene: den Merkmalen der einzelnen Person(en), des – sozialen – Kontextes und der jeweiligen Risikosituation, bezogen auf jeweils drei vertikal dargestellte Kulturebenen. Diese beschreiben ihrerseits unterschiedliche Zugänglichkeitsniveaus: Merkmale, die auch für Außenstehende erfassbar sind (beobachtbare Ebene), Merkmale, die nicht mehr unmittelbar durch Externe oder außerhalb der Situation wahrnehmbar, aber den Beteiligten bekannt sind (nicht beobachtbare Ebene) und Merkmale, die auch Mitgliedern einer Kultur oder sozialen Einheit nicht unmittelbar bewusst sind (implizite Ebene). Diese mittels der drei Ebenen beschriebene, unterschiedliche Zugänglichkeit ist ein zentrales Merkmal kultureller Identitäten (Schein 1988, 2017). In fremde Länder Reisende kennen die implizit genannte Erfahrungsebene: Sie empfinden die dort lebenden Menschen in einigen Bereichen als unterschiedlich, eben als „landestypisch“. Auf Nachfrage können die Einheimischen meist nicht unmittelbar benennen, warum sie bestimmte Einstellungen, Überzeugungen oder Verhaltensweisen eigentlich haben („Das ist halt so“, „Das haben wir immer schon so gemacht“, „Darüber habe ich noch nie nachgedacht“). Ein Beispiel hierfür ist die jeweilige körperliche Distanz, die man Unbekannten gegenüber im Gespräch wahrt. Für Außenstehende, z.B. unbeteiligte Wanderer, verhält es sich bei der Begegnung mit einer Naturwahrnehmungs-Gruppe im Bachbett möglicherweise ebenso: Einige Dinge wie Ausrüstung oder Gruppengröße sind für sie beobachtbar, andere können bei den Leitungen der Maßnahme erfragt werden, z.B. warum die Gruppe blind Gegenstände ertastet. Manches ist vielleicht auch für die Leitenden schwer erklärbar. So könnte es eine eigene, implizite Regel in der Gruppe geben, dass jede:r für sich auf Erkundungstour geht und die Gruppenmitglieder ihre Entdeckungen den anderen auch nicht mitteilen, obwohl dies nicht ausdrücklich vereinbart war. Warum sich die Gruppe so verhält, könnten dann weder Leitung noch Teilnehmende unmittelbar erklären.
Bezogen auf die Person und den sozialen Kontext sind in der beobachtbaren Ebene üblicherweise die formalen Vorgaben und Regeln angesiedelt. Im Kontext der handlungsorientierten Pädagogik wären dies schriftlich fixierte Lehrmeinungen (z.B. Lehrbücher), Handlungsanweisungen und Regeln (z.B. von Einrichtungen), Leitbilder, Konzepte, Methodenbeschreibungen, Seminar- und Ausbildungsinhalte oder formale Qualifikationen der Leitung. In der von außen nicht direkt beobachtbaren, aber den Akteuren bewussten Ebene befinden sich u.a. das bewusste (Handlungs-)wissen und die Einstellungen, reflektierte Erfahrungen, Gruppenabsprachen und vereinbarte Regeln und Ziele. Auf der impliziten Ebene sind das nicht unmittelbar bewusst zugängliche Wissen, nicht-reflektierte Lernerfahrungen, unausgesprochene (Gruppen-)Regeln und implizite Erwartungen (z.B. der Auftraggeber, der Leitung und der Teilnehmenden) verortet. Alle drei Ebenen beeinflussen unser Erleben und Verhalten.
Typischerweise werden Inhalte der bewussten Ebenen eher bei überlegtem, planvollem und reflektiertem Tun handlungsleitend, die impliziten Inhalte eher bei automatisiertem und spontanem Handeln. Dies ist unkritisch, solange alle drei Ebenen inhaltlich zueinander stimmig und angemessen für die realen Gefahren sind. Problematisch wird es, wenn sich die implizite und die beobachtbare Ebene widersprechen. Zur Verdeutlichung ein Beispiel:
Die formale Vorgabe eines Veranstalters ist es, bei Wasseraktivitäten wie einer Bootstour mit selbstgebauten Flößen die Schwimmfähigkeiten der Teilnehmenden schriftlich abzufragen. Dies ist so in den Manualen zu den jeweiligen Aktivitäten festgelegt. Je häufiger die Trainer:innen aber eine Aktivität durchführen, desto seltener lesen sie die Manuale, denn sie kennen die Aktion und haben Erfahrung damit. Zusätzlich stellen sie fest, dass Teilnehmer:innen sich regelmäßig über die Frage nach Schwimmfähigkeiten lustig machen, dass das Austeilen und Einsammeln der Bögen den Kursbeginn erheblich stört und dass es bislang noch nie eine(n) Nichtschwimmer:in gab. Ihre implizite Lernerfahrung ist, dass diese Maßnahme in dieser Form unnötig ist. Daher gehen sie dazu über, nur lapidar in die Runde zu fragen: „Ihr könnt sicher alle schwimmen?“ Als Rückmeldung geben sie sich zufrieden, wenn die gefühlte Mehrheit in der Gruppe die Frage bejaht oder nickt.
In dem Beispiel widersprechen sich die impliziten Lernerfahrungen der Trainer:innen mit der bewussten Ebene der formalen Regeln. Entscheidend ist dabei, dass die implizite Ebene die Erwartungen und Wahrnehmungen formt und dadurch handlungsleitend wird. Dies kann in Risikosituationen insbesondere dann der Fall sein, wenn entweder die formalen Vorgaben nicht mit den Erfahrungen der Betroffenen übereinstimmen oder die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der formalen Vorgaben nicht ausreichend vermittelt werden. In der Folge entsteht ein Risiko, das durch das Manual eigentlich ausgeschlossen werden sollte: Teilnehmer:innen mit unzureichenden Schwimmfähigkeiten teilen dies möglicherweise nicht mündlich auf eine lapidare Anfrage an die Gesamtgruppe mit und nehmen dann an einer Wasseraktion teil (s.a. Fall Ich kann nicht schwimmen).
Des Weiteren sind Risikokulturen dann problematisch, wenn die Merkmale der Person(en) und des sozialen Kontextes nicht zur Risikosituation passen. Im oben angeführten Beispiel eines Veranstalters von Wasseraktivitäten bestünde eine solche Diskrepanz, wenn die Teilnehmenden selbst entscheiden dürften, ob sie Schutzkleidung wie Neoprenanzüge tragen oder nicht, oder Trainer:innen ohne geeignete Qualifikation eingesetzt werden. Für die sichere Durchführung ist daher neben der Frage, was subjektiv als Risiko wahrgenommen und wie damit umgegangen wird, entscheidend, welche realen Gefahren es gibt bzw. geben könnte. Gerade bei pädagogischen Outdoormaßnahmen besteht die Herausforderung manchmal darin, zwei Anforderungen gerecht zu werden: der Sicherheit und dem pädagogischen Potenzial. Einerseits sollen Maßnahmen so sicher wie möglich sein, und daher müssen insbesondere die Kompetenzen und Fähigkeiten der Leitung, die gewählte Methode und Art der Durchführung, die Auswahl und Verwendung des Materials und die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Teilnehmenden den Anforderungen der Risikosituation entsprechen. Andererseits liegt das pädagogische Potenzial gerade in Handlungsfreiräumen und in der Unsicherheit von Situationen. Ein Zuviel an Sicherheit durch Regeln, Vorgaben und Material kann das pädagogische Potenzial deutlich einschränken (s.a. die Nachbetrachtungen zum Fall Sturz im Hochseilgarten).
Ausgehend vom Risikokulturmodell sind drei Bereiche für unser Erleben und Verhalten in Risikosituationen besonders bedeutsam: die einzelne Person, der soziale Kontext und das Handlungsfeld selbst. Im Folgenden werden zentrale Merkmale dieser drei Bereiche ausgeführt.
Merkmale des Risikos
Aus dem pädagogischen Blickwinkel stehen zunächst die beteiligten Personen, insbesondere die Teilnehmer:innen, im Vordergrund. Daran schließt sich häufig die Überlegung an, welche Maßnahmen sinnvollerweise durchgeführt werden und wie diese sicher gestaltet werden können. Für die sichere Gestaltung ist es aber wichtig, aus dem Blickwinkel der Risikosituation herauszudenken, um die möglichen sicherheitstechnischen Herausforderungen und Gefahren zu erfassen. Denn unterschiedliche Gefahren und Bedingungen können sich bezüglich ihrer Merkmale erheblich unterscheiden, wie folgende Beispiele verdeutlichen:
Eine Gruppe soll an einem schönen Frühlingsvormittag in einem ruhig gelegenen Waldstück einen sogenannten Säureteich (eine Fläche, die nicht betreten werden darf) überwinden. Der Ort ist der Leitung gut bekannt und liegt in unmittelbarer Nähe zum Seminarhaus. Der symbolische Säureteich ist mit einem Seil markiert, in seiner Mitte befindet sich ein Schatz, den die Gruppe mittels eines weiteren Seils bergen soll. Der Boden ist eben und weich. Eine andere Gruppe befindet sich im Herbst auf einer mehrtägigen Gebietsdurchquerung in einem Mittelgebirge. Die Gruppe ist für die Routenwahl verantwortlich und beschließt, weglos, weit abseits von Ansiedlungen zu gehen. Die Leitung kennt nur die Gegend, aber nicht das ausgewählte Gelände. Geschlafen wird im Freien unter improvisierten Zeltplanen. Seit einem Tag gibt es keinen Mobilfunkempfang mehr, die Wetterentwicklung ist im Wald nicht einzuschätzen und die in der Karte verzeichneten Wasserstellen erweisen sich als unzuverlässige Trinkwasserquellen.





























