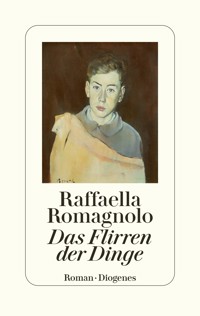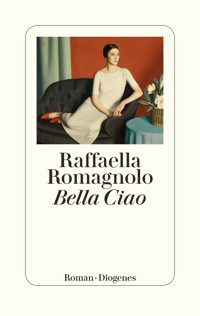
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Piemont, 1946. Giulia Masca kommt als gemachte Frau zurück in das Städtchen ihrer Kindheit, wo sie noch eine Rechnung offen hat. Vor fünfzig Jahren wurde sie von ihrer besten Freundin und ihrem Verlobten hintergangen, weshalb Giulia die Flucht ergriff und sich in New York eine Existenz aufbaute. Nun will sie ihre Freundin wiedertreffen – wie werden sie sich gegenübertreten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Raffaella Romagnolo
Bella Ciao
ROMAN
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Diogenes
Für die Jungen von der Benedicta.
Für Lia, wunderbare Tochter von Borgo di Dentro.
Für Ro natürlich.
Beim Anblick dieser Landschaft und dieses Nichts habe ich verstanden, dass es in der Gegenwart nichts gibt, das erzählt zu werden verdient. Die Gegenwart ist Lärm: Millionen, Milliarden von Stimmen, die schreien, alle gleichzeitig und in allen Sprachen, und dabei versuchen, einander zu übertönen mit dem Wort »ich«. Ich, ich, ich … Um die Schlüssel zur Gegenwart zu suchen und um die Gegenwart zu verstehen, muss man aus dem Lärm heraustreten, in die Tiefe der Nacht gehen oder zum Grund des Nichts.
Sebastiano Vassalli, Die Hexe aus Novara
Die Wahrheiten der Literatur werden durch Bilder erzeugt; hier aber erzeugen die historischen Tatsachen die Bilder.
Joyce Carol Oates, Die Verfluchten
ERSTES BUCH
Weitere Figuren
Lebt im Palazzo Reale. Der Vater Antonio und der Erstgeborene Achille sind Schuhmacher. Der Zweitgeborene Pietro ist Arbeiter in der Baumwollfabrik Raggio.
Pfarrer. Die Familie Salvi ist Eigentümer der Seidenspinnerei, in der Assunta, Giulia und Anita arbeiten.
Schwester von Libero, lebt mit Mann und Kindern über der Grosseria in der Mulberry Street.
Stammt aus Kalabrien, ist Mutter von drei Kindern und Kundin der Grosseria.
Sohn eines Einwanderers apulischer Herkunft, ist Abgeordneter und späterer Bürgermeister von New York.
BORGO DI DENTRO6. MÄRZ1946
Erstes Kapitel
Die Vergangenheit gibt es nicht, denkt Mrs. Giulia Masca vor dem verrammelten Palazzo Reale. Dasselbe hatte sie gedacht, als sie sich nach dem Verlassen ihrer Kabine auf dem Erste-Klasse-Deck unvermittelt in der Umarmung des weitläufigen, unübersichtlichen Hafens von Genua wiederfand, weiß von Licht und schwarz von Ruß.
Lieber nicht auf das Gedächtnis bauen, es hatte schon den Weg von der Stadt ins Dorf ganz falsch in Erinnerung: die Mole, die Gebäude, die Straße, die die Hügel hinaufführt, die Höhenlinie, das schwammige Grün der Kastanien, die schiefen Rebenreihen, dann die düstere Silhouette von Borgo di Dentro, die Gasse, den Geruch und nun auch das Tor.
Zwar sind die Dinge dieselben, als hätte die Zeit sich nicht die Mühe gemacht, in dieser Gegend hier vorbeizu-kommen. Neu und überraschend ist eher die Beschaffenheit der Wirklichkeit. Leichter? Und auch die Dimensionen: Mrs. Giulia Mascas Meinung nach müsste das Tor des Palazzo Reale größer sein. Viel größer. Das könnte sie schwören bei ihrem Sohn Michael, der am Ende der Straße wartet, zusammen mit dem Chauffeur, der sie am Schiff abgeholt hat und ein Schild hochhielt, auf dem stand: LIBEROS GOCERI. Banausen. Ungebildete italienische Analphabeten. Libero’s Grocery! heißt es richtig! Nicht einmal vom Briefkopf abschreiben können sie!
Sie ballt die behandschuhten Hände zur Faust und blickt hinauf, über die Hutkrempe hinaus. Sie sucht nach einem Zeichen. Wohnt da noch jemand? Winzige, tiefliegende Fensterchen, ärmlich, bau-fällig sieht es aus. Mit den Jahren ist sie leicht ge-schrumpft, daher müsste ihr alles riesig vorkommen. Schon seit fünfundvierzig Jahren bereitet sie sich auf diesen Mo-ment vor. Da: die abgebröckelten Stellen rund um die Tor-angeln, die Diamantquader, die Kratzspuren von Hunden, die Nagespuren von Holzwurm und Mäusen – sie erinnert sich daran und erkennt sie doch nicht. Sind es noch dieselben?
Eigentlich darf sie nicht trödeln, Michael muss zur Abendessenszeit in Mailand sein: Das sind von hier aus noch über zweihundert Kilometer auf schlimm zugerichteten Straßen. Sie haben den Krieg ja nur in der Zeitung verfolgt, aber durch die Scheiben des Aprilia hat sie sich schon ei-nen Eindruck verschaffen können und weiß deshalb, dass die Reise ihres Sohnes kein Honigschlecken sein wird.
Sie selbst wird sich hier ein Hotel für die Nacht suchen – es gab damals eins, da ist sie sicher –, doch davor wollte sie noch mit Michael am Palazzo Reale vorbeischauen. Aus Nostalgie. So ist das im Alter. Und dann wunderte sie sich über dieses … Nichts. Was hatte sie erwartet? Dass sie ein Willkommenstransparent vorfinden würde? Eine Kapelle und Majoretten? Oder sollte sie vielleicht hineingehen und die neuen Mieter ansprechen: Entschuldigen Sie, ich habe mal hier gewohnt, bin sogar hier geboren, im ersten Stock, auf dem alten Holztisch, darf ich hereinkommen? Ist die Maisstrohmatratze noch da?
Würde sie, Mrs. Giulia Masca aus der Mulberry Street, überhaupt noch darauf schlafen können?
In der ersten Grundschulklasse ließ sie der Lehrer im Chor wiederholen: Borgo di Dentro erhebt sich / auf einem Felsensporn / der liegt im Zusammenfluss / der Wildbäche Orba und Stura / auf hundertsiebenundneunzig Meter / über dem Meeresspiegel. Das Kind Giulia hatte keine Ahnung, was ein Sporn oder ein Zusammenfluss waren, jedenfalls hat sie nie mehr einen solchen Ort gesehen. Eine Handvoll Häuser, und darunter Wasser. Grünliche, übelriechende Pfützen im Sommer, Strudel im Herbst und Frühling, Eis im Winter, Wasser überall. Nicht genug, um ein Boot zu nehmen und zu verschwinden, ausreichend, um die Dämme und Fundamente zu zerfressen. Warum sollte man an so einem Ort sein Leben verbringen?
Will man Borgo di Dentro verlassen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste im Norden: von der Piazza unter dem Felsensporn aus führen Brücken über die zwei Wildbäche, die vor dem Zusammenfluss wie offene Arme aussehen. Hier musste einmal ein Schloss gestanden haben, da der Platz Piazza Castello heißt, doch Mrs. Giulia Masca vermutet, dass der Zusammenfluss es irgendwann verschluckt hat. Sie erinnert sich jedenfalls nicht an Türmchen oder zinnenbewehrte Mauern, sondern nur an die Straßenbahnhaltestelle. In der Tat kann man auf der Piazza Castello in die Straßenbahn steigen und über die erste Brücke abhauen, die die Stura überquert. Oder die andere Brücke nehmen über die Orba. Doch das ist, als machte man sich durch die Hintertür davon, nichts Heldenhaftes. Sogar sie Brücken zu nennen fällt ihr schwer. Brooklyn Bridge, das ist eine Brücke. Oder die Queensboro, die Williamsburg Bridge.
Die zweite Möglichkeit ist, sich nach Süden zu wenden. Das hat sie vor fünfundvierzig Jahren getan: An einem Februarmorgen hat sie Borgo di Dentro den Rücken gekehrt, ist durch die Neustadt und dann die Hügel hinauf losgelaufen. Aber ein Ort, dessen Hauptfluchtweg über ein Gebirge führt, hat etwas Verschlossenes und Finsteres an sich.
Entlang der zwei Wildbäche wimmelte es von Werkstätten, Schmieden, Mühlen, Gerbereien, Spinnereien. Noch jetzt hört Mrs. Giulia Masca den Lärm. Ob es die Filanda Salvi noch gibt? Diese Spinnerei befand sich einhundertzwanzig Schritte und sechzehn Stufen unterhalb des Palazzo Reale, in Richtung Stura. Wäre es nicht schon so spät, würde sie in die Gasse einbiegen und hinuntergehen, um nachzusehen. Ob das Dach nachgegeben hat? Ob die Mauern noch stehen?
New York altert nicht. Eines schönen Tages errichtet jemand einen Lattenzaun, hängt ein Schild auf, und einen Monat später steht an der Stelle des alten ein neuer Skyscraper. Himmel-Kratzer: Als sie zum ersten Mal unten vom Gehsteig aus den Himmel von Manhattan gesehen hat, eingezwängt zwischen funkelnden Kanten, schien es ihr, als würde er gleich explodieren und die Straße überfluten, die Schaufenster, den Hot-Dog-Verkäufer, das Bänkchen des Schuhputzers, die Unmenge von Leuten, die schwatzend vorbeiliefen, sie rücksichtslos anrempelten. Aber die Spinnerei Salvi?
Morgen wird sie sich vorwagen und einen Blick darauf werfen, ihr Sohn kommt sowieso nicht vor dem Abendessen zurück. Bei der Fahrt hierher stellte Michael, den Blick aus dem Fenster gerichtet, ihr unentwegt Fragen. Er bemühte sich, die Namen auf Italienisch zu wiederholen, die Mrs. Giulia Masca einen um den anderen aus den Tiefen des Gedächtnisses fischte. Punta Martin, Monte Tobbio, Madonna della Guardia, Borgo di Dentro, Palazzo Reale. »How does it feel?« Wie fühlt es sich an, Mama? Sie wusste keine Antwort.
Jetzt legt sie die Hand auf den Türklopfer, unentschieden, ob sie klopfen soll oder nicht, und im Geist sieht sie sich wieder als junges Mädchen – vor einem anderen geschlossenen Tor, dem der Spinnerei Salvi. Sie war zwanzig Jahre alt – zwanzig, sie ist sich sicher, denn es war gegen Ende des Jahres 1900, am Morgen des 23. November –, und an dem Tor hing ein rundes Holzbrett, ein ehemaliger Fassboden, mit der roten Aufschrift:
WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN
»Scheiße.«
So redete ihre Mutter Assunta. Scheiße. Kotze. Nutte. Pisse. Fotze. Hure. Als Giulia in der Schule im Turnen einmal das Wort Arsch gebrauchte, unterbrach Herr Olivieri, der Lehrer, den Unterricht, zog den Stock aus dem Hosengürtel, hieß sie ihre Finger ausstrecken, den Handrücken zur Decke des Turnsaals gewandt, und schlug siebenmal zu. Daraufhin machte die kleine Giulia es sich zur Regel, niemals Wörter zu benutzen, die sie nur aus dem Mund ihrer Mutter gehört hatte.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, wiederholt Assunta, während sie mit der flachen Hand auf die Schrift schlägt. Sie gebraucht halbe Sätze. Nach wenigen giftigen Wörtern hustet sie und spuckt Schleim. Nicht immer ins Taschentuch.
Auch Anita Leone ist bei ihnen. »Das hat bestimmt ein Maler geschrieben«, sagt sie, während sie mit dem Finger über die eleganten, scharlachroten Buchstaben fährt. Sie ist am selben Tag geboren wie Giulia, im Abstand von weniger als einer Stunde. Sie hat ein nachdenkliches Wesen, einen durchdringenden Blick, der bei den Einzelheiten innehält und Dinge sieht, die die anderen nicht sehen: Nuancen, Alternativen, Auswege. Und Augen wie Obsidiansplitter, einen dunkel schimmernden Teint, dicke, weiche Haut. Nie hätte man sie für eine irische Nutte halten können (Anita wäre es nie in den Sinn gekommen, mit einem Messer bewaffnet klarzustellen, wie die Dinge lagen). Eine mexikanische Puta vielleicht? Nicht mit diesen geraden Schultern, dieser Haltung, bei ihr hätte sich niemand getäuscht. Ihre Freundin Anita. Eine feige Verräterin. Deshalb ist Mrs. Giulia Masca doch zurückgekehrt, oder?
Assunta beachtet sie nicht, wie immer. Sie versteht Anita nicht, nennt sie Prinzessin oder Gräfin, oder Bela Rosin oder Königin Taytù, auch wenn sie in der Seidenspinnerei Salvi alle drei an den Schüsseln mit den Kokons stehen. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Sie hustet noch einmal, dann reibt sie sich die von dreiundfünfzig Jahren siedendem Wasser, gekochten Raupen und gewickelten Fäden rissigen Hände und schiebt sie unter die Achseln, während sie ihren Tuchumhang fester um sich zieht.
Giulia rechnet unterdessen. Ihre Hauptbeschäftigung seit Beginn des Streiks vor elf Tagen: Ein Arbeitstag bei den Gebrüdern Salvi dauert 12 Stunden und ist 80 Centesimi wert. Ein Teller Suppe und ein Viertel Brot kosten in den Cucine Economiche15 Centesimi (nur Suppe 10 Centesimi); ein Stück Stärkeseife zum Wäschebügeln: 20 Centesimi, eine Fahrt (hin und zurück) mit der Straßenbahn nach Novi Ligure: 40 Centesimi. Für ein Kilo Rindfleisch braucht man den gesamten Lohn von einem Tag, für Kalbfleisch sogar 1 Lira 40 Centesimi, also fast zwei Arbeitstage. Die Eintrittskarte für einen Ball? Je nachdem, was für ein Ball, zwischen 40 und 50 Centesimi. Sie kennt die Preise aller Sachen, die sie sich nicht leisten kann.
Der Reinverlust seit Beginn des Streiks beträgt 8 Lire und 80 Centesimi, macht mal zwei 17 Lire und 60 Centesimi, denn in der Familie gibt es zwei Spinnerinnen, der Vater ist gestorben, als Giulia gerade die Grundschule beendet hatte, und niemand trauert ihm nach. Sie hat eine Buchhalterseele, ein Erbe der Mutter, die nicht lesen kann, aber blitzschnell begreift und ihrer Tochter nun direkt in die Augen sieht. »Zufrieden?«, knurrt sie. Dann kehrt sie den beiden Mädchen den Rücken und geht wieder zum Palazzo Reale hinauf.
»Kommt sie denn nicht mit?«, fragt Anita. Giulia macht eine Handbewegung, als wollte sie sagen: besser so. Eigentlich sollten sie alle drei zum Kastaniensammeln in den Wald gehen. Am Nachmittag haben die Mädchen einen Sack voll beisammen. Um ihn aufzuteilen, gehen sie zu Anita, die auf einem Bauernhof auf der anderen Seite der Orba zu Hause ist, wo der Hügel und der Weinberg anfangen. Sie sprechen über das Schild, das an der Spinnerei hängt. WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN? Das glaubt doch kein Mensch.
Jedenfalls nach dem Theater, das drei Tage zuvor der Bürgermeister gemacht hatte, der Avucatein, der kleine Anwalt, ein Männchen mit lenkerförmigem Riesenschnauzbart, Spitzbart und Kaiserkoteletten. Er empfing die Spinnerinnen im zweiten Stock des Rathauses, im Sitzungssaal. Als die Verlegenheit überwunden war – noch nie hatten sie so große Gemälde, so glänzende Tische und für ihre zerlumpten Kleider so unangemessene Stühle gesehen –, legten drei Delegierte die Forderungen der Streikenden dar. Erstens: sofortige Entlassung der neuen Aufseherin Agostini, Maria Filippa: Sie quält die Arbeiterinnen, indem sie ihnen nur einmal alle vier Stunden den Gebrauch des Aborts gestattet; sie lässt sie zwei Centesimi Strafe zahlen, wenn ein Faden reißt oder ein Fadenanfang nicht zu finden ist; sie beleidigt sie, schimpft sie Drückebergerinnen und sogar, mit Verlaub, Dirnen.
Zweitens: Wiedereinstellung der Arbeiterinnen, die den Streik eröffnet haben. Drittens: Reduzierung der Stunden von 12 auf 11 pro Tag und Lohnerhöhung von 80 Centesimi auf 1 Lira. »In den Spinnereien von Novi« – schloss die Mutigste der drei – »verdienen die Spinnerinnen 1 Lira 30 pro Tag, plus Unterbringung und Heizung.« Und der Avucatein?
Der Avucatein, nichts. Nie einen Streik gesehen. Er brüstete sich immer vor dem Unterpräfekten und dem Oberleutnant der Carabinieri damit: Wir schreiben das Jahr 1900, beinahe 1901, und noch nie hat es in Borgo di Dentro einen Streik gegeben. Die Ziegelbrenner (vor vier Jahren) und die Straßenarbeiter (vor zwei Jahren) zählten nicht. Das waren Kindereien. Mussten jetzt ausgerechnet die Frauen anfangen?
Er stand auf Seiten der Besitzer, klar. Ja, er würde den Signori Salvi die unabweislichen Gründe der Streikenden vortragen. Ja, er würde eine günstige Gelegenheit abpassen, um ihr Anliegen zu einem guten Ende zu bringen. Ja, ganz gewiss. Unter der Voraussetzung, dass sie sofort zur Arbeit zurückkehrten. Sie sollten doch bedenken, dass sich die Situation nur verschärfe, falls ihre Starrköpfigkeit andauere. Sollten an die Mäuler denken, die sie stopfen müssten, und an die Härten des bevorstehenden Winters. Der Boden so gefroren, dass man keine Rübe herausziehen kann. Die Kastanien und Pilze, die zu Ende gehen. Die hungrigen Kinder mit ihren großen, flehenden Augen.
Er sprach zu sich selbst, ganz bestimmt nicht zu den Spinnerinnen, er vermied sogar, ihnen ins Gesicht zu sehen, starrte lieber auf die Körper, die dick vermummten Brüste, die Frostbeulen an den Händen (kein Vergleich mit dem blassen Teint seiner Gattin, den langen, schmalen, schneeweißen Fingern, mit denen die Frau ihm jeden Morgen die Krawattennadel ansteckte). Oder er ließ den Blick über die Gemälde an den Wänden schweifen, über die Kragenspiegel des Oberleutnants, die Stifte der Zeitungsschreiber, die Blätter, die er in seinen ebenso weißen Fingern hielt. Sein Ton war getragen, gefühlig: Kurz, sie sollten auf den Rat eines Vaters hören, denn ein solcher sei doch ein Bürgermeister: der Vater aller, Männer wie Frauen. Sie sollten noch heute in die Spinnerei zurückkehren. Morgen bei den Signori Salvi an die Tür zu klopfen, aus Hunger zurückzukehren wäre viel schlimmer.
Nach diesem Schluss herrschte verblüfftes Schweigen. Dann brüllte eine Frauenstimme vom Ende des Saals: »Avucatein, ciàntia lì! Jetzt reicht’s! Verhungert ist hier noch nie jemand!«, und der Bürgermeister verließ unter Pfiffen den Saal.
Kurz und gut, sie waren im Krieg. Der erste Schachzug der Besitzer war dieses Schild: WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN. Anders gesagt, sie saßen richtig tief in der Scheiße, bis hier. So hätte Giulias Mutter es ausgedrückt, die flache Hand auf Nasenhöhe haltend, wenn ihr Atem für einen Satz mit acht Wörtern gereicht hätte. Im Kopf hält sie nämlich ständig stumme Reden, neben dem Ofen sitzend, endlose, wütende Selbstgespräche, die ab und zu in einer Aufwallung von Vulgarität über ihre Lippen kommen.
Im Frühjahr 1850 ging auf dem Land rund um Borgo di Dentro die Seidenraupenpest um. Assunta Parodi war noch nicht ganz elf und arbeitete schon seit vier Jahren mit ihrer Mutter und zwei Schwestern in der Spinnerei. Da der Rohstoff mangelte, stand die Produktion monatelang still. Die jüngere Schwester starb innerhalb von vier Wochen an einem Brustleiden – »Scheiße« –, die ältere Schwester landete als Dirne in den Gassen von Genua – »Hurensau« –, und sie schafften es dank der Barmherzigkeit der Nachbarn, die Kartoffeln, Wirsing und manchmal ein Ei spendeten, bis zur Wiedereröffnung der Spinnerei durchzuhalten.
Mit siebzehn Jahren heiratete Assunta Erminio Masca, den Ersten, der ein freundliches Wort und ein halbes Lächeln – »Schleimscheißer« – für sie gehabt hatte, als sie mit niedergeschlagenen Augen hungrig, zerzaust und stinkend nach einer Zwölf-Stunden-Schicht von der Arbeit nach Hause ging.
Am 17. November 1869 wurde im Beisein der Kaiserin Eugénie und unter den Klängen des Ägyptischen Marsches von Johann Strauß Sohn der Suezkanal eingeweiht. Chinesische Seide überflutete den Markt, und Assunta verlor ihren Arbeitsplatz. Sie war neunundzwanzig, hatte zwei Kinder bekommen, die noch vor dem Abstillen gestorben waren, und einen ewig betrunkenen Mann.
»Hundesohn.«
»Suez« taufte sie die Suppe aus drei Zwiebeln, einer Rübe und einer Handvoll Kohlblätter, die mit Wasser, Salz und einem Esslöffel Essig zur Übertönung des ranzigen Geschmacks gestreckt wurde und für eine ganze Woche reichen musste. Sie aßen um halb fünf zu Abend, und um sechs lagen sie schon unter der Decke, weil nicht einmal das Geld für Kerzen da war. »Iss und sei froh, dass es kein Suez ist«, wiederholte sie seitdem jeden Abend vor einer Kartoffel, drei gesalzenen Sardinen oder einer Schüssel Kutteln.
Der Streik in der Spinnerei Salvi ist am Tag nach ihrem sechzigsten Geburtstag losgegangen. Sie hat von Arthritis verformte Finger und nur einen Zahn im Mund. Um atmen zu können, schläft sie nachts im Sitzen oder wacht am Ofen und zählt sich ihre über dreiundfünfzig Jahre gesammelten guten Gründe auf, um nicht an Gott und den Sozialismus zu glauben. Die Pfarrer auf der Kanzel und die Redner mit der roten Nelke, die von Genua den Berg herauf- und dann bis nach Borgo di Dentro hinunterkommen, sind ihrer Meinung nach zu fett, um die Wahrheit zu kennen. Männer, und fett. Paradies? Revolution? Ammenmärchen. Geschwätz für Säufer wie ihren Mann. Der Tag, als sie ihn in seinem Erbrochenen in der Gasse hinter der Kirche gefunden haben, ist der einzige, an dem Assunta mit dem Rosenkranz zwischen den Fingern eingeschlafen ist, und es war ein Dankgebet. Voller Teller und Holz im Ofen: Das ist ihr Credo. Und wenn es das Paradies nicht gibt – die Hölle hat sie erfahren und weiß, dass der Weg dorthin mit Streikparolen gepflastert ist.
»Miststücke.«
Alle, auch Giulia und die Prinzessin. Hätte sie nicht dreizehn Kinderarbeiterinnen und achtundfünfzig erwachsene Spinnerinnen gegen sich, würde Assunta allein bei den Salvi vorstellig: »Hier bin ich!«, würde sie sagen, das Feuer unter dem Kessel anzünden, den Hahn des ersten Beckens öffnen und anfangen, nach dem Fadenende zu suchen. Deshalb hat Giulia keine Lust heimzugehen, das Schild WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN war schon genug: Die Besitzer wollen sie zermürben, das ist klar. Auch noch die Verwünschungen der Mutter über sich ergehen zu lassen hält sie nicht aus.
Bei Anita zu Hause weht ein anderer Wind. Den Leones gehört das Bauernhaus, in dem sie leben, samt einem steinigen, kleinen Grundstück, das kaum etwas abwirft. Sie bewirtschaften in Halbpacht die Felder des Grafen Franzoni. Sankt Martin ist vorüber, die Verträge sind erneuert worden, für ein weiteres Jahr werden sie genug zum Arbeiten und zum Leben haben.
Der hinterhältige Schachzug der Salvi überrascht hier niemanden, weder die, die Anita bei jenem Namen rufen, den Großvater Domenico wollte, ein Garibaldiner, Veteran von Marsala und Calatafimi, noch die, die sie Maria Vergine nennen, worauf Großmutter Luigina bestanden hatte, da sie zur Madonna della Guardia betete und so fromm war, dass sie drei Wallfahrten im Jahr unternahm, im Frühling, im Sommer und im Herbst: In der Nacht wanderte sie mit Glocke um den Hals und Stock in der Hand den Berg hinauf und vor Sonnenuntergang kehrte sie mit zerlöcherten Strümpfen und blauen Zehennägeln zurück.
Auch Anitas zwei jüngere Brüder tragen den Geist des Großvaters im Namen: Pio Giuseppe Garibaldi Leone, achtzehn Jahre alt und Sozialist – zitiert Filippo Turati und schwärmt für den Klassenkampf; Benedetto Nino Bixio Leone, siebzehn Jahre und zum Noviziat bereit – hat Bildchen vom heiligen Franziskus und Leo XIII. in der Tasche. Anita steht daneben, während sie sich in die Haare geraten, lächelt und rührt die Polenta um. Ja, hier weht ein anderer Wind.
Giulia gefällt auch das, was die Cascina Leone umgibt: der Hühnerstall, der Kaninchenstall, der Keller, der Viehstall, der Laubengang, die Schaukel, die Jutesäcke, die Bottiche für die Trauben, die Weinpresse, die Hacken, die Spaten, das hölzerne Joch und die Eisen für die Ochsen, die Körbe, das Becken mit Kupfervitriol, der Geruch nach Stall und sogar der des Misthaufens, der anders ist als der Kloakengestank in Borgo di Dentro. Und dann die Sachen im Haus: die strohgeflochtenen Stühle, die Hocker, der große Tisch mit den Messerkerben, die Nähmaschine in einer Ecke, das rote Hemd, das an der Küchenwand hängt, mit allen Medaillen und einem an den Kragen genähten beinernen Kreuz. Unter dem Fenster das Bänkchen von Primo Leone, Anitas Vater, Maestro der Dorfkapelle und Trüffelsucher: Darauf liegen wohlgeordnet zwei glänzende Trompeten, das Organetto, ein krummes Messerchen, die Bürste mit weichen und harten Borsten, die Trillerpfeife für den Hund unter einem Porträt von Karl Marx. Über dem Spülstein dagegen hängt ein Bild der Madonna von Loreto, geschmückt mit einem Olivenzweig.
Im Hause Leone vergeht der Nachmittag schnell für Giulia. Bei einbrechender Dunkelheit nimmt Anita für alle beide ihren Mut zusammen, übergibt Giuseppe Garibaldi den Rührlöffel, bindet sich das Kopftuch um und zieht ihren Umhang an. »Ich begleite dich«, sagt sie.
Sie überqueren die Brücke und gehen wieder hinauf Richtung Borgo di Dentro bis zu der Stelle, wo man das Tor der Spinnerei sieht, Giulia mit ihrem halben Sack Kastanien. Ohne sich abzusprechen, sehen sie nach, ob das Schild noch da hängt, dann verabschieden sie sich. Anita macht kehrt, und Giulia geht weiter bergauf zum Palazzo Reale. Als sie fast oben ist, dreht sie sich um und betrachtet das große schwarze Fabrikgebäude, den langen kalten Schornstein, die Riesenfenster, in denen sich das Mondlicht spiegelt, das Tor mit dem Schild, Anitas rasche Gestalt, die in der Dunkelheit kaum noch zu erkennen ist. Dann biegt sie in die Gasse ein.
Sie lässt das prächtige Haus hinter sich, in dem die Salvis leben. Ob sie aus dem Fenster schauen? Haben sie den Tag damit verbracht, die Wirkung des roten Schilds auf den Gesichtern zu messen? Und jetzt, können sie sie sehen? Können sie ihre Gedanken hören?
Entlang der Nordseite der Mauern wachsen im November ein Streifen schwarzes Moos und eine Menge übelriechender kleiner Pilze. Um nicht draufzutreten, hält Giulia sich mehr in der Mitte, wo die Tramontana den Rauch der Öfen wegfegt und den Schmutz verweht. Mitten auf der Straße fordert sie die Dunkelheit heraus, die Schultern gerade, das Kinn zum Himmel gereckt, mit dem Sack, der gegen ihre Fußgelenke schlägt, sollen sie ruhig denken, dass sie ein liederliches Mädchen ist, ihr ist das egal.
Der Palazzo Reale ist ein dreistöckiges Gebäude mit einem Dach aus Reisig und zerbrochenen Rundziegeln, unter denen es von Raupen wimmelt. Gierig verschlingen sie die frischen Maulbeerblätter, die Giulia und ihre Mutter auf der anderen Seite des Flusses sammeln und in ein großes Tuch geknüpft hinauftragen. Die Frauen bewohnen zwei Zimmer im ersten Stock und dürfen für die Raupen die vier Gestelle auf dem Dachboden nutzen, die rund um den Kamin angebracht sind. Wenn die Raupen das richtige Stadium erreicht haben – nicht zu früh, so dass der Kokon noch nicht vollständig ist, nicht zu spät, so dass das Schlüpfen schon begonnen hat –, verkaufen sie sie an einen Zwischenhändler, der sie an einen weiteren Zwischenhändler verkauft, der sie dann an die Signori Salvi verkauft. Assunta begnügt sich mit dem, was sie ihr geben, sie würde nie auf einen Mittelsmann verzichten, eine Verhandlung mit dem Spinnereibesitzer auf sich zu nehmen fällt ihr gar nicht ein.
An der Kurve zur Gasse bleibt Giulia stehen, um das Gebäude zu betrachten. Sie weiß nicht, warum es »Palazzo Reale«, Königlicher Palast, genannt wird. Feuchte Zimmer, klein wie Abstellkammern, bröckelnde Stufen, schiefe Wände, Mauerrisse, Plumpsklos mit einem Loch zum Graben. Das dreckige Herz von Borgo di Dentro. Hühnerdiebe, Taschendiebe und Prostituierte. Und dann »Dentro« – drinnen – aber worin? Auch das kann sich Giulia nicht erklären. Mit ihrem genagelten Stiefel schiebt sie einen Haufen fauler Blätter beiseite. Sie hebt den Blick, sucht nach dem Mond, doch die Dunkelheit ist undurchdringlich, stumpf. Sie denkt, dass »Borgo di Dentro« der perfekte Name ist: Dentro, drinnen, das klingt wie im Gefängnis.
Der Kloakengeruch überwältigt sie. Bei Kälte riecht man ihn weniger, doch heute war ein lauer Tag. Sie stellt sich vor, wie die Sonne mit gleißenden Flammen durch die großen Scheiben des Gebäudes dringt. Hitze und Gestank nach toten Raupen. Weitere 80 Centesimi sind in Rauch aufgegangen. 55 hätte sie ihrer Mutter abgegeben, »wenn du nicht jeden Abend Suez essen willst«, der Rest wäre hinten in ihrer Nachttischschublade verschwunden, die kürzer ist als die Gleitschienen. Dort verwahrt Giulia die Hülle mit den Ersparnissen, die sie mit unnachgiebiger Selbstdisziplin über Jahre zurückgelegt hat: 1 Lira und 25 Centesimi pro Woche, also 5 Lire im Monat, für zehn Monate im Jahr, über elf Jahre, ergibt 550 Lire, und die sind nach Einschätzung des Verkäufers der Textilhandlung Mode e Novità vierundzwanzig Meter Qualitätsbaumwollstoff extra wert, 12 Meter Leinen, sechs Wäschegarnituren für den Winter und vier für den Sommer, eine dicke Wolldecke und zwei dünne, also beinahe eine Aussteuer.
Sie hat auch an ein Geschenk für Pietro Ferro gedacht. Ein Ölbildchen, das sie beim Trödler gesehen hat. Es kostet zwar dreißig Lire, doch Giulia findet, das ist es wert. Es zeigt zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, bei einer Schneeballschlacht in einem Hof, der dem Hof vor dem Tor des Palazzo Reale ähnelt. Der Junge trägt einen langen, in der bläulichen Luft flatternden Schal um den Hals. Er wirft einen Schneeball, und das Mädchen läuft lachend davon. Sie hat auch an ein Kärtchen gedacht. Darauf wird sie nur scheiben »Wir«. Ende Februar wird sie die Schublade leeren und kaufen, was nötig ist. Am zweiten Sonntag im März wird sie Pietro Ferro heiraten, und sie freut sich sehr, auch wenn sie nicht weit wegzieht: Die Ferris belegen den ganzen zweiten Stock des Palazzo Reale. Sie sind zu viert, Vater, Mutter, Pietro und der Erstgeborene Achille. Bei ihnen gibt es Platz, Essen, Wärme.
Am liebsten würde sie jetzt gleich zu ihm gehen. Die Treppe hinaufsteigen und darauf achten, dass ihre Mutter sie nicht hört. Sie käme im zweiten Stock an, würde eintreten, aber dann? Es gehört sich nicht, dass ein Mädchen um diese Zeit ihren Verlobten daheim besucht, als sie noch Kinder waren, war das anders, aber Pietro wird sowieso noch nicht zurück sein, der Straßenbahnwagen – und mit ihm die Neuigkeiten aus Novi Ligure – kommt nicht vor sieben Uhr abends an. Da Pietro in der Baumwollspinnerei Raggio arbeitet, weiß er alles über diese Tätigkeit. Giulia erwägt, ob sie zum Bahnhof gehen und ihn abholen soll, aber das schafft sie nicht mehr. Bei der lauen Luft dieses späten Martinssommers vermehren sich die Pilze entlang der Gräben, und die Jauche gärt, fließt über. Ihre Mutter hat recht, es ist ein Scheißleben, und darum sollten sie doch wenigstens gerecht entlohnt werden, denkt Giulia. Zu berechnen, was gerecht bedeutet, ist ihre und Anitas Lieblingsbeschäftigung, seit sie in der Spinnerei angefangen haben. In den neun Jahren vor den siedenden Schüsseln haben sie festgelegt, was sie darunter verstehen:
drei Mahlzeiten pro Tag
eine Portion gekochtes Rindfleisch oder ein halbes Huhn einmal die Woche
eine Schüssel Stockfisch am Freitag
Eier, Milch, Butter und Käse nach Bedarf
ein Tütchen gerösteten Kolonialkaffee pro Monat
ein Päckchen Amaretti oder Spritzgebäck pro Monat
ausreichend Kerzen und Petroleum, damit bis zehn Uhr abends Licht brennen kann
ein Konfektionskleid für den Winter, das man im Herbst kauft
ein Konfektionskleid für den Sommer alle zwei Jahre
ein Paar Schuhe pro Jahr
Nach Meinung Anitas müsste die Firma auch an ein Geburtstagsgeschenk für die Arbeiterinnen denken: ein Fläschchen Violetta di Parma für die Großen und eine Schachtel Buntstifte für die kleinen Mädchen. Giulia wiederum findet einen Panettone mit Rosinen zu Weihnachten nicht zu viel verlangt. Außerdem meinen sie, müssten sie von ihrem Lohn auch so viel zurücklegen können, wie sie für ihre Aussteuer brauchen, und sehen für jeden Monat ein kleines Extra vor: Januar: einen Muff; Februar: Wolle für zwei Paar Strümpfe und eine Eintrittskarte für den Karnevalsball; März: nichts, denn es ist Fastenzeit; April: ein Paar Seidenstrümpfe; Mai: einen Topf oder eine Pfanne oder zwei Schüsseln (nach Bedarf); Juni: ein Kopftuch für die Johannisprozession; Juli: neue Holzschuhe für die Madonna del Carmine; August: einen BH oder einen Unterrock mit Spitzensaum oder zwei Paar Unterhosen; September: Wolle, ausreichend für einen Schal; Oktober: drei Säcke Kohle; November: drei Salami; Dezember: außer dem Panettone einen Lippenstift und eine Eintrittskarte für den Silvesterball. Der gerechte Lohn ist also nicht nur so aus der Luft gegriffen, er ist messbar. Während sie in der Dunkelheit Borgo di Dentro durchquert, ist Giulia immer mehr davon überzeugt. Und Giuseppe Garibaldi Leone hat recht, Streik ist die einzige Möglichkeit, sie müssen sich gegenseitig den Rücken stärken, durchhalten bis zum Sieg, auch wenn es einen Monat dauert, auch zwei, Suez essen bis zum Frühjahr, solange es eben nötig ist. Wieder faule Blätter, im Abwasserkanal schwimmt ein Stück Scheiße. In der Mitte, in der Mitte der Gasse gehen, denkt sie und zieht die Schultern hoch, sollen der Herr Bürgermeister, der Herr Polizeipräsident, der Herr Oberleutnant der Carabinieri, die Herren Salvi und ihre Frau Mutter doch ruhig denken, dass sie liederlich ist. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Das Schild am Albergo Grande Vittoria verspricht Zimmer zu gemäßigten Preisen. Michael hat zwei dicke Brieftaschen eingesteckt, die eine voll Dollar, die andere voll Lire, und er verlangt eine angemessene Unterbringung. Den beruhigenden Worten des Portiers traut er nicht, die Livree ist zu fadenscheinig, Manschetten und Kragen zu abgewetzt, er will das Zimmer mit eigenen Augen sehen, deshalb begleitet er Mrs. Giulia Masca hinauf, stellt die Koffer neben dem Schrank ab, inspiziert Nachttische und Kommode, lässt am Waschbecken das Wasser laufen, fühlt, ob die Heizkörper warm sind, ob die Bettwäsche frisch ist und das Kopfkissen weich. »Tomorrow«, sagt er dann.
Morgen, ja. Als der Sohn das Zimmer verlassen hat, lauscht sie ihm hinterher, noch im Mantel. Was für ein Theater für eine Nacht. Wenn sie an die erste Zeit in der Mulberry Street zurückdenkt, muss sie lachen. Hat Michael das vergessen? Ratten, so groß wie Katzen, und Katzen, die so hungrig waren, dass man sich nicht trauen konnte, das Kind in der Wiege allein zu lassen. Mit über vierzig Jahren hat ihr Sohn noch immer die Kraft der Kindheit, die alles vergisst, der Jugend, die alles überwindet, Mrs. Giulia Masca dagegen kommt es vor, als hätte sie gar nichts überwunden, das Elend ist immer noch da und plagt sie in den Albträumen, die sie aufwecken, in dem Stück Brot, das nicht übrig bleiben darf, in dem Bonbonpapier, das man nicht wegwirft, denn man weiß ja nie.
In der Stille vernimmt sie die Schritte des Sohnes auf der Treppe, seinen Gruß in lächerlichem Italienisch, das Geräusch der Eingangstür, die sich öffnet und schließt. Dann erst zieht sie die Handschuhe aus, nimmt den Hut ab, legt alles auf die Kommode, schlüpft aus dem Mantel, schüttelt die Schuhe von den Füßen und lässt sich aufs Bett fallen. Sie denkt an die Blicke in der Eingangshalle. Der Portier hat sie nicht erkannt, wie sollte er? Er muss um die dreißig sein. Nicht einmal der Name im Pass erinnerte ihn irgendwie an etwas Vertrautes, an eine Zugehörigkeit zu Borgo di Dentro. Denn die Amerikanerin trägt einen ortsfremden Namen: Erminio Masca, ihr Vater, kommt von weit her, er hat zufällig kurz hier haltgemacht und nur eine Tochter hinterlassen, also nichts. Ob es daran liegt, dass Mrs. Giulia Masca sich nicht zu Hause fühlt?
Das Bett ist weich. Mit einer Hand streicht sie über die Kante des Kopfteils. Was bedeutet überhaupt zu Hause? Zu Hause, das ist die Lexington Avenue Nummer 12, erster Stock, über der neuesten der sieben Filialen von Libero’s Grocery. Küche, Wohnzimmer, Salon, zwei Speisekammern, Bad mit Badewanne und drei große Schlafzimmer. Riesig, für eine Frau allein, doch warum soll sie darauf verzichten, wenn sie es sich doch leisten kann? Zu Hause, das ist auch die Mulberry Street 117, wo noch das erste Geschäft ist, mit demselben Schild, das sie so beeindruckt hatte, als sie von Ellis Island kam und noch den Geruch nach Kielraum und abgestandenem Schweiß in der Nase hatte. Den unvergesslichen Gestank der dritten Klasse. In der Wohnung im ersten Stock wohnen jetzt acht kürzlich angekommene Kalabresen, vielleicht auch neun, Mrs. Giulia Masca ist sich nicht sicher. Sie vermehren sich rasch. Ungebildete Italiener, Analphabeten mit zu vielen Kindern, dago, wop, guinea. Zu Hause ist, wenn sie einmal im Monat dorthin zurückkehrt, um die Miete zu kassieren, ein Spaziergang über 22nd, Park Avenue, Union Square und Broadway bis Bleecker und Mulberry Street. Zu Fuß ein Stündchen, um die Rechnung zu begleichen und den ganzen Abstand zu genießen, den Weg, den sie zurückgelegt hat, aus der dunklen, brackigen dritten Klasse ins Licht von Lexington Avenue. Aber der Palazzo Reale? Ist das auch zu Hause?
Irgendwie ist sie beunruhigt. Die Vergangenheit gibt es nicht, okay, das hat sie verstanden, sie wird sich nicht auf die Erinnerungen verlassen. Amerika lehrt dich, immer nach vorn zu schauen! Doch vor dem verrammelten Tor des Palazzo Reale hat sie entdeckt, dass die Zeit keine gerade Straße ist, die in die Ferne führt, sondern dehnbar ist wie ein Band, das sich um sich selbst wickelt, und sie ist in einer Falte hängengeblieben. In Manhattan ist ihr das nie passiert.
Der Schrank im Albergo Grande Vittoria riecht nach Kampfer. 1917 hatte ein an die italienisch-österreichische Front entsandter Reporter in der New York Times geschrieben, dass die italienischen Soldaten Kampferpastillen lutschten, um den Leichengestank nicht wahrzunehmen. Libero hatte den Artikel verbrannt und aufgehört, die Pastillen zu verkaufen. Mrs. Giulia Masca hatte auch den restlichen Vorrat weggeworfen. Sie hasst den Geruch: Sie lässt die Schranktüren offen und reißt das Fenster auf, zieht ihren Mantel wieder an und schaut hinaus. Ein fast vollkommen rechteckiger Platz mit einer längeren Seite, perfekt für Faustball. Anitas Vater und ihre Brüder waren Spitzenspieler, und auch Pietro Ferro konnte mithalten.
Dann lehnt sie die Fensterflügel an bis auf einen Spalt, damit Luft hereinkommt, und stellt sich dem Schrank und dem Geruch. Camphor Tree. Vor zehn Jahren hat sie in Florida einen riesigen Kampferbaum gesehen, auf der letzten Reise mit Libero. Sie zieht eine Handvoll Kleiderbügel heraus und wirft sie aufs Bett. Dann beginnt sie, die Koffer zu leeren, Wäsche auf die eine Seite, Blusen und Röcke auf die andere, die Schuhe am Boden aufgereiht. Kalte Luft erfüllt das Zimmer, doch Mrs. Giulia Masca ist es lieber so: kalt, sauber. Zuletzt verstaut sie die Sachen im Schrank und in den Schubladen und wiederholt dabei: »Tomorrow, tomorrow.«
Als alles an seinem Platz ist, sieht sie sich zufrieden um. Mit der Hand streicht sie über die obere Leiste des Schranks: kein Staub. Sie bückt sich, um unters Bett zu schauen: Auch dort alles sauber. Nachdenklich streichelt sie über die Tapete. Hinter dieser Wand hatte der Circolo Democratico seinen Sitz: schwere, düster rote Vorhänge, Häkeldeckchen auf den Tischen und gusseiserne Spucknäpfe, auf einer Konsole die Bücher, die man ausleihen konnte (Edmondo De Amicis, Filippo Turati und Karl Marx). Porträts von Felice Cavallotti und Giuseppe Garibaldi, dem echten. Zu den Kundgebungen gingen sie und Anita in Männerkleidung: Hose, Jacke, Stiefel, Hut. So hatten sie es auch in jenem Winter gemacht. Anfang November war der Abgeordnete Pietro Chiesa, ein Sozialist aus Genua, nach Borgo di Dentro gekommen. Proletariat, Ausbeutung, Revolution. »So ein Scheiß!«, hatte Assunta geschimpft und mit dem Finger auf die zwei vermummten Mädchen gezeigt. Was sollte das bringen, wenn sie doch nicht einmal wählen durften? Dennoch stellten beide den Kragen auf, steckten das Kinn hinein und machten sich auf den Weg. Sie lauschten den Rednern, den Kommentaren. Noch tagelang diskutierten sie darüber.
Auch der Tanzabend, der organisiert wurde, um Geld zur Unterstützung der Spinnerinnen zu sammeln, fand hinter dieser Wand statt. Es war Samstag, der 15. Dezember 1900, der fünfundzwanzigste Streiktag. Wie kommt es, dass man bestimmte Daten nicht vergisst? Hätte Mrs. Giulia Masca damals hingehen können, würde sie die Zeit jetzt vielleicht nicht als gewunden empfinden, wie einen um die Spule gewickelten Seidenfaden. Sie mustert ihre Hände, die verdickten Gelenke. Dann wäre der Ball nur eine beliebige Erinnerung, ein winziges Pünktchen auf der Lebenslinie. Möglicherweise wäre sie gar nicht davongelaufen und würde sich heute nicht so fühlen: fremd in ihrem Heimatdorf. Ist es nicht mehr dein Zuhause, wenn du weggelaufen bist? Kannst du nicht zurückkommen?
Ranken aus Feuchtigkeit säumen die Ränder der Tapete. Aus dem Tanzabend wurde nichts, sie bekam Fieber. Murrend stieg Assunta hinauf, um es Pietro Ferro zu sagen, und dann hustend hinunter, um die Königin Taytù zu verständigen, die vor dem Tor des Palazzo Reale auf die Verlobten wartete. Anita erbleichte, als sie es hörte. »Sie ist ja nicht gestorben!«, hatte Assunta geknurrt. Ohne ein Wort hatten sich Pietro und Anita auf den Weg gemacht.
Seit mindestens drei Wochen hatten die beiden sich nicht mehr in die Augen geschaut. Wenn, dann nur aus Versehen. Am Sonntag zuvor, als sie alle zusammen im Hause Leone Karten spielten, hatten sie auch aufgehört, miteinander zu sprechen. Es hatte sich ganz natürlich so ergeben, wenn es auch schmerzte. Eine Frage der Vorsicht.
Sich nicht in die Augen zu schauen war schier unmöglich, aber sie hielten durch: Pietro begnügte sich damit, auf ihre Hände zu starren, die zarte Rundung ihres Ohrs, den aufreizenden Busen. Als ihm klar wurde, was er da machte, sah er abrupt woanders hin, doch auch das war unvorsichtig, jemand hätte es bemerken können.
Anita dagegen betrachtete seine Schultern und seine langen, dichten, immer sauberen Haare, die Art, wie sie sich im Nacken und an den Schläfen lockig ringelten, doch es war verkehrt und gefährlich und anstrengend, eine ständige starke Spannung, die es unmöglich machte, miteinander zu sprechen.
Wann war es zum ersten Mal passiert? Wann war Pietro Ferris Körper Anita Maria Vergine Leone aufgefallen – die Arme, die Schenkel, die sich unter der Hose abzeichnen –, seit wann war Pietro von Anitas Lippen fasziniert, fleischig wie schwarze Pflaumen? Wann hatte Giulia aufgehört, Giulia zu sein – Freundin, Verlobte –, und hatte plötzlich zwischen ihnen gestanden wie ein Hindernis? Wann war sie die andere geworden?
Sie kennen sich von klein auf: Pietro, der Freund von Giulia, und Giulia, die Freundin von Anita. Sie spielen Verstecken, Blinde Kuh, Ball. Dass Pietro und Giulia sich verloben würden, war selbstverständlich, sogar Assunta feierte das Ereignis mit zwei Bratwürsten. Und sie alle trafen sich weiterhin jeden Wintersonntag zu einem Imbiss, zu einem gemeinsamen Spaziergang im Wald, zum Kartenspielen im Hause Leone (Focaccia, Salami, in Milch gekochte Kastanien, Pfirsichkompott), Pietro und Giulia kamen zusammen und gingen zusammen wieder fort. Nur dass Pietro auf einmal nicht mehr fortgehen mochte und Anita wünschte, er würde bleiben. Allein.
Assunta sieht ihnen nach, wie die beiden sich zum Ball aufmachen, und lässt dann hinter sich das Tor zuknallen. Seltsam, dieses Schweigen, denkt sie. Aber so ist die Prinzessin eben: hochmütig. Ihr zukünftiger Schwiegersohn tut gut daran, nicht das Wort an sie zu richten. Wenn Gefahr droht – für Assunta droht immer irgendwo Gefahr –, kommt sie nicht von so einer.
Die zwei gehen zügig, ohne sich zu berühren, aber auch nicht zu weit auseinander, damit es nicht auffällt, dass sie sich bewegen wie ein auseinandergerissenes Paar. Doch woher das schlechte Gewissen? Was tun sie denn Böses? Eigentlich hätten sie zu dritt hier sein sollen, das Geplauder, die Aufregung des Balles, schon halb wie Weihnachten für diejenigen, die in diesem Jahr aufgrund des Streiks nicht einmal eine Mandarine bekommen werden. Welche Schuld trifft sie, wenn Giulia krank geworden ist, nicht sie haben entschieden, sich in dieser Situation wiederzufinden, hier im Licht des Sonnenuntergangs, mit ihren besten Kleidern. Sie mit aufgesteckten Haaren, im roten Kleid, dessen Saum unter dem Umhang hervorschaut wie fließende Lava – er nach Seife duftend, sie nach Lavendel, sich zu bestimmten Gelegenheiten festlich zu kleiden und zu parfümieren ist normal, wer konnte ahnen, dass Giulia nicht mitkäme?
Als sie aus Borgo di Dentro in den offenen, elektrisch beleuchteten Teil der Neustadt kommen, atmen sie erleichtert auf. Geräuschlos passieren sie den noch geöffneten Kurzwarenladen, die Konditorei mit Torroni und Bergen von glasierten Mandeln, die Schenke mit den aufgereihten Flaschen. Im Nu erreichen sie den Saal, treten hintereinander ein und lassen es wortlos zu, dass die Menge sie trennt. Er fordert sie nicht zum Tanzen auf, sie würde sowieso ablehnen, eine Ausrede erfinden, zu warm, zu müde, jede Ausrede wäre recht.
Sie unterhält sich mit allen, den anderen Spinnerinnen, den Schwestern, den Ehemännern, den Cousinen, nur nicht mit ihm, und Pietro hält es genauso. Als die Kapelle einen langsamen Walzer spielt und sie mit einem rüstigen kleinen Typen tanzt und Pietro eine Grundschullehrerin im Arm hält, kreuzen sich ihre Blicke, und beide merken, dass der Abend nicht vergeht, er scheint ewig zu dauern, seit einer Ewigkeit suchen sie einander, und jetzt stört sie die an Pietro geschmiegte Lehrerin, und ihn stört der Typ, der auf Anitas Hals atmet, und die ganzen guten Vorsätze, mit denen sie zu dem Ball gegangen sind, retten sie nicht vor dieser Qual.
Anita beschließt zu gehen, doch allein kann sie das nicht, nach zehn ist es dafür zu spät, also löst sie sich von ihrem Kavalier und sucht nach Giuseppe Garibaldi. Wenige Minuten zuvor hat sie ihn am Arm einer Blondine hereinkommen sehen, nun fragt sie ihn, ob er sie heimbringen kann, weil sie sich nicht wohl fühlt.
Der Bruder hat gar keine Lust dazu. »Warte mal«, sagt er, überquert rasch die Tanzfläche, bis er Pietro Ferro erreicht, und flüstert ihm ins Ohr, ob er bitte Anita nach Hause begleiten könne, sie sei doch die beste Freundin seiner Verlobten, und Pietro gehöre ja fast zur Familie, sei ja fast der dritte der Brüder Leone – nur für dieses eine Mal, mit der Blondine habe er noch was vor, kurz gesagt, Giuseppe Garibaldi wäre ihm wirklich sehr dankbar. Dann kehrt er hocherfreut zu Anita zurück, zeigt auf Pietro, der blass und ernst neben dem Podium steht, und sagt: »Keine Bange, er begleitet dich.«
Wieder müssen sie durch Borgo di Dentro. Sie gehen über einen kleinen Platz, biegen in eine übelriechende, zwischen hohen, düsteren Mietshäusern eingezwängte Gasse ein. Sie reden nichts, Anita ist einen Schritt voraus, Pietro mit gesenktem Kopf gleich hinter ihr. Es ist stockdunkel, rechts und links tiefschwarze Gewölbe, hinter denen sich Höfe voller Gestrüpp und Unrat auftun. Eine Ratte rennt über die Straße und schlüpft in ein Loch. Wie angewurzelt bleibt Anita stehen, Pietro kann nicht rechtzeitig bremsen und prallt mit ihr zusammen. Sie fühlt seinen Atem, läuft noch schneller weiter, erreicht den Ortsrand. Sie schaut hinunter auf die Piazza Castello. Borgo di Dentro ist Mittelalter, doch die vor ihr liegende, von Gaslampen erleuchtete Freitreppe wird sie aus der Finsternis hinausführen. Anita stürmt mit großen Sprüngen hinunter, eilt auf die Bogenlampe zu, die den Anfang der Brücke über die Orba anzeigt. Es ist windig, das schnell fließende Wasser gluckert, das brechende Eis kracht. Das Mädchen beschleunigt weiter. Wie im Flug durchqueren die beiden die Handvoll niedriger Häuser und Werkstätten am Fluss, die keinen richtigen Namen haben, einfach nur Borgo. Immer noch mit gesenktem Kopf laufen sie hintereinander, sie rennen schon fast, wer sie sähe, würde meinen, es gebe einen Notfall, jemanden, der Hilfe braucht, Anita keucht, verlangsamt aber nicht, Pietro ist es heiß, er schwitzt, bemüht sich, die vor ihm laufende Gestalt nicht anzusehen, hält die Augen fest auf die Straße gerichtet, aber auf dem Schotter sieht er ihre Fesseln, die rote Welle ihres Kleides, im Nu sind sie auf dem offenen Land, die ansteigende Straße zwingt Anita, langsamer zu werden, und um sie nicht umzurennen, passt Pietro erneut seinen Schritt an. Ein Karren fährt ratternd an ihnen vorbei, überholt sie und lässt sie in der geballten Stille zurück, die die Kartoffelfelder und die dürren Weinstöcke umfängt. Der Mond steht hoch, die Straße glitzert eisig. An der ersten Biegung sieht man den Weg zur Cascina Leone. Nur darauf wartet Anita, die Rede hat sie schon vorbereitet: Danke, Pietro, geh nur wieder zum Ball, weiter brauchst du mich nicht zu bringen, wir sind da. Schon seit sie den Saal verlassen haben, denkt sie daran, das Wichtigste ist, den Abend ohne Schaden zu beschließen, morgen kann sie sich dann Gedanken machen, wie sie diese Sache bewältigt, wie sie diese Leidenschaft in den Griff bekommt, Giulia und Pietro heiraten im März, werden Mann und Frau, es ist, als seien sie das schon, es wäre, als würde sie eine Schwester betrügen. Danke, Pietro, wird sie zu ihm sagen, du kannst jetzt zurückgehen, nicht nötig, zwei Schritte, und ich bin daheim. Also bleibt Anita stehen, als sie oben an der Straße den Weg zur Cascina Leone weiß leuchten sieht, und wendet sich um, doch statt mit niedergeschlagenen Augen zu sprechen, hebt sie den Blick und begegnet dem seinen, hungrig, verstört.
»Pietro«, sagt sie.
Er legt ihr fest die Finger auf den Mund. Sie sind kalt und rauh. Anita keucht, ihr Atem hüllt sie beide ein. Noch nie hat sie Pietros Augen so aus der Nähe gesehen. Sie schließt die ihren und legt ihre Finger auf seine Lider, dann auf seine Backenknochen, auf seine eiskalten Wangen.
»Bitte, Anita.«
Es ist ein wilder Kuss. Mehr, denken beide, als die Körper sich voneinander lösen. Mehr, mehr, mehr, doch Anita Maria Vergine Leone sagt: »Nie mehr«, und Pietro Ferro nickt.
Sie hastet nach Hause, schlüpft ins Bett, schläft erst im Morgengrauen ein; am nächsten Tag gibt sie vor, krank zu sein, und bleibt liegen. Aber sie tut nicht nur so, es geht ihr wirklich schlecht, so schlecht wie noch nie, sie hat weder Kraft noch Appetit, hat keine Kontrolle über ihre Gedanken, sieht immer noch Pietro vor sich, erlebt wieder den Kuss, die Augen, den Kuss, die Hände, den Kuss, die Lippen, den Kuss. Sie verjagt die Bilder, doch sie kehren zurück, sie meint sogar den Geschmack zu spüren. Wenn jemand ans Bett tritt, dreht sie den Kopf zur anderen Seite, sie fürchtet, jeder könne in ihren Augen lesen, den Geruch erraten. Sie überlegt, sich zu waschen, doch dann bringt sie es nicht fertig, sie will ihn immer noch spüren, es ist schrecklich, so etwas ist ihr noch nie passiert. Das ist also die Liebe, denkt sie: eine Krankheit. Tatsächlich sprechen alle von Grippe, wahrscheinlich die gleiche wie Giulia, und lassen sie ruhig im Bett liegen. Großmutter Luigina bringt ihr ein Schüsselchen Hühnersuppe, Giuseppe Garibaldi einen gekochten Apfel. Nach drei Tagen steht sie wieder auf, blass und zerschlagen, als hätte jemand sie verprügelt. Wenn das Liebe ist, will Anita Maria Vergine Leone nichts davon wissen.
Pietro Ferro hält sich fern. Zehn Tage nach dem Ball trifft Giuseppe Garibaldi ihn zufällig an der Straßenbahnhaltestelle und will wissen, warum er sich nicht mehr sehen lässt. Mit verschlossenem Blick schustert Pietro eine Geschichte von dringenden Aufträgen und plötzlichen Verpflichtungen zusammen. So verbringt er zwei weitere Wochen, in denen er die ganzen Familie Leone meidet, bis Weihnachten kommt und einen schwarzen Schleier über alles wirft.
Am Abend des vierundzwanzigsten, zehn Minuten vor Mitternacht, verlässt er mit Giulia den Palazzo Reale, um zur Messe zu gehen. Sobald die beiden sicher sind, dass sie niemand sieht, verkriechen sie sich in einem Torbogen. Borgo di Dentro leert sich, die einen sind in der Kirche, die anderen bereiten zu Hause die Suppe für nachher vor. Auch die Verbrecher ruhen sich aus. Die beiden kehren um, steigen leise zum Dachboden hinauf, strecken sich auf einem Lager aus dürren Blättern und Lumpen aus, das Pietro am Nachmittag unter den Seidenraupengestellen hergerichtet hat, und lieben sich zum ersten Mal.
Die Idee stammte von Pietro. In den vergangenen Tagen genügte ihm das Bordell nicht mehr. Trotz der neuen Mädchen, die die Puffmutter ihm zum Sonderpreis angepriesen hatte. Pralle Titten und nackte Schenkel löschten Anitas Lippen nicht aus. Alles duftete nach ihr. Er war zerstreut, verirrte sich, verpasste die Straßenbahn. Manchmal hielt er bei der Arbeit in der Baumwollspinnerei verträumt inne und brachte so seine Finger in Gefahr. Wenn ich mit Giulia schlafe, dachte er, wird Anita verschwinden.
Er muss es versuchen, eine Erfahrung verdrängt die andere. Außerdem liebt er Giulia, da ist er ganz sicher, er will sie heiraten, seit sie fünf sind und sie ihn mager wie ein Vögelchen mit Zahnlücken anlächelte und ihm das Schälchen mit Milchkaffee hinhielt. Mit der Frau zu schlafen, die er gewählt hat, wird ihn gesund machen.
Giulia willigt ein, weil ihr bang ums Herz ist. Der Streik, die Mutter, jeden Abend Suez. Und außerdem heißt es, dass etliche aufgeben. Es hat ein Treffen mit einem Vertreter der Arbeitgeber stattgefunden, sie war nicht eingeladen, Anita schon, ist aber daheim geblieben, und Giulia hat begriffen, dass sie gern hingegangen wäre.
Sogar der Pfarrer hat sich eingemischt. Drei Tage vor Weihnachten hat er von der Kanzel gegen den Tanzabend gewettert und gegen die Streikenden, die von den Sozialisten Geld angenommen haben. Von Leuten, die nur Unruhe stiften und die nicht einmal Respekt vor dem Allerheiligsten haben, wenn die Prozession vorbeizieht. Und während die Gläubigen das Loblied des Herrn singen, arbeiten diese Halunken eifrig weiter und klopfen Nägel in die Sohlen. Aber Gott ist ja nicht taub. Weder taub noch blind. Das Geld der Sozialisten ist schmutzig, Gott sieht es genau.
Was heißt hier Geld. Der kleine Zuschuss, den Giulia und ihre Mutter vom Circolo Democratico bekommen haben, hat für zwei Dutzend Eier, zwei Kilo getrocknete Bohnen, eine Flasche Milch und drei Körbe Kohle gereicht. Sie nimmt ständig ab, unter dem Kleid stehen die Rippen heraus, der Busen ist verschwunden. Soll doch der Pfarrer mal ein bisschen Mildtätigkeit üben. Wäre das nicht seine erste Pflicht?
In Borgo di Dentro lieben ihn alle, denn kaum war er mit dem Seminar fertig, hat er vom Vater seinen Teil des Erbes verlangt, und mit diesem Geld will er demnächst ein Freizeitheim eröffnen, wo arme Kinder Mittagessen und Vesper bekommen. Die Bauarbeiten haben schon begonnen. Es wird einen Hort geben, einen Fußballplatz, ein Theater und »Lichtspiele«. Bisher nur Wörter. Dennoch betrachten sie ihn hier schon als Heiligen. Auch Anita betet ihn an. Ihr Maria-Vergine-Anteil, denkt Giulia.
Salvi. Der Pfarrer heißt Don Giuseppe Salvi. Der Erbteil, mit dem er das Freizeitheim bauen will, stammt von der Fron von Spinnereiarbeiterinnen wie ihnen. Auch sie wird etwas von dem kleinen Theater bezahlen, denkt Giulia, den Stoff für den Bühnenvorhang vielleicht oder die Bretter für den Bühnenboden, und dann denkt sie, als Unser Herrgott Don Giuseppe Salvi genötigt hat, zwischen Barmherzigkeit und Familie zu wählen, da hat er sich entschieden, und wie er sich entschieden hat.
Anita war von der Predigt beunruhigt, sie hat dem Circolo das Geld zurückgegeben, für jemanden, der es nötiger braucht. Dieser Maria-Vergine-Anteil macht Giulia manchmal rasend. Deshalb fragt sie sie nicht um Rat, sondern nimmt Pietros Vorschlag widerspruchslos an, obwohl sie in dieser Dringlichkeit ein Sich-Überstürzen des Lebens spürt, einen Missklang, der ihr nicht gefällt, nachdem sie so viele Jahre auf die Offenbarung der Hochzeitsnacht gewartet hat. Und sowieso mag sie es nicht, vor Anita Geheimnisse zu haben. Es hemmt und stört sie in ihren Gedanken. Doch sie fühlt sich schon am Altar und glaubt, Pietro Ferro von ganzem Herzen zu lieben: Warum soll sie ihm den Wunsch nicht erfüllen?
Dann ist Weihnachten vorbei und auch Silvester. Das neue Jahrhundert erschüttert Borgo di Dentro mit einem leichten Erdbebenstoß, ohne Schaden, eine Kurznachricht im Corriere delle Valli. Don Salvi hat eine außerordentliche Novene beten lassen, und Assunta hat eine Extraration Kohle verbraucht, um einen Kessel mit Salzwasser zu kochen: »Man muss die Luft reinigen«, sagt sie. Anita verlässt das Haus nicht mehr: Sie hat Giulia durch Nino Bixio ausrichten lassen, dass sie sich immer noch nicht wohl fühlt. Die Schaufenster der Konditoreien sind nicht mehr verlockend, der Kohlevorrat ist um die Hälfte geschrumpft, das Schild WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN hängt immer noch da, und Pietro Ferro hat sie nicht gebeten, es noch einmal zu machen. Sie hätte Verdacht schöpfen müssen. Aber diese Dinge merkt man erst später.
Im ersten Moment hatte sie sich nicht gewundert, denn auch sie hatte kein Verlangen danach. Es war schmerzhaft gewesen, hastig und linkisch von beiden Seiten. Das jedenfalls schloss sie aus Pietros Verhalten, diese abgehackten Bewegungen, die lange Pause, die er sich genommen hatte, als sie mittendrin waren. Eine Minute? Zwei? Das Gesicht zur anderen Seite gewandt. Vielleicht sind die Männer so, brauchen Unterbrechungen. In einem echten, warmen Bett wäre es etwas anderes gewesen, dachte sie in jenen Tagen. Wie töricht sie gewesen war.
In den drei Tagen Liebesfieber verschmilzt Pietro Ferros Bild in Anitas Kopf mit dem des heiligen Martin, der kürzlich gefeiert wurde, mit dem makellosen Hemd des Avucatein, dem roten Schild, dem Pfarrer, der mit der Faust auf die Kanzel schlägt, mit Assunta, die spuckt und flucht, mit den siedenden Schüsseln. Im Halbschlaf hat sie auch den ersten Tag in der Spinnerei noch einmal durchlebt. Sie ist gerade neun geworden, ihre Mutter lebt noch, ist aber krank und kann nicht mehr zu den Salvi gehen. Jetzt ist sie an der Reihe, doch sie weiß nicht, wohin mit den Händen, und legt sie deshalb in den Schoß. Die Aufseherin zeigt ihr, wie man den Dampf einstellt, der die Schüssel erhitzt, und den Korb mit den Kokons, dann erklärt sie ihr, wie man die verpuppten Larven bürsten und dabei das Fadenende herausziehen muss, wie man sie mit dem deutlich sichtbaren Fadenende in die Körbchen legt, aus denen sich die vier Spinnerinnen bedienen, die sie versorgen muss. Die Aufseherin spricht barsch. »Ich habe keine Zeit zu verlieren, schau zu und lerne«, sagt sie. Sie geht und lässt Anita mit einem Bürstchen in der einen und einem Häufchen bigat in der anderen Hand zurück. Die kleine Anita taucht alles in das siedende Wasser.
Wie anders das ist als bei den Probeversuchen daheim! Alles muss schnell laufen, der Raum ist riesig, der Lärm ohrenbetäubend, von dem Geruch wird einem übel, die Aufseherin geht auf und ab (jetzt brüllt sie eine andere Kleine an, sie solle sich sputen), bald wird sie wiederkommen und kontrollieren, und die Angst, der Gestank und der Lärm sind so groß, dass Anita spürt, wie ihre Fingerspitzen taub werden, die Finger brennen, die Tränen hinunterlaufen, eine, dann noch eine, im Nu ist ihr ganzes Gesicht nass, und ihre Hände stehen in Flammen.
Doch plötzlich schlingen sich kleine Finger um die ihren, einmal, zweimal, dreimal: Sie ziehen das Fadenende heraus, legen den Kokon ins richtige Körbchen, halten ihre Finger in das kleine Becken mit kaltem Wasser. Wer hilft ihr da?
Sie ist zu eingeschüchtert, um den Blick zu heben, während die kleinen Finger immer wieder zwischen den ihren auftauchen, anfangs andauernd und dann nur noch ab und zu, wenn Anita aus dem Rhythmus kommt; und wenn die Aufseherin naht, sind sie wieder zur Stelle und legen zwei oder drei Kokons mit schon heraushängendem Fadenende in ihre Schüssel, bereit für die Spinnerinnen. Kleine, hilfsbereite, geduldige Finger, die Finger einer guten Fee, eines Heinzelmännchens, die ihr beistehen, bis nach einer Ewigkeit, die sie noch nicht zu messen gelernt hat, die Sirene gellt und es Zeit ist, die Kartoffeln und Zwiebeln zu essen, die andere pfiffig zusammen mit den Raupen gekocht haben. Erst in dem Augenblick erkennt Anita sie. »Beeil dich« – ein Eichhörnchenmäulchen hinter den stinkenden Dämpfen –, »lass uns rasch essen, dann können wir Himmel und Hölle spielen.« Ihre Banknachbarin, ihre Freundin Giulia. Die »zweite« Schwester Leone.
Gegen Mitte Januar, als drei der fünf Vorarbeiterinnen in den Räumen des Arbeiterhilfswerks eine Versammlung organisieren, begreift Giulia, dass etwas nicht stimmt. Einige der Spinnerinnen sind eingeladen, alles in allem etwa fünfzehn, diejenigen, die am ehesten bereit sind, die Arbeit wiederaufzunehmen. Dazu gehört Giulia nicht. Assunta dagegen schiebt ihre Haare unter eine graue Haube, wickelt sich in einen Schal und macht sich entschlossen auf den Weg vom Palazzo Reale zum Stadtrand, in die Gegend des Krankenhauses und des Gefängnisses. Sie betritt den vor drei Jahren eingeweihten Saal. Sie grüßt nicht, wirft keinen Blick auf das weiß-rot-goldene Banner, das Manifest mit den Namen der verdienstvollen Mitglieder und den großen Tisch aus Nussbaumholz, den die Patriotische Gesellschaft gespendet hat. Ganz hinten sucht sie sich einen Stuhl, weit weg von den anderen, und stützt die Ellbogen auf die Knie, das Kinn auf die zur Faust geballten Hände. Sie hätte viel zu sagen, ergreift aber aus Angst vor einem Hustenanfall nie das Wort. Zwei Stunden später kommt sie wütender als zuvor wieder heim, weil keine Einigung zustande gekommen ist. »Reicht’s denen noch nicht?«, keift sie, während sie ihre eisigen Finger an den Ofen hält. Giulia antwortet nicht und strickt weiter.
»Blöde Weiber. Wollen sie verhungern?«
Beim Schweigen der Tochter verliert Assunta die Geduld. Sie reißt ihr Nadeln und Wolle aus der Hand und schleudert sie gegen die Wand. »Antworte, wenn ich mit dir rede!« Giulias Blick ist müde. »Wir sind uns alle einig«, sagt sie.
Assunta wirft sich derweil eine Decke über die Schultern, dann packt sie das Strickzeug, wickelt den Faden wieder auf und fängt an, wütend mit den Nadeln zu klappern. »Quatsch«, erwidert sie.
»Wir werden gewinnen. Anita –«
»Königin Taytù saß in der ersten Reihe.«
Mrs. Giulia Masca erinnert sich noch an den heftigen Schmerz nahe am Brustbein. Sie lief ohne Umhang hinaus. Die Gasse, dann die Piazza, dann die Neustadt und zuletzt die Straße, die an der Stura entlang und dann wieder den Berg hinaufführt. Ohne die Kälte zu spüren, ging sie eine gute halbe Stunde. Der Streik ist doch ihr Fluchtweg, der Weg in die Freiheit: Wie konnte Anita nur? Ihr Traum. Ach was, Traum, ihr Projekt! Die gemeinsamen Kundgebungen, in Männerkleidung, die Diskussionen. Will sie etwa keinen gerechten Lohn mehr verdienen? Kohle, Schuhe, Strümpfe, Stockfisch? Giulia kann es nicht glauben. Nicht Anita, die nicht. Assunta hat sich geirrt, Giulia ist sicher. Fast sicher. Warum hat sie sich nicht mehr blicken lassen? Sie lässt ihr ausrichten, sie sei krank, und dann geht sie zur Versammlung?
Von den rauhreifglitzernden Hügeln weht schneidende Luft herunter. Giulia biegt von der Straße in einen Weg durch das Weidengehölz ein, erreicht die Böschung und die Steine. Daneben fließt das Wasser, hier und da gibt es Eispfützen. Als kleine Mädchen hatten sie sich einmal gemeinsam zum Wäschewaschen bis zu dieser verbotenen Stelle vorgewagt, wo das Wasser tief und tückisch ist. Ein Kinderstreich, und Giulia, die sich auf den Steinen unbesiegbar fühlte, war hingefallen und hatte sich am Bein verletzt und den Kopf angeschlagen. Es war ein bleierner Tag gewesen, und die Nacht zog rasch hinter den eisengrauen Wolken herauf. Die eine Verletzung reichte von der Fessel bis unters rechte Knie. An den geschwollenen Wundrändern bildeten sich schwarze Krusten zwischen dem lebhaft roten Fleisch und dem erdfarbenen zerrissenen Strumpf. Die andere Verletzung war an der Stirn, eine bläuliche, aufgeschürfte Beule über dem linken Auge. Sie konnte sich nicht auf den Beinen halten und hatte Mühe, wach zu bleiben. Sie weiß noch, wie Anita aus dem Wäschekorb den Zipfel des Lakens zog, das sie zusammen ausgewrungen hatten. Eiskalt, fast steif, mit Schlammflecken. Sie erinnert sich an die Berührung mit der Haut, den Schauer und an Anita, die sagte: »Keine Sorge, Giulia, ich bleibe bei dir.« Sie erinnert sich, dass es schön war, sich fiebernd dem Nebel eines plötzlichen Schlafs zu überlassen und sicher zu sein, ihre Freundin beim Erwachen wiederzufinden. Sie erinnert sich, dass Anita keine Angst hatte vor Wölfen, vor Käuzchen, vor dem Eis auf den Pfützen, vor den Banditen, die kleine Kinder stehlen. Anita saß neben ihr, sang ihr die Lieder aus der Spinnerei vor, hauchte ihr auf die Finger, um sie zu wärmen, deckte ihr mit dem eigenen Rock die Beine zu und wachte, bis bei Sonnenaufgang mit großem Trara die Familie Leone erschien. Wie kann es sein, dass dieses mutige Mädchen sie heute aus Angst vor den Salvi verraten hat?
In der Luft flattert etwas. Ein Stück Papier. Eine Zeitungsseite. Ein Windhauch hebt es auf, und das Blatt beginnt zu tanzen. Als Kinder hätten sie gewettet: Wer es fängt, gewinnt … was? Ein halbes Pausenbrot? Eine halbe, in der kochend heißen Raupenschüssel gegarte Kartoffel? Viel zu verspielen hatten sie nicht. In kleinen Sätzen hüpft sie von Stein zu Stein, hinter dem Blatt her. Jetzt weht es in die Höhe, dann stürzt es plötzlich ab, Giulia erwischt es, bevor es ins Wasser fällt. Es ist verblasst, aber noch lesbar: North German Lloyd. S.S. Werra. Bestimmungsort New York über Gibraltar. Preis dritter Klasse Lire 190. In obengenannten Preisen Verpflegung bis Ankunft inbegriffen. Das Papier ist dünn, rauh, und Giulia hat rote, geschwollene Finger. Einen Augenblick kommen sie ihr vor wie die von Assunta, und ihr schaudert bei dem Gedanken.