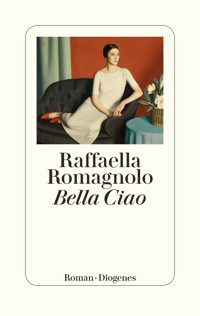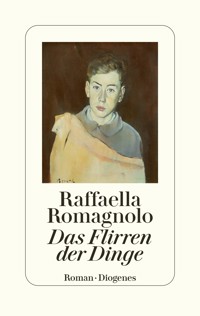
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Antonio ist auf einem Auge blind – und trotzdem wählt der große Fotograf Alessandro Pavia von allen Kindern im Waisenhaus ausgerechnet ihn als Lehrbuben aus. Er nimmt ihn mit in sein luftiges Atelier über den Dächern von Genua und bringt ihm seine Kunst bei. Im frisch vereinigten Italien gilt es viel festzuhalten. Doch als bei einem Arbeiteraufstand eine junge Hebamme vor Antonios Linse läuft, sieht er mehr als ihre Gestalt. Vielleicht die Zukunft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Raffaella Romagnolo
Das Flirren der Dinge
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Diogenes
Für Ro
Vielleicht ist das Leben wirklich
wie du es entdeckst in jungen Tagen:
ein ewiger Hauch, der
von Himmel zu Himmel
wer weiß welche Höhe sucht.
Doch wir sind wie das Gras auf den Wiesen
das den Wind über sich hinstreichen fühlt
und überall singt im Wind
und immer lebt im Wind,
aber nie genug wachsen kann
um diesen höchsten Flug aufzuhalten
oder von der Erde aufzuspringen
um sich in ihm zu ertränken.
Antonia Pozzi, Wiesen
All die jungen Photographen, die durch die Welt hasten, weil sie sich dem Aktualitätenfang verschrieben haben, wissen nicht, dass sie Agenten des Todes sind.
Roland Barthes
Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie
You press the button, we do the rest.
Werbespruch der KODAK Nr. 1 (1889)
Viele Jahre nach dem Aprilmorgen, an dem alles begann, dachte der Fotograf Antonio Casagrande, als er sich, wie schon so oft, unerwartet mit dem Tod konfrontiert sah, dass das Leben immer unscharf ist.
Der Sonnenaufgang war genau wie der von damals, als ihn als Junge der unbändige Wunsch packte, ein Mann zu sein, und ihn nicht mehr losließ: klare Luft, schräg zwischen den Ästen einfallendes Licht, schwellende Knospen, prall, zum Aufplatzen bereit.
Zuerst verwirrte ihn der flammende Himmel, der so blutrot leuchtete wie ein Sonnenuntergang. Doch als dann unverzüglich die Helle des Tages triumphierte, tat Antonio Casagrande das, was er noch nie versäumt hatte, seit sein Meister ihm die rudimentären Anfangsgründe der Kunst beigebracht hatte: Schatten, Farben, Tiefe der Aufnahme und Kontrast messen. Aber das gewohnte, herrliche Gefühl von Kontrolle über die Schöpfung war nicht von Dauer. Was wichtig ist, sagte er sich in einer blitzartigen, hellseherischen Eingebung, was wirklich zählt, ist immer verschwommen.
Freitag, 26. April 1867, zwischen Genua und Borgo di Dentro
In den ruhmreichen Tagen des feuchten Kollodiums, als man die Geschicklichkeit eines Illusionisten brauchte, um Abzüge von einem Glasnegativ zu machen, erkannte man nichtsnutzige Stümper sofort an den verwischten Ecken. Gespenstische Schatten, geheimnisvolle Nebel waberten um Brustbilder und Ganzkörperaufnahmen. Auf Pappe aufgezogen, um Kräuselungen zu vermeiden, wurden die Fotografien in mit Goldbuchstaben bedruckten Etuis oder in schweren, ledergebundenen Alben verwahrt oder gut sichtbar in kostbaren Rahmen aufgestellt, als handle es sich um Ölgemälde. Die Mischung aus Salz, Silbernitrat und Eiweiß, mit der das Fotopapier getränkt war, zersetzte sich rasch, und die Bilder nahmen eine wässrige, gelbliche Färbung an. Der Kunde war es dennoch zufrieden, da er ja sein Äußeres noch nie gesehen hatte, außer flüchtig im Spiegel.
Diese von Gespenstern heimgesuchten Porträts, diese Gruppenbilder von Familien, von Geistern belagert wie das Tischchen einer Hellseherin, waren eine Neuigkeit und große Mode, als Antonio Casagrande geboren wurde. Höchstwahrscheinlich in der Nähe des Hafens von Genua, vielleicht zwischen Sottoripa und Porta Soprana. Den genauen Ort kennt man nicht, weder die Straße, noch das Haus, den Hinterhof oder die Straßenecke, nur Tag, Monat und Jahr: 13. Juni 1855. So zumindest die Kartei des Ospedale Maggiore, genannt Pammatone, Abteilung Findelkinder.
Es war nicht möglich, in den Spalten »Vater« und »Mutter« anzugeben, welche Lenden ihn gezeugt und welcher Schoß ihn empfangen hatten. Beim Klingeln des Glöckchens, das einen Neuzugang ankündigte, setzte der Pförtner den Hebel des Rads in Gang und fand ein vor Schrecken graues Neugeborenes vor. Sofort fiel ihm das ins Nichts starrende Auge auf, die milchige Pupille, dann die hastig verknotete Nabelschnur, ein Zeichen für wenig Erfahrung, und zuletzt der raue, mit Blut und Fruchtwasser getränkte Stofffetzen, der den kleinen Körper vor dem nackten Holz schützte. »Genueser Tuch« hieß dieser Stoff gewöhnlich. In Amerika »Jeans«. Zeug für Schiffsjungen, Maschinisten oder Hafenarbeiter. Sonst nichts. Keine zwei Zeilen zur Begleitung, kein Medaillon, keine Brillantbrosche, weder ein Band mit Monogramm noch sonst irgendein Zeichen, das dem Neugeborenen – wie in den Romanen, die unter den Bogengängen hinter dem Pammatone an Ständen verkauft wurden – nach sechshundert Seiten ein reiches, glückliches Schicksal verheißen hätte. Nicht einmal ein Korb oder eine kleine Steppdecke. Auch deshalb blieb Antonio Casagrande nichts außer einem unbesiegbaren Gefühl von Leere im Rücken, einem leichten Schwindel, wie bei jemandem, der um Haaresbreite den Griff verfehlt, dazu die Antwort auf die schwierigste Frage: Wer bin ich eigentlich?
Zweifellos quält ihn diese Frage nicht beim Sonnenaufgang am Freitag, 26. April 1867. Es fehlen noch wenige Wochen bis zu seinem zwölften Geburtstag, und Antonio Casagrande verliert sich nicht in komplizierten Grübeleien. Auch verschwendet er keinen Gedanken auf das, was das Leben ihm gerade geschenkt hat. Endlich Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt zu haben, zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass er seit einigen Monaten nicht mehr mit vor Hunger knurrendem Magen zu Bett geht. Oder vor allem die Mission, den aufregenden Grund – historisch!, donnert der Meister –, aus dem sie die Reise angetreten haben.
Nichts von alledem beschäftigt seinen Geist: nur der warme, starke und aromatische Strahl, der aus den Eingeweiden des Mannes hervorsprudelt. Der überschwemmt seine Gedanken, verstört ihn, weckt seinen Neid. Wenn er zu Neid fähig wäre mit seinem spitzen Gesichtchen eines wachsamen, kleinen Tiers, den dünnen Armen dessen, der gerade noch an der Abteilung für rachitische Kinder vorbeigeschrammt ist, den Beinen, die knotigen Stecken gleichen in den zu weiten Hosen.
Wenn es Neid wäre, würde der Junge den Blick abwenden. Stattdessen genießt er das Schauspiel. Im Geist registriert er das Prasseln, wenn scharfe Spritzer den silbrigen Film auf den Steinen treffen, die der Meister am Abend zuvor um das Feuer angeordnet hat und die sich erwärmt haben, während sie beide auf dem Pritschenwagen schliefen.
Er würde ihn gern einholen, den Meister, es ihm gleichtun, das ist es. In ein paar Jahren vielleicht, wer weiß. Wird er auch einen so kräftigen Strahl haben? Einen unaufhaltsamen Strom? Eine so herrliche Pisse? Das wünscht er sich mehr als alle anderen Schätze, die der Mann sonst noch bei sich hat, mehr als die mit Arabesken bestickte Weste, mehr als die glänzende Messingtrompete. Mehr als den Rauschebart, der den Meister schon von Weitem ankündigt, struppig wie das Fell eines wilden Tiers: Platz da, ich komme, hier bin ich.
Zwar ist der Bart für Antonio eine fixe Idee, er sehnt ihn herbei, doch bisher nichts, eine Pfirsichhaut. Nur verkrusteter Rotz unter der Nase und der L-förmige Schmiss auf der linken Backe, unter der Binde, die sein blindes Auge schützt.
»Leck mich am Arsch, Michele«, denkt er jedes Mal, wenn seine Fingerkuppen die Narbe ertasten, die das kleine Klappmesser hinterlassen hat. Michele Casagrande, Jahrgang 1855, wie Antonio. Sie heißen alle Casagrande, die Bankerte aus dem Pammatone. Oder Dellacasa oder Dellacà oder Diotallevi. Sie teilten dasselbe Stockbett – Michele oben, er unten –, bis der Gefährte schließlich einen Strohsack in der Hütte eines Viehhirten auf den Höhen fand. Mit dem Messer war er flink wie ein Maler mit dem Stift. Er verwahrte es unter der Matratze, zusammen mit seinem restlichen Arsenal: einer Schleuder, fünf eisernen Murmeln, einer Handvoll spitzer Steine und einem Schlagring, den er aus Seilresten angefertigt hatte, Knoten für Knoten. Ein Meisterwerk der Grausamkeit.
Antonio gab es zu der Zeit, als er im Pammatone lebte, nur einen, nur ihn, eingetroffen am Tag des Schutzheiligen der Kinder und der Prostituierten. Diesem Beruf ging vermutlich auch die Frau nach, die an selbigem 13. Juni 1855 zwischen Sottoripa und Porta Soprana niedergekommen war. Jung wahrscheinlich, vielleicht sogar Erstgebärende, in Anbetracht der ungeschickt verknoteten Nabelschnur, die nun als Nabel wie eine Kichererbse auf seinem Bauch balancierte. Jung und wahrscheinlich allein. Vielleicht Waise, vielleicht ebenfalls im Pammatone aufgewachsen, eine der zahllosen Zeilen in den Registern vor der von Antonio Casagrande. Nicht alle kleinen Waisenmädchen sind ja als Helferinnen im Flügel für Syphiliskranke gelandet, nicht alle wechseln Binden und Umschläge, nicht alle haben den Schleier genommen. Wäscherin? Näherin? Tänzerin? Nutte? »Einfach eine billige Schlampe«, versicherte Michele Casagrande.
Quälende Bilder. Würde der Bart ihn zukünftig vor Übergriffen schützen? Antonio Casagrande ist davon überzeugt. Doch an diesem Morgen im April 1867, während die Frühlingsluft über die neugeborenen Blättchen streicht, verfliegt die Erinnerung an Michele Casagrande wie ein Traum beim ersten Licht. Und müsste er zwischen dem einen und dem anderen wählen, zwischen dem schönen Gesicht eines erwachsenen Mannes und einer so machtvollen Pisse wie der, die gerade ihr Lagerfeuer überschwemmt, würde Antonio Casagrande sich für die Pisse entscheiden.
Er wäre gern so groß wie der Meister, so stark wie der Meister, er wäre gern selbst der Meister. Er möchte die Meisterlichkeit aufsaugen wie ein Putzlappen die Nässe. Er ahnt nicht, dass dieser unbändige Wunsch, der sich in manchen Nächten in einen Albtraum verwandelt und ihn aufweckt, damit zu tun hat, dass bei seinem Eintrag im Register des Pammatone unter dem Stichwort »Vater« steht: »unbekannt«. Er wünscht sich nur, den großen, starken Mann, den das Schicksal ihm zugedacht hat, weiter zu ergründen.
Er hat so lange auf ihn gewartet. Dutzende von Waisenknaben, Mengen von Ausgesetzten, Legionen von Bankerten nahmen den Weg in die Berge, aber er nicht. Die anderen würden Kühe melken, Lämmer schlachten, im Frühjahr Kartoffeln pflanzen, sie im Sommer ernten, im Herbst das Feld hacken und die Erde von Steinen befreien, im Winter Körbe flechten. Aber er nicht. Die Bauern kamen jede Woche hinunter in die Stadt, erst Markt und dann Pammatone, dort suchten sie sich die Besten aus und verhandelten über den Zuschuss.
»Mit diesen breiten Schultern wird er für zwei essen«, sagten sie zum Vorsteher.
»Mit diesen breiten Schultern wird er für zwei arbeiten«, erwiderte der Vorsteher, während er mit gerunzelten Brauen rechnete.
Sie wählten immer andere, auch wegen seinem blinden Auge. Dann kam der Meister. Gerade noch rechtzeitig, denn der Junge war schon elf Jahre alt. Auch wenn er nicht viel Ahnung von Zahlen hatte, wusste er, dass elf eins weniger als zwölf ist, und nach seinem zwölften Geburtstag würden sie ihn nicht mehr durchfüttern können. Sie würden ihn dem Leben in den grausigen Rachen werfen, und es würde ihn mit seinen Klauen zerfetzen: Hochmut, Trägheit, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Geiz. So der Beichtvater bei Erledigung der wöchentlichen Pflichtübung.
Als der Meister den Saal betrat, wo Schulter an Schulter aufgereiht die Waisenknaben warteten, regnete und stürmte es draußen. Vor dem Tisch des Vorstehers tropfte das Wasser aus dem Kraushaar auf den Bart, die Schultern, den Bauch, die Stiefelspitzen und sammelte sich zu einer Pfütze auf dem Marmorboden. Er sah aus wie ein Ungeheuer.
»Für die Größeren gibt es keinen Zuschuss«, sagte der Vorsteher.
»Was schert mich der Zuschuss! Ich brauche einen Assistenten, kein Almosen, zum Donnerwetter!«
Er sah aus wie Blaubart.
Zwei Handbreit größer als die anderen, hielt Antonio die Augen auf die Pfütze gesenkt, die sich ausbreitete, platsch, platsch, die tropfnassen Stiefel, platsch, platsch, platsch. ›Da werde ich wieder putzen müssen‹, dachte er. Stattdessen wurde er ausgewählt.
»Er?«, fragte der Vorsteher.
Er. So ist das Leben. Blitzschnell packte er seine Sachen – welche Sachen? –, und dann los, hinaus auf die Gasse, Piccapietra, Porta Soprana, die schwarz-weiße Kathedrale San Lorenzo, immer hinter Blaubart her. Den Blick stur zu Boden gerichtet, um das Leben nicht herauszufordern, das in den Erdgeschossbehausungen, unter den Bögen, an jeder Kreuzung lauerte. Piazza Valoria Nummer 4, schwarzes Eingangstor, dunkle Treppen, hinauf und weiter hinauf und noch weiter hinauf bis zu einem gleißend hellen Dachboden. Drinnen ein Wirrwarr von Gläsern, Fläschchen, Flüssigkeiten, Truhen, Regalen, Akten, Büchern, Gefunkel, Spiegeln, Kerzenleuchtern, Fächern, Brokatvorhängen, Säulen, Palmen, Meeres- und Gebirgskulissen und einem Geruch wie nach Staub und Gewürzen. Und ein Spinnennetz von Schnüren, die von der Decke herabhingen. In einer Ecke ein Paravent, ein Feldbett und ein Nachttopf. Für ihn? Für ihn.
»Der Abort ist hier draußen. Gegessen wird einen Stock tiefer, bei Giuse. Frühstück, Mittag- und Abendessen. Hier ist der Arbeitstisch, hier das Lager und hier das Archiv. Ich schlafe da drüben. Die Apparate stehen dort hinten. Der Altan gehört zum Studio. Pass auf, dass du dich nicht zu weit vorbeugst, das Geländer fehlt.«
Keine Türen, keine Zimmer, nichts von all dem, was Antonio vom Pammatone gewöhnt war: Schlafsaal, Refektorium, Direktion, Kapelle, Hof, Waschraum, Sakristei, Männer-Krankenstube, Frauen-Krankenstube, Kinder-Krankenstube, Vorratskammer, Spezerei, und dann Reihen von Betten, Bänken, alten Holztischen. Im Dachboden an der Piazza Valoria weitete und verengte sich der Raum nur dank verschiedener Vorhänge.
»Gib Acht, der Kunde muss genau hierhin. Weder weiter hüben noch weiter drüben. An die Säule gelehnt, oder auch sitzend, er darf sich bloß nicht bewegen. Das Licht fällt durch das große Fenster direkt aufs Gesicht. Der Rest des Körpers bleibt im Schatten, so sieht er aus wie ein Papst auf dem Thron.« Dann zog der Meister abrupt an einem Vorhang, der dunkler und dicker war als die anderen. »Und hier ist das Sancta Sanctorum.« Das Allerheiligste. Ein weiterer Arbeitstisch tauchte auf, dem ersten gleich und ebenso vollgestellt mit Fläschchen und Schüsseln. Von einem Balken hing eine mit rotem Papier abgedunkelte Lampe herunter. »Merk’s dir, Wunder sind wie Sünden: Sie geschehen im Dunklen.«
Antonio hatte kein Wort verstanden. Wo zum Teufel war er hingeraten? Was war das bloß für eine Werkstatt?
Von dem Tag an beobachtet er Blaubart unausgesetzt. Er will ihn auswendig lernen, so wie er das Einmaleins und das Alphabet gelernt hat. Vom Meister natürlich. Der Oger hat auf die Narbe unter seinem Auge gezeigt und darin ein L gesehen. Zack, ein Kniff in die Wange, und dann eine kleine Lektion: »L wie Lampe, Leber, Linse, Lupe, Lob. A-E-I-U-O. Die Vokale. Wiederhole.«
»Lob?«
»Lob. Wenn jemand zu dir sagt, gut gemacht. Los, wiederhole.«
»Wie Lob Gottes?«
Der Meister hat ungehalten geschnauft. Wenn man ihm gegenüber Gott, Heilige und Madonnen erwähnt, schnauft er, doch das wusste Antonio am Anfang nicht. Im Pammatone war Gott im Himmel und auf Erden und überall.
»Laster, Leere, List, Lore, Lues. A-E-I-O-U. Wiederhole.«
»Lues?«
»Lass gut sein, dafür bist du noch zu jung, hahaha. A-E-I-O-U. Wiederhole.« Und noch ein Kniff.
Antonio Casagrande will alles von ihm lernen, einfach alles. Sogar wie er geht. Er beobachtet ihn, prägt sich jede Einzelheit ein, schaut zu, wie er auf einen Zug eine ganze Flasche leert, ohne Atem zu holen, wie er so rülpst, dass die Tauben erschrecken, wie er Litaneien von Flüchen ausstößt, solche Obszönitäten, dass die Seeleute erbleichen, mit denen er abends am Hafen den Tisch teilt. Am Altan stehend, der auf die Dächer hinausgeht, im Blau und Orange des Sonnenuntergangs, sieht er ihn die Backen aufblasen, halb die Augen schließen und eine Trompete ansetzen, so golden wie die der Cherubim, um eine schmachtende, schmelzende Melodie zu spielen, bei der ihm die Tränen über den Rauschebart strömen. Er sieht ihn durch die Gassen marschieren, ein General beim Angriff: Mit königlichem Schritt und Trommelwirbel in der Brust stürmt er in das Bordell im Vico Falamonica oder das an der Piazza dello Amor Perfetto. Der Junge setzt sich auf die Stufen und wartet. Er genießt das bunte Treiben der Händler, Bettler, Marktschreier, Lumpensammler. Durchs offene Fenster hört er, wie die tiefe Stimme »Libiamo, libiamo ne’ lieti calici / che la bellezza infiora« anstimmt und die Nutte antwortet »Godiam, fugace e rapido / è il gaudio dell’amore«, und dann lachen beide lauthals. Und er hört ihn knurren: »Ich habe es mir genau ausgerechnet!«, wenn jemand zu fragen wagt, ob er diesmal denn wirklich übergeschnappt sei.
»Ein leichtfertiges Unternehmen«, provozieren ihn Brüder, Schwestern, Nachbarn, Neugierige und Tagediebe aller Art. »Todsicher ein Reinfall«, schieben sie nach. Daraufhin faucht der Meister mit dröhnender Bassstimme: »Ausgerechnet bis auf den Centesimo, zum Donnerwetter!« Sein Gebrüll erstickt jede Diskussion.
Wie oft hat der Junge solche Szenen miterlebt? Seit sie die Stadt in Richtung Borgo di Dentro verlassen haben, gar nicht mehr: Was wissen die Leute auf dem Land schon davon, was ein so vornehmer Mann wie er im Kopf hat?
ALESSANDRO PAVIA
FOTOGRAF
PORTRÄTAUFNAHMEN UND FAMILIENBILDER
VEDUTEN UND VISITKARTEN
REPRODUKTIONEN VON JEDEM GEGENSTAND
Auf dem Land tragen die Frauen schwarze Kleider und Kopftücher, die ihre Haare verbergen, nicht etwa Reifröcke und Perlenschnüre. Die alten Männer tragen keinen Frack, stützen sich nicht auf Spazierstöcke mit Silberknauf, wandeln nicht an endlosen, vernebelten Nachmittagen mit langsamen Schritten auf den farbigen Granigliaplatten unter Bogengängen hin und her. Hier gibt es weder Bogengänge noch Graniglia, noch Mosaiken, noch marmorne Riesen, die Balkone tragen, noch Statuen von Wohltätern wie im Pammatone. Fünfundzwanzig Lire Vermächtnis garantieren eine Gedenktafel, fünfzig reichen für eine Büste, das Doppelte für eine stehende Figur und eine ungeheure Summe, die Antonio noch nicht ausrechnen kann, für eine Prachtstatue. Dazu noch Material, Transport, Montage, Bildhauer und Steinmetz.
Auf dem Land haben die Kinder Triefaugen und bronzefarbene Füße. Wenn sie den Wagen mit der Aufschrift FOTOGRAF sehen, ist es, als kämen die Gaukler. Sie können nicht lesen – Antonio erkennt sie sofort, abgründige Augen, vor Staunen halb offene Münder –, Buchstaben sind ihnen ein Rätsel, und doch erfassen sie das Wesentliche auf diese geheimnisvolle Weise, die bis vor Kurzem auch die seine war.
»Lack, Lese, Liste, Lupe, London. A-E-I-U-O. Wiederhole.« Und noch ein Kniff.
»London?«
»Geografie! Zum Donnerwetter, Geografie! Mazzini ist in London, London musst du kennen!«
Die Diskussionen darüber, was der Meister im Kopf hat, sind eher in der Stadt von Bedeutung, zwischen Piazza Fontane Marose, Soziglia und dem Sestiere di Prè. Dort versuchen sie, ihm Steine in den Weg zu legen. Unter irgendeinem Vorwand halten sie ihn an, verhören ihn, verwarnen ihn, bringen ihn zur Vernunft. »Dickkopf!«, schnattern sie. Er gibt nicht auf.
Sturer Kopf, ja, und ewige Pisse. Jetzt, da das Feuer fast erloschen ist und nur noch wenig Glut unter der perlgrauen Schicht glimmt, bis die Pfützen dann irgendwann überschwappen, zwischen Aschenhäufchen versickern, sich um verkohlte Holzreste schlängeln, jetzt läuft ein Rinnsal direkt auf Antonios Schuh zu. Zwölf Lire auf dem Markt an der Piazza Nunziata, dem besten der Stadt. Wäre schade, ihn zu beschädigen, ein Sakrileg, ein Fluch. Nie ein solches Paar Schuhe besessen. Überhaupt nie Schuhe besessen, höchstens Holzpantinen. Sie tun weh, reiben und pieksen am Knöchel wie Fischgräten im Hals, doch Antonio Casagrande nimmt es guten Mutes hin, denn er weiß, das ist sein persönlicher Rosenkranz. Auf die schmerzhaften Geheimnisse folgen immer die glorreichen. Das vergisst man nicht, wenn man jeden Abend Gebete gesprochen hat, seit man mit gefalteten Händen zu knien gelernt hat. Fünf mal zehn Avemaria plus das Pateravegloria dauerten eine Viertelstunde, wenn Pater Agostino, genannt »Blitz«, das Gebet leitete. Eine halbe Stunde, wenn Bruder Sebastiano dran war, der bei »g«, »p« und »d« zu stottern anfing. »Ave Maria, g-g-g-grazia p-p-p-plena, d-d-d-dominus tecum.« Bruder Sebastiano wurde »Donner« genannt wegen der Fürze, die seine Aussprachebemühungen begleiteten. War es kein guter Abend, dauerte das Konzert vierzig Minuten. Gebete und Fürze, Fürze und Gebete. Im Nachthemd. Auf dem eisigen Fliesenboden. Die Knie in Flammen.
Vor der Werkbank des Schusters an der Piazza della Nunziata hatte der Meister nicht viele Worte gemacht: »Willst du vorankommen? Dann brauchst du Schuhe.«
Auch wegen dieses soundsovielten, grandiosen Beweises von »Meisterlichkeit« zwingt sich der Junge durchzuhalten. Am Abend massiert er seine Füße mit Walfett und reibt das Oberleder mit dem ein, was er hat, Kügelchen aus geschmolzenem Wachs oder Fischöl. Am Morgen ist der Geruch immer noch ekelerregend, und zwischen der Maddalena und San Lorenzo sind ihm die Katzen dicht auf den Fersen. Er schert sich nicht darum, denn Besorgungen zu machen ist seine vergnüglichste Aufgabe. Frische, frittierte oder eingesalzene Sardellen. Kichererbsenfladen in öligen Papiertütchen. Innereien, die Giuse dann mit Knoblauch, Essig und Petersilie in der Pfanne schwenkt. Kerzen. Olivenöl. Lampenöl. Notenpapier und dünnes, feinkörniges Papier für die Drucke. Eier zu zwei Dutzend: Das Eigelb wird verquirlt, gebraten und gegessen, das Eiweiß wird großzügig gesalzen und zu Schnee geschlagen. Was unter dem Schaum übrig bleibt, eine schön gelbe, durchsichtige Flüssigkeit, kommt dann in eine Schüssel. Einzeln legt man die Blätter darauf, lässt sie an der Oberfläche schwimmen wie Laub auf einem See. Eine Feinarbeit, für die man Pinzetten, Wäscheklammern, Geduld braucht. Im richtigen Moment hebt man das Blatt hoch, lässt es abtropfen und hängt es zum Trocknen auf, bis der Dachboden sich mit großen, makellosen Schmetterlingen füllt, die beim ersten Lufthauch an den Schnüren tanzen. Es folgt ein letztes Bad in der Silbernitratlösung, aber das erledigt der Meister allein, eingeschlossen im dunkelroten Schein des Sancta Sanctorum, angetan mit Handschuhen und einer großen, alten Schürze aus steifem Leinen.
Und außerdem sind die neuen Schuhe so schön mit ihren winzig gestichelten Nähten – wie Ameisenstraßen – und den glänzenden Nieten rund um den ganzen Rand. Also zieht der Junge den Fuß schnell weg, um dem Strahl des Meisters auszuweichen. Doch dabei verliert er das Gleichgewicht, schwankt gefährlich, und sein leichtes Geplätscher – was bei ihm kommt, ist nichts gegen den Wildbach, der neben ihm braust – kurz, sein eigenes bisschen Pipi trifft haarscharf seine andere Schuhspitze. Eine Schande.
Der Meister merkt es jedoch nicht, sonst würde er in sein dröhnendes Gelächter ausbrechen und ihm mit einer Anspielung auf sein kleines Dingsda einen Klaps zwischen Hals und Nacken verpassen. Mit derselben Hand, mit der er sein Dings hält. Einen dieser Schläge ins Genick, bei dem du, wenn du ihn nicht erwartest, mit den Zähnen klapperst und das Lachen des Meisters donnernd anschwillt. Doch mittlerweile ist der Junge auf der Hut, und der Schlag kommt sowieso nicht.
Kinderpisse ist etwas anderes. Sie schmeckt nach Kohl und Zwiebel. Was den Urin von Michele Casagrande betrifft, könnte Antonio das jedenfalls bezeugen. Er stellt sich vor, dass das Pipi aller Bankerte aus dem Pammatone den gleichen Geschmack hat. Der Grund ist ja leicht verständlich, wenn man den Speiseplan betrachtet. Kohl, Zwiebeln, ein paar Kartoffeln, Kohl, Zwiebeln, eine Handvoll Bohnen oder Erbsen, Kohl, Zwiebeln, ab und zu ein Ei und süßen Brotauflauf, aber nur sonntags. Pisse zu trinken ist obligatorisch. Und schon bevor du sie runterschluckst – ausspucken unter Strafe verboten –, bevor du sie auf einen Zug runterkippst, als ob es Quellwasser wäre, hast du dich sowieso schon an die Pisse gewöhnt. Man lebt im Pisskohl. Man riecht ihn überall, vermischt mit dem Geruch von gelblichem Schweiß in den Laken aus kratzigem Leinen, von getrockneter Kotze und dem Gestank von Hintern, die nie sauber genug sind. Er verpestet die Aborte. Hängt in den Ecken. Tränkt den Strohsack. Im Winter, bei geschlossenen Fenstern, weil der Nordwind tobt. Im Sommer, wenn der Schirokko die Mauern aufheizt.
»Gleich nach dem Aufwachen pissen ist besser als vögeln«, sagt dagegen Blaubart jeden Morgen. Er tritt aus dem Abort auf der Etage an der Piazza Valoria, die Hosen halb aufgeknöpft, die Pranke drinnen, um die Angelegenheit zu ordnen, das Gesicht noch von der Nacht zerknittert. Und er sagt es auch jetzt, während er freudig die Welt mit seinen nächtlichen Säften besprengt, die Augen funkelnd im Grün der Kastanien, in Gedanken schon beim Reisetag nach Borgo di Dentro. »Besser als einen geblasen kriegen. Hahaha!«
Die herrliche Pisse des Meisters ist nicht das einzige Wunder, seitdem sie aufgebrochen sind. Antonio vermerkt die bedeutendsten Sachen in dem Übungsheft zwischen den Vokalen, den Konsonanten und den vier Grundrechenarten. Er schreibt sich Wörter auf, die er noch nie gehört hat, und fügt die Bedeutung hinzu. »Eisenbahn« und »Lokführer«, zum Beispiel, denn nach Florenz sind sie mit dem Zug gefahren. Und »Vorzimmer«, denn Seine Majestät, Viktor Emanuel II., ließ sie acht Tage lang warten, ehe er den Meister empfing.
»Angesichts der bevorstehenden Audienz würde ich an Ihrer Stelle die Dienste eines Barbiers in Anspruch nehmen«, hatte ein Beamter mit gezwirbeltem Schnurrbart vorgeschlagen, der dem König aus dem Piemont in die neue Hauptstadt gefolgt war.
Er war ein hagerer Typ, mit der stumpfen Haut der Leberleidenden. Er hatte sie in einem Salon voller Stuck und Kostbarkeiten empfangen und ihnen ausgerichtet, ja, Seine Majestät werde sie empfangen wie brieflich vereinbart, doch nein, nicht am selben Tag und auch nicht am folgenden, wann genau wisse man letztlich nicht. Das hinge von den Rebhühnern ab. Vielleicht auch von den Hirschen, Seine Majestät liebe die Großwildjagd. Die Großwildjagd und den Pinienwald von San Rossore. Nicht so sehr wie die Alpengipfel, nicht so sehr wie die Tannenwälder und Schneehöhen, nicht so sehr wie die nebelverhangenen Sonnenaufgänge in Pollenzo und Sommariva Perno. Doch Seine Majestät besitze das Temperament eines Soldaten und habe es verstanden, sich den Umständen anzupassen. Die ja die Folgen des unglücklichen Zwangsumzugs nach Florenz seien.
»Also?«
Also sollten sie eine Adresse angeben und auf ein Zeichen warten.
Acht Tage lang. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Bett in einer Locanda im Borgo San Frediano in Florenz. Ungesalzenes Brot, Schinken, bistecca, gesottener Kapaun, Kalbsleber, garnierte Rinderzunge und Rotwein aus Korbflaschen hatten die Taschen des Meisters geleert, sodass er sogar seine Uhrkette versetzen musste. »Der Zweck heiligt die Mittel. Machiavelli. Wiederhole. Lerne. Schreib es in dein Heft.«
Beim Frühstück sagten sie zu ihm: »Ach was, Hirsche. Rebhühner, von wegen. Höchstens das Rebhuhn, oder vielmehr die Rebhenne!« Sie war der Grund für die Verzögerung, die Geliebte des Königs. Schwarze Augen, schwarzes Haar. Butterweiche Lippen. Wohnhaft ohne Miete zu zahlen in der Villa Petraia der Medici und derzeit übersiedelt nach San Rossore. Geboren als Rosa Vercellana, wiedergeboren als Contessa di Mirafiori und Fontanafredda. Auch dort Stuck und Kostbarkeiten. Wurzelholz, Ebenholz, Tapeten mit Blumenmuster. Gobelins. Danaë, die auf Zeus wartet. Zeus, der in Form eines Goldregens erscheint und sie schwängert. »Zweimal!«, im speziellen Fall, ein Mädchen und ein Junge.
»Gobelin«, »Tapete«, »Zeus«. Antonio notierte, der Meister korrigierte. Das gastfreundliche Heft bot auch den Wörtern der Reichen Platz.
Beim Mittagessen ging es wieder los: »Wozu willst du bloß zum König, wenn der sich doch gewiss seinen Fotografen aus Turin mitgebracht hat? Genauso wie den Minister, den Sekretär, den Advokaten, den Kammerdiener, den Lakai, den Stallburschen, den Schneider, den Schuhputzer und den Schornsteinfeger. Nirgends kehren sie die Kamine so gründlich wie in Turin. Auch den Maler wird sich Seine Majestät mitgebracht haben, in Florenz, das weiß man ja, sind Künstler Mangelware!«
»Lakai.«
»Stahlbursche.«
»Nicht Stahlbursche, Stallbursche. Mit zwei L. Schreib’s noch mal.«
Beim Abendessen dasselbe: »Wozu willst du bloß zum König, du mit deinem Republikaner-Bart?«
Der Meister erstarrte. »Eben, das wird ein historisches Ereignis. Das man später den Enkeln erzählen kann«, erwiderte er.
»Republikaner«: Einer, der die Republik will, also, dass das Volk die Macht hat.
»Was heißt das?«
»Das Volk soll herrschen, anstelle des Königs.«
Antonio riss die Augen auf.
»Mach nicht so ein Gesicht. Schreib ›Volk‹, großgeschrieben. Wie ›König‹. Nein, streich es durch und schreib ›könig‹ klein.«
»Und Ihr seid Republikaner?«
»Bis ins Mark.«
»Aber warum wollt Ihr dann zum König?«
»Auch Garibaldi hat sich mit ihm getroffen. Es ging nicht anders. Vorerst begnügen wir uns damit, dass wir Italien geeint haben, aber dann …«
Dann, was? Ein Riesendurcheinander, im Kopf des Jungen. Als man sie endlich rief, wurde er an der Schwelle des Casino Annalena aufgehalten, eines kleinen Gebäudes in den Boboli-Gärten. Das sei unumgänglich. Nur Alessandro Pavia dürfe das persönliche Kabinett Seiner Majestät betreten. Jemand zeigte dem Jungen eine Marmorbank neben einer Buchsbaumhecke.
Ein herrlicher Ort: Grotten, kleine Tempel, Statuen, Mosaiken, Kletterpflanzen, Rosenstöcke, Bassins, Kolonnaden, Terrassen, Springbrunnen. Geometrisch angelegte Pfade, wie bei einem Kinderspiel, aber von den Großen gemacht: Das Casino Annalena und das Persönliche Kabinett Seiner Majestät befanden sich in einem Garten der Lüste.
Und wer weiß, wie wundervoll erst das Klo sein musste in dem Bordell, wo der König den Meister erwartete. Nachttöpfe aus purem Gold? Edelsteinfunkelnde Waschschüsseln? Seidenläppchen anstelle von Papier zum Arschabwischen? Antonio fantasierte die geschlagenen sechs Minuten, die die Audienz dauerte, wild drauflos, bis Alessandro Pavia mit einem breiten, monarchischen Lächeln auf dem Gesicht herauskam, das den ganzen Tag lang nicht mehr erlosch. »Große Sache! Große Sache!«, sagte er immer wieder.
Die Feierlichkeiten fraßen die letzten Ersparnisse auf, da der Meister jeden zum Trinken einlud, der Lust hatte, ein paar Worte über das »großartige Unternehmen« zu wechseln, von dem man sagen konnte, dass es heute »an einem Wendepunkt angekommen« war. Er lachte, die anderen tranken und stießen auf seine Gesundheit an. Auch Antonio war ein bisschen beschwipst, als sie bei Sonnenuntergang endlich in der Locanda eintrafen. Eine Nacht Schlaf, am nächsten Morgen würden sie mit dem ersten Zug nach Genua abreisen. Der Wirt passte sie an der Schwelle ab, die Stirn schweißnass.
»Ihr werdet erwartet«, sagte er und deutete nach innen. Neben dem Tresen stand aufrecht ein Soldat in tailliertem Waffenrock mit glitzernd dekorierten Epauletten, in der Hand ein Päckchen, auf dem im rauchigen Dämmer des Raums das Wappen des Königshauses schimmerte. Aus der Dunkelheit löste sich ein Mann im Gehrock. »Alessandro Pavia?«
Der Meister brachte kein Wort heraus, er hatte den stumpfsinnigen Ausdruck dessen, der zu viel getrunken hat. Der Junge nickte. »Vonseiten Ihrer Majestät, mit den besten Wünschen.« Und schon waren sie verschwunden. Pavia blieb mit dem Päckchen in der Hand stehen. An den Tischen, auf den rohen Bänken unnatürliches Schweigen. Kein Laut aus der Küche. Pavia legte das Päckchen also auf den Tresen, rückte die Öllampe näher heran, wischte seine Finger an der Weste ab und öffnete es. Ein Etui aus dunkelblauem Samt kam zum Vorschein. Antonio berührte ihn am Arm. »Nicht hier, lieber auf dem Zimmer«, sagte er mit dem Blick. Die ganze Welt ist Pammatone.
Der Meister war verblüfft. In dem Augenblick schien er der Junge zu sein. Die Gläser funkelten kalt. Acht, zehn Augenpaare starrten ihn aus der Dunkelheit an.
Im Schaukeln des Wagens gleicht Borgo di Dentro einem Schiff, das in einem Hügelmeer gestrandet ist. Ein Schoner, ein Zweimaster, die Zwillingsglocken der Oberkirche weiß wie Segel bei Sonnenuntergang.
Der Meister hält auf einem Platz am Ortsrand. Während sich der Junge um das vom Tagesmarsch erschöpfte Pferd kümmert, zieht er ein Blatt Papier aus der Tasche. Antonio kennt den Inhalt auswendig, wegen eines besonders schwierigen Übungsdiktats:
Leone Domenico, di Pietro – Halbpächter
Marchelli Bartolomeo, di Giacomo – Illusionist
Buffa Emilio, di Paolo – Barbier
Repetto Domenico, di Giuseppe – Landarbeiter
»Vier! In diesem elenden Kaff!«, sagt Pavia.
Der Junge hatte über das »h« in Marchelli gestöhnt, über das »bp« in Halbpächter und vor allem über Il-lu-sio-nist.
»Kann man nicht einfach ›Zauberer‹ sagen?«
»Zaubern ist kein Beruf.«
»Nein?«
»Es ist eine Tugend.«
Je mehr der Junge lernt, umso komplizierter wird das Leben. Er kennt schon die drei theologischen Tugenden auswendig – Glaube, Liebe, Hoffnung – und die vier Kardinaltugenden: Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Er hat eine Schwäche für die Tapferkeit, sie erinnert ihn an Ritter und Fehden, eine sehr vage Vorstellung von der Bedeutung der Mäßigung. Ob er nun Zaubern hinzufügen muss? Und er hat auch noch andere Zweifel: »Emmilio« oder »Emilio«? Was bedeutet »Halbpächter«? Die schiefen Umrisse der Stadt schweben über ihnen.
»Zu uns beiden, Leone!«, sagt Pavia. Er steigt vom Kutschbock und springt mit einem Satz in den Wagen. Antonio hört, wie er herumkramt, Sachen verschiebt, umkippt, stolpert, dann einen Fluch und einen Jubelschrei.
»Junge!«
Von der Ladepritsche reicht er ihm Schüssel, Tuch, Spiegel, Seife und das Fässchen mit Wasser herunter.
»Los, waschen, es gibt keine Zeit zu verlieren.«
Das graue Reisehemd fliegt ins Innere. Die Brust ist struppiger als das Gesicht, die Achseln sind schwarze Höhlen.
Der Meister wäscht sich so, wie er alles macht: ohne Maß. Er taucht die behaarten Unterarme in das seifige Wasser, schüttet es sich mit vollen Händen auf Hals, Gesicht und Schultern, bis hinunter zu den Handgelenken, breit wie Kalbsknochen, während in der Schüssel bald lange, dunkle Haare schwimmen. Dann drückt er die Stirn in das Tuch, fährt sich rasch über den Oberkörper, schlüpft in das saubere Hemd, das sofort nasse Flecken bekommt. Dann Weste, Binder, Jackett. »Wie sehe ich aus?«
In den steifen Kragen gequetscht, gleicht sein Kopf dem eines großen, schwarzen, tropfenden Hundes. Die feuchten Ränder auf dem Hemd zieren jetzt auch die Jacke. Die Hosen sind noch grau vom Straßenstaub, mit großen Flecken schaumigen Wassers.
»Soll ich eine Bürste holen?«, fragt Antonio mit einem Blick auf die genagelten Stiefel, die der Meister immer trägt, wenn er auf dem Kutschbock sitzt. Der Staub und das Wasser aus der Schüssel haben sich zu einem glänzenden Matsch verbunden. Pavia zuckt die Schultern. »Diese Leute haben Italien geeint, Junge. Der Dreck auf dem Fußboden ist denen doch egal, glaubst du nicht?«
»Aber ist es nicht zu spät? Was wollt Ihr um diese Zeit noch tun?«
»Schluss mit im Freien schlafen«, antwortet Pavia, während er den Anstieg hinauf ins Dorf beginnt. »Warte hier. Üb noch mal das Einmaleins. Oder schlaf, tu, was du willst. Ich wünsche dir jedenfalls schon mal einen schönen Abend.« Antonio folgt ihm mit dem Blick, bis die dunkle Gestalt im Borgo di Dentro verschwindet.
Das Pferd grast unter der Linde, an der er es angebunden hat. Nach der Waschorgie des Meisters gleicht der Platz einem Schlachtfeld. Der Junge schüttet das Seifenwasser in den Graben am Straßenrand, faltet das Tuch zusammen, bugsiert die Schüssel und das halb volle Wasserfässchen wieder auf den Wagen. Man wird Vorrat schöpfen müssen. Einen Augenblick überlegt er, ob er es sofort erledigen soll, der Wildbach ist nicht weit. Dann denkt er, dass er sich lieber nicht vom Wagen entfernen sollte. Er räumt das Innere auf, legt die Kleider zu den Kleidern und die Gerätschaften an ihren Platz. Er stapelt die Druckpressen und klemmt sie in einer Ecke fest, damit sie unterwegs nicht beschädigt werden. Er kontrolliert den Riemen, mit dem der erste Apparat an der Innenwand gesichert ist. Er überprüft, ob der zweite Apparat, der für die Visitkarten, gut in seinem schützenden Etui verstaut ist, die vier Objektive gegen mögliche Stöße gefeit. Die Ausstattungsstücke schiebt er in einer Ecke zusammen: die falsche Säule, das falsche Kapitell, die falsche Balustrade (anstrengend, sie vom Dachboden an der Piazza Valoria rauf- und runterzutragen). Er geht den Vorrat an albuminiertem Papier durch und die Sachen, die für die mobile Dunkelkammer nötig sind und die der Meister mitnimmt, wenn er draußen fotografiert: Alkohol, Äther, Schießbaumwolle, Kaliumiodid, Silbernitrat, Salz, Natriumthiosulfat.
Als er meint, dass alles schön ordentlich ist, nimmt er die Klappe ab und steckt sie in die Tasche. Wenn er allein ist, trägt er sie nie. Dann öffnet er den Kasten mit den wiederverwendbaren Glasplatten. In einer Ecke findet er sein Heft und den Bleistift. Er setzt sich auf die Ladepritsche, den Rücken an die Wagenwand gelehnt, die Füße auf der persönlichen Truhe des Meisters, das Heft auf den Knien. Er beginnt mit dem Vierer-Einmaleins, dann mit dem Fünfer. Beim Sechser-Einmaleins fängt er an, sich umzuschauen.
Im Pammatone blähte sich die Langeweile ganze Nachmittage lang zu Riesenblasen auf. Er erwägt, ein paar Platten zu polieren, aber es wäre kompliziert, auf die Schnelle ein Säurebad zusammenzustellen. Außerdem möchte der Meister bei seiner Rückkehr vielleicht sofort losfahren.
Auf die Truhe gestützt, sehen die neuen Schuhe wirklich bildschön aus: Leder auf Leder, Messing auf Messing. Antonio denkt, dass der flache Deckel sich als Schreibtisch eignen könnte. Bestimmt besser als die Schenkel, also verändert er seine Körperhaltung: Er kniet sich hin, Po auf den Fersen, Ellbogen auf der festen Fläche, den Bleistift in der Hand und das Heft vor Augen.
Doch so, mit den Schuhen an den Füßen, ist es nicht bequem. Er zieht sie aus und stellt sie auf die Truhe, in Sichtweite. Was für ein Wunder, diese Schuhe, den Pipifleck an der Spitze sieht man nicht mehr.
Er hockt sich wieder auf die Fersen, den Kopf über das Heft gebeugt. Was könnte er schreiben? Er lässt den Tag an sich vorüberziehen, das Erwachen im Morgengrauen, das Pissen aufs Feuer, das Frühstück mit Wurstresten vom Vorabend, die Fahrt über die Hügel. Kastanienbäume, Eichen, Lichtungen, Schafe, Kühe, Weinstöcke, der Bauernhof, wo sie um die Mittagszeit Pause gemacht haben. Bittere Kräutersuppe, geschmortes Huhn, zwei Eier pro Kopf und einen runden Käse für ein Familienporträt und eine Ganzkörperaufnahme des Erstgeborenen in langen Hosen. Dann noch zwei Bauernhöfe und noch vier Posen. Zehn Centesimi pro Aufnahme, Alessandro Pavia ist spendabel.
»Alessandro Pavia ist ein Dummkopf«, sagen Brüder, Schwestern, Nachbarn, Neugierige und Tagediebe aller Art.
Dann noch andere bemerkenswerte Dinge: eine dreibeinige Katze, ein Wolfsgerippe, ein Froschteich, aber kein einziges neues Wort. Die Langeweile kommt in Wellen. Weit und breit kein Buch, nicht einmal eine Zeitung, sonst könnte er etwas abschreiben. Besonders gut gefällt ihm die »Camera obscura. Universalzeitschrift über die Fortschritte der Fotografie«. Stöße davon liegen auf dem Dachboden an der Piazza Valoria! Die Zeitschrift enthält sehr viele Wörter, die der Junge nicht kennt, etwa »Daguerreotypie« und »Pyrogallol«. Der Meister kann sie ihm fast alle erklären. Einmal hat er an die Redaktion geschrieben und sein Rezept für ein Silberbad vorgeschlagen. Sie haben geantwortet, es handle sich ja nicht um eine großartige Neuigkeit, aber der Brief begann mit »Hochverehrter Herr Kollege«, und der Meister hat eine ganze Woche lang immerzu wiederholt hochverehrt hier, hochverehrt da. Sollte er die letzte Ausgabe wirklich nicht dabeihaben? Er konsultiert doch dauernd irgendwelche Handbücher, blättert in seinem Chemiekompendium. Die Zeitschriften müssen in der Truhe liegen, die aber abgeschlossen ist, und den Schlüssel trägt Pavia um den Hals. Normalerweise. Er nimmt ihn nie ab. Fast nie. Antonio konzentriert sich: Hat er ihn bei der Waschorgie gesehen? Er glaubt nicht. Ob der Meister ihn abgelegt hat? Und hat er ihn hinterher wieder umgelegt? Er glaubt nicht. Und wo könnte er ihn hingelegt haben? Wo ist der sicherste Platz?
»Also, Junge. Nehmen wir an, sie ist verheiratet«, hatte er einmal zu ihm gesagt, als er tief in der Nacht mit einem total schlafbedürftigen Gesicht heimgekommen war. »Und nehmen wir an, der Mann ist nicht zu Hause. Mitten im schönsten Geplänkel, sage ich, wo legst du da die Uhr hin?« Beim Sprechen ließ er die große Taschenuhr baumeln, die er benutzt, um die Dauer der Pose zu messen. Bald wurde sein Mund trocken, bald riss er ihn im Gähnen weit auf.
»Auf den Tisch?«, hatte Antonio auf seinem Feldbett mit schlaftrunkener Stimme geraten.
»Du Einfaltspinsel!« Und schon traf ihn ein Schlag in den Nacken, aber nur leicht. Der Meister hatte begonnen, sich auszuziehen. Jacke, Weste, Hemd, so, wie Pavia sich immer seiner Kleidung entledigt – indem er sie im Raum verstreut.
»Du armer Tropf! Wenn du die Uhr auf den Tisch legst und dann eilig davonlaufen musst, vergisst du sie bestimmt. Und weißt du, wo sie dann landet?« Die Stimme kam innen aus dem Nachthemd, der Kopf war im Kragen stecken geblieben, der mit einer Reihe kleiner Knöpfe geschlossen wurde.
»Wo denn?«
»In der Westentasche des betrogenen Ehemanns!« Der Meister hatte die Knöpfe gesprengt und ließ sich auf sein Lager fallen. »Also, denk nach: Wo tust du die Uhr hin? Wo ist der sicherste Platz?«
Der Fotograf war eingeschlafen, bevor Antonio die Antwort einfiel. Die er jetzt, allein im Wagen, lächelnd vor sich hin flüstert.
»Im Schuh!« Vor dem Aufstieg nach Borgo di Dentro hat sich der Meister nicht umgezogen, er hat die schmutzigen Stiefel anbehalten.
»Im Schuh, ist ja klar! Da ist der sicherste Platz!«, wiederholt der Junge, während er zu der Ecke geht, wo er kurz zuvor Pavias Lederstiefel hat stehen sehen.
Den Schlüssel herausholen, ins Schloss stecken und die Truhe öffnen ist eines. Es ist das erste Mal, dass er sie von innen sieht. Sieht und berührt. Wird der Meister böse sein?
Ein einziges Tohuwabohu. Zusammengeknüllte Unterwäsche, die wer weiß wie lang schon dort liegt, ein Flachmann, ein Tabaksbeutel, eine kaputte Pfeife, eine verfilzte Decke, das dunkelblaue Etui des Königs – der Meister hat es immer dabei –, ein fleckiges Kissen, ein Fläschchen mit Borsäure, die Trompete, die Partituren, einige Bücher und ein kleiner Stoß von Heften der »Camera obscura«.
»Ich wusste es!«, sagt der Junge. Er will die Hefte herausziehen, als er bemerkt, dass darunter eine Glasplatte liegt. Ein Negativbild, acht Aufnahmen desselben Gegenstands, so wie sie aus der Kamera für die Visitkarten herauskommen. Die Platte gleicht denen, die der Junge gewöhnlich mit einer Mischung aus Schwefelsäure und Kaliumdichromat poliert, damit man sie wieder verwenden kann. Ob der Meister die vergessen hat?
Auf dem Speicher an der Piazza Valoria stehen gut drei Kisten mit solchen Negativen. Aber das sind besondere Bilder, unverzichtbar für das Vorhaben: in einem Album die Bilder der tausend Freiwilligen zu versammeln, die sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1860 in Genua Quarto auf der Piemonte und der Lombardo eingeschifft haben, unter dem Befehl des Generals Giuseppe Garibaldi.
Drei Tage nach seinem Umzug aus dem Pammatone hat ihm der Meister alles erklärt: »Am 11. Mai sind sie in Marsala im Königreich beider Sizilien angekommen. Um die Italiener vom bourbonischen Joch zu befreien, verstehst du? Tausend schlecht bewaffnete Freiwillige gegen ein echtes Heer, VERSTEHST DU?«
Antonio staunte. Die Glasplatten waren ordentlich nebeneinander aufgereiht. Die Trenner aus dünnem Holz. Die gestapelten Fächer im richtigen Abstand mit Stützen versehen. Das Register mit Namen und Platz in der Kiste. Konnte es im Chaos des Dachbodens noch etwas Verblüffenderes geben? Wer war Alessandro Pavia nun wirklich? Der Wirrkopf, der dreckige Unterhosen, Silberstaub und einen angebissenen Apfel ins selbe Fach legte, oder der, der ein solches Archiv entworfen und angelegt hatte?
»Und dann gewinnen sie – tausend gegen dreitausend – in Calatafimi und dann in Palermo: Wo Garibaldi hinkam, war sofort Revolution. Cavour machte sich in die Hose, das sag ich dir. Zum Schluss organisieren die hier noch im Handumdrehen die Republik, hahaha!«
Antonio hatte keine Ahnung von Garibaldi, Palermo oder Cavour. Im Jahr 1860 war er fünf und hatte nur eine Aufgabe: den Assistenten beizustehen, die den Ärzten assistierten, die den Kranken beistanden. Und einen einzigen Gedanken: Michele Casagrandes hinterlistigen Attacken zu entgehen.
Die Tausend also. In jenem Frühling 1867 sind nicht alle in Pavias Kisten versammelt. Tausend minus die in der Schlacht Gefallenen, die an Krankheit Gestorbenen, die aus irgendeinem Grund Unerreichbaren. Im Augenblick waren es achthundertdrei im Visitformat, großartige, aus Paris stammende Neuigkeit, und in unterschiedlichsten Posen: Großaufnahme, Halbfigur, Ganzkörperaufnahme, in Zivil, in Uniform, in Hemdsärmeln, mit Hut, mit Mütze, mit Kragenspiegel, mit Medaillen, mit Umhang, mit Persianerkragen, mit Mantel, mit Schwert, mit Spazierstock, mit Papillon, mit Anarchistentuch. Achthundertdrei, die nach dem Besuch in Borgo di Dentro und der Foto-Sitzung mit Leone Domenico, dem Halbpächter, Marchelli Bartolomeo, dem Illusionisten, Buffa Emilio, dem Barbier, und Repetto Domenico, dem Landarbeiter, achthundertsieben sein werden.
Aber das, was Antonio in der Truhe gefunden hat, ist kein Negativ eines Soldaten. Er hat nur ein Kind vor Augen. Drei, höchstens vier Jahre alt. Es sitzt in einem Sessel mit gepolsterten Armlehnen, trägt ein langes Hemd, eine Art helle Kutte, die auf dem umgekehrten Bild natürlich dunkel aussieht. Man denkt an ein Büßerhemd. Der Junge erinnert sich an die Kutten, die die Findelkinder aus dem Pammatone bei Prozessionen oder Beerdigungen trugen, um bei den Reichen Mitleid zu erwecken und sie zu bewegen, durch eine Ablasszahlung ihre Seele zu reinigen.
Die acht Aufnahmen sind nicht identisch. ›Es hat sich bewegt‹, denkt Antonio und stellt sich vor, wie die Verschlüsse der Reihe nach klicken. Auf dem ersten Bild sitzt das Kind ganz still, vielleicht etwas angespannt, den Blick zu Boden gerichtet, sodass man die Augen nicht sehen kann. Bei der zweiten Pose sind die Augen geschlossen und die Finger – auf dem Negativ dunkel – scheinen sich in die Armlehnen zu krallen. Bei der dritten und vierten Pose dreht der Kleine das Gesicht einmal nach rechts, einmal nach links, als hätte ihn jemand gerufen. Dann folgen drei schlecht erkennbare Posen, vielleicht hat er sich weiter heftig bewegt. Das letzte Bild dagegen ist scharf: Der Junge reckt sich vor, als wollte er einen Satz zum Objektiv hin machen. Sein Ausdruck ist fassungslos. Er sieht den Betrachter mit aufgerissenen Augen an. Eine Pupille ist dunkel. Die andere – ohne jeden Zweifel –, die andere Pupille ist weiß.
Antonio fühlt einen Schauder im Nacken, die Haare stehen ihm zu Berge. Die Finger, die die Platte halten, werden feucht. Er kneift die Augen zusammen, diese Augen will er nicht sehen, er will nicht hinschauen, sieht aber trotzdem lauter wirre, schreckliche Bilder. Rauchschwarze Wolken, metallischer Himmel, riesige Wellen, ein kochendes Meer aus geschmolzenem Blei. Eisiges Grauen schnürt ihm die Luft ab. Er will die Platte weglegen, aber es ist zu spät, der Sturm hat ihn schon überrollt. Er fühlt Wasser auf sich, eiskalt, Wasser rundherum, überall. Und das bittere Salz auf den Lippen, auf der Zunge, im Hals. Übelkeit würgt ihn. Er möchte schreien, aber seine Stimme versagt. Das Wasser, das er in den Pupillen des Kindes gesehen hat, drückt wie Stein auf seine Lungen, schwer, immer schwerer, bis er ohnmächtig wird. Als er die Augen wieder öffnet, beugt sich der Meister über ihn, mit geballten Fäusten, das Gesicht so ernst wie noch nie.
San Fiorano Lodigiano, Villa Pallavicino Trivulzio, zwei Wochen früher. Der Haushofmeister spricht gedämpft. Der Wagen kann im Hof bleiben, er stört nicht, ein Diener wird sich um das Pferd kümmern. Der Marchese Giorgio ist verreist. Wenn sie mitkommen wollen, der General ist hier zu Hause. Stuck und Kostbarkeiten auch hier, gewiss, aber eine ländliche Atmosphäre. Blumenduft und Stallgeruch. Sie sollen nur hereinkommen, der General ist Frühaufsteher. Beide? Beide.
Der General empfängt sie in der Küche. Er ist im Schlafrock, tunkt Brot in eine Schale Milch. In Kürze wird er sechzig Jahre alt, und Antonio sieht all diese Jahre, auch wenn der Meister hinterher immer wiederholt: »Hast du gesehen, was für eine Figur? Hast du die Haltung gesehen?« Die Köchin stellt eine riesige Schale Milch vor Antonio hin.
Schweigend verzehrt der General sein Brot, Tropfen und Krümel im Bart. Alessandro Pavia bleibt stehen, wie ein Adjutant, der auf Befehle wartet. Er! Der Meister! Antonio kann es nicht fassen, diese Ehrfurcht eines Rekruten. Verlegen senkt er den Blick auf die Milch.
Nachdem er seine Schale leer gegessen hat, wischt sich der General mit dem Handrücken den Mund ab, unterdrückt den Schluckauf, der sich in einen Rülpser verwandelt, und beginnt dann, das auf dem Tisch liegende Album durchzublättern. Er betrachtet die Verzierungen, die Widmung, die Liste der Namen, die ersten Bilder. Antonio mustert ihn heimlich hinter seiner Tasse. Der Meister, eine Statue.
Ab und zu hält der General inne, berührt eine Gestalt, dann blättert er weiter. Auf der Hälfte angekommen, lässt er sich das Nötige bringen und schreibt ein Billett.
Mein lieber Pavia, danke für das überaus kostbare Album mit den Porträts der Tausend, meinen Waffenbrüdern.
Der Meister schwitzt. Antonio hat ihn noch nie so wehrlos gesehen. Das Billett ist kurz, kaum ist es geschrieben, hat der Junge seine Milch vertilgt. Die Köchin gießt ihm noch mehr ein.
Derweil erhebt sich der General, bindet den Morgenrock in der Taille fest und reicht dem Meister zuerst das Billett und dann die Hand. Pavia trocknet die seine an der Hose ab und schlägt ein. Dem Jungen kommt es so vor, als habe der General es eilig, die Sache zu beenden, doch der Meister scheint es nicht zu merken, nein, er stammelt sogar irgendetwas.
»Gehen wir«, möchte Antonio zu ihm sagen. »Gehen wir, seht Ihr nicht, dass er anderes im Kopf hat?« Aber er beschränkt sich darauf, die Augen zuzukneifen, und taucht das Gesicht in die Tasse.
Spontan ist Pavia diese Idee gekommen, beim Händedruck mit dem General, der an anderes denkt. Eine Eingebung des Augenblicks.
»Meine Hand?«
Antonio hört zu essen auf.
»Die Hand, die Italien geeint hat, General.«
Ein Porträt vorzuschlagen traut er sich nicht. Reimt sich Meisterlichkeit auf Unterwürfigkeit? Als er daran zurückdenkt, spürt der Junge einen leisen Verdruss.
»Antonio!«
Alessandro Pavia kniet neben ihm. Er nimmt ihm die Platte aus den Fingern, legt sie in die Truhe, streicht ihm über die Stirn.
Der Junge ist verwirrt. In der Hosentasche tastet er nach der Augenklappe und setzt sie wieder auf. Er sieht, wie Pavia sich entfernt und mit der Wasserflasche wiederkommt.
»Trink.«
Er versucht es gar nicht erst, er mag gar nichts schlucken.
Der Meister fixiert ihn, er wirkt besorgt. »Ich habe herausgefunden, wo dieser Leone wohnt«, sagt er. »Heute Nacht schläfst du schön, dann geht alles vorbei.«
Was alles? Was ist denn passiert? Der Meister starrt ihn immer noch an. Der Junge zeigt auf die Platte. »Wer ist dieses Kind?«
»Und wenn es nicht vorbeigeht, suchen wir einen Arzt.«
»Wer ist dieses Kind?«
»Welches Kind? Ach so, ja. Das weiß ich nicht mehr, wie sollte ich mich daran erinnern.«
»Einer aus dem Pammatone?«
»Ach so, ja, das ist Jahre her.«
Antonio strafft die Schultern. »Wie viele?«, fragt er.
»Mindestens zehn. Du bist es jedenfalls nicht, das steht fest. Trink jetzt.«
»Aber vielleicht …«
»Vielleicht was? Kennst du ihn?«
Antonio schüttelt den Kopf. Unmöglich, sich an alle zu erinnern. Die Kleineren verschwimmen im Gedächtnis. Einige Namen, viele Giuseppe, viele Giovanni Battista. Und ein paar Einzelheiten: ein Spiel mit Holzklötzchen, Lieder, Kinderreime. Die Zeit genügte nicht, um Freundschaften zu schließen. Die meisten wurden zu einer Amme gegeben. Die anderen nahm irgendjemand mit, sobald ihre Schultern etwas breiter, ihre Beine länger und das Gesicht fester geworden waren. Und außerdem, »Freundschaft«, was für ein großes Wort. Feinde, würde er sie eher nennen. Alle aufgereiht im Zimmer des Vorstehers. Mich. Nimm mich. Wenn jemand erschien, der an einem Bankert und dem entsprechenden Zuschuss interessiert war, hatten alle den gleichen Gedanken im Kopf. Bitte, mach, dass er mich nimmt. Sie übergaben sich vor Anspannung.
Als ihm klar wurde, dass er wegen des blinden Auges sowieso nicht infrage kam, war er fast erleichtert. Er hörte auf, ins Bett zu machen, und begann zu überlegen, wie er die vielen Michelecasagrandes in Schach halten konnte, die seine Tage vergifteten. Wenn ich hierbleiben muss, muss ich eine Art finden. Und die Art war folgende: nicht auffallen, nicht die Initiative ergreifen, sich klein, ganz klein machen, verschwinden. Niemandem trauen. Nicht auf Provokationen antworten, stur weitergehen. Und vor allem: nicht die Binde abnehmen. Niemals, aus keinem Grund. Keine Schwäche zeigen. Sich nicht an einsame Orte vorwagen. Und sich ein Messerchen besorgen. Mit dem Messerchen üben. So jeden Tag, alle Tage bis zu dem gesegneten Morgen, an dem Alessandro Pavia die Schwelle des Zimmers des Vorstehers überschritt.
»Er? Wirklich er? Habt Ihr das Auge gesehen, ja?« Wie ein Verkäufer, der sagt: »Die Ware ist fehlerhaft, ich habe Euch gewarnt, kommt später nicht, um Euch bei mir zu beklagen.«
»Er, er.« Der Meister bei seinem ersten fabelhaften Beispiel von Meisterlichkeit.
»Es ist nicht nur das Auge, er ist auch ein bisschen … wild. Unglück verändert den Charakter.« Bei »wild« und »Unglück« hatte der Vorsteher die Stimme gesenkt. Aber nicht genug.
Der Meister hatte sie gehoben: »Ja, er, zum Donnerwetter! Wie oft soll ich es noch sagen?« Antonio hatte den Schauder der Enttäuschung bei den Bankerten gespürt.
Wild, ja, und wie. Jahrelange Übung. Die beste Strategie. Auch wegen dieser Wildheit, weil er immer mit gesenktem Kopf herumlief und es vermied, fremde Blicke zu kreuzen, hat Antonio jetzt Mühe, den vielen, die im Pammatone durchgekommen sind, ein Gesicht zu geben. Aber einen Jungen mit einer weißen Pupille wie der seinen hätte er bestimmt nicht vergessen.