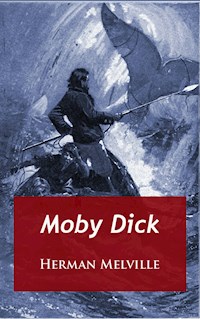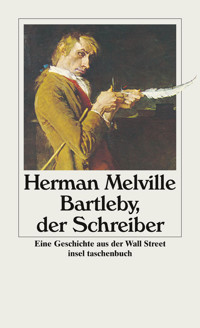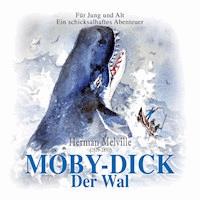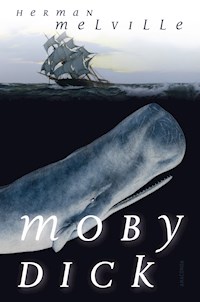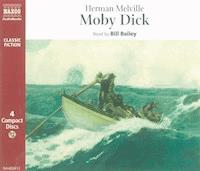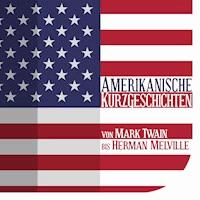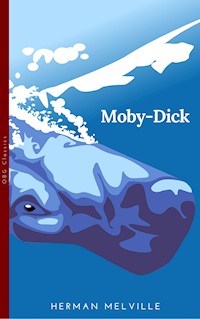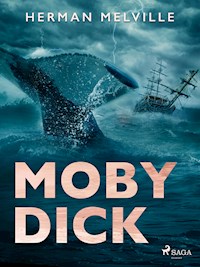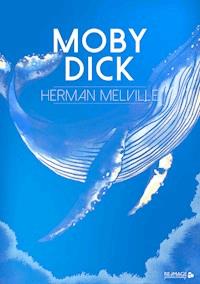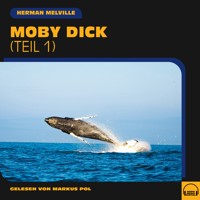0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In "Benito Cereno" entführt Herman Melville seine Leser in die komplexe Welt des 19. Jahrhunderts, in der Themen wie Rassismus, Kolonialismus und die menschliche Natur eindringlich behandelt werden. Die Novelle, die auf einem historischen Ereignis basiert, erzählt von einem amerikanischen Handelsschiff, das auf ein gestrandetes spanisches Sklavenschiff stößt. Melvilles eindringlicher und komplexer Schreibstil fesselt den Leser durch den Einsatz von suspense und Ironie, was zu einer tiefen Reflexion über Machtverhältnisse und moralische Dilemmas führt. Die Erzählung wirft Fragen über die Wahrnehmung und Interpretation von Freiheit und Unterdrückung auf und stellt somit einen bedeutenden Beitrag zur Literatur der amerikanischen Romantik dar. Herman Melville, geboren 1819 in New York, war ein Autor, dessen Leben und Reisen seine Werke stark prägten. Seine Erfahrungen als Matrose und seine Auseinandersetzung mit der Walfangindustrie flossen in viele seiner Schriften ein. "Benito Cereno", veröffentlicht 1855, reflektiert Melvilles persönliche Überzeugungen und seine kritische Haltung gegenüber der gesellschaftlichen Realität der Sklaverei. Der Autor kämpfte zeitlebens mit den moralischen Konflikten seiner Zeit, was sich deutlich in der Darstellung der Charaktere und ihrer Interaktionen zeigt. Dieses Buch ist nicht nur eine fesselnde Erzählung, sondern auch eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der menschlichen Psyche und den paradoxen Strukturen der Gesellschaft. Es wird dem Leser empfohlen, der bereit ist, sich den komplexen ethischen Fragestellungen zu stellen, die Melville meisterhaft in seine Prosa eingewebt hat. "Benito Cereno" ist ein unverzichtbares Werk, das sowohl literarisch als auch philosophisch herausfordert und bereichert. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Benito Cereno
Inhaltsverzeichnis
Im Jahr 1799 lag Kapitän Amasa Delano aus Duxbury in Massachusetts, der ein großes Robbenfang- und Handelsschiff befehligte, mit einer wertvollen Fracht im Hafen von St. Maria vor Anker – einer kleinen, verlassenen, unbewohnten Insel am südlichen Ende der langen Küste Chiles. Dort hatte er Wasser aufgenommen.
Am zweiten Tag, nicht lange nach Sonnenaufgang, lag er in seiner Koje, als sein Maat zu ihm kam und ihm mitteilte, dass ein seltsames Segel in die Bucht einfuhr. Damals gab es in diesen Gewässern noch nicht so viele Schiffe wie heute. Er stand auf, zog sich an und ging an Deck.
Der Morgen war ein für diese Küste typischer Morgen. Alles war still und ruhig; alles war grau. Die See, die sich in langen Wellen auftürmte, schien festgefroren und war an der Oberfläche glatt wie gewelltes Blei, das abgekühlt und in der Form des Schmelzers erstarrt ist. Der Himmel schien ein grauer Anzug zu sein. Schwärme von beunruhigten grauen Vögeln, die mit Schwärmen von beunruhigten grauen Dämpfen, unter die sie sich mischten, niedrig und unruhig über das Wasser flogen, wie Schwalben über Wiesen vor einem Sturm. Der Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens ist vorhanden und deutet auf einen noch tieferen Schatten hin, der kommen wird.
Zu Kapitän Delanos Überraschung zeigte der Fremde, durch das Glas betrachtet, keine Flaggen; obwohl es unter friedlichen Seeleuten aller Nationen Brauch war, beim Einlaufen in einen Hafen, sei er auch noch so unbewohnt an seinen Ufern, wo vielleicht nur ein einziges anderes Schiff lag, die Farben zu zeigen. Angesichts der Gesetzlosigkeit und Einsamkeit dieses Ortes und der Art von Geschichten, die zu jener Zeit mit diesen Meeren verbunden waren, hätte Kapitän Delanos Überraschung in ein gewisses Unbehagen übergehen können, wäre er nicht eine Person von außergewöhnlich argloser Gutmütigkeit gewesen, die nur unter außergewöhnlichen und wiederholten Anreizen – und selbst dann kaum – dazu neigte, persönliche Ängste zu hegen, die in irgendeiner Weise die Unterstellung bösartiger Bosheit im Menschen beinhalteten. Ob eine solche Eigenschaft, angesichts dessen, wozu die Menschheit fähig ist, neben einem wohlwollenden Herzen auch eine überdurchschnittliche Schnelligkeit und Genauigkeit der intellektuellen Wahrnehmung impliziert, mag den Weisen überlassen bleiben, zu entscheiden.
Aber welche Bedenken auch immer beim ersten Anblick des Fremden aufkommen könnten, würden sich in den Augen eines jeden Seemanns fast zerstreuen, wenn er beobachtet, dass das Schiff beim Einlaufen in den Hafen zu nahe am Land vorbeifährt; ein versunkenes Riff, das vor seinem Bug auftaucht. Dies schien zu beweisen, dass sie in der Tat ein Fremder war, nicht nur für den Seefahrer, sondern auch für die Insel; folglich konnte sie kein gewohnter Freibeuter auf diesem Ozean sein. Mit nicht geringem Interesse beobachtete Kapitän Delano sie weiterhin – ein Vorgehen, das durch die Dämpfe, die den Rumpf teilweise umhüllten, nicht gerade erleichtert wurde. Durch diese strömte das ferne Morgenlicht aus ihrer Kabine, das der Sonne ähnelte, undeutlich genug; zu diesem Zeitpunkt war es halbkreisförmig am Rand des Horizonts und anscheinend in Begleitung des seltsamen Schiffes, das in den Hafen einfuhr – das, von denselben niedrigen, kriechenden Wolken verhüllt, nicht unähnlich dem ein unheimliches Auge, das über die Plaza spähte, aus dem indianischen Schlupfloch ihres dämmrigen saya-y-manta .
Es könnte eine Täuschung durch die Dämpfe gewesen sein, aber je länger der Fremde beobachtet wurde, desto einzigartiger erschienen seine Manöver. Es schien schwer zu entscheiden, ob er einlaufen wollte oder nicht – was er wollte oder was er vorhatte. Der Wind, der in der Nacht etwas aufgefrischt hatte, war jetzt extrem leicht und verwirrend, was die scheinbare Unsicherheit seiner Bewegungen noch verstärkte. Schließlich vermutete Kapitän Delano, dass es sich um ein Schiff in Not handeln könnte, und befahl, das Walboot zu Wasser zu lassen. Gegen den vorsichtigen Widerstand seines Maats bereitete er sich darauf vor, an Bord zu gehen und das Schiff zumindest in den Hafen zu lotsen. In der Nacht zuvor war eine Gruppe von Seeleuten, die zum Fischen unterwegs waren, weit hinaus zu einigen abgelegenen Felsen gefahren, die für den Robbenfänger nicht zu sehen waren, und war ein oder zwei Stunden vor Tagesanbruch mit einem nicht geringen Erfolg zurückgekehrt. In der Annahme, dass sich das fremde Schiff weit vor der Küste befinden könnte, lud der gute Kapitän mehrere Körbe mit Fisch als Geschenk in sein Boot und fuhr davon. Da er annahm, dass der Fremde sich zu weit von der Küste entfernt hatte, und ihn für in Gefahr hielt, rief er seinen Männern zu und beeilte sich, die anderen an Bord über ihre Lage zu informieren. Doch bevor das Boot auftauchte, hatte der Wind, obwohl er schwach war, gedreht und das Schiff abgetrieben und die Nebelschwaden um das Schiff herum teilweise aufgelöst.
Als man eine weniger entfernte Sicht gewann, erschien das Schiff, das am Rande der bleifarbenen Wogen signifikant sichtbar wurde, mit den hier und da zerrissenen Nebelfetzen, die es unregelmäßig umhüllten, wie ein weißgetünchtes Kloster nach einem Gewitter, das auf einer düsteren Klippe in den Pyrenäen thront. Doch es war keine rein phantastische Ähnlichkeit, die Kapitän Delano nun für einen Moment fast glauben ließ, dass nichts Geringeres als eine Schiffsladung Mönche vor ihm lag. Über die Schanzkleider hinweg schauten, was in der nebligen Ferne wirklich wie Scharen dunkler Kapuzen wirkte; während durch die geöffneten Schießscharten hin und wieder andere dunkle, sich bewegende Gestalten schemenhaft zu erkennen waren, wie Schwarze Mönche, die durch die Kreuzgänge schreiten.
Als es sich noch näherte, änderte sich diese Erscheinung und der wahre Charakter des Schiffes wurde deutlich – ein spanisches Handelsschiff der ersten Klasse, das neben anderer wertvoller Fracht auch Negersklaven von einem Kolonialhafen zum anderen transportierte. Ein sehr großes und zu seiner Zeit sehr schönes Schiff, wie man sie damals in Abständen entlang der Hauptroute antraf; manchmal ersetzte es Acapulco-Schatzschiffe oder ausgemusterte Fregatten der spanischen Königsmarine, die wie veraltete italienische Paläste unter dem Niedergang ihrer Herren noch immer Zeichen ihres früheren Status bewahrten.
Als das Walboot immer näher kam, wurde der Grund für das eigentümliche, lehmverputzte Aussehen des Fremden in der schlampigen Vernachlässigung gesehen, die es durchzog. Die Spieren, Taue und ein großer Teil der Schanzkleider sahen struppig aus, da sie schon lange nicht mehr mit Schaber, Teer und Bürste in Berührung gekommen waren. Ihr Kiel schien gelegt, ihre Rippen zusammengefügt, und sie war aus Hesekiels „Tal der verdorrten Gebeine“ gestartet.
In der gegenwärtigen Angelegenheit, mit der sie beschäftigt war, schienen das allgemeine Modell und die Takelage des Schiffes keine wesentlichen Veränderungen gegenüber ihrem ursprünglichen kriegerischen und Froissart-Muster erfahren zu haben. Es waren jedoch keine Kanonen zu sehen.
Die Toppen waren groß und mit einem ehemals achteckigen Netzwerk versehen, das nun in einem traurigen Zustand war. Diese Dächer hingen wie drei verfallene Volieren über den Köpfen, in einer davon saß auf einem Rattennetz ein weißer Noddi, ein seltsames Geflügel, das wegen seines lethargischen, schlafwandlerischen Charakters so genannt wird und auf See häufig von Hand gefangen wird. Das zerschlagene und verschimmelte, zinnenbewehrte Vorschiff wirkte wie ein alter Turm, der vor langer Zeit im Sturm erobert und dann dem Verfall preisgegeben wurde. Zum Heck hin öffneten sich zwei hoch aufragende Seitengalerien – die Balustraden hier und da mit trockenem, zunderartigem Meeresmoos bedeckt – von der unbewohnten Staatskabine aus, deren Oberlichter trotz des milden Wetters hermetisch verschlossen und abgedichtet waren – diese unbewohnten Balkone hingen über dem Meer, als wäre es der große venezianische Kanal. Aber das wichtigste Relikt verblasster Pracht war das große Oval des schildartigen Heckstücks, das kunstvoll mit den Wappen von Kastilien und Leon verziert war und von Gruppen mythologischer oder symbolischer Darstellungen umgeben war. Ganz oben und in der Mitte befand sich ein dunkler Satyr mit einer Maske, der seinen Fuß auf den ausgestreckten Hals einer sich windenden, ebenfalls maskierten Gestalt stellte.
Ob das Schiff eine Galionsfigur oder nur einen einfachen Schnabel hatte, war nicht ganz sicher, da dieser Teil mit Leinwand umwickelt war, entweder um ihn während einer Renovierung zu schützen oder um seinen Verfall anständig zu verbergen. Grob mit Kreide oder Farbe gemalt stand auf der Vorderseite einer Art Sockel unter der Leinwand der Satz: „Seguid vuestro jefe“ (folgt euren Mächtigen dieser Welt); während auf den angelaufenen Kopfbrettern in der Nähe in stattlichen, einst vergoldeten Großbuchstaben der Name des Schiffes „SAN DOMINICK“ erschien, wobei die Buchstaben jeweils von Kupferrost durchzogen waren; während wie Trauergras wogten dunkle Seegrasgirlanden schleimig bei jeder leichenwagenartigen Bewegung des Rumpfes über den Namen hin und her.
Als das Boot schließlich vom Bug entlang zur Gangway mittschiffs eingehakt wurde, schabte sein Kiel, der noch einige Zentimeter vom Rumpf entfernt war, hart wie auf einem versunkenen Korallenriff. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen riesigen Haufen zusammengeballter Seepocken handelte, die wie eine Warze unter Wasser an der Seite hafteten – ein Zeichen für verwirrende Winde und lange Flauten, die irgendwo in diesen Meeren herrschten.
Beim Aufstieg an der Seite war der Besucher sofort von einer lärmenden Menschenmenge aus Weißen und Schwarzen umgeben, wobei letztere in der Überzahl waren, was man angesichts des Neger-Transportschiffs, als das der Fremde im Hafen galt, nicht erwartet hätte. Aber in einer Sprache und wie mit einer Stimme schütteten alle eine gemeinsame Leidensgeschichte aus, in der die Negerinnen, von denen es nicht wenige gab, die anderen in ihrer schmerzlichen Vehemenz übertrafen. Der Skorbut und das Fieber hatten einen großen Teil ihrer Zahl dahingerafft, insbesondere die Spanier. Vor Kap Hoorn waren sie nur knapp dem Schiffbruch entgangen; dann lagen sie tagelang wie betäubt ohne Wind; ihre Vorräte waren knapp, ihr Wasser ging zur Neige; ihre Lippen waren in diesem Moment ausgetrocknet.
Während Kapitän Delano so zum Ziel aller eifrigen Zungen wurde, ließ sein einziger eifriger Blick alle Gesichter und alle anderen Gegenstände um ihn herum erfassen.
Immer wenn man zum ersten Mal ein großes und bevölkerungsreiches Schiff auf See betritt, insbesondere ein ausländisches Schiff mit einer nicht näher beschriebenen Besatzung wie Lascars oder Manilla-Männern, unterscheidet sich der Eindruck auf besondere Weise von dem, den man beim ersten Betreten eines fremden Hauses mit fremden Bewohnern in einem fremden Land hat. Sowohl Haus als auch Schiff – das eine durch seine Wände und Jalousien, das andere durch seine hohen Bollwerke wie Schutzwälle – verbergen ihr Inneres bis zum letzten Moment vor den Blicken: Aber im Falle des Schiffes kommt noch hinzu, dass das lebendige Schauspiel, das es enthält, bei seiner plötzlichen und vollständigen Enthüllung im Gegensatz zum leeren Ozean, der es umgibt, etwas von der Wirkung eines Zaubers hat. Das Schiff wirkt unwirklich; diese seltsamen Kostüme, Gesten und Gesichter, aber ein schemenhaftes Tableau, das gerade aus der Tiefe aufgetaucht ist und das direkt zurückerhalten muss, was es gegeben hat.
Vielleicht war es ein solcher Einfluss, wie er oben zu beschreiben versucht wurde, der in Kapitän Delanos Geist alles, was bei einer nüchternen Prüfung ungewöhnlich erscheinen mochte, verstärkte; insbesondere die auffälligen Gestalten von vier älteren, ergrauten Negern, deren Köpfe wie schwarze, verwitterte Weidenkronen wirkten, die, in ehrwürdigem Kontrast zu dem Tumult unter ihnen, sphinxartig gelagert waren: einer auf dem Steuerbord-Katkopf, ein anderer auf dem Backbord-Katkopf, und das verbleibende Paar saß einander gegenüber auf den gegenüberliegenden Schanzkleidern über den Hauptketten. Jeder von ihnen hielt Stücke von aufgedröseltem, altem Tauwerk in den Händen und zupfte mit einer Art stoischer Selbstzufriedenheit das Tauwerk zu Werg, von dem ein kleiner Haufen neben ihnen lag. Sie begleiteten diese Arbeit mit einem kontinuierlichen, leisen, monotonen Gesang; sie summten und werkelten dahin wie so viele grauhaarige Dudelsackpfeifer, die einen Trauermarsch spielten.
Das Achterdeck stieg zu einer großen erhöhten Plattform an, auf deren vorderem Rand, wie die Wergsammler etwa acht Fuß über der allgemeinen Menschenmenge, sechs weitere Schwarze in einer Reihe saßen, die durch regelmäßige Abstände voneinander getrennt waren. Jeder von ihnen hatte ein rostiges Beil in der Hand, das er mit einem Stück Ziegel und einem Lappen wie ein Küchenjunge zum Scheuern nutzte. Zwischen jeweils zwei von ihnen befand sich ein kleiner Stapel Beile, deren verrostete Schneiden nach vorne gerichtet waren und auf eine ähnliche Behandlung warteten. Obwohl die vier Wergsammler gelegentlich kurz mit einer oder mehreren Personen in der Menge unten sprachen, sprachen die sechs Axtpolierer weder mit anderen, noch flüsterten sie untereinander, sondern widmeten sich konzentriert ihrer Aufgabe, außer in Abständen, in denen sie, mit der besonderen Vorliebe der Neger, Fleiß mit Zeitvertreib zu verbinden, paarweise ihre Äxte seitlich aneinander schlugen, „wie Zimbeln, mit einem barbarischen Lärm“. Alle sechs hatten im Gegensatz zur Allgemeinheit das raue Aussehen ungekünstelter Afrikaner.
Aber dieser erste umfassende Blick, der diese zehn Gestalten mit weniger auffälligen Merkmalen erfasste, ruhte nur einen Augenblick auf ihnen, als der Besucher, ungeduldig über den Lärm der Stimmen, sich auf die Suche nach demjenigen machte, der das Schiff befehligte.
Aber als ob er nicht abgeneigt wäre, die Natur ihren eigenen Fall unter seiner leidenden Anklage bekannt machen zu lassen, oder aber in der Verzweiflung, sie für die Zeit zurückzuhalten, stand der spanische Kapitän, ein höflicher, zurückhaltend aussehender und für das Auge eines Fremden eher junger Mann, gekleidet in einzigartigem Reichtum, aber mit deutlichen Spuren von kürzlich erlittenen schlaflosen Sorgen und Unruhen, passiv da, lehnte sich an den Hauptmast und warf einen traurigen, geistlosen Blick auf seine aufgeregten , dann wieder einen unglücklichen Blick auf seinen Besucher. An seiner Seite stand ein kleiner schwarzer Mann, dessen raues Gesicht, das er gelegentlich wie ein Schäferhund stumm dem Spanier zuwandte, Trauer und Zuneigung gleichermaßen ausdrückte.
Der Amerikaner kämpfte sich durch die Menge, ging auf den Spanier zu, versicherte ihn seines Mitgefühls und bot ihm an, jede Hilfe zu leisten, die in seiner Macht stünde. Der Spanier erwiderte dies vorerst mit ernsten und feierlichen Dankesworten, wobei seine nationale Förmlichkeit von der düsteren Stimmung seiner schlechten Gesundheit überschattet wurde.
Aber Kapitän Delano verlor keine Zeit mit Komplimenten, kehrte zur Gangway zurück und ließ seinen Fischkorb heraufbringen. Da der Wind immer noch schwach war und es noch mindestens einige Stunden dauern würde, bis das Schiff vor Anker gehen konnte, befahl er seinen Männern, zum Robbenfänger zurückzukehren und so viel Wasser zu holen, wie das Walboot tragen konnte, mit allem weichen Brot, das der Steward haben könnte, allen verbleibenden Kürbissen an Bord, mit einer Zuckerdose und ein Dutzend seiner privaten Flaschen Apfelwein.
Nur wenige Minuten nachdem das Boot abgelegt hatte, flaute der Wind zum Ärger aller vollständig ab und die Flut begann, das Schiff hilflos zurück aufs Meer zu treiben. Da Kapitän Delano jedoch darauf vertraute, dass dies nicht lange anhalten würde, versuchte er, die Fremden mit guten Hoffnungen aufzumuntern, und war nicht wenig zufrieden, dass er sich mit Personen in ihrer Situation – dank seiner häufigen Reisen entlang der spanischen Hauptroute – in ihrer Muttersprache frei unterhalten konnte.