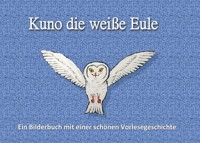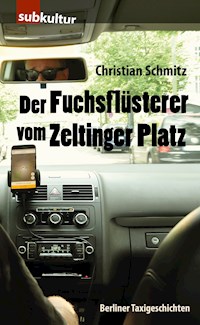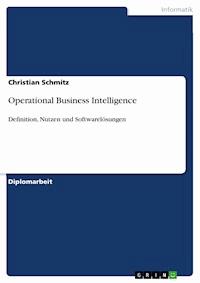7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition subkultur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herr Schmitz ist Taxifahrer in Berlin. Und als solcher trifft man jeden Tag die skurrilsten und interessantesten Gestalten und erlebt die schrägsten Geschichten. Herr Schmitz hat sie aufgeschrieben und erklärt uns nun mit viel Humor und einer Prise Philosophie, wie mit Schlechte-Laune-Verbreitern, Gurus oder Nazis im Taxi umzugehen ist, dass man als Pedant am besten über sich selbst lacht oder was Taxifahrer eigentlich unter einem „rauchenden Hund“ verstehen. „Benzin im Wischwasser“ ist nach seinem gefeierten Debüt „Der Fuchsflüsterer vom Zeltinger Platz“ Christian Schmitz’ zweites Buch mit Berliner Taxigeschichten in der Edition Subkultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Frau, für ihr Lachen.
Für meine Kolleginnen und Kollegen.
Christian Schmitz
Christian Schmitz ist gebürtiger Berliner und einer dieser klugen Taxifahrer der Hauptstadt. In seinem geheimen früheren Leben war er nämlich Historiker. Taxifahrer ist er immer noch mit Leib und Seele. Weder die Mauer, noch deren Fall, noch die Pandemie konnten das ändern. Und nach Jahren auf dem Fahrersitz haben sich allerlei lustige, skurrile und nachdenklich machende Geschichten über die Leute angesammelt, die seine Rückbank oder den Beifahrersitz bevölkert haben.
2018 erschien deshalb seine erste Taxigeschichtensammlung „Der Fuchsflüsterer vom Zeltinger Platz“ ebenfalls bei Subkultur. Seitdem ist er mit seinen Geschichten auch auf den Berliner Lesebühnen zu erleben.
christianschmitzberlin.wordpress.com/
Christian Schmitz
BENZIN IM WISCHWASSER
Berliner Taxigeschichten
edition.subkultur.de
CHRISTIAN SCHMITZ: „Benzin im Wischwasser“
Berliner Taxigeschichten
1. Auflage, März 2021, Edition Subkultur Berlin
© 2021 Periplaneta - Verlag und Medien / Edition Subkultur
Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin
edition.subkultur.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden.
Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Lektorat: Laura Alt
Coverfoto: Marion Alexa Müller Satz & Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-948949-02-0
epub ISBN: 978-3-948949-03-7
Vorwort
Als ich ein kleiner Junge war, waren Taxis noch schwarz. Die Zeiten waren unsicher für Taxifahrer, die immer wieder ausgeraubt wurden. Manche bezahlten diese Überfälle mit dem Leben. Es wurde eine Verordnung erlassen, nach der jedes Taxi mit einer Trennwand zwischen Taxifahrer und Fahrgästen im Wagenfond ausgestattet sein musste. Die Scheibe kam nicht gut an, weder bei den Taxifahrern noch bei den Fahrgästen. Es gab Proteste, die Verordnung wurde aufgehoben und keine zwei Jahre später war die Trennwand im Taxi Geschichte. Das war Ende der 1960er Jahre.
Als ich ein junger Mann war, waren Taxis hell-elfenbeinfarbig. Ich entschloss mich, Taxifahrer zu werden, um mein Studium zu finanzieren und die junge Familie zu ernähren. Die Zeiten waren nicht die schlechtesten. Auf der West-Berliner Insel ließ sich mit Taxifahren gutes Geld verdienen und viel erleben. Ans Aufschreiben der Geschichten, die ich im Taxi erlebte oder die mir erzählt wurden, dachte ich damals noch nicht. Schließlich war mein Taxifahrerdasein nur vorübergehend.
Aber das war der Job, den ich nach meinem Abschluss machte, dann auch. Die Zeiten ändern sich. Selbst Bob Dylan, der das mal sang, hat inzwischen all seine Lieder verkauft.
Ich wollte mich nicht verkaufen. Und so saß ich Jahre später wieder hinterm Lenkrad einer Taxe. Im mittlerweile mauerlosen Berlin war der Überlebenskampf auf den Straßen härter geworden und sollte noch härter werden.
Aber zu erleben gab es immer noch genauso viel wie früher. Und so fing ich an, Taxigeschichten aufzuschreiben, Geschichten von einem mit Erschießung drohenden Nazi oder einer Verfolgungsjagd mit Baseballschläger, von einer Chinesin, die Angst hat, von mir bei ihrer Chefin verpfiffen zu werden, oder von Russen, die lachen, dass die Scheiben der Taxe anfangen zu zittern, von einem empfindsamen Rolls-Royce-Fahrer oder einem moppeligen Radrennfahrer, der sein Rennrad am Kühlergrill der Taxe montiert wissen möchte.
Und dann kam das Corona-Virus und mit diesem die Rückkehr der Trennscheibe, nicht in ihrer martialischen Version der sechziger Jahre, aber nicht weniger verstörend. Es folgten Umsatzeinbrüche von historischem Ausmaß mit Standzeiten an Taxihalten von nicht gekannter Länge und Taxitagen ohne eine einzige Geschichte, die es lohnt, erzählt zu werden.
Wann werden wir wieder unser Leben zurückhaben?
Niemand weiß es. Aber die Zeiten ändern sich. Und sie werden wieder besser werden. Auch für uns. Da bin ich mir sicher. Es wird wieder Taxikinder geben und Gestrandete, die sich auf Kurzstrecke einen Psychologen sparen. Wir werden wieder Menschen in die Clubs und wieder nach Hause fahren, vor die Hotels und zum Flughafen.
Dieses Buch widme ich allen Taxifahrern, Taxifahrerinnen und unseren Fahrgästen.
Wie mit Pannen, Dummen und Gurus umzugehen ist
Taxifahrer in Berlin! Das ist nicht immer einfach. Die Hektik, der Verkehr, die Leute. Und was kann ein Taxifahrer bei alledem am wenigsten gebrauchen? Eine Panne! Und was widerfährt einem jeden Taxifahrer dennoch hin und wieder? Eine Panne! Mir auch, ich bin in der Hinsicht leider keine Ausnahme. Ist wie mit den Krankheiten. Da denkt auch jeder: Die kriegen nur die anderen. Und dann erwischt es einen selbst.
Neulich erst: Es war mitten in der Nacht und ich habe einem späten Fahrgast Gepäckstücke aus dem Kofferraum gereicht. Ich schließe die Klappe und gehe zur Fahrertür, da fällt mein Blick auf das linke Hinterrad. Ich gucke einmal, ich gucke zweimal. Kein Zweifel. Ich habe eindeutig einen Plattfuß. Was nun? Der Wagen hat kein Reserverad, nur ein Reifenreparaturset. Zwar gibt es beim Büro der Firma ein Kabuff, aus dem ich mir ein Reserverad holen könnte. Doch zunächst sollte ich versuchen, das defekte Rad abzunehmen. Ich schnappe mir den Radschlüssel, ziehe die Radkappe ab – wunderbar, die Hände sind im Nu kohlrabenschwarz – setze den Schlüssel an einer der Radmuttern an und versuche, diese zu lockern. Hm, sitzt ziemlich fest, das Ding. Ich versuche es bei der nächsten. Nichts zu machen. Ich probiere sie alle durch. Keine einzige lässt sich von Hand lockern. Ich setze den Schlüssel an einer der Muttern so an, dass er waagerecht anliegt, halte mich an der Dachreling der Taxe fest, stelle mich mit beiden Füßen auf den Schlüssel und versuche, ihn wippend niederzudrücken. So hüpfe ich mitten in der Nacht eine Weile auf diesem Radschlüssel herum. Er bewegt sich nicht einen einzigen Millimeter. Ich verfluche die Werkstatt, die diese Radmuttern angezogen hat. Ich klettere vom Radschlüssel herunter und tue mir leid. So wächst als Nächstes ein Gedanke in mir heran, der mich erschauern lässt. Reifenreparaturset! Wenn ich allein an die Betriebsanleitung denke. Die Verfasser solcher Anleitungen sind hochqualifizierte, teuer bezahlte Fachleute. Sie machen einen wichtigen Job. Sie sollen eine schwierige Materie in einfache Worte fassen. Sie sollen den Leser denken lassen: „Och, das mach ich doch mit links!“ Darin hat der Verfasser dieses Textes kläglich versagt. Beim Lesen der Betriebsanleitung eines Reifenreparatursets kann sich nur ein einziger Gedanke aufdrängen: „Das schaff ich nie!“
Ich mache mich ans Werk. Eigentlich alles gar nicht so schwer. Im Nu ist der Generator dabei, den platten Reifen aufzublasen. Das Ding ist eine Höllenmaschine und veranstaltet einen infernalischen Lärm. Ich schaue mich um, beobachte die dunklen Fenster. Geht irgendwo Licht an? Wird eine Gardine beiseite geschoben? Ich mache mich darauf gefasst, dass jeden Augenblick eines der Fenster aufgerissen wird und mich jemand von oben herab anbrüllt: „Ruhe da unten! Wir wollen schlafen!“ Aber nichts dergleichen geschieht und so füllt sich der Reifen tatsächlich allmählich mit Luft, auf dass ich immerhin in dieser Nacht noch bis zur Reifenwerkstatt komme, wo ich die Taxe abstelle und dem Kollegen Tagfahrer eine Nachricht schreibe, dass er den Pneumatikern den Wagenschlüssel vorbeibringen möge. Am nächsten Tag lerne ich, dass der Reifen aufgrund des Dichtmittels nicht mehr zu reparieren war. Na toll, umsonst die ganze Arbeit.
Anderntags, die Karre fährt immerhin wieder, geht es mit den Widrigkeiten des Taxifahreralltags prompt weiter, kaum dass ich meine Schicht angefangen habe. Funkauftrag in Wannsee. Ein kleines verstecktes Häuschen, sodass ich aussteigen muss, um zu schauen, ob ich vor der richtigen Hausnummer stehe. Das liebe ich. Ich bin beileibe kein Paragraphenreiter, möchte aber gleichwohl an dieser Stelle beiläufig einflechten, dass es in Paragraph 3 der Berliner Nummerierungsverordnung ausdrücklich heißt: Grundstücksnummern müssen von der Straße aus lesbar sein. Ich muss als überwiegend nachts seinen Dienst versehender Taxifahrer sogar darüber hinaus noch Paragraph 4 der Berliner NrVO zitieren, nach der die zum Anbringen der Grundstücknummern Verpflichteten dafür zu sorgen haben, dass die Grundstücknummern bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet sind. Natürlich ist dem nicht so – jedenfalls nicht überall. Und dann kommt mir nachts in einer schmalen Einbahnstraße und zwei Autos im Rückspiegel der Fahrgast mit beiden Armen wild fuchtelnd entgegen, um mir zu bedeuten: „Wo stehen Sie denn? Hier habe ich Sie herbestellt! Jetzt muss ich Ihretwegen auch noch drei Meter laufen! Unerhört! Schweinerei! So nicht, mein Lieber!“ Na klar, er und seine Nachbarn haben keine einzige lesbare, geschweige denn beleuchtete Hausnummer an ihren Häusern, aber der Taxifahrer hat natürlich exakt vor seiner Tür zu halten. Aber egal, wen interessiert das schon außer Taxifahrern und Rettungskräften, bei denen es um Leben und Tod und jede Sekunde geht. Meine Hausnummer bei mir zu Hause ist gut erkennbar und beleuchtet, falls ich mal einen Sanitäter brauchen sollte. Allen anderen können die Hinterbliebenen in die Todesanzeige schreiben: „Er rang mit dem Tode und rief Eins-Eins-Zwei. Die Retter, sie eilten geschwinde herbei. Doch dunkel war’s, sie fanden ihn nicht. Hätt’s Haus nur gehabt eine Nummer, ein Licht.“
Aber zurück zu meinem hausnummerlosen Wannseer Auftrag. Dass ich richtig stehe, sagt mir nur das kleine Zusatzschild mit der Hausnummernangabe unterm Straßenschild. Ich liebe Berlin. Das gibt es sonst nirgends. Ich warte. Die Zeit verstreicht. Gleich ruf ich die Funkzentrale an. Die sollen mal nachfragen, was nun ist. Denn Namensschild und Klingel kennt dieses Haus ebenso wenig wie eine Hausnummer. Nicht einmal ein Briefkasten hängt am Gartenzaun. Dafür verwehrt eine mannshohe verwilderte Hecke jeden Blick auf Haus und Grundstück. Was wohnen hier für Leute? Und dann kommen sie endlich, die Herrschaften. Ein älteres Ehepaar, beide jenseits der siebzig. In dem Alter kommt niemand mehr angerannt, wenn er die Taxe hat warten lassen. Die paar Minuten mehr oder weniger für den beschwerlichen Weg von der Haustür durch den Vorgarten übern Bürgersteig bis zum Taxi spielen keine Rolle mehr. Sehe ich genauso. Irgendwann sind meine Frau und ich ebenso alt wie die beiden und dann wird auch uns nichts und niemand mehr hetzen. Die Hauptsache ist, dass sich etwas tut, dass ich nunmehr tatsächlich davon ausgehen darf, in Bälde eine Fahrt antreten zu dürfen.
Die Erscheinung der beiden steht in starkem Kontrast zu ihrem renovierungsbedürftigen Hexenhäuschen und dem vernachlässigten Garten. Wie aus dem Ei gepellt, trägt er einen dunklen Anzug mit mattblauer Krawatte, sie ein schwärzliches Kostüm mit pastellgrünem Halstuch – ganz bürgerlich-etablierter Ausgehstil, an dem sich das zurückliegende halbe Jahrhundert wenig geändert haben dürfte. Gemessenen Schrittes bemühen sich beide um straffe Haltung, wenn auch insbesondere sein altersschwacher Rücken ihn unübersehbar vornüberbeugt. Aussteigen meinerseits, um behilflich zu sein, ist nicht vonnöten. Das schaffen die beiden auch ohne mich, haben ja nicht einmal Gehstöcke oder gar Rollatoren dabei. Ich öffne beide rechten Türen und schiebe den Beifahrersitz ein Stückchen nach hinten, da er offensichtlich auf diesen zustrebt. Die beiden steigen ein, allseits höfliche Begrüßung, die Türen fallen zu, es geht nach Potsdam, der Kutscher kennt den Weg. Bis hierher alles freundlich, kultiviert.
Sodann eröffnet er das Gespräch, kommt ohne Umschweife auf ein für mich in der Situation, in der wir uns befinden, völlig aus der Luft gegriffenes Thema, das ihm sehr wichtig zu sein scheint – den Unterschied zwischen Schalotte und Schaluppe. Ja, richtig, den Unterschied zwischen Schalotte und Schaluppe, das ist sein Thema, das er gerne mit einem Berliner Taxifahrer besprechen möchte. In seiner Tageszeitung stünden in regelmäßigen Abständen Kochrezepte, die er stets lesen würde, da er leidenschaftlich gerne koche. Und da hätte doch tatsächlich letztens in einem der Rezepte bei den Zutaten gestanden, dass Schaluppen an das Essen müssen. „Können Sie sich so etwas vorstellen?“, empört er sich und schaut mich dabei mit todernster Miene an.
Ich stutze. Schaluppe, Schaluppe … habe ich schon gehört das Wort. Ist aber definitiv keines von denen, die ich häufig benutze. Schaluppe, was war das noch mal? Irgendetwas mit Wasser. Ein kleines Boot? Ja richtig, das muss es sein. Eine Schaluppe ist eine Art Boot. Genauer kann ich es in dem Moment nicht definieren. Will der Mann mich prüfen, examinieren, auf die Probe stellen, will er herausfinden, ob er von einem gebildeten Chauffeur oder einem Dummkopf von Taxifahrer gefahren wird?
Ich schweige. Wenn ich etwas im Leben gelernt habe, dann das Schweigen. Das kann ich gut. In bestimmten Situationen ist es nach meiner Einschätzung und Erfahrung schlicht und ergreifend das Beste, fürs Erste zu schweigen.
Und siehe da, richtig gemacht. Das hält er nicht aus. Also bricht es aus ihm heraus: „So eine blöde Kuh!“ Es war fraglos eine untalentierte, ja, unwissende, nein, unfähige Kochrezeptskribentin. „Die muss doch den Unterschied zwischen Schaluppe und Schalotte kennen!“, prustet es aus ihm heraus und er schaut mich wieder herausfordernd an.
Schalotte, das Wort ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Aber was war, verdammich nochmal, eine Schalotte? Irgendetwas mit Essen. Eine kleine Zwiebel? Genau, das ist es. Eine Schalotte ist eine Art Zwiebel. Diesmal lasse ich ihn das Schweigeduell gewinnen und sage mit unbewegtem Gesichtsausdruck: „Ja, den sollte sie kennen.“ Damit kann ich nichts falsch machen, falle ihr nicht in den Rücken, ohne um die näheren Umstände zu wissen. Den Unterschied zwischen einer Zwiebel und einem Boot sollte sie tatsächlich kennen.
Ich schaue meinen kochenden Beifahrer für einen Moment an. Seine verzerrten Gesichtszüge entspannen sich und er schaut geradeaus. Aber da, ich sehe es, noch während sich mein Blick wieder auf die Straße richtet, verzerren sie sich bereits wieder.
„Na, ich habe einen bitterbösen Leserbrief an die Redaktion der Zeitung geschrieben. Das kann ich Ihnen sagen. So geht es doch nicht. Was sind denn das für Leute, die die Zeitung schreiben? Was haben die gelernt? Aber was will man schon erwarten? Was lernen die denn heutzutage noch in der Schule? Machen alle Abitur, studieren, wollen alle schnell das große Geld verdienen und kennen nicht den Unterschied zwischen Schaluppe und Schalotte! Ach, es ist ein Graus. Armes Deutschland! Wo soll das nur alles hinführen?“ Wie ein Häufchen Elend kauert der alte Mann auf dem Beifahrersitz. Er ist sichtlich erschüttert und erbost zugleich. Das regt ihn alles auf, dass sein schönes Deutschland, das er aufgebaut hat, von Nichtsnutzen und Raffkes zuschanden gemacht wird. Er schimpft und schimpft und schimpft, von Wannsee bis Potsdam.
„Tja“, entgegne ich in einer kurzen Redeschwalllücke, „ist ja vielleicht alles nicht ganz unrichtig, was Sie da sagen. Aber nun stellen Sie sich doch mal vor, Sie leben in einer tatsächlichen Bananenrepublik, wo alles drunter und drüber geht, alle durch und durch korrupt sind, Sie nicht frei Ihre Meinung sagen können, weil Sie Angst haben müssen, dass der Taxifahrer Sie verpfeift. Auf der Wannseer Seite der Glienicker Brücke hätten Sie vielleicht auch früher schon so geredet. Auf der Potsdamer Seite der Brücke hätten Sie noch vor ein paar Jahren nicht so vor einem Taxifahrer reden können!“
Jetzt schweigt er. Wir kommen zum Ziel, einem Restaurant, vor dem sich schon eine kleine Festgesellschaft versammelt hat. Er bezahlt, kleines Trinkgeld, dann steigen die beiden wortlos aus. Als er schließlich auf der Straße steht, die Taxitür schon in der Hand hat, schaut er mich noch einmal mit seinen glasigen Augen an und sagt: „Sie sind auch so einer, der zu allem und jedem eine Meinung haben muss, was?“ Sprachs und schlägt die Tür zu. Ich lächle und fahre an. So viel Verbitterung kann einem schon fast wieder leidtun. Problematisch daran ist nur, dass auch so einer wählen geht und mit seinem Kreuz über die Zukunft der Jugend seines geliebten Deutschlands entscheidet, eine Zukunft, die er womöglich nicht mehr lange miterleben wird.
Aber der Stupor findet sich in allen Altersklassen. Neulich erst hatte ich einen jungen Mann, der mich erstaunte. Es ging in dem Gespräch, das wir auf unserer gemeinsamen Fahrt hatten, um die Zeitumstellung und deren mögliche Abschaffung in Europa. Zunächst einmal muss ich ihm erklären, dass die Uhren im Frühjahr um eine Stunde vor- und im Herbst um eine Stunde zurückgestellt werden. Nun gut, damit fällt er noch nicht allzu sehr aus dem üblichen Rahmen. Damit haben viele ihre Schwierigkeiten. Warum sonst muss zweimal jährlich die Zeitumstellung in den Medien ausführlich erklärt werden? Darüber will ich nicht richten. Ich brauche auch meine Eselsbrücke: Mit spring forward and fall back hilft mir das Englische Jahr für Jahr aus der Patsche.
Aber dann geht es weiter mit dem jungen Mann, als wir auf das Thema kommen, dass die Zeitumstellung in Europa abgeschafft werden soll. Sie bringt nichts, die Leute mögen sie nicht – also weg damit. Schön, so weit sind wir uns einig. „Problematisch wird es nur“, sage ich zu ihm, „in Europa eine einheitliche Lösung zu finden. Schließlich ist jedes Land am Ende selbst dafür verantwortlich, ob es sich für die permanente Sommer- oder Winterzeit entscheidet. Da kann ein Flickenteppich entstehen, der nichts als Probleme bringt.“
Eine Pause tritt ein, die für ein Gespräch recht lang ist. Ich schaue in den Rückspiegel. Hat er keine Lust mehr, sich mit mir über das Thema zu unterhalten? Hat sein Telefon geklingelt, ohne dass ich es gehört habe? Doch da hebt er plötzlich wieder an: „Wenn die Sommerzeit jetzt in einem Land beibehalten wird, wird es dann dort jedes Jahr eine Stunde später?“ Ich stutze. Will er mich veräppeln? Wieder schaue ich in den Rückspiegel. Im Zwielicht der Nacht begegnen sich unsere Blicke. Er schaut mich nachdenklich an. Ich komme zu der Erkenntnis: Die Frage ist ernst gemeint. Auweia, das schmerzt. Dabei macht er gar keinen geistig eingeschränkten Eindruck. Er hat einen klaren Gesichtsausdruck, schaut mich offen an, formuliert deutlich und verständlich.
Es heißt doch immer, es gäbe keine dummen Fragen. Ob es in Ländern mit Sommerzeit jedes Jahr eine Stunde später wird … Na klar, wenn in dem einen Land gerade Mittagszeit ist, haben wir im Nachbarland nach zwölf Jahren beim höchsten Stand der Sonne Mitternacht. Wenn das keine dumme Frage ist, dann weiß ich nicht, was eine dumme Frage ist. Doch gleichwohl bin ich der Meinung, dass es ein Recht auf dumme Fragen gibt. Wer will wem verbieten, dumme Fragen zu stellen? Dumme Fragen müssen mit derselben Ernsthaftigkeit beantwortet werden wie schlaue Fragen. Die Schlauberger dieser Welt sollten sich nicht zu viel einbilden auf ihre Schläue. Niemand kann beeinflussen, was ihm väterliches Spermium und mütterliche Eizelle genetisch verheißen; niemand kann was dafür, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden zu sein. Wer kann schon was für sein Glück, sein Pech, den Zufall? Die Schlauberger allerorten sollten sich hüten, sich über die vielen Dummköpfe zu erheben, sie lächerlich zu machen, sie auszunutzen, sie hinters Licht zu führen, um sich womöglich Vorteile auf ihre Kosten zu verschaffen. Der Schlauberger ist nicht besser als der Dummkopf. Und so lautet denn meine ach so schlaue Antwort auf die ach so dumme Frage: „Nein!“
Abermals tritt eine längere Gesprächspause ein. Ich konzentriere mich auf den Verkehr, er schaut aus dem Fenster. Nach ein paar hundert Metern wendet er sich mir zu und sagt: „Wer weiß, ob hinter all dem nicht die Bilderberger stecken. Kennen Sie die Bilderberger? Sie müssen sich unbedingt mal die YouTube-Videos dazu im Netz ansehen.“ Wieder begegnen sich unsere Blicke im Rückspiegel. „Sie wissen, wer sich da jedes Jahr trifft, um über uns zu bestimmen? Das sind alles nur Milliardäre und ganz hohe Politiker, Generäle und Spione und sone Leute. Gucken Sie sich mal die YouTube-Videos an. Da wird Ihnen ganz anders. Die bestimmen alles über uns. Die machen Krieg und sone Sachen. Und die Leute wissen überhaupt nichts davon. Fragen Sie mal rum, wer die Bilderberger kennt. Wissen Sie, von wem ich rede? Die YouTube-Videos zu den Bilderbergern müssen Sie sich anschauen. Dann wissen Sie Bescheid.“
Ich brauche mir keine YouTube-Videos zu den Bilderbergern anzuschauen. Ich weiß, wer die Bilderberger sind. Das sind einflussreiche Menschen, die sich in den fünfziger Jahren erstmals in dem niederländischen Hotel de Bilderberg trafen und seitdem regelmäßig zusammenkommen, um sich über Probleme der Welt auszutauschen. Josef Ackermann von der Deutschen Bank gehörte genauso dazu wie die ehemaligen Außenminister Henry Kissinger oder Joschka Fischer, Mathias Döpfner vom Axel-Springer-Konzern genauso wie der damalige Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, oder die niederländische Königin Beatrix. Die Zusammenkünfte finden ohne formalen Auftrag irgendeiner Regierung dieser Erde statt. Es herrscht Geheimhaltung und es gibt keine Abschlusserklärung. Diese vollkommene Undurchsichtigkeit führt dazu, dass die Konferenzen im höchsten Maße geheimnisumwittert sind, dass sich Verschwörungstheorien noch und nöcher um sie ranken. Die einen sagen, dass die Bilderberger als Geheimzentrale der Weltregierung erbarmungslos die kapitalistische Weltdiktatur anstreben, die anderen, dass es sich um distinguierte Freizeitgestaltung handelt. Die einen behaupten, dass die Bilderberger den Irakkrieg von 2003 angezettelt hätten, die anderen meinen, dass von dem vornehmen Debattierklub nicht die geringste Wirkung ausgehe.
„Na klar“, sage ich zu dem jungen Mann. „Das Mittelalter, den Holocaust und die Mondlandung hat es nie gegeben, Elvis lebt, Paul ist tot und das ganze Gerede von der Erderwärmung ist sowieso vollkommener Quatsch.“ Mit dieser klitzekleinen Zuspitzung unserer Konversation will ich meinem Gesprächspartner die Gelegenheit zum Einlenken geben, dass das alles vielleicht nicht ganz so ernst gemeint war. Und was antwortet der?
„Wow, Sie sind ja gut informiert!“
Ich bin sprachlos. Das habe ich nicht erwartet. Ich hätte wohl besser Rückfragen stellen, sogenannte subversive Kritik üben sollen. Zu spät. Manche glauben an den lieben Gott, andere an Kommunismus oder Nationalismus und wieder andere an Verschwörungstheorien. Bei den Betbrüdern oder Politschwärmern weiß ich wenigstens, woran ich bin, bei Verschwörungstheoretikern nicht. Bei denen kann ich nicht einfach sagen: „Daran glaube ich nicht.“ Argumentieren nützt nach meiner Erfahrung im Taxi leider gar nichts. Also, was tun? Am besten den jungen Mann einfach zu seinem Fahrtziel bringen, kassieren, weiterfahren und den Kopf schütteln. Und so mache ich es dann auch. Bei ihm zu Hause angekommen, gibt er mir ein fürstliches Trinkgeld und haut beim Aussteigen noch raus: „Mann, dass Sie wussten, dass Paul McCartney in Wirklichkeit schon lange tot ist, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut! Das wissen nur die wenigsten!“ Er lächelt mich an und schlägt die Wagentür schwungvoll zu.
Ich fahre weiter und schüttle den Kopf. Und so ein Holocaustleugner geht nun auch wählen und entscheidet über die Zukunft eines Deutschlands, das er von finsteren Mächten umzingelt sieht. Gruselig. Nicht auszudenken, wo der wohl sein Kreuz macht.
Woher kommen all diese Hoffnungslosigkeit und Schwarzseherei, die Unken- und Kassandrarufe, diese Mies- und Angstmacherei? Warum haben die Deutschen das Gefühl, Paternoster zu fahren, wie es die Forschung formuliert: Es geht, von manch kleinerer oder größerer Krise einmal abgesehen, anhaltend wirtschaftlich aufwärts, aber die meisten treibt die Sorge um, wann es wieder abwärts geht. Die Deutschen sind ein Volk von Till Eulenspiegeln, der sich auf seinen Berg- und Talwanderungen freut, wenn es strapaziös bergan geht, weil er weiß, dass es danach leichten Fußes wieder talwärts geht, und umgekehrt ärgerlich ins Tal stapft, weil er danach wieder beschwerlich auf den Berg muss. In diesem Land der Freiheit und des Wohlstands glaubt nur eine Minderheit von weniger als einem Zehntel an eine gute Zukunft. In China, einem Land der Unfreiheit und eines Wohlstands, der sich noch lange nicht mit dem hiesigen messen kann, schaut mehr als die Hälfte voller Zuversicht in die Zukunft.