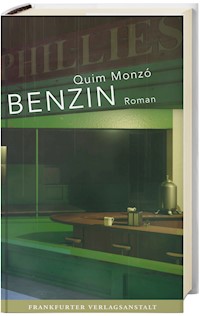
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Heribert am Morgen des 1. Januars neben seiner Geliebten Hildegarda erwacht, stellt er fest, dass nicht nur ein neues Jahr angebrochen ist, sondern sich seine ganze Welt verändert hat. Heribert ist ein erfolgreicher Maler – Problem ist nur: Die Kunst interessiert ihn nicht mehr. Auch die Frauen und alles, was ihm bisher wichtig war, sind ihm mit einem Mal gleichgültig. Er lässt sich durch New York treiben, gibt sich absurd-witzigen Gedankenspielen hin und entdeckt durch Zufall, dass seine Frau, die Galeristin Helena, ein Verhältnis hat. Nach einem Unfall liegt Heribert im Krankenhaus, und Helena ergreift ihre Chance, ihrem jungen Geliebten Humbert den Weg in die Kunstszene (und in ihr Leben) zu ebnen. Humbert schlüpft von einem Tag auf den anderen in die Rolle Heriberts, und die nächste erfolgreiche Künstlerkarriere kann beginnen. Benzin ist eine witzig-bissige Satire und scharfsichtige Parodie auf die Welt der Kunst, ein ironisch-unterhaltsamer Roman, in dem Quim Monzó Künstlerdasein, Erfolg, Scheitern, persönliche Krisen, Konkurrenz und das ganze Spielfeld menschlicher Beziehungen zu unserem Vergnügen literarisch auslotet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als Heribert am Morgen des 1. Januars neben seiner Geliebten Hildegarda erwacht, stellt er fest, dass nicht nur ein neues Jahr angebrochen ist, sondern sich seine ganze Welt verändert hat. Heribert ist ein erfolgreicher Maler – Problem ist nur: Die Kunst interessiert ihn nicht mehr. Auch die Frauen und alles, was ihm bisher wichtig war, sind ihm mit einem Mal gleichgültig. Er lässt sich durch New York treiben, gibt sich absurd-witzigen Gedankenspielen hin und entdeckt durch Zufall, dass seine Frau, die Galeristin Helena, ein Verhältnis hat. Nach einem Unfall liegt Heribert im Krankenhaus, und Helena ergreift ihre Chance, ihrem jungen Geliebten Humbert den Weg in die Kunstszene (und in ihr Leben) zu ebnen. Humbert schlüpft von einem Tag auf den anderen in die Rolle Heriberts, und die nächste erfolgreiche Künstlerkarriere kann beginnen.
Benzin ist eine witzig-bissige Satire und scharfsichtige Parodie auf die Welt der Kunst, ein ironisch-unterhaltsamer Roman, in dem Quim Monzó Künstlerdasein, Erfolg, Scheitern, persönliche Krisen, Konkurrenz und das ganze Spielfeld menschlicher Beziehungen zu unserem Vergnügen literarisch auslotet.
Inhalt
JANUAR
Zitat
Wieder dieses Gefühl …
In der Subway …
Da keiner von beiden Lust hat …
In der Subway findet er …
Heribert betrachtet die neue …
Durch das Fenster scheint …
Als er sie um halb sechs Uhr …
Er isst mit Herundina …
DEZEMBER
Zitat
Er träumt von einem Pool …
Er streift eine kurze Hose …
Er schaut auf seine Füße …
Er sucht den Namen delNonno …
Humbert fährt auf dem Highway …
Hildegarda wacht um viertel vor acht auf …
Für Mary Ann Newman
JANUAR
»Blas!«
»Ich kann nicht.«
»Dann lass uns gehen.«
Francesc Trabal, Nächstes Jahr
Wieder dieses Gefühl, gleichzeitig zu schlafen und zu wachen, doch wenn er darauf achtet, scheint es ihm, richtig zu schlafen. Zehntelsekunden später fällt ihm ein, Hildegarda könnte vielleicht schon wach und aufgestanden sein und sich (gelangweilt) angezogen haben, während er seine Zeit damit vergeudet, sich in Träumen zu fragen, ob er schläft oder wacht. Danach Windböen, Apfelsinen, Fahrräder, ein Clown aus Blech, ein Mann, der sich von einem Wolkenkratzer stürzt, ein Tunnel und eine Lokomotive, die eine Dampfwolke hinter sich herzieht, die sich langsam ausbreitet und dabei die Form einer Straßenecke, eines Cafés mit mehreren Personen annimmt: Der Traum reproduziert exakt Edward Hoppers Nighthawks, und es berührt ihn, dass er, obwohl er träumt, nicht nur den Ursprung der Traumbilder erkennen kann, sondern sich dessen auch bewusst ist und sich erinnert, dass er vor vielen Jahren (unmöglich zu schätzen, vor wie vielen), als er noch klein war, das Gemälde im Art Institute of Chicago gesehen hat. Er erkennt auch, dass das Bild deshalb in seiner Fantasie auftaucht, weil er es am Abend zuvor als Reproduktion im Schaufenster einer Bilderrahmenhandlung neben zwei weiteren Reproduktionen von Hopper gesehen hat; eine hat er noch vor Augen: ein Büro, in dem eine Sekretärin mit prallem Hintern (er glaubt, dass sie blau gekleidet war und eine Brille trug) in einem Karteischrank blättert und ein muffiger Büroangestellter am Schreibtisch sitzt.
Das Café befindet sich an einer dunklen, menschenleeren Straßenecke; mit einer großen Fensterfront, dem Schild PHILLIES und hinter dem Tresen einem alten, mageren Kellner mit weißem Käppchen. Zwei Männer mit breitkrempigen Hüten und eine Frau trinken an der Bar, doch bald füllt sich das Café mit weiteren Personen: Männer, die genauso aussehen (Gesicht, Hut und Anzug) wie der Mann oder die beiden Männer, die schon da sind und identischen Frauen (Gesicht, Frisur und Kleid) wie die Frau, die bereits am Tresen sitzt (aber mit Hüten, Pelzschals um den Hals und schimmernden Abendtäschchen). Draußen auf der Straße liegt eine dicke Schneeschicht, was normal ist, denn es ist Silvester, auch wenn auf dem Bild, das er als Kind gesehen hat (und logischerweise auch auf der Reproduktion von gestern), kein Schnee zu sehen ist.
Plötzlich verlassen die Leute die Bar und strömen lachend auf die Straßen. Zu Dutzenden, Hunderten laufen sie hinaus. Es sind Tausende, sie fliehen wie Insekten. Aber so viele auch weggehen, die Bar bleibt rappelvoll. Die Leute trinken Milchshakes mit Vanille-, Erdbeer-, Himbeer- oder Schokoladengeschmack; sie essen zerstoßenes Eis mit einem guten Schuss Heidelbeer-, Zitronen- oder Pfefferminzsirup. Es ist wie bei dem Kino-Gag (sie laufen im Kreis und kommen außerhalb des Blickwinkels der Kamera wieder durch die Tür herein), bei dem ein Haufen Leute aus einem winzigen Auto klettert, in das kaum vier Personen hineinpassen.
Außer dem Barkeeper sind von den vielen Leuten genau zwei Personen immer im Café: die Frau mit dem granatroten Kleid und dem rötlichen Haar und der Mann, der ein weißes Eis mit Schokoladenhäubchen verspeist und der er selbst ist (er kann kaum glauben, dass er sich nicht schon früher erkannt hat), er schaut konzentriert auf die Straße hinaus, durch die er (wie ein Blitz) ein Auto fahren sieht. Allmählich färbt sich der Himmel von Schwarz zu Dunkelblau, in einigen Fenstern leuchten die ersten Lichter auf; sie schwinden, als der Tag endgültig da, der Morgen unwiderruflich und die Bar nicht mehr die Lichtinsel ist, die sie in der Nacht war. Der Kellner deckt den Tresen ein, mit Tassen, kleinen Löffeln, Messern, Brot, Marmelade und Butter. Alsbald stürmt eine Gruppe ausgehungerter Büroangestellter ins Café, sucht drängelnd einen Platz, verschlingt Toasts und Croissants und schüttet Filterkaffee und Milch in sich hinein. Da er sich wieder auf das Innere der Bar konzentriert, liegt das Draußen im Dunkel. Als er versucht, die Straße wieder in den Fokus zu rücken (zu dieser vormittäglichen Stunde, wo alle Büroangestellten wieder verschwunden sind und im Lokal nur der Mann und die Frau sitzen oder die Frau und die beiden Männer, von denen einer er selbst ist), erscheint das Drumherum überbelichtet: Alles wird weiß, blendend hell und verwandelt sich in einen Strand. Ach, was für ein Genuss dieses Café von Hopper mitten auf dem Strand zu sehen, Plastikstühle stehen herum, trostlose Markisen überall und im Hintergrund eine Kulisse mit erstarrten Wellen und ein paar surfenden Jugendlichen. Endlich träumt er frei; er nimmt sich vor, der Fantasie freien Lauf zu lassen und nichts mehr zu kontrollieren. Die Frau mit dem granatroten Kleid trägt genau wie der Kellner eine Sonnenbrille. Der andere Mann ist mal da, mal nicht, taucht auf und verschwindet wieder. Als er den Hut abnimmt (und sich damit der Schatten, der sein Gesicht verbirgt, verflüchtigt), erkennt Heribert sich nun voll und ganz, vor Angst schwitzend, in einem winterlichen Wollanzug, der Feuer fängt.
Der Traum langweilt ihn schon eine geraume Weile. Heribert versucht, ihn zu stoppen, aber ohne Erfolg. Jetzt sieht man beide in Badekleidung: Er in einer schwarzen, glänzenden Badehose und sie in einem dieser superengen Badeanzüge mit zwei Trägern, ohne Rückenteil, die sich vorne vom Höschen aus nach oben verlängern, die Brüste bedecken und um den Hals gebunden werden. Sie kullern eine Treppe hinunter, und er bleibt an einer weichen Glastür hängen. Den Bruchteil einer Sekunde lang fragt sich Heribert (gerade dabei, ins Wasser zu steigen), ob es Helena ist. Im Moment schwimmen sie, jeder auf seiner Seite, gegen die sich um sie aufbäumenden Riesenwellen an. Sie schwimmen wortlos, und als Heribert untertaucht, wünscht er sich, nie wieder aufzutauchen. Wie Stunden kommt ihm die Zeit unter Wasser vor. Als sein Kopf wieder über Wasser ist, läuft sie bereits über den Strand und schlendert langsam zum Café. Er eilt ihr hinterher. Im Sand zertritt er einen kleinen, schwarzen Käfer. Hildegardas Stimme (war es also Hildegarda und nicht Helena?) tönt, er solle sich doch beeilen, er solle schneller gehen, sie müsse weg. Nun rennt er und versucht dabei, keinen der Tausenden Käfer zu zertreten, die aus dem Sand hervorkrabbeln. Er hebt den Blick, sucht das Café, aber es ist nirgends: Der Strand ist eine Scheibe, grenzenlos und verlassen bis zum Horizont, vor dem zwei Personen rennen: die Frau und der andere Mann, der nun doch da ist und scheinbar die Gelegenheit genutzt hat, um mit ihr wegzulaufen (was beweist, dass dieses ganze Fort- und Da-Spielchen nur ein Trick war, um unbemerkt mit der Frau zu fliehen). Er denkt: Wenn ich mich an das Gesicht des Mannes erinnern könnte …; wenn ich sein Gesicht gesehen hätte …; wenn ich jetzt einen anderen Traum träumen könnte … Er hat wieder die Vorahnung, dass er nie wieder träumen wird, und flüchtet durch Passagen zwischen Gebäuden, durch stille Kellergeschosse, unter Wasser schwimmend, das gegen Hallen peitscht, erreicht einen Hafen, einen nächtlichen Platz in einer Stadt, ein Café in der alten Straße, mit der Frau im granatroten Kleid und einem dunkelgekleideten Mann mit Hut, dessen Schatten sein Gesicht verbirgt, und während er sich fragt, ob nun die Gestalt eines zweiten Mannes sichtbar wird oder nicht, der Schrei, der Schlag auf das Kinn, der sich öffnende Boden, er lacht, der Fall.
Er wird von einem lauten Knall geweckt. Zuerst denkt er, die Sektflasche sei vielleicht auf den Boden gefallen und zerbrochen, aber dann bewegt er seinen Fuß und findet sie dort, wo er sie seiner Erinnerung nach hingestellt hat, bevor er die Augen zugemacht hat: neben dem Bett. Dann vermutet er einen Schlag der Jalousie gegen das Fenster. Er öffnet die Augen und dreht sich um. Vielleicht war es auch eine Katze auf dem Dach oder der Wind hat einen der Korbstühle auf der Terrasse umgeweht oder die Glaskugel ist gegen das Geländer geschlagen. Er setzt sich auf, legt seine Hand an den Kopf. Er tut weh. Er denkt wieder an die Jalousie: Sie muss gegen das Fenster geknallt sein, stärker als die anderen Male. Vielleicht ist auch ein Einbrecher mit Maske und gestreiftem T-Shirt durch das Esszimmerfenster eingestiegen? Oder ein Killer (mit einem langgestreckten, schwarzglänzenden Auto mit laufendem Motor vor der Tür) hat die Tür aufgebrochen und tastet sich nun langsam die Treppe hoch bis zu seinem Zimmer, in das er eindringen und ihn töten wird? Oder vielleicht ist es Helena selbst (Helena braucht keinen Mörder zu dingen), die plötzlich Lust hat …?
Er gähnt. Gähnen macht schläfrig. Er schließt die Augen fester und versucht, wieder einzuschlafen.
Es klappt nicht. Er hebt den Kopf. Mit einem Finger streicht er über Hildegardas Schulter. Küsst sie aufs Ohr. Im Halbdunkel betrachtet er ihren Rücken, ihren Po. Er presst seine Augenlider zusammen. Er möchte den Traum noch mal zu fassen bekommen, aber der verflüchtigt sich; je mehr er sich anstrengt, desto mehr entschwindet er. Er erinnert sich nur an den Strand. Im Sommer würde er aufstehen, in den Ozean rennen und baden. Es gibt Leute, die im Winter an einem bestimmten Tag im Ozean baden gehen. In Barcelona schwimmen sie durch den Hafen. An Silvester? Oder zu Dreikönig? Oder an Weihnachten? Er erinnert sich an den Strand voller Punkte, wie roter Kaviar. Plötzlich erkennt er den Tresen wieder, den Kellner, die Frau.
Er hat das Gemälde zum ersten Mal mit dreizehn Jahren gesehen, von seinem Vater in gutgebügelten Hosen von einem Museumssaal zum nächsten gezerrt (bis zu dem Moment, da er das Bild entdeckte, und dann war es schwierig, ihn von dort wieder wegzuziehen). Nighthawks hat ihn sofort fasziniert. Als ein Kritiker viele Jahre später (beiläufig in einem Artikel) schrieb, Hopper sei ein Vorläufer der Hyperrealisten, las Heribert das mit Erstaunen. Es war eine Abwertung, eine Ungerechtigkeit, ihn als Vorläufer der Hyperrealisten zu bezeichnen (ihn also in eine Schublade zu stecken, ihn einzugrenzen, ihn in Formaldehyd zu legen), wo doch in egal welchem Hopper viel mehr (ein Gespinst von Erinnerungen und Sehnsüchten) steckt als in dieser ganzen vergänglichen Lawine von Gemälden mit Ketchup, Pommes frites und glänzenden Automobilen.
Er weiß, warum er davon geträumt hat. Weil er es am Abend zuvor, als er es im Schaufenster hängen sah, kalt betrachtet und dabei gedacht hat, dass es eigentlich gar nicht so außergewöhnlich sei, und sähe er es heute zum ersten Mal, es vielleicht gar nicht so besonders fände. Er gähnt erneut; er beschließt, die Augen zu schließen, aber er hat sie schon geschlossen.
Es ist nichts zu machen. Er presst die Augen noch fester zusammen und stellt sich die Frau vor, die er in der Nacht auf der Party gesehen hat (mit einem Zauberhut voller Pappsterne und einem silbernen Mond), die die Trauben in ihren Händen verschlungen und sich dabei verschluckt hat. Nun hat er wieder das Bild vor sich. Er stellt sich neben sie und lächelt ihr zu. Sie erwidert das Lächeln. Sie trinken hastig die Gläser aus (Hildegarda tanzt allein in einer Ecke) und Hand in Hand treten sie auf die Straße. Auf einer Treppe hinter ein paar Sträuchern streichelt er ihre Schenkel, sie streichelt seine Brust.
Das Fantasieren langweilt ihn, aber er bleibt dabei: die Frau nackt; nein, nicht nackt; mit Rock, ohne Slip. Oder nein: mit schwarzem Slip und ohne BH; nein: mit weißem Slip … Er hat Lust einzuschlafen, fühlt sich aber nicht müde.
Er schaut auf die Uhr: Es ist vier. Vor wenig mehr als einer Stunde ist er ins Bett gegangen und hat sich geschworen, das nächste Mal an Silvester um neun Uhr abends schlafen zu gehen. Seine Zunge unternimmt einen Spaziergang auf Hildegardas Rücken und Taille, was sie im Schlaf erschauern lässt.
Er schaltet sein Nachttischlämpchen ein und greift nach einem Buch. A Coleira do Cão. Er beginnt zu lesen.
So achtzig Seiten. Dann lässt er es: Nicht, weil es langweilig wäre, aber er hat keine Lust mehr. Er steht auf, zieht die Hose an, hebt die Jalousie ein bisschen, drückt auf den Schalter des Außenlichts, schaut auf die verschneite Terrasse und auf den Strand ein Stück weiter, schwarz wie der Himmel. Er öffnet die Balkontür: Ein eisiger Wind dringt herein und das Rauschen der Wellen. Sofort drückt er sie wieder zu.
In der Küche macht er sich einen Kaffee und gießt einen Schuss Milch dazu. Er zieht die Jalousie hoch. Wenn jetzt ein Vampir am Fenster erscheinen und ihn mit seinen beißbereiten Eckzähnen anglotzen würde, fände er das die vorhersehbarste Sache der Welt.
Er zieht die Jalousien im Wohnzimmer, im Esszimmer, in allen Zimmern hoch. Mit der Tasse Milchkaffee in der Hand setzt er sich auf den Läufer neben das Bett, in dem Hildegarda noch schläft. Er lässt seinen Blick durch das Zimmer schweifen und hält am Fenster inne. In der Fensterscheibe spiegelt sich ein runder Fleck: das Nachttischlämpchen. Er betrachtet den Fensterrahmen, die Fensterläden, die Holzleisten zwischen der einen und der anderen Scheibe … Wie mögen die Streben in einem Fenster heißen? Es gibt sicher ein spezielles Wort dafür. Es gibt eigene Wörter für jedes Ding. Er schaut die Fensterbank an und denkt: Das heißt Fensterbank. Wie heißen aber die seitlichen Bänke? Und das Gegenstück zur Bank, die obere Bank? Und die Kante der Fensterbank, hat sie einen Namen? Heißt sie anders, wenn sie abgerundet oder eckig ist? Er geht hinunter ins Wohnzimmer, sucht im Bücherregal und greift nach einem Lexikon; wieder oben setzt er sich erneut neben das Bett. Er schlägt das Lexikon irgendwo auf und liest: PENSION f. Haus, in dem mehrere Personen zu einem angemessenen Preis übernachten und essen können. Ich bin in einer Pension in der Carrer del Carme. Ich wohne in einer Pension. Dreihundert Peseten Pension zahlen. Er klappt es zu. Und schlägt es irgendwo anders auf: GEORGICA n, pl. altgriechisch Gedichte vom Landbau sind ein Lehrgedicht in vier Büchern von Publius Vergilius Maro (Vergil).
So liest er weiter. Nach ein paar Stunden klappt er es endgültig zu, lässt es auf dem Boden liegen und beobachtet, wie am Horizont ganz langsam die Sonne aufgeht und diese erste Morgendämmerung des Jahres alle Dinge in Licht taucht: das Wasser, den Sand am Strand, die aufgerollten Markisen, die Terrassenstühle, das Fensterkreuz, die Fensterbank, den Zimmerfußboden, die Möbel, seine Füße, die er ziemlich lange anschaut, so als wären sie zwei Monster. Dann hört er, dass Hildegarda aufwacht und sich aufsetzt. Er spürt ihren Blick im Nacken. Er dreht sich nicht um, bis sie mit ihrem Fingernagel über seine Wirbelsäule streicht.
Danach übermannt ihn der Schlaf. Als er wieder die Augen aufschlägt, steht die Sonne (eine fahle, blasse Sonne) schon weit oben und Hildegarda sitzt im Sessel und lackiert sich in einem blauen Bademantel (einem blaueren Himmelblau als der heutige, ganz graue Himmel) die Fußnägel; jeden Nagel in einer anderen Farbe: einen rosa, einen blau, einen grün, einen gold, einen schwarz, einen lila, einen weiß, einen silbern, einen gelb und einen grau.
Hildegarda rekonstruiert die (ungefähr) zwei Wochen, seitdem sie zusammen sind, und wägt die Pros und Kontras ihrer Beziehung ab. Heribert denkt, dass die Begriffe, die sie benutzt (Zusammensein, unsere Beziehung), nichts als Beschönigungen seien. Aber was genau redet sie schön? Was bedeutet Zusammensein? Die zwei Wochen, die sie sich nun berühren? Aber berühren kommt ihm auch wie eine Beschönigung vor. Die zwei Wochen, die wir uns küssen und uns die Genitalien streicheln? Er findet diesen Ausdruck, weil kalt, ziemlich treffend. Dann hört er eine Weile lang zu, was Hildegarda ihm erzählt: Für ihn hört sich das alles beschönigend an.
»Du weißt nicht, wie schwierig es war«, sagt sie, »Tiziana glauben zu machen, dass ich nicht hierherkomme. Sie wollte unbedingt mitkommen. Du gehst jedes Jahr hin und nimmst mich nie mit. Ich würde ihr zwar immer versichern, dass ich nicht hingehe, wäre aber dann doch jedes Mal hier. Deshalb habe ich Angst, dass sie plötzlich mit einem Blumenstrauß und einer Schachtel Pralinen vor der Tür steht. Jedes Jahr wird sie melancholischer und sucht jemanden, der ihre Tristesse teilt, aber offen gestanden, ich habe keine Lust mehr darauf. Außerdem finde ich, wenn Marino weg ist, muss nicht unbedingt ich ihre Sehnsucht nach ihm ertragen. Sie kann ihn ja anrufen. So viel Abhängigkeit halte ich nicht aus. Außerdem fände ich es überhaupt nicht toll, wenn sie wüsste, dass du und ich … Stell dir vor! Dir hat Tiziana überhaupt nicht zugesagt, oder? Aber die Party war klasse. Findest du nicht? Marino fand Tiziana am Anfang auch nicht gerade toll. Und nun siehst du … Jeder kann sich ändern. Sogar er. Er ist ein seltsamer Typ. Nicht, weil er sich ändert. Er ist aus vielen Gründen seltsam, wegen seiner Anfälle, die er manchmal bekommt. Ihr Künstler seid alle seltsam, egal, aus welcher Sparte, oder zumindest tut ihr ein bisschen so. Und die Nicht-Künstler auch. Früher habe ich mich sehr gut mit ihm verstanden. Jetzt ist es, als interessiere er sich nicht für mich. Ich habe Stunden genommen. (Habe ich dir das erzählt?) Ich habe Gesang studiert, denn ich wollte Opernarien singen. Hast du schon mal Arien oder so etwas gesungen? Oder Theater gespielt? Ich fühle mich so gut, wenn ich oben auf der Bühne stehe … Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe in einem Chor gesungen und weiß, was es heißt, allein vor dem Abgrund zu stehen, das Publikum der Abgrund. (Das Publikum der Abgrund, klingt gut, nicht wahr?) Allein stand ich natürlich nie auf der Bühne, aber ich weiß, was ich sage. Du fühlst dich allein, inmitten der anderen. Tiziana hat im selben Chor gesungen. Wir kennen uns von der Musikschule. Marino habe ich im letzten Studienjahr kennengelernt, bevor ich im Chor gesungen habe. Er hat mir geholfen, in den Chor zu kommen, denn er mochte mich echt gerne. Jetzt nicht mehr. Er ist ein so guter Sänger und ist so mit Arbeit eingedeckt, dass er keine Minute für mich übrighat. Ich weiß nicht, ob ich zuerst ihn und dann die Oper nicht mehr mochte, oder erst die Oper und dann ihn. Ich habe begriffen, dass die Oper nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, mitnichten das, von dem ich geträumt habe. Hat sie mich vielleicht enttäuscht, weil ich einen Opernsänger geheiratet habe? (Vielleicht sollte ich nicht Opernsänger sagen, sondern den besten Opernsänger, aber ich will nicht spitzfindig sein. Obwohl, wenn ich mich nicht selbst lobe, ist es das ja eigentlich nicht, oder?) Es kam dann eine Zeit, in der ich gerne geschrieben habe. (Das habe ich dir aber sicher schon erzählt, oder?) Als Jugendliche … Neulich habe ich ein Stück gehört, was ich total toll fand. Nein, nein. Jazz. Jazz gefällt mir langsam. Das Stück hieß Blue Rondo à la Turk vom Dave Brubeck Quartet. Kennst du es? Da ich von Jazz noch nicht so viel verstehe, dachte ich, es sei nicht so bekannt. Hast du es? Von Take Five? Was ist Take Five? Ah. Leihst du mir die Platte? Oh, du machst mich so glücklich! Leih sie mir. Vergiss es nicht. Vielleicht … Eines Tages … Nein, nichts. Nichts, nichts … Eines Tages … vielleicht … würde ich es gerne mit Jazz probieren. Allerdings weiß ich nicht, welches Instrument mich interessiert. Nein, natürlich nicht. Die Malerei beansprucht mich im Moment völlig, seit ich Marino geheiratet und mit der Oper aufgehört habe. Ich finde, ich sollte versuchen, meine Bilder auszustellen. Der Dialog mit dem Publikum ist elementar wichtig, nicht wahr? Wie kann sich ein Werk entwickeln, wenn kein Austausch mit der Öffentlichkeit stattfindet, für die man es letztendlich macht. Nein, ich will dir damit nichts andeuten, aber nun kennen wir uns schon ein paar Tage. Nein, ich will dir die Bilder nicht zeigen. Das trau ich mich nicht. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt mit der Malerei weitermachen will. Aber ich sage das schon seit ein paar Jahren und mach munter weiter. Nein, nein, ich trau mich nicht, du bist ja der Profi. Komm, gib mir einen Kuss. Mmh. Ok. Wenn du mir versprichst, dich nicht lustig zu machen, zeige ich dir meine Bilder. Ja, ehrlich. Wir werden schon einen Weg finden. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Wenn du sie nicht gut findest, darfst du mir nicht sagen, dass du sie gut findest. Ich will keinen Honig um den Mund. Das würde ich nicht ertragen! Hast du’s eilig? Ich fahr dich in die Stadt. Ich muss auch nach Hause; ich muss noch so viel erledigen … Aber ich hatte eine schöne Zeit, diese ganzen Tage mit dir zusammen. Es war schön, das neue Jahr mit dir zu beginnen. Hältst du das für ein gutes Omen? Für dich oder für mich? Du sagst nichts? Umarm mich ganz fest. Wir sehen uns bald wieder, nicht? Ich lass dich an einer Subway-Station raus, einverstanden?«
In der Subway zwischen einer klapperdürren Frau und einem schlafenden Mann, dessen Kopf auf seine Brust gesunken ist, denkt Heribert, dass er gewöhnlich um diese Uhrzeit bereits seit drei Stunden im Atelier am Arbeiten ist. Dann findet er es seltsam, dass er »gewöhnlich« gedacht hat, denn in der letzten Zeit ist er immer weniger dort und findet immer leichter Ausreden, um gleichfalls »gewöhnlich« nicht dort zu sein.
Vor ihm bewegt sich ein Mann in Synkopen: Er klopft mit den Füßen auf den Boden, als würde er dem Rhythmus einer Melodie folgen, aber er trägt weder Kopfhörer noch ist ein Radio zu sehen. An der nächsten Station steigt dieser Mann aus, ebenso der Mann, der mit dem Kopf auf der Brust geschlafen hat, und auch Heribert. Der Mann mit den Synkopen bleibt auf dem Bahnsteig und wartet auf den Eilzug. Heribert geht nach draußen.
Er betritt eine Buchhandlung und während er die Drehkreuze passiert, merkt er, dass es ihm zu keinem Zeitpunkt bewusst war, dass ihn seine Schritte hierherführen würden. Die Buchhandlung zu betreten, bedeutet immer die Gefahr eines sich verflüchtigenden Nachmittags, denn es könnte sein (und eigentlich ist es immer so), dass er erst viele Stunden später wieder herauskommt. Die Buchhandlung zieht ihn magisch an. Sie ist aufgeteilt in zwei Läden, einer auf jeder Straßenseite, und in beiden steht eine riesige, beeindruckende Pflanze. Buchhandlungen und Bibliotheken haben ihn immer mehr fasziniert als die eigentlichen Bücher. Er liebt die Wände mit den aneinandergereihten Buchrücken. Er liebt es, über den Umschlag einer Enzyklopädie oder eines Wörterbuchs zu streichen, irgendeinen Band aufzuschlagen und sich die Zeichnungen anzuschauen, glänzend gestrichenes Papier zu berühren, daran zu riechen, die Buchstaben ganz aus der Nähe zu betrachten, ihre unregelmäßigen Ränder, einzelne Härchen. Seit seiner Entscheidung vor zwei Monaten, zu keiner Ausstellung mehr zu gehen (er findet sie allesamt mittelmäßig …), betrachtet er alles wie eine Kunstausstellung und entdeckt in jedem Gegenstand etwas Unerwartetes.
Im Erdgeschoss stehen die Kinderbücher. Kinderbücher nerven ihn. Es nervt ihn, dass sie für Kinder sind. Er hat noch nie verstanden, aus welchem unerfindlichen Grund einer entscheidet, wo die Trennungslinie zwischen Büchern für Kinder und Büchern für Erwachsene verläuft, was erotische Literatur und was Pornoliteratur ist, die ganz hinten in der Ecke steht, und was Liebesromane sind, die noch weiter hinten aufgestellt sind. Und es nervt ihn auch, dass eine ganze Regalwand mit Poesie überschrieben ist. Was heißt Poesie? Was heißt Liebesroman?
Sobald er den Fuß auf die Rolltreppe gesetzt hat, dreht er sich um, so fährt er mit dem Rücken zuerst nach oben und beobachtet, wie sich das Erdgeschoss langsam entfernt: die Eingangstür, die Drehkreuze, die Kassen, die beiden riesigen Tische mit den Sonderangeboten. Als er merkt, dass er Sonderangebot gedacht hat, dreht sich ihm der Magen um. Ist Sonderangebot ein nicht genauso gewagter Begriff wie Liebesroman, Poesie oder Krimi als Bezeichnung für Bücher? Und doch hat er den Begriff Sonderangebot vernünftig gefunden, zumindest bis jetzt? Er kommt sich vor wie ein Kind bei dem Spiel, bereits entdeckte Dinge entdecken. Aber als er sich wieder umdreht, um die Rolltreppe zu verlassen und den Fuß auf festen Boden zu setzen, wird ihm klar (wie bei einer Erleuchtung: ohne die Gründe zu kennen), das Kindliche daran ist die Weigerung zu akzeptieren, dass die Klassifizierung der Dinge ihr Gutes hat; auch wenn die Etikettierung unvollkommen ist, so ist sie doch die einzige Möglichkeit, die Dinge abzugrenzen, sie zu verstehen, zu kontrollieren, zu begreifen. (Und diesen Gedanken als kindlich klassifiziert zu haben, ist auch eine Kinderei; er kann dem nicht entgehen). Als er oben seinen Blick über die Schilder der Abteilungen schweifen lässt (Kochen, Do it yourself, Taschenbücher, Schulbücher, Krimis, Literatur, Kunst, Belletristik, Neuerscheinungen, Bestseller …), spürt er, dass die Tatsache, dass sie sortiert sind, wirklich das Logischste auf der Welt ist. Was wäre das sonst für ein Durcheinander! Sogar das Schild Poesie erscheint ihm nun kohärent und logisch. Jeder weiß, was er unter dieser Kategorie findet, und das ist genau das, was ihr nicht nur einen Wert beimisst, sondern sie unerlässlich macht. Er versteht sogar, warum die Bücher in den mit Krimis beschrifteten Regalen zwangsläufig in einer gewissen Entfernung von den Bestseller-Regalen stehen müssen. Und wenn ein Krimi gleichzeitig ein Bestseller ist, sucht man ihn unter Bestseller, denn das ist die (zusätzliche und damit offensichtlichere) Eigenschaft, die ihn über die wesenhafte Eigenschaft Krimi hinaus unterscheidet. Immer, immer die Oberfläche der Dinge: das, was man betasten und sehen kann, ohne es aufschneiden und zerstören zu müssen, um ihr Inneres zu erforschen. Wie kommt es, dass er bisher die Vollkommenheit dieser Klassifikationen nicht begriffen hat? Es ist offensichtlich, dass die Bücher der Abteilung Belletristik dort stehen müssen und nicht bei der Literatur. Dass er diese Klassifizierungen als willkürlich empfunden hat, kommt ihm wie eine Ewigkeit vor, was aber schlichtweg falsch ist, denn beim Betreten der Rolltreppe vor wenigen Minuten hat er noch genau in dieser absurden Weise gedacht. (Aber er hat auch Recht: Seit drei Wochen, vielleicht einem Monat, ist er sich der Dinge nicht mehr so sicher wie vorher: Es ist so, als hätte er sich unwahrnehmbar verändert und als wäre er jetzt nicht mehr er selbst; vielleicht war also das, was er beim Betreten der Rolltreppe gedacht hat, nur ein Gedanke seiner früheren Sicherheit, und auf der Rolltreppe hat er kaum merklich gespürt, dass dieser Gedanke nicht mehr zu seinen jetzigen Gefühlen passt.) Einmal hat er – in jenem Früher, das, ohne dass er weiß warum, sich unwiederbringlich weiter und weiter entfernt – versucht, den Haken zu finden und die in den Regalen verborgenen Widersprüche aufzudecken: Steinbeck steht bei der Belletristik und Hardy bei der Literatur. Damals fand er die Einteilung willkürlich und schloss daraus auf die Ansicht, die Literatur sterbe im 19. Jahrhundert aus und danach sei alles Belletristik. Aber er hatte auch Brüche in diesem Denkgebäude entdeckt: Kafka stand bei der Literatur. Was machte er da? Vielleicht ergänzten ja die Schriftsteller des 20. Jahrhunderts mit, sagen wir, einem gewissen tragischen Leben, den Bereich Literatur. Jetzt ist ihm hingegen alles klar: Selbstverständlich gehören Hardy und Kafka zur Literatur und Steinbeck zur Belletristik. Man muss sich nicht gegen die Dinge stellen. Im Gegenteil, damit die Dinge uns nützlich sind, muss man sich nicht gegen sie stellen, sondern sie nehmen, wie sie kommen. Er spürt einen Schauer im Nacken und schlägt den Mantelkragen hoch. Doch dann merkt er, wie warm ihm eigentlich ist. In der Buchhandlung wird so stark geheizt, dass er schwitzt. Er zieht seinen Mantel aus.
Er blättert in ein paar Kunstbüchern: einem von Tamara de Lempicka, einem von Hopper (was ihm Fetzen aus dem Traum in Erinnerung ruft), einem von Matisse (mit roten Blumen und veilchenlila Flecken, die sich zu bewegen scheinen) und einem von Magritte. Ob darin auch Käfer sind? Er schaut sich die Beine der Büchertische an in der Hoffnung, Holzwürmer zu entdecken. Es gibt keine. Er wendet sich wieder dem Buch zu, blättert eine Seite um, sieht die Zeichnung einer Pfeife mit der Bildunterschrift: Ceci n’est pas une pipe. Unbedingt, denkt er und fühlt sich ein klein wenig glücklich.





























