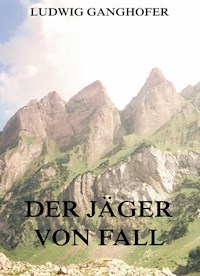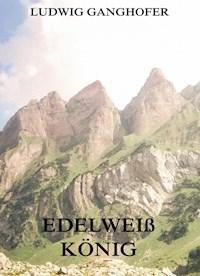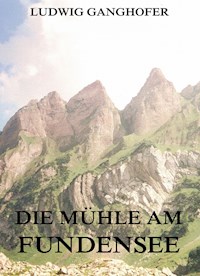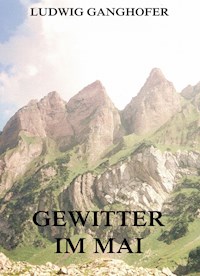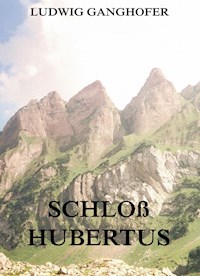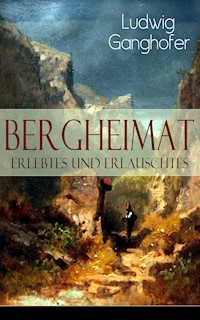
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Bergheimat: Erlebtes und Erlauschtes" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ludwig Ganghofer (1855-1920) war ein deutscher Schriftsteller, der durch seine Heimatromane bekannt geworden ist. Viele Werke Ganghofers greifen Geschehnisse aus der Geschichte des Berchtesgadener Landes auf, wo er sich regelmäßig aufhielt. Ganghofer ist einer der meistverfilmten deutschen Autoren. Zahlreiche Heimatfilme der 1950er Jahre - im Zuge des Kinowunders - sind Verfilmungen seiner Romane. Inhalt: Der Schuß in der Nacht Die Seeleitnersleut Pirsch auf den Feisthirsch Der rote Komiker Stutzi, der Pechvogel Künstlerfahrt an den Königssee Wenn sich die Blätter färben Adlerjagd Die Hauserin Herzmannski, der Getreue Der Graben-Teufel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bergheimat: Erlebtes und Erlauschtes
Inhaltsverzeichnis
Der Schuß in der Nacht
Kaum einen Büchsenschuß vom Waldsaum stand das Haus meiner Eltern – das Forsthaus. Oh, ihr allzu nahen Bäume! Wie manche Portion wohlgesalzener Hiebe habt ihr mir eingetragen! Wenn ich da, ein achtjähriges Bürschlein, nach Hause kehrte, in zerkratzten Händen das ausgenommene ›Eichkatzl‹, die junge Nebelkrähe oder den flatternden, kaum flüggen Kuckuck schwingend, so galt der erste Blick meiner guten Mutter durchaus nicht dem erbeuteten Getier; forschend überflog vielmehr ihr Auge die Ellbogen meines Jöppchens und die Knie- und Sitzgegend meiner Unaussprechlichen. Weh mir, wenn da zutage kam, daß die allzu spitzen Aststümpchen oder die Pechnarben der erkletterten Tanne dem teueren Buckskin ein Leids getan. Heute noch seh ich sie vor mir, die gefürchtete, langriemige Peitsche mit dem Rehfußgriff, die zu unbenutzten Zeiten im Hausflur zwischen Gewehren und Rucksäcken am Zapfenbrett hing. Wurde sie dann, was glücklicherweise nicht allzu häufig geschah, durch die Hand ihres gestrengen Herrn vom Haken gelöst, so verkrochen wir uns in alle Winkel, ich, Hektor, der hochstämmige Schweißhund, und Bursch, der krummbeinige Teckel.
Jenen allzunahen Bäumen bin ich aber deshalb doch niemals gram geworden. Und heut noch gedenk ich ihrer in dankbarer Liebe. Strömte doch das geheimnisvolle Leben, das zwischen ihren weitgespannten Ästen und in ihrem moosigen Schatten webte und wirkte, jene unendliche Fülle grüner Poesie über die Zeit meiner frühesten Jugend aus! Wenn der Lenzwind leise durch die Wipfel plauderte und mit zischelndem Rauschen vom Waldsaum niederstrich über die rohrdurchwachsenen Teiche, wenn hoch in sonnigen Lüften der Weih seine stillen Kreise spannte, wenn aus den abenddunklen Buchen und Eichen das Gurren und Liebeslocken der Wildtauben klang, wenn im tauigen Wiesengrunde das schlanke braune Reh im Dämmerlicht zur Asung zog und der graue Reiher mit ruhigem Flügelzuge zu Horste strich – wenn dann erst die Nacht herniedersank über die weite Flur, wenn ich pochenden Herzens am offenen Fenster saß, dem eintönigen Lied der Unken lauschte und dem schauerlichen Huhn des ›Holimanns‹, der draußen im schwarzen Wald seine Kinder, die Käuzlein, zum Nachtgejaide rief, da trieb meine jugendliche Phantasie ihre Blüten, so seltsam und zahlreich, wie der Waldgrund seine Pilze treibt nach einer lauen Regennacht.
Und welch ein lautes, lustiges Jägerleben umgab mich im eigenen Hause! Da war der kiesige Hof mit den munteren, schmucken Hunden, da war der Wiesengarten mit dem Scheibenstand, an dem die Büchsen eingeschossen wurden, da war die Zwirchkammer, darin die erlegten Böcke, Füchse und Hasen an den schweißfleckigen Eisenhaken hingen, da sah man in allen Gängen und Gemächern Jagdgeräte und Jagdtrophäen – und wenn der Abend kam, dann saßen im traulichen Wohnzimmer rings um den Eichentisch die Jäger, hinter dem Bierkrug ihre Pfeifen schmauchend, und da gab es Jagdgeschichten, deutsch und lateinisch.
Was Wunder, daß in solcher Umgebung die Liebe zum waldfrohen Weidwerk in meinem Herzen bald eine dauernde Wohnstätte fand! Schon als kleiner Junge schlich ich mich, die hölzerne Armbrust – vulgo Balester – auf dem Rücken, hinaus in den Wald und schnellte meinen Lindenbolz nach dem kreischenden Häher in das Buchenlaub. Und welch ein Vergnügen, da ich das erstemal als Treiber zum Fuchsriegeln mitgenommen wurde oder auf den Anstand und zur Hühnerjagd! Mit welcher Inbrunst drückte ich das kleine Zimmergewehr an die Wange, mit dem ich überrascht wurde, als ich nach dem ersten Lateinschuljahr auf Ferien kam! Und als ich gar acht Jahre später mit dem roten Käpplein und einer guten Note heimzog, wurde ich vor Freude halb verrückt, als ich auf dem Tisch meines Ferienstübchens eine vollständige Jagdausrüstung, eine zierliche Büchsflinte und eine wahrhaftige Jagdkarte vorfand.
Nun ging's aber an ein ›Jagern‹!
Tag und Nacht gönnte ich mir keine Ruh. Und als ich nur erst einen Rehbock mit der Kugel geschossen hatte, legte ich mich ›unter uns Jägern‹ breit in den Tisch und lateinerte mit den graubärtigen Hubertusjüngern um die Wette. Meine Phantasie hatte damals, um mich eines beliebten Ausdrucks zu bedienen, alle Hände voll zu tun, damit es meinem Jägerlatein nur niemals an Stoff gebrach. Aber dann ist mir ein ganz seltsames Abenteuer wirklich und wahrhaftig widerfahren – ja, ja, ein recht seltsames Abenteuer!
Ein starkes Gewitter hatte mir die Frühpirsch verregnet. Als es aber neun Uhr vormittags wurde, ließ das Unwetter nach, die Sonne brach sich Bahn durch die treibenden Wolken, und in ihrer milden Wärme kräuselten sich blau und luftig die Wasserdünste aus den dunklen Wäldern. Da hatt' ich jetzt ein Pirschwetter, wie es ein Weidmann sich nur wünschen mag.
Rasch nahm ich einen Imbiß zu mir, der mich das Mittagessen verschmerzen lassen konnte. Dann ging's hinaus unter die regennassen Bäume, von denen der leichte Wind die schillernden Tropfen auf mich niederstäubte.
Lautlos gleitet zu solcher Zeit der Fuß des Jägers über den feuchten Waldgrund; da raschelt kein Laub, und unhörbar schmiegt sich das nasse Reisig unter dem Tritt ins weiche Moos.
Und welch ein reiches Leben umgibt zu solcher Stunde den unter triefenden Ästen spähend von Stamm zu Stamm sich schleichenden Jäger! Tausende von Käfern und flinkfüßigen Würmchen kribbeln und huschen zwischen den glitzernden Moosfasern und tropfenschweren Farnblättern hin und her; in gesteigertem Eifer reisen die fleißigen Ameisen durch die Rindenklunsen aller Bäume vom Grunde zu den Wipfeln und wieder niederwärts zur Erde; die Vögel, die sich während des Regens stumm und ängstlich unter die dichtesten Zweige duckten, recken und spreizen pispernd die nassen Flügel und schwingen sich zwitschernd von einem sonnigen Plätzchen zum anderen; unter Kreischen und Krächzen beginnen die Häher, diese Gassenbuben des Waldes, von neuem ihr lärmendes Flatterspiel. Da bockelt auch schon ein junges Häslein mit sorglosem Gleichmut, als gäb es weder Hund noch Jäger, über die vielverschlungenen Wurzeln dem Felde zu, manchmal sich verhaltend, um von dem winzigen Moosklee zu naschen; und die Rehe, die nun in dem nassen Buschwerk ein gar unbehagliches Weilen haben, recken windend die zierlich schönen Köpfe aus den Stauden und ziehen äsend nach den grasigen Waldwegen und Lichtungen, um sich in der Sonne zu trocknen.
Solche Lichtungen und Wege suchte ich schleichenden Fußes auf; und es währte auch nicht lange, da hatt' ich schon einen Rehbock, der mir auf zwanzig Gänge über den Weg getreten war, in der unverzeihlichsten Weise gefehlt.
Durch dieses Mißgeschick – wir Jäger sagen ›Pech‹ – war ich unmutig, ungeduldig und unvorsichtig geworden, so daß ich, als ich nachmittags vier Uhr an der weitentlegenen Jagdgrenze aus dem Wald auf die Wiesen trat, einen völlig erfolglosen Pirschgang hinter mir hatte.
Zu meinen Füßen im Tal, kaum zwanzig Minuten von der Stelle, an der ich stand, lag eine kleine Ortschaft, in der ich schon manchmal auf meinen Streifzügen ein paar Stunden hinter einem Kruge kühlen Sommerbieres gerastet hatte.
Im aufziehenden Winde hörte ich von der Kegelbahn des Wirtshauses her das Rollen der Kugel, das Poltern der fallenden Kegel und ab und zu ein lautes, mehrstimmiges Gelächter. Ich traf also jedenfalls da drunten eine lustige Gesellschaft, die mir recht willkommen schien, um mir den Unmut über mein Weidmannspech aus den Gedanken zu treiben.
Ich hatte Zeit bis sechs Uhr. Anderthalb Stunden brauchte ich dann für den Heimweg – und inmitten dieses Weges lag an der stillen Waldstraße eine vor wenigen Jahren erst neubebaute Windbruchfläche, die kreuz und quer von Wildwechseln durchzogen war. Da konnte ich vor Einbruch der Dämmerung noch eine Stunde ansitzen und, wenn Hubertus mir gnädig war, durch einen glücklichen Schuß das Mißgeschick des Morgens wieder gutmachen.
In solcher Hoffnung schritt ich über den Hügel hinunter und dem lockenden Wirtshaus entgegen. Auf der Kegelbahn traf ich außer zwei rundlichen Geistlichen und einem mageren Alumnus den Förster und Jagdaufseher der nahegelegenen Wartei, sowie den Doktor und Schullehrer des Ortes, zwei große Jäger vor dem Herrn.
Da war denn auch neben Sommerbier und Kegelspiel die Jagd das unversiegbare Gesprächsthema, bei dem uns die Zeit wie im Fluge verfloß, so daß erst die sinkende Dämmerung mich gemahnte, nach der Uhr zu sehen. Die dem ›Anstand‹ zugedachte Stunde war versäumt. Ich brauchte mich also mit dem Fortgehen nicht übermäßig zu beeilen und setzte mich behaglich wieder an den Tisch.
Als aber um neun Uhr, nach dem Gebetläuten, die beiden Geistlichen mit ihrem zukünftigen Berufsgenossen sich verabschiedeten, wollte ich nach Büchse und Rucksack greifen; doch ich ließ mich vom Förster leicht überreden, für meinen Heimweg den Mond abzuwarten, der längstens in einer Stunde über die nachtschwarzen Baumwipfel emportauchen mußte.
Nun waren wir Jäger unter uns. Und da kam nach mancherlei wunderlichen Geschichten auch jenes nur für Jägerohren ganz gerechte Gesprächskapitel an die Reihe: das Kapitel der Wildschützen. Die Einleitung bildete eine vom Förster an mich gerichtete Frage, wie es dem ›Deberjackl‹ ginge. Der ›Deberjackl‹, ein Bursche meines heimatlichen Dorfes, war ein Wilderer, der seit Jahren in den umliegenden Jagdgebieten großen Schaden angerichtet hatte, ohne daß man ihn jemals auf der Tat hätte ertappen können. Schließlich aber war ihm doch einmal ein nächtlicher Pirschgang übel geraten, denn er hatte statt der erhofften Rehgeiß ein paar Dutzend Schrotkörner im eigenen Fleische mit nach Hause gebracht.
Von diesem Vorfall kamen wir auf Ähnliches zu sprechen; jeder meiner Gesellschafter wußte langes und breites über ein Zusammentreffen mit Wilddieben zu berichten; und besonders der Förster brachte Geschichten aufs Tapet, daß mir achtzehnjährigem Burschen ein wohliges Schaudern über den Rücken rieselte.
Als ich gegen halb elf Uhr in die mondhelle Nacht hinaustrat, um heimwärts zu wandern, war mir nach allem Gehörten sonderbar zumut. Während ich auf schmalem Fußpfad über die feuchten Wiesen dem Wald zuschritt, sann ich immer wieder diesen gruseligen Geschichten nach, in denen es mit Schuß und Schuß um Tod und Leben gegangen war. Und als ich zwischen finsteren Tannen auf das schmale Sträßchen einlenkte, das sich in der Länge einer Wegstunde durch den Wald dahinzog, spannte ich unwillkürlich die linke Hand mit festerem Druck um meine Büchse.
In raschem Gange schritt ich vorwärts. Eng flochten sich über mir die Äste der Bäume ineinander und gewährten dem Mondlicht nur in spärlichen Lücken einen Durchweg, so daß sich die Straße gerade noch in erkennbarem Dämmerschein von dem Moosgrund abhob. Ihr lehmiger Boden war von dem ausgiebigen Regen des Morgens her noch sehr erweicht, so daß mein Fuß lautlos darüber hinschritt. Kein Windhauch regte die Wipfel der dunklen Bäume.
Ich schalt mich selbst um der leichten Beklommenheit willen, die inmitten dieser atemlosen Stille mein Herz beschlich. Dann dachte ich an hundert lustige Dinge, um nur meine Gedanken von jenen blutigen Schauergeschichten loszureißen. Aber was half's? Bald vermeinte ich im Wald einen knisternden Fußtritt zu vernehmen, bald glaubte ich den Hall eines fernen Schusses zu hören, bald sah ich einen vom Mondlicht gestreiften Fichtenast für einen blinkenden Gewehrlauf an.
Was würde ich tun, so fragte ich mich unter dem Zwange meiner aufgeregten Phantasie, wenn ich plötzlich an einer lichteren Stelle unter den Bäumen so einen Kerl gewahrte, der vor dem nächtlich erlegten Wild auf der Erde kniete? Sollt' ich ihn anrufen? Oder gleich – – ?
Ein um das andere Mal nahm ich die Büchse von der Schulter und versuchte durch die Dunkelheit nach einem Baumstamme zu zielen; oder ich blieb minutenlang stehen und lauschte in den nachtstillen Wald hinein, worauf ich mit raschen Schritten wieder meinem Weg folgte.
Erleichtert atmete ich auf, als die Straße heller und heller wurde. Eine Strecke von kaum hundert Schritten trennte mich noch von jener offenen Windbruchfläche, und wenn ich diese passiert hatte, war ich in einem halben Stündchen zu Hause. Schon traten linker Hand die hohen Bäume vom Wege zurück, und das grasüberwachsene Moos senkte sich in einen mannstiefen Graben, der die Straße bis zu den Wiesen hinaus geleitete.
Nun trat ich unter dem Schatten der letzten Bäume hervor auf die mondbeschienene Lichtung, mein Auge schweifte mit raschem Blick über den rechts ansteigenden, buschigen Hang – und ich vermeinte, das Blut müsse mir jählings zu Eis gerinnen. Denn mitten im Tannengestrüpp stand auf etwa sechzig Schritte vor mir ein langer, hagerer Kerl mit berußtem Gesicht, das Gewehr im Anschlag gegen meine Brust gerichtet.
Doch nur für die Dauer einiger Sekunden hielt meine Erstarrung an. Dann riß ich die Büchse an die Wange. Mein Schuß krachte. Gleichzeitig hörte ich den Aufschlag der treffenden Kugel. Und ehe der Pulverrauch sich verzogen hatte, war ich von der Straße in den Moosgraben hinuntergesprungen, in dessen Schutz ich hastigen Laufes den Wiesen zustürzte.
Unter welchen Empfindungen und in welcher Zeit ich damals den Hofraum meines Elternhauses erreichte, vermag ich nicht zu sagen. Es blieb nur die Erinnerung an den grauenvollen Gedanken: ›Du hast einen Menschen getötet!‹
Die Haustür fand ich versperrt. Aber die Kanzlei meines Vaters sah ich noch erleuchtet. Ich pochte an das Fenster. Und als mir eine Minute später mein Vater, die Lampe in der Hand, das Haus öffnete, erschrak er nicht wenig über mein blasses Gesicht und über mein verstörtes Aussehen. Auf seine besorgten Fragen brachte ich keine Antwort heraus. Unter keuchenden Atemzügen sank ich auf die Stufen der Treppe nieder. Und es währte geraume Zeit, bis ich imstande war, mich wieder zu erheben und Büchse und Rucksack abzulegen. Nun erst gewahrte ich, daß ich meinen Hut verloren hatte. Mit bleischweren Knien schritt ich meinem Vater voraus in die Kanzlei.
»Papa! Ich hab einen erschossen!«
So leitete ich den Bericht des bösen Abenteuers ein, das mir vor kaum einer halben Stunde widerfahren war.
Schweigend hörte mein Vater die Geschichte an. Als ich schwieg, durchmaß er eine Weile mit langen Schritten das Zimmer. Dann trat er auf mich zu, sah mir mit einem guten Blick in die Augen und sagte:
»Leg dich jetzt schlafen! Morgen früh um fünf Uhr werde ich dich wecken. Und dann wollen wir ihn miteinander suchen ... den Toten.«
Als ich die Treppe zu meinem Stübchen hinaufstieg, lagen mir Müdigkeit und Erregung wie Blei in den Gelenken. Kaum hatte ich mich in die Kissen fallen lassen, da hörte ich die Turmuhr mit dumpfen Schlägen Mitternacht verkünden. Ein kalter Schauer rüttelte mich.
›Mörder! Mörder!‹ rief eine Stimme in meinem Gewissen.
Heiliger Herrgott! Was hatte ich getan! Ich hörte ein Elternpaar, dem ich den einzigen Sohn getötet, um seine verlorene Lebensfreude jammern. Ich hörte ein Weib klagen, dem ich den Gatten, ich hörte Kinder weinen, denen ich den Vater gemordet hatte. Und war's denn auch wirklich ein Wildschütz, auf den ich geschossen hatte? Oder war es der Förster, der bei Mondschein im Walde Schutzdienst machte? Oder von den Forstgehilfen einer, der mich für einen Wilddieb nahm und mich anrufen wollte, als ich ihn mit sinnloser Übereilung niederschoß?
Ob ich solche Dinge bei wachen Sinnen dachte oder ob ich sie nur träumte, nachdem der Schlaf meines übermüdeten Körpers sich erbarmt hatte – das weiß ich nimmer.
Als ich geweckt wurde, fuhr ich mit schwerem und dumpfem Kopf aus dem Kissen.
Drunten im Flur fand ich meinen Vater schon wegbereit.
»Wollen wir ohne Begleitung gehen?« fragte ich.
Ein leichtes Kopfnicken war meines Vaters ganze Antwort. Und er sah mich fragend an, als ich nach meiner bei Jagdausflügen sonst so verachteten Studentenmütze und nach meinem Stocke griff. Nicht um alles in der Welt hätt' ich es vermocht, meine Büchse zu berühren.
Schweigend durchschritten wir das erwachende Dorf. Und als wir uns nach kurzer Wanderung über die Wiesen dem Walde näherten, gewahrten wir von ferne schon im taunassen Gras den dunklen Streif, der den Weg bezeichnete, den ich in der Nacht aus dem Moosgraben quer durch die Wiesen genommen hatte.
Am Saum der Windbruchfläche, während wir dem Waldsträßchen folgten, untersuchten wir die Gräser und Kräuter des Raines. Sie waren weiß und naß vom Tau. Kein Fuß hatte also während der Nacht den Rain überschritten. Wohl aber fanden wir die Stelle, an der ich in den Moosgraben hinabgesprungen war; da drunten lag auch mein Hut.
»Bevor wir die Lichtung durchsuchen«, sagte mein Vater, »müssen wir genau die Schußlinie feststellen. Geh also einige zwanzig Schritte ins tiefere Gehölz, kehre dann zurück, und wenn du unter den Bäumen hervortrittst, blicke genau nach der Richtung, in die du geschossen hast.«
Schweigend tat ich, was der Vater haben wollte. Und als ich aus dem Schatten der hohen Bäume ins Freie trat und über die Böschung hinaufspähte, fuhr aus meiner Kehle ein halblauter Schrei – der Verlegenheit.
Da stand er wieder, der lange, hagere, rußgesichtige Wilddieb von heute nacht! Statt im fahlen Mondschein jetzt im lauteren Lichte der aufgehenden Sonne betrachtet, entpuppte er sich als der dunkle, halbvermoderte Strunk einer Föhre, die der Sturm vor Jahren gebrochen hatte. Ungefähr in der Armhöhe eines Mannes ragte aus dem Baumstumpf ein gebrochener, morscher Ast gegen die Ausmündung des Waldweges.
Das Blut stieg mir vor Scham ins Gesicht. Mein Vater lachte. Und lachend winkte er mir, während er durch das junge Fichtengestrüpp dem verhängnisvollen Föhrenstrunke zuschnitt.
Dicht über dem aussagenden Aste fanden wir das mürbe Holz von meiner Kugel durchbohrt.
Die Seeleitnersleut
»Hat ihn schon!« rief der Jagdgehilfe, als mein Schuß im Bergwald verhallte und der Hirsch in rasender Flucht über den steinigen Hang hinaufstürmte.
Pochenden Herzens sah ich dem flüchtigen Tiere nach, sah es stürzen, wieder aufspringen und weiterfliehen – nun brach es nieder; und sich überschlagend, kollerte es die Höhe hinunter, daß die Steine rasselten und die Aste flogen, die es im Sturz mit seinem mächtigen Geweih zerschlug.
Seit drei Tagen war ich unter der Führung Anderls, des Jachenauer Jagdgehilfen, diesem Hirsch vergebens nachgestiegen. Nun hatte mich ganz unerwartet ein glücklicher Zufall zu Schuß gebracht. Während ich in Gedanken die Überraschung noch einmal nachfühlte, die ich empfunden hatte, als ich, von Anderl aus einem unweidmännischen Mittagsschläfchen geweckt, den Hirsch auf achtzig Schritt vor mir im Jungholz gewahrte, sah ich durch den schattigen Bergwald hinunter. Zwischen den Asten schimmerte ein helles Blaugrün.
»Was glänzt da drunten durch die Bäume?« fragte ich den Jäger.
Er hob den Kopf. »Dös is der Walchensee.«
»Was? Sind wir so nah beim See?«
»No freilich, kaum a Viertelstündl den Berg abi und über a schmale Wiesen, so sind S' am Wasser. ja, wir sind gut dritthalb Stund von der Jachenau. Sö sind halt noch net lang in der Gegend. Da können S' Ihnen net recht verorientieren.«
Immer wieder mußte ich zu dem lockenden Schimmer hinunterblicken. Das wäre ein Hochgenuß, bei dieser drückenden Sommerhitz da drunten hineinzuspringen ins kühle Bergwasser.
»Anderl? Möchtest du ein Stündel auf mich warten?«
»Gern. Warum denn?«
»Ich möchte baden.«
Anderl lachte. »Wann S' dös wollen, kann ich Ihnen an andern Fürschlag machen. Den Hirsch können wir net liegen lassen bei so einer Hitz. Da richt ich an Schlitten zamm.
Nacher ziehen wir den Hirsch abi bis zum Straßl am See. Drunt schick ich an Buben in d' Jachenau um an Wagen. Und Sö können baden derweil. Grad gnug. Is Ihnen dös recht?«
»Großartig! Fein!«
Als Anderl mit seiner roten Jägerarbeit zu Ende war, schnitt er starke, lange Aste von den Bäumen und flocht sie durcheinander, daß sie ein festes und doch elastisches Kissen bildeten. Auf diesen grünen Schlitten hoben wir den Hirsch und schleiften ihn über den Berghang hinunter.
Als wir den Waldsaum erreichten, blieb ich stehen und betrachtete das wundervolle Bild, das der See mit seiner schillernden Wasserfläche und seinem dunkeln, bergigen Hintergrunde bot.
»Was ist das für ein Haus da drunten?« fragte ich und deutete auf einen kleinen Bauernhof am Rand der hügeligen Wiese, die sich vom Waldsaum gegen den See hinuntersenkte.
»›Beim Seeleitner‹ heißt man's. Der Alte is verstorben, und jetzt hausen da seine drei Kinder, zwei Buben und a Madl, die Mali. Dös is die beste Sängerin weit umundum in der ganzen Gegend. Da haben d' Jachenauer d' Ohren gspitzt, wann d'Mali am Sonntag im Hochamt gsungen hat. Schad, jetzt geht s' schon lang nimmer eini in d' Jachenau und singt nimmer in der Kirch, seit ihr d' Singerei zu einer unglücklichen Liebesgschicht verholfen hat.« Anderl griff wieder nach den Asten des Schlittens. »jetzt machen wir aber, daß wir abi kommen!«
Einige Minuten noch, und wir standen im Schatten des Hauses. Anderl zog den Hirsch ins Gras, riß die verflochtenen Aste auseinander und deckte sie zum Schutz gegen die Fliegen über das tote Tier.
Da klang ein Schritt im gepflasterten Hofraum. Um die Hausecke bog ein schlank aufgeschossener Bursch von etwa achtundzwanzig Jahren. Ein grobes Hemd, eine abgewetzte Tuchhose und plumpe Lederpantoffeln, das war seine Kleidung. In der Hand trug er einen Hammer, und zwischen den Lippen hielt er ein paar lange Bretternägel. Sein Haar war kurzgeschoren. Unter der Stirn, auf der sich Falte an Falte reihte, blickten finstere, unruhige Augen hervor. Das Gesicht hatte einen galligen Ausdruck.
»Grüß Gott, Lipp!«
Mit kaum merklichem Nicken dankte der Bursch für den Gruß des Jägers, ging auf den Hirsch zu und hob mit dem Fuß die Zweige, die das Tier bedeckten.
»Du, Lipp, magst net so gut sein, natürlich gegen a richtigs Trinkgeld, und in d' Jachenau einispringen und dem Herrn Oberförster ausrichten, daß er an Wagen für'n Hirsch aussischickt? Da kannst mit'm Wagen zruckfahren.«
»Ja, schon!« brummte Lipp. »Aber so pressieren wird's net, daß man grad so springen muß? Ich bin allein im Haus. Der Bruder is draußen am See, und d' Mali is in Urfeld drüben. Sie muß jeden Augenblick heimkommen. Ich kann mir sowieso net denken, warum s' so lang ausbleibt, dö greinige Hatschen!«
»Heut hast aber wieder an schiechen Tag!« lachte Anderl, während wir dem Burschen in den Hofraum folgten.
Lipp überhörte diese Worte. Ohne sich umzusehen, rief er: »Geht's nur derweil in d' Stuben eini!« Er trat auf den Zaun des kleinen Gemüsegartens zu, dessen neue Staketen vermuten ließen, daß unser Kommen den Burschen in der Ausbesserung des Zaunes unterbrochen hatte.
Wir gingen in die Stube. Ein niedriger Raum mit vier kleinen Fenstern; in der Lichtecke der gescheuerte Tisch vor den beiden in die Mauer eingelassenen Bänken, darüber im Wandwinkel das Kruzifix mit den unvermeidlichen Palmzweigen; in der gegenüberliegenden Ecke der grüne Kachelofen mit den durch Schnüre an die Decke gehefteten Trockenstangen; daneben ein altes Ledersofa und neben der Tür ein Geschirrkasten – eine Bauernstube wie hundert andere. Der einzige Schmuck dieser Stube war eine schöne, mit Perlmutter eingelegte Gitarre, die zwischen zwei Fenstern an der Wand hing.
Wir stellten unsere Gewehre hinter den Ofen. Während Anderl sich auf das Ledersofa streckte, verließ ich die Stube wieder, um drunten am See eine Stelle für das erwünschte Bad zu suchen.
Unweit vom Hause floß ein breiter, seichter Bach aus dem See, die Jachen. Es führte wohl ein Steg hinüber, aber das Seeufer da drüben schien sumpfig oder versandet. Ich folgte also dem schmalen Sträßchen, das am diesseitigen Ufer hinlief.
Eine weite Strecke war ich schon den See entlang gewandert, ohne einen guten Badeplatz gefunden zu haben. Das Ufer war entweder dicht mit Gesträuch bewachsen oder so steil, daß das Aussteigen aus dem Wasser eine unangenehme Sache gewesen wäre.
Schon wollte ich wieder umkehren, als ich nahe vor mir ein Geräusch hörte wie von einem Stein, der ins Wasser fällt. Bei einer Biegung des Weges gewahrte ich ein kleines Felsplateau, das vom Sträßchen in den See hineinsprang. Auf einer niederen Holzbank saß ein Mädel in einem dunklen, halb städtisch geschnittenen Kleid. Das weiße Tuch, das sie um den Kopf gebunden hatte, war in den Nacken zurückgefallen, so daß sich das feine Profil des Gesichtes und die wohlgestaltete Form des Kopfes scharf vom schimmernden Seespiegel abhoben. Regungslos ruhte ihr Blick auf dem Wasser, während sie den einen Arm um ein kleines, rot bemaltes Kreuz geschlungen hielt.
Nun mußte sie meinen Schritt vernommen haben. Sie wandte das Gesicht, erhob sich rasch, und während sie noch einen Blick auf die verlassene Stelle warf, bekreuzte sie die Stirne, den Mund und die Brust, als hätte sie gebetet.
Während sie auf die Straße trat, hob sie die Arme und zog mit beiden Händen das weiße Tuch über den Kopf bis tief in die Stirne. Ich staunte bei dieser Bewegung über die schöne Regelmäßigkeit ihrer Gestalt.
Nun war sie mir so nahe, daß ich das Gesicht trotz des Schattens, den das vorgezogene Tuch darüber warf, deutlich unterscheiden konnte. Das mußte die Mali sein! Die Ähnlichkeit mit Lipp war unverkennbar. Freilich war das eine Ähnlichkeit wie die Ähnlichkeit von Tag und Nacht, die beide doch auch Geschwister, Kinder der gleichen Mutter Sonne sind. Was in Lipps Zügen gallige Verbissenheit, das war hier das Erbe überwundener Schmerzen; was in Lipps Augen finstere Unruh, das war in diesen großen, dunklen Sternen eine tiefe Schwermut.
»Grüß Gott, Herr!« sagte sie leise.
»Grüß Gott auch!« dankte ich und blieb stehen, um ihr nachzuschauen. Mich hatte diese weiche, klangvolle Altstimme eigentümlich berührt. Es war, als hätte sie den Gruß nicht gesprochen, sondern gesungen.
Als sie an der Wegbiegung verschwand, ging ich der Stelle zu, wo sie geruht hatte. Schon beim Nähertreten erkannte ich das kleine Holzkreuz als ein ›Marterl‹. Auf dem Blechschilde, das auf das Kreuz genagelt war, sah ich den See in Farben abgebildet. Meine Phantasie redete mir ein, daß diese weißen, blauen und grünen Sicheln den See und seine Wellen, diese braunen und grauen Dreiecke darüber die Berge des Hintergrundes vorstellen möchten. Aus dem gemalten Wasser ragten zwei bleiche Hände mit gespreizten Fingern. Und darunter stand in schwarzen, klecksigen Buchstaben auf weißem Grunde:
Wanderer, ein Vaterunser!
Hier an dieser Stelle im Wasser starb in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober des Jahres 1875 der ehr- und tugendsame Jüngling Dominicus Haselwanter, Schulgehilfe in der Jachenau, in der Blüte seines Lebens eines unglücklichen Todes infolge von Ertrinkens, als er gerade von einer Kirchweih in Urfeld nach Hause ging.
Wanderer, ein Vaterunser!
Der See ist weit, der See ist breit, Der See ist tief wie d' Ewigkeit. Gott lohn der Erde Not und Leid Dem Toten mit der Seligkeit. Herr, gib ihm die ewige Ruh! R.I.P.
Nach einer Stunde – ich hatte noch gefunden, was ich suchte – kehrte ich zu dem Bauernhause zurück. Als ich in die Stube trat, rief mir Anderl aus dem Herrgottswinkel über den Tisch entgegen: »Jetzt kriegen wir ebbes Guts zum Essen!« Er deutete mit dem Daumen nach einem etwa fünfunddreißigjährigen Burschen, der neben ihm am Tische saß: »Der Christl hat a paar Pfund von die schönsten Forellen mit heimgebracht. Ich hab mir denkt, Sie werden aufs Bad auffi an rechten Hunger kriegen. Drum hab ich ihm d' Forellen abgehandelt, und d' Mali steht schon am Herd.«
»Wer ist denn der da?« wandte sich Christl, unbekümmert um meine Gegenwart, an den Jäger.
Ich hatte mir einen dreibeinigen Stuhl an den Tisch gezogen, und während Anderl die Neugier des Bauern befriedigte, konnte ich den Christl mit Muße betrachten. Auch an ihm war die Ähnlichkeit mit den Geschwistern auf den ersten Blick ersichtlich. Was diese Ähnlichkeit an den dreien ausmachte, war die tiefe Senkung der Nasenwurzel, das scharfe Hervortreten der Augenbogen mit den gradlinigen, fast schwarzen Brauen und besonders die eigenartige Zeichnung der schmalen Lippen.
Trotz der auffallenden Ähnlichkeit war der Ausdruck in Christls Gesicht von dem der anderen wieder ganz verschieden. Eine gedankenlose Trägheit sprach aus den schlaffen Wangen und aus der Art, wie er beim Zuhören die Zunge zwischen den Zähnen hielt, so daß sie die Unterlippe bedeckte. Sah er einem ins Gesicht, so kniff er das linke Auge ein, daß es fast geschlossen erschien. In diesem halben Blick lag es wie furchtsames Mißtrauen.
Auf meine Fragen über den See, über die Fischgattungen und die Art ihres Fanges gab er kurze, ungenügende Antworten; doch schien mir das weniger einem Mangel an gutem Willen zu entspringen als der trägen Unfähigkeit, auf eine sachliche Frage mit überdachten Worten zu erwidern.
Nicht lange war ich so am Tisch gesessen, als sich die Stubentür öffnete und Anderl mir zurief: »Da is die Mali! jetzt schauen Sie s' an!«
Ich gewahrte, wie dem Mädel ein flüchtiges Rot über die Wangen huschte. Wir haben schon halb und halb Bekanntschaft gemacht. »Gelt, Mali?« Ich bot ihr die Hand, in die sie wortlos einschlug.
»Bekanntschaft? Wo denn?« fragte Anderl neugierig.
»Drunten am See, wo das Marterl steht.« Ich sah die Mali an, die aus der Tischlade zwei Eßbestecke hervornahm. »Hast du für die arme Seele ein Vaterunser gebetet?«
Unwillig erhob sich Christl. »Dö verruckte Narretei kunnt schon bald amal an End haben!« schnauzte er die Schwester an, verließ die Stube und schlug die Tür zu, daß die Fensterscheiben klirrten.
»Was ist denn?« fragte ich verdutzt. Da spürte ich unter dem Tisch einen recht ungelinden Fußtritt, und als ich den Jäger verwundert ansah, blinzelte er und machte heimliche Zeichen. Unwillkürlich suchte mein Blick das Gesicht der Mali, die vor uns ein blaues, verwaschenes Tischtuch ausbreitete. Ihre Züge waren starr und hart. Ober die gesenkten Lider ging ein leichtes Zittern wie ein Anzeichen naher Tränen. Nun wandte sie sich hastig ab und ging auf den Geschirrkasten zu; als sie wiederkam und zwei weißglasierte irdene Teller auf den Tisch setzte, gewahrte ich einen glänzenden Schimmer an ihren Wimpern.
Ich faßte ihre Hand. »Mali! Es wäre mir leid, wenn ich etwas gesagt hätte, was dir nicht lieb war?«
Sie schüttelte stumm den Kopf und ging aus der Stube.
»Anderl! Was hab ich denn angestellt?«
»Gar net so viel! Sö hätten halt vor'm Christl net sagen sollen, daß d' Mali beim Marterl war. Dö zwei Buben haben's net gern, daß d' Schwester noch allweil an dem Platzl hängt. Wann der Lipp von der Jachenau heimkommt und der ander sagt's ihm, so kriegt d' Mali an groben Putzer. Aber Sö haben ja net wissen können –« Anderl schwieg, weil Mali in die Stube trat.
Auf einer flachen zinnernen Schüssel brachte sie die Forellen, die, wie ich zu meinem Schreck bemerkte, mit Semmelbröseln gebacken waren. Dennoch mundeten sie mir. Die Morgenpirsch und das kalte Bad hatten mich hungrig gemacht.
Meiner Einladung folgend, holte Mali für sich einen Teller und setzte sich zu uns an den Tisch. Sie stocherte an dem kleinen Stück Fisch herum, das sie genommen hatte, hob einen sorgsam gesäuberten Bissen auf die Zungenspitze, legte die Gabel wieder fort und schob den Teller von sich.
»Ich weiß riet«, sagte sie, »jetzt haben wir bei uns fast Tag für Tag Fisch in der Schüssel, und noch allweil hab ich mich net dran gwöhnen können. Fisch hab ich nie net mögen. Und jetzt schon gar nimmer!«
»Ja! Ich begreif's!« sagte der Jäger. Er deutete auf die letzte Forelle, sah mich an und fragte: »Mögen Sie's noch?« Als ich den Kopf schüttelte, packte er den Fisch bei der starren Schwanzflosse, und während er ihn auf seinen Teller niederklatschen ließ, sagte er zu Mali: »Da is dein Bruder, der Christl, an andrer Fischesser wie du! Den hab ich neulich in Urfeld vier oder fünf Pfund zammraumen sehen – dös is bloß so a Hui gwesen. Aber gelt, jetzt hast dich ärgern müssen wegen seiner unguten Red?«
»Ah na!« erwiderte Mali ruhig. »Da hätt ich viel z' tun den ganzen Tag, wann ich mich jedesmal ärgern wollt. Von dene zwei bin ich d' Roheiten gwöhnt. So ebbes lauft an mir ab wie 's Wasser am Stein.« Sie erhob sich, um den Tisch zu räumen.
»Wart a bißl, nacher hilf ich dir!« brummte Anderl, während er den letzten Bissen in den Mund schob. Er stellte die Teller übereinander, legte sie mit dem Besteck in die Schüssel und trug sie in die Küche.
»Schau, solltest bald heiraten!« rief ihm Mali scherzend nach, während sie den Brotlaib und das Salzbüchsl in die Tischlade schob. »Du gäbst an guten Mann ab, der seiner Frau manchen Gang verspart.«
»Kannst net wissen, ob's net bald amal kracht!« klang von draußen die heitere Stimme des Jägers.
Mali lächelte. »Ich glaub gar, du Schlaucherl, du hast ebbes im Sinn?«
»Kann schon sein!« entgegnete Anderl, der wieder in die Stube trat, während Mali vor dem Fenster die Brosamen vom Tischtuch schüttelte.