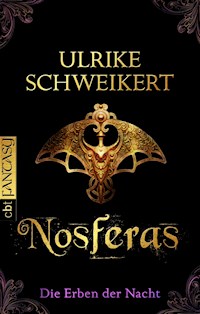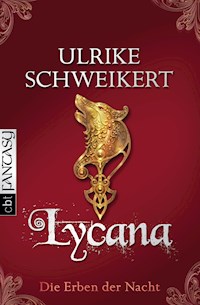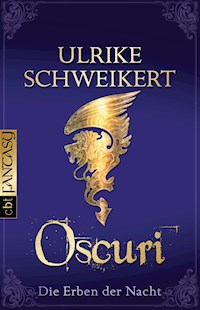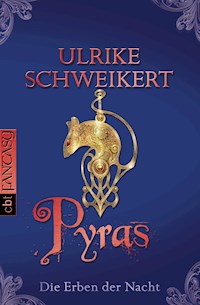9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Friedrichstraßensaga
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Ulrike Schweikert entführt uns in ihrer neuen großen Familiensaga in die 1920er Jahre. Ein Zeit des Glanzes, aber auch eine Zeit, in der Frauen um ihren Platz in der Welt kämpfen mussten. Der Bahnhof Friedrichstraße. Ein Jahrhundertbauwerk. Stolzes Herz einer Stadt auf dem Sprung zur modernen Weltstadt. Als der junge Architekt Robert 1920 den Auftrag bekommt, am Neubau des Bahnhofs und der Planung der ersten U-Bahn-Linie Berlins mitzuarbeiten, ist er überglücklich. Endlich kann er seiner großen Liebe Luise einen Heiratsantrag machen. Doch ihr Glück ist nicht ungetrübt. Seit dem Großen Krieg ist Roberts bester Freund Johannes, mit dem er gemeinsam an der Front kämpfte, verschollen. Johannes war Luises erste Liebe. Als sie glaubte, er sei tot, fand sie Trost bei Robert. Ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit taucht Johannes wieder auf, kriegsversehrt und ohne Hoffnung, Luise eine Zukunft bieten zu können … Zwei Familien, verbunden durch eine unmögliche Liebe und ein einzigartiges Bauwerk. Ulrike Schweikert erzählt die Geschichte einer großen Liebe und einer Zeit voller Glanz und Schatten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ulrike Schweikert
Berlin Friedrichstraße: Novembersturm
Roman
Über dieses Buch
Zwei Familien, verbunden durch eine unmögliche Liebe und ein einzigartiges Bauwerk.
Der Bahnhof Friedrichstraße. Ein Jahrhundertbauwerk. Stolzes Herz einer Stadt auf dem Sprung zur modernen Weltstadt. Als der junge Architekt Robert 1920 den Auftrag bekommt, am Neubau des Bahnhofs und der Planung der ersten U-Bahn-Linie Berlins mitzuarbeiten, ist er überglücklich. Endlich kann er seiner großen Liebe Luise einen Heiratsantrag machen. Doch ihr Glück ist nicht ungetrübt. Seit dem Großen Krieg ist Roberts bester Freund Johannes, mit dem er gemeinsam an der Front kämpfte, verschollen. Johannes war Luises erste Liebe. Als sie glaubte, er sei tot, fand sie Trost bei Robert. Ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit taucht Johannes wieder auf, kriegsversehrt und ohne Hoffnung, Luise eine Zukunft bieten zu können …
Eine mitreißende und lebenspralle Familiensaga, die in den Schicksalsjahren der deutschen Geschichte spielt.
Vita
Ulrike Schweikert arbeitete nach einer Banklehre als Wertpapierhändlerin, studierte Geologie und Journalismus. Seit ihrem Romandebüt «Die Tochter des Salzsieders» ist sie eine der bekanntesten deutschen Autorinnen historischer Romane. Beide Bände ihrer Erfolgsreihe «Die Charité» standen in den Top 10 der Bestsellerliste und verkauften sich insgesamt über 200000-mal. Zuletzt begeisterte die Verfilmung ihrer Jugendbuchserie «Die Erben der Nacht» zahlreiche Zuschauer.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Heike Brillmann-Ede
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Rekha Garton/Trevillion; Bildindex/Foto Marburg, Wikipedia; Shutterstock
ISBN 978-3-644-00282-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Danke für die Rettung aus dem Coronatrübsinn:
Katja, Alessandra, Olivia und mein geliebter Mann Peter
Prolog
1882
Heute, am 6. Februar 1882, war es endlich so weit. Auguste kam es so vor, als habe ihr Verlobter seit Monaten über nichts anderes mehr gesprochen: Samuel Rosensteins erstes großes Projekt als Bauingenieur sollte gleich ein Jahrhundertbauwerk werden. Achtundzwanzig Jahre und damit noch ein blutiger Anfänger war er gewesen, als der Architekt Johannes Vollmer vor vier Jahren mit dem ersten, symbolischen Spatenstich den Beginn dieses Mammutbaus eingeläutet hatte. Und er war es auch gewesen, der sich den jungen Rosenstein an seine Seite geholt hatte, um ihm die Berechnungen und Detailplanungen des ehrgeizigen Objekts anzuvertrauen. Der Bahnhof Friedrichstraße sollte nicht nur irgendein Bahnhof in Berlin werden, an dem Züge hielten und Reisende ein- und ausstiegen. Er würde das Herz des modernen, mobilen Berlins werden!
Wie die Viaduktstrecke selbst, auf der die Schienen durch die Stadt verliefen, wurde der gesamte Bahnhof Friedrichstraße auf gemauerten Bögen errichtet, zwischen und unter denen hindurch man bequem von einem Bahnsteig zum anderen gelangte.
«Die weitläufigen, niedrigen Räume mit ihren Gewölben und mittelalterlichen Architekturformen erinnern an die Kreuzgänge in alten Klöstern. So ist die Wirkung umso stärker, steigt man die breite Granittreppe hoch zur Bahnsteighalle. Denn ohne Stützen in schwindelnder Höhe schwingt sich der Glasbogen überm lichten Raum, in dem der Mensch so klitzeklein sich ausnimmt», beschrieb der dänische Schriftsteller Georg Brandes das Wunderwerk moderner deutscher Baukunst. «Seine Perronhalle überspannt volle vierzig Meter! Ihre Höhe wird auf der Welt von keiner einzigen übertroffen.»
Und was noch außergewöhnlich war: Die Bahnsteighalle wölbte sich, der Biegung der vier Geleise mit ihren beiden Bahnsteigen folgend, was ihr zusätzlich einen optischen Reiz verlieh.
Während Auguste – am Arm ihres Verlobten untergehakt – ihm durch den Haupteingang an der Nordseite folgte, sprach Samuel von Fachwerkbindern unterschiedlicher Spannweite, die zur Errichtung der bogenförmigen Halle benutzt worden waren. Zwischen der tragenden Stahlkonstruktion sorgten die unzähligen Glasscheiben der Halle für ein Gefühl von Luft- und Leichtigkeit.
Auguste bemühte sich, Samuel aufmerksam zuzuhören, obgleich sie vieles nicht verstand, dabei war sie eine durchaus gebildete junge Frau, die eine der vornehmen höheren Töchterschulen besucht hatte, in denen Mathematik oder Physik allerdings nur sehr eingeschränkt als wichtig für die Bildung einer Tochter aus dem gehobenen Bürgertum erachtet wurden.
Augustes Gedanken schweiften für einen Moment ab. Ein wenig verstimmt stellte sie fest, dass Samuel ihr neues Kleid vermutlich gar nicht bemerkt hatte. Zumindest hatte er ihr kein Kompliment darüber gemacht. Seine Gedanken gehörten heute allein dem Gebäude, an dessen Errichtung er die Ehre gehabt hatte mitzuwirken, wie er das so schön formulierte.
Während er sich über weitere architektonische Details ausließ, betrachtete Auguste die Garderobe der anwesenden Damen und Herren, die der festlich mit Fahnen und viel Grün geschmückten Bahnsteighalle zustrebten, zu deren Eröffnungsfeier sich der Kaiser höchstpersönlich angekündigt hatte. Eine Musikkapelle spielte, doch die Menge wartete auf den Höhepunkt der feierlichen Eröffnung: die Ankunft ihres Monarchen, der die gesamte Stadtbahnstrecke mit einer Festfahrt einweihen wollte.
«Ich höre den Zug!»
«Der Kaiser kommt!»
Die Rufe breiteten sich wie eine Welle unter den Wartenden aus, und dann konnte man auch schon das Schnaufen der Lokomotive hören, die die Festwagen hinter sich herzog und mit einem Begrüßungspfiff einfuhr, um dann unter ohrenbetäubendem Quietschen zu bremsen. HALT! Lokomotive und Wagen kamen zum Stehen.
«Auf dem Bahnhof in der Friedrichstraße, der mit Fahnen, Emblemen und grünen Guirlanden ganz besonders reich ausgeschmückt und dessen Perron mit Teppichen belegt war, verließen sämmtliche Theilnehmer der Festfahrt das Kupee. Der Kaiser äußerte wiederholt seine außerordentliche Befriedigung über den imposanten Bau», beschrieb das Berliner Tageblatt das Ereignis. Und die Vossische vermeldete: «Ganze vier Minuten blieben der Kaiser und seine Entourage – gerade so lange, um die Hochrufe der Eisenbahnbeamten entgegenzunehmen.»
Dennoch versicherte jeder, der dabei gewesen war, der Bahnhof Friedrichstraße sei unbestritten der Höhepunkt der Festfahrt gewesen, mit der die gesamte Stadtbahn eingeweiht wurde, die zur Ergänzung der bereits länger bestehenden Ringbahn nun auf ihren Backsteinbögen einmal quer durch Berlin führte, vom Schlesischen Bahnhof im Osten bis nach Charlottenburg im Westen.
Dorthin wanderten Augustes Gedanken, wo sich das junge Paar vor wenigen Tagen in einem der repräsentativen Vorderhäuser zum Stuttgarter Platz hin eine äußerst großzügig geschnittene Wohnung angesehen hatte.
«Könntest du dir vorstellen, nach unserer Hochzeit hier zu wohnen?», hatte Samuel sie höflich gefragt, während Auguste begeistert von einem Zimmer zum anderen geeilt war.
«Auguste?»
An seinem Stirnrunzeln bemerkte sie, dass er sie nicht zum ersten Mal ansprach. «Wo bist du nur wieder mit deinen Gedanken?»
Auguste drückte seinen Arm. «Beim Tag deines Triumphes natürlich», behauptete sie und setzte ihr bestes Lächeln auf.
«Ich habe dich gefragt, ob wir noch in ein Kaffeehaus fahren sollen?», wiederholte Samuel und musterte seine Verlobte mit diesem strengen Blick, der sie noch immer verunsicherte. Sie beeilte sich, ihm zu versichern, dass ihr nichts lieber wäre, um diesen Festtag ausklingen zu lassen, was durchaus der Wahrheit entsprach, denn in ihrem dünnen, dafür farblich passenden Mantel fror sie schrecklich.
Samuel führte sie zum Südausgang, auf dessen dreieckigem Vorplatz zahlreiche Droschken standen, und half ihr beim Einsteigen. Als die Droschke anfuhr, drehte er sich noch einmal um und sah mit verklärter Miene hinaus, bis der Bahnhof seinem Blick entschwand. Endlich wandte er sich seiner Verlobten zu. «Auguste, weißt du, dieser Bahnhof wird Berlin endgültig zur Weltstadt machen, und wir waren dabei.»
Die Jahre verstrichen. Seit 1883 lebten Samuel und Auguste Rosenstein als Ehepaar am Stuttgarter Platz, gegenüber dem Bahnhof Charlottenburg. Und nach einer Fehl- und einer Totgeburt kam 1890 endlich Tochter Ilse zur Welt und zwei Jahre später der ersehnte Sohn, den sie Johannes tauften. Zwar hatten Samuels Eltern – zumindest der Form nach – noch dem jüdischen Glauben angehangen, doch Samuel selbst ließ sich taufen, was für seine Karriere ganz sicher kein Nachteil war, die ihn ins Bauministerium führte, wo er als Ministerialbeamter eine Stufe nach der anderen erklomm, während Auguste sich in Charlottenburg um Hausmädchen, Köchin und ihre beiden Kinder kümmerte. Sie fühlte sich wohl in der weitläufigen Wohnung mit ihrem geschmackvoll eingerichteten Salon, dem Speisezimmer mit einem ovalen Tisch, an dem bequem zwölf Personen Platz fanden, und dem Kaminzimmer, das auch die Bibliothek des Hausherrn beherbergte, wo er abends in Ruhe seine Zigarre rauchte und einen Cognac trank, wenn seine beiden Sprösslinge in ihren Nachtgewändern noch einmal hereinkamen, dem Vater pflichtschuldig die Wange zum Kuss hinhielten und ihm höflich eine gute Nacht wünschten, ehe Auguste sie zu Bett brachte.
In der ähnlich geschnittenen Wohnung auf der anderen Seite des Treppenabsatzes lebte seit einiger Zeit eine nette Familie mit einem Knaben in Johannes’ Alter. Johannes und Robert kamen in die gleiche Klasse und freundeten sich rasch an. Mutter Margarete Wagenbach war ein paar Jahre jünger als Auguste. Eine freundliche Frau, mit der sie sich über allerlei Fragen des Haushalts oder der Erziehung der Kinder austauschen konnte. Ihr Ehegatte Jakob Wagenbach war jüngst zum Professor an der Technischen Hochschule hier in Charlottenburg ernannt worden, wo Samuel Architektur und Ingenieurwesen studiert hatte.
Als die beiden Jungen mit zehn Jahren in die vierte Klasse kamen, zog eine neue Familie in die etwas kleinere Wohnung über den Wagenbachs: Gertrud und Walter Richter mit ihrer Tochter Luise.
Luise zählte ein Lebensjahr weniger, war eher zierlich, hatte ein schönes Gesicht, ein strahlendes Lächeln, blaue Augen und trug lange blonde Zöpfe. Als sie ein paar Tage nach dem Einzug die Jungen auf dem Stuttgarter Platz vor dem Bahnhof sah, ging sie geradewegs auf die beiden zu. Sie reckte das Kinn, sah sie abwechselnd an und streckte dann dem Dunkelhaarigen zuerst die Hand hin. «Guten Tag, ich bin Luise Richter aus dem zweiten Stock», stellte sie sich höflich vor.
Die Buben giggelten. «Fräulein Richter aus dem zweiten Stock. Guten Tag! Wie wohlerzogen mit sauberen Strümpfen und lieblichen Zöpfen», spottete der Blonde.
Luises Blick verfinsterte sich. «Ja, wohlerzogen im Gegensatz zu euch!», schimpfte sie und trat dem Blonden gegen das Schienbein. Der jaulte auf und hüpfte auf einem Bein herum, während der Dunkle nach einem ihrer Zöpfe griff und kräftig daran zog.
Nun schrie Luise vor Schmerz, hob die Hand und klebte dem Dunklen eine, dass sich der Abdruck rot auf seiner Wange abzeichnete. Er hob überrascht die Hand an seine Wange. «Du hast aber einen Schlag», sagte er bewundernd.
«Und sie tritt auch ordentlich zu», bestätigte der Blonde und richtete sich drohend auf, um ihr deutlich zu machen, dass er größer und stärker war als sie, doch Luise senkte nicht einmal den Blick und wich auch nicht zurück. Stattdessen nickte sie nur und sah die Jungen kühl an. «Ja, und das werde ich auch weiterhin tun, wenn ihr so unhöflich zu mir seid.»
Sie starrten einander feindselig an, bis der Dunkle nachgab, den Blick senkte und leicht den Kopf neigte. «Ich bin Johannes, und das ist mein Freund Robert, der direkt unter euch wohnt. Wir haben die Wohnung gegenüber. Ich habe noch eine Schwester, Ilse, aber die ist schon zwölf und hat keine Zeit, mit uns zu spielen. Entweder ist sie im Ballett, oder sie hat Klavierstunde, oder sie muss Hausaufgaben machen.»
Luise schenkte Johannes ein bezauberndes Lächeln, das ihre ganze Gestalt zum Leuchten zu bringen schien. «Grüß dich, Johannes!», sagte sie freundlich.
Da streckte ihr Robert die Hand hin und schüttelte sie feierlich. «Hallo, Luise. Schön, dass du jetzt hier wohnst», sagte er mit Nachdruck.
Luise ließ ihn an ihrem warmen Lächeln teilhaben, dann wandte sie den Blick auf eine andere Gestalt, die ihr schon zuvor aufgefallen war. «Und wer ist die da drüben?», wollte sie wissen und deutete auf ein mageres Mädchen in einem verwaschenen Kittelkleid, das in einiger Entfernung herumlungerte und die drei nicht aus den Augen ließ.
Robert machte eine wegwerfende Handbewegung. «Ach, das ist nur Ella aus dem Hinterhaus. Die rennt uns immer hinterher. Die geht erst in die Zweite, ist aber ganz schön stark für ihr Alter. Für ein halbes Pausenbrot trägt die jeden Tag alle Bücher bis zu unserer Schule! Ella geht natürlich auf die Volksschule, aber die ist gleich gegenüber. Du kommst doch sicher auch hier in Charlottenburg zu uns in die Grundschule, oder?»
Luise nickte. «In die dritte Klasse.»
Die Jungen wirkten enttäuscht, doch dann lächelte Johannes das Mädchen an. «Wir treffen uns jeden Morgen um sieben hier unten und gehen dann zusammen zur Schule. Willst du auch mitkommen? Wir können Ella sicher auch noch deine Bücher zum Tragen geben.»
Dies war der Beginn einer Freundschaft, die die Kinder zu einem verschworenen Dreigestirn werden ließ – meist beschattet von einem kleinen, trüben Licht aus dem Hinterhaus, das für jedes freundliche Wort dankbar schien.
Johannes, Robert und Luise sah man in Charlottenburg nur selten ohneeinander. Und wo die drei waren, war auch Ella meist nicht weit.
Kapitel 1
1920
«Wie sehe ich aus?» Luise drehte sich langsam um ihre Achse und linste dabei in den goldgerahmten Spiegel, der an der Wand in ihrem Zimmer hing.
Ilse lag quer über Luises Bett auf dem Bauch und stützte den Kopf in beide Hände. Der Saum ihres Rockes umspielte die Knie. Kokett bewegte sie ihre Beine, dass ihre bestrumpften Waden und die roten Lackschuhe zur Geltung kamen. «Für meinen Geschmack ist es zu lang und zeigt zu wenig Bein», kommentierte sie das neue Kleid der Freundin.
Luise wandte sich mit einem Ruck um. «Es hat genau die richtige Länge. Dein Kleid ist unzüchtig kurz!»
Ilse lachte. «Das mag sein, doch solange man noch schöne Beine hat, sollte man sie auch zeigen. Und du hast sehr schöne Beine!»
Luise zog den Saum ein wenig höher, dass nicht nur ihre Knöchel, sondern auch die wohlgeformten Waden enthüllt wurden.
«Ja, gut so! Wen willst du eigentlich beeindrucken?», erkundigte sich Ilse.
«Robert kommt um acht und will mich zum Essen ausführen», gab Luise Auskunft.
«Aaa-ha!», feixte Ilse. «Und was macht ihr danach? Wollt ihr tanzen gehen? Wir könnten uns treffen, und ich würde euch einen neuen Club zeigen, der ist umwerfend!»
«Du bekommst vom Tanzen nie genug, nicht wahr?», sagte Luise mit einem Lächeln.
«Na klar, wir haben ja auch viel nachzuholen. Was waren das für endlos trübe Abende während des Krieges, als öffentliches Tanzen überall verboten war.»
«Die Tanzlokale sind schon seit Silvester vor einem Jahr wieder geöffnet», wandte Luise ein, «und du hattest bereits jede Menge Gelegenheiten, das Tanzbein zu schwingen.»
«Ja, ich liebe das Tanzen, wenn es nicht gerade Ballett ist», gab Ilse mit einer Grimasse zurück. «Das habe ich früher schon immer gehasst!»
«Stimmt, deine Mutter hat dich damals ins Ballett gezwungen», erinnerte sich Luise. «Aber später, als du studiert hast, bist du doch freiwillig zu dieser Tanzgruppe gegangen, oder nicht?»
«Ja, aber das kann man nicht vergleichen. Das war Ausdruckstanz im Stil von Isadora Duncan. Die hielt übrigens auch nichts von Ballett.»
«Also gut, halten wir fest, deine Tanzlust ist noch lange nicht gestillt.»
«Ja klar! Das ist nicht wie beim Essen, dass man irgendwann satt wird.»
Luise kicherte. «Nein, du jedenfalls nicht. Nicht einmal nachts um drei hast du genug oder wann auch immer die Dielen schließen.»
Ilse versuchte es noch einmal. «Überlege es dir: Foxtrott, Jimmy, One Step! Die Jazzband im Kakadu spielt die neuesten Stücke aus Amerika. Sie haben sogar einen waschechten Neger von drüben, der himmlisch Saxophon spielt.»
Luise zögerte. «Ich glaube, das ist keine so gute Idee», sagte sie gedehnt.
«Ach, denkst du, der Club wäre nichts für Robert? Und wenn schon. Ich finde, so was würde ihm guttun. Er ist jetzt immer so steif. Wenn er den Spielverderber geben will, gehen wir beide eben alleine hin.»
«Vielleicht nächste Woche», vertröstete Luise die Freundin. «Heute nicht. Er hat einen Tisch im Adlon reserviert!»
Ilse drehte sich um und riss ihre schönen grünen Augen auf. «Wird irgendwas gefeiert, von dem ich wissen müsste? Geburtstag hat er nicht und du auch nicht.»
«Richtig.» Luise warf der Freundin einen ernsten Blick zu.
«Oh!», stieß diese aus. «Meinst du, er wird dich fragen?»
Luise hob die Schultern. «Ich weiß es nicht. Er hat sich verändert, seit er zurück ist. Du hast recht, er ist oft steif. Richtig ernst, und manchmal wirkt er ganz traurig. Dann kommt es mir so vor, als würde ich ihn nicht mehr kennen.»
Ilse nickte. «Stimmt, früher war er lustiger. Ein richtiger Kindskopf, wenn auch nicht so albern wie Johannes!» Sie brach ab und schluckte, ehe sie etwas bemüht locker weitersprach: «Aber auch wir haben uns verändert, sind erwachsen geworden – und die besten Freundinnen. Der Krieg hat uns alle verändert. Die Männer vielleicht noch mehr als uns. Was wissen wir schon davon, was sie dort draußen erlebt haben?»
«Er spricht nicht darüber», gab Luise zu.
«Eben! Vielleicht ist es für ihn zu schrecklich gewesen, um es in Worte zu fassen.»
Sie schwiegen eine Weile und sahen einander stumm an: Ilse mit ihrem schmalen Gesicht, den rot geschminkten Lippen und dem dichten dunkelbraunen Haar, das sie neuerdings kurz geschnitten trug. Luise mit dem herzförmigen Gesicht, den großen blauen Augen und dem langen blonden Haar, das sie an der Seite mit einem Onduliereisen in Wellen gelegt und zu einem falschen Bob aufgesteckt hatte, der kaum die Schultern berührte.
«Was wirst du sagen, wenn er dich fragt?», durchbrach Ilse die Stille.
Luise starrte sie stumm an, während sich ihre Augen mit Tränen füllten.
Ilse sprang vom Bett und schlang ihre Arme um sie. «Nicht weinen! Du musst Johannes vergessen. Er kommt nicht wieder.»
«Willst du ihn denn vergessen? Deinen eigenen Bruder?» Luise schluchzte.
Ilse schüttelte den Kopf. «Nein, aber das ist etwas anderes. Luise, du darfst dein Leben nicht seinetwegen wegwerfen. Du bist jung und schön und lebendig, und du musst dein Leben genießen. Sag ja! Schließlich hast du mir früher selbst einmal gesagt, dass du nicht sicher weißt, ob du mehr in Johannes oder in Robert verliebt bist.»
Luise legte sich die Hand auf die Brust und fühlte unter ihrer Wäsche den altmodisch anmutenden Ring mit dem Rubin, der für ihre zarten Finger viel zu weit war. «Ja, du hast recht. Ich war so jung und ging noch zur Schule, während Robert und Johannes ihren Wehrdienst absolvierten.»
«Und du hast den beiden abwechselnd den Kopf verdreht», erinnerte sich Ilse, die zwei Jahre älter war als die beiden Jungen und zu dieser Zeit bereits Kunst und Gestaltung studierte.
«Es tut so weh, wenn ich an ihn denke, und ich träume noch immer von ihm», gestand Luise. Tränen rollten jetzt über ihre Wangen.
Ilse, die fast einen Kopf größer war, küsste die Freundin zärtlich auf die Stirn. «Es ist richtig, der Toten zu gedenken, und es ist auch gut, um sie zu trauern, aber alles zu seiner Zeit. Die nächsten Stunden sollst du dich freuen und mit Robert essen und tanzen gehen!»
Der Klang der Türglocke ließ sie beide zusammenfahren.
«Mein Gott, da ist er schon, und ich stehe hier mit verheultem Gesicht herum. Was soll er nur denken?» Energisch wischte Luise sich mit beiden Händen übers Gesicht. Draußen waren die Schritte der Mutter zu hören, die die Wohnungstür öffnete.
«Guten Abend, Frau Richter. Ich komme, das Fräulein Luise abzuholen.»
Luise hörte ihre Mutter lachen. «Guten Abend, Robert. So förmlich heute? Du hast dich aber fein rausgeputzt!» Laut rief sie: «Luise, Robert ist da. Bist du fertig?»
Luise wollte schon die Zimmertür öffnen, da zog Ilse sie zurück. «So kannst du dich nicht sehen lassen. Hinsetzen!» Sie drückte die Freundin aufs Bett und zog ein Taschentuch hervor. Mit dem angefeuchteten Tuch wischte sie die Tränenspuren ab. Dann griff sie in ihre Tasche, holte ihren Lippenstift heraus und verwandelte Luises blasse Lippen in einen roten Puppenmund. Vergeblich versuchte diese zu protestieren.
«Sitz still, wenn ich nicht alles verschmieren soll.»
«Aber was soll Robert von mir denken?», klagte Luise, als sie ihren knallig roten Mund im Spiegel betrachtete.
«Dass du eine wunderschöne moderne Frau bist!», antwortete Ilse ungerührt. «Und nun lauf, dein Verehrer wird sonst unruhig.»
Luise drückte die Freundin noch einmal an sich, dann verließ sie das Zimmer und ging den Flur entlang ins Wohnzimmer, wo ihre Mutter mit Robert auf sie wartete.
Statt mit der Elektrischen zu fahren, hatte Robert beschlossen, die Dame seines Herzens mit dem inzwischen etwas antiquiert wirkenden Ford seines Vaters zu kutschieren, den Jakob Wagenbach noch kurz vor Ausbruch des Großen Krieges gekauft hatte. Das Auto hatte den Krieg in einer Garage sicher überdauert und war gar der Requirierung durch das Kriegsministerium entgangen. Sein Vater dagegen war als Offizier an die Ostfront geschickt worden und im April 1917 gefallen.
Natürlich besaß Margarete Wagenbach keinen Führerschein, doch sie hatte es bis jetzt nicht übers Herz gebracht, den von ihrem Mann so bewunderten Wagen zu verkaufen. Immerhin erlaubte sie, dass Robert ihn sich ab und zu für wichtige Anlässe auslieh. Und das war heute ein wichtiger Anlass! Ein Anlass, der sein ganzes Leben verändern würde, wie er seiner Mutter versichert hatte.
«Entweder macht mich dieser Abend zum glücklichsten Mann von ganz Berlin oder zu einem verzweifelten.»
«Robert, nicht so melodramatisch», hatte ihn seine Mutter gerügt. «Du weißt, dass Vater so etwas nicht mochte.»
Oh ja, Gefühle waren für den Herrn Professor ein Fremdwort gewesen. Und wenn man schon welche hatte, dann war man nicht so unschicklich, sie nach außen zu zeigen. Robert hatte sich des Öfteren gefragt, in welcher Weise sein Vater wohl um die Hand der Mutter angehalten hatte. Vermutlich hatten die Großeltern damals alles in die Wege geleitet und die Brautleute dann über ihren Entschluss informiert.
«Das Fräulein Richter kann sich glücklich schätzen, wenn ein Wagenbach um ihre Hand anhält.»
Robert hatte die Augen verdreht. «Früher hast du sie einfach Luise genannt.»
«Als sie noch ein Kind war, ja, doch nun ist sie immerhin schon siebenundzwanzig! Zu meiner Zeit galt man da als alte Jungfer und konnte froh sein, überhaupt noch einen Mann abzubekommen.»
«Ich bin derjenige, der froh ist, wenn sie ja sagt», hatte Robert die Diskussion beendet. «Gibst du mir jetzt den Autoschlüssel? Ich muss los, sonst komme ich zu spät.»
Er hatte seiner Mutter angesehen, dass sie noch viel zu dem Thema zu sagen gehabt hätte, doch hatte sie die dünnen Lippen aufeinandergepresst, ihrem Sohn den Schlüssel gereicht und hinter ihm die Wohnungstür geschlossen.
Lässig steuerte Robert den Wagen seines Vaters über die Charlottenburger Chaussee durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor, hinter dem die Berliner Prachtstraße Unter den Linden begann und wo sich gleich rechts, hinter dem Tor, das erste Luxushotel Berlins erhob.
Das Adlon war durch die Unterstützung Kaiser Wilhelms II., der sich als dessen Pate gesehen hatte, zum ersten Hotel in Berlin gereift, das es mit den Luxusherbergen in Paris, London oder New York aufnehmen konnte. Lorenz Adlon hatte zwanzig Millionen Goldmark Schulden aufgenommen, um dem Kaiser das Beste vom Besten zu bieten: die Halle wie ein venezianischer Palast mit wertvollen Kunstgegenständen, kostbaren Stoffen, Marmor aus Carrara. Im grünen Empiresaal hingen riesige Spiegel mit goldverschlungenen Rahmen. Es gab den Raffael-Saal, den Goethe-Garten, und der Damensalon war im Stil Louis XVI. eingerichtet. Schon 1907 hatte es von den Fürstenappartements bis zu den einfachen Zimmern im vierten Stock in allen Badezimmern heißes Wasser gegeben, überall elektrisches Licht, und die Bediensteten wurden mittels Lichtsignalen gerufen, damit kein Klingeln die Ruhe der anspruchsvollen Reisenden störte.
Nur am Eingang zeigte man sich sehr bescheiden: Zwar gab es ein schönes Portal, eingerahmt von zwei Laternen, die auf monumentalen, von Figuren getragenen Wandarmen ruhten, doch das Bronzeschild mit der zierlichen Aufschrift Hotel Adlon nahm sich äußerst bescheiden aus. Jeder kannte das Adlon. Was musste man da mit einer riesigen Leuchtschrift auf das Hotel aufmerksam machen?
Im Adlon angekommen, verbeugte sich der befrackte Kellner vor dem jungen Paar und führte es im weitläufigen Speisesaal zu seinem Tisch, der etwas abseits des Trubels am Fenster stand. Um den silbernen Platzteller waren unterschiedlich große Messer, Löffel und Gabeln angeordnet, die Servietten steif gestärkt. In der Mitte stand eine Vase mit drei roten Rosen, die beiden Kerzen in einem polierten Silberleuchter brannten schon. Mit einer weiteren Verbeugung brachte der Kellner Robert die Speisekarte und Luise die Damenkarte, in der nur die kulinarischen Köstlichkeiten, nicht aber die Preise vermerkt waren. Von manchen Speisen hatte Luise keine so rechte Vorstellung, daher folgte sie gerne Roberts Empfehlungen. Er bestellte auch den Champagner zur Vorspeise, Weißwein zum Fisch und einen roten zum Fleischgang.
«Wie war dein Tag?», erkundigte sich Robert.
«Ach, ganz gut. Ich habe meine Mutter heute Morgen zum Einkaufen begleitet, und danach kam Ilse zu Besuch.»
«Ihr beide seid ja inzwischen wie zwei Kletten», kommentierte Robert mit einem Lächeln. «Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ihr früher so dicke Freundinnen wart.»
Luise überlegte. «Ilse ist drei Jahre älter. Das war viel, als wir noch Kinder waren, doch später, als sie studierte, und dann während des Krieges ist unsere Freundschaft immer enger geworden. Wir haben beide versucht, das Beste aus der langen Kriegszeit zu machen.»
Nach der Vorspeise erzählte Luise von ihrer Arbeitswoche. Sie war Sekretärin bei der Sittenpolizei und arbeitete im Polizeipräsidium am Alexanderplatz, das jeder nur die Rote Burg nannte. Natürlich sprach man in der Burg gerade viel über den Schumann-Prozess, der vor dem III. Landgericht in Moabit verhandelt worden war. Schumann wurden zahlreiche Morde, versuchte Morde sowie Notzucht und schwerer Diebstahl zur Last gelegt. Den «Massenmörder vom Falkenhagener See» nannte ihn die Presse. Nach acht Tagen Prozess wurde er sechsmal zum Tode verurteilt.
Luise merkte, dass Robert das Gesprächsthema unangenehm war, daher erkundigte sie sich nach seinem Tag. Doch kaum hatte er mit der Erläuterung der komplizierten Statikberechnungen begonnen, mit denen er sich gerade herumschlug, wurde der nächste Gang serviert.
Aus dem großen Wintergarten klang Musik herüber, obgleich die Zeit des Tanztees längst vorbei war. Salome war ein Foxtrott, dessen Harmonien ein wenig orientalisch klangen. Dann setzte die Stimme des Sängers ein: «Salome, schönste Blume des Morgenlands …»
Inzwischen waren sie bei einer luftigen Süßspeise aus Früchten und Eischnee angelangt. Ihr Gespräch plätscherte so dahin. Eine ungewöhnliche Stimmung lag in der Luft. Robert war zwar ernster geworden, seit er aus dem Krieg zurückgekommen war, doch heute schien er ungewöhnlich angespannt.
Draußen sang der Mann am Klavier gerade: «Hallo, du süße Klingelfee.»
Luise lächelte und sang leise mit: «Hallo, wenn ich so lang hier steh, dann frisst mich schier der Kummer: Ich komm zu keiner Nummer, wie gern wär ich verbunden auf Stunden mit dir! Hallo! Du machst mich desperat! Hal-lo! Bei mir, da streikst du grad! Lass mich hinein, du Schlanke, Schmale, mal in die Zentrale! Du, du, du, hast mich am Draht!» Dann prustete sie los, und Robert fiel in ihr Gelächter ein, bis sich einige der vornehm gekleideten Gäste fortgeschrittener Jahrgänge mit pikierten Mienen zu ihnen umdrehten.
«Vielleicht hätten wir woanders essen gehen sollen», überlegte Robert.
Luise streckte die Hand aus und legte sie auf die seine. «Nein, es ist alles ganz wunderbar. Aber vielleicht können wir danach noch tanzen gehen. Ilse hat von einer neuen Diele erzählt, die ihr gut gefällt.»
Robert verzog kurz das Gesicht. Begeisterung sah anders aus. «Ja, gern, aber vorher möchte ich dir etwas sagen.» Er holte tief Luft, reckte sich ein wenig und machte ein wichtiges Gesicht.
Luise spürte, wie ihre Atmung schneller wurde. «Ja?»
«Du weißt doch, dass Johannes’ Vater damals, noch zu Zeiten des Kaisers, die große Halle am Bahnhof Friedrichstraße mitgebaut hat.»
Luise schluckte trocken. Das hatte sie jetzt nicht erwartet. Allein beim Klang von Johannes’ Namen durchfuhr es sie heiß. Sie sah sein Gesicht vor sich, sein dunkles Haar, sein charmantes Lächeln. Luise konnte nur stumm nicken, doch Robert schien ihre Verwirrung nicht zu bemerken.
Mit Begeisterung fuhr er fort: «Seit vergangenem Jahr ist Ministerialdirektor Rosenstein auch für den Ausbau der Stadtbahn verantwortlich und hat durchgesetzt, dass der geplante Umbau des Bahnhofs Friedrichstraße endlich angegangen wird. Schon vor dem Krieg war der Bahnhof für die vielen Menschen, die dort täglich durchmüssen, zu klein.» Er hielt inne, holte noch einmal tief Luft und verkündete dann: «Ich werde die Statik berechnen und den Umbau als leitender Ingenieur überwachen!»
«Das ist eine große Aufgabe», stieß Luise hervor. «Aber … aber du hast noch gar keine Erfahrung mit solch großen Bauvorhaben. Du warst doch gerade erst mit deinem Studium fertig, als du an die Front musstest … Ich meine, ihr, du und Johannes», fügte sie leise hinzu.
«Wenn Johannes zurückgekommen wäre, hätte sein Vater sicher dafür gesorgt, dass er als Architekt verpflichtet worden wäre und nicht dieser Carl Brodführer», behauptete Robert.
«Und nun sorgt er dafür, dass wenigstens du eine große Aufgabe bekommst», schloss Luise.
Robert nickte ernst. «Du hast schon recht. Wenn Ministerialrat Rosenstein mir die Chance gibt, dann wäre ich dumm, sie nicht zu ergreifen. Ich werde sehr viel mehr verdienen und bequem einen eigenen Hausstand gründen können, obwohl jetzt alles immer teurer wird.»
Luise begann zu verstehen, warum es ihm so wichtig war, ihr von dem neuen Projekt zu berichten.
«Ich möchte dich nämlich etwas Wichtiges fragen», fügte er rasch hinzu. Seine grauen Augen waren starr auf ihr Gesicht gerichtet.
Luise spürte, wie sich in ihr etwas zusammenballte, das ihr wie ein Fels im Magen drückte.
Sein Blick huschte kurz durch den Raum, ehe er ihn wieder auf die Frau richtete, die ihm gegenübersaß. «Du bist wunderschön», sagte er, doch sie wusste, dass es nicht das war, was er sagen wollte.
Höflich bedankte sie sich für das Kompliment und wartete geduldig, dass er weitersprach. Er lachte trocken, es klang fast wie ein Husten.
«Ich weiß noch, wie wir zum ersten Mal gemeinsam zur Schule gegangen sind. Du warst gerade erst mit deinen Eltern in die Wohnung über uns eingezogen. Schon in diesem Moment habe ich mich in dich verliebt.»
Luise kicherte undamenhaft. «Schwindel mich nicht an. Ich war neun und ein mageres Ding mit langen Zöpfen.»
«Es ist die Wahrheit!», beteuerte Robert mit einem Ernst, der sie rührte.
«Ihr habt mich gehänselt und mich mehr als einmal an den Zöpfen gezogen!»
«Und du hast mich getreten, aber in diesem Alter zeigt man seine Zuneigung eben anders. Später habe ich dich im dunklen Treppenhaus geküsst!»
Erinnerungen brachen über sie herein, doch es waren nicht Roberts schüchterne Küsse, die sie auf ihren Lippen zu spüren glaubte. Es war ein anderer Mund, heiß und fordernd, seine Arme pressten ihren Körper an sich. Luise erwiderte den Kuss und spürte eine ungewohnte Hitze in ihrem Leib aufsteigen. Dunkle Wünsche und Gedanken überschlugen sich. Romantisches vermischte sich mit Unbekanntem, Verschwiegenem, das in Filmen, Büchern und Liedern nur angedeutet wurde. Sie erwiderte seine Küsse, bis oben die Tür aufging und das Flurlicht angeschaltet wurde.
«Luise? Bist du das? Warum kommst du nicht herauf?»
Ein letzter Kuss, dann löste sie sich und rief atemlos: «Ja, ich bin da!» – und rannte die Treppe nach oben.
Luise spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. Hastig blinzelte sie, während Robert eine kleine Schachtel aus seinem Jackett zog und aufklappte. Natürlich war ein Ring darin. Ein geschmackvoller goldener Ring mit einem kleinen Diamanten, der bestimmt perfekt auf ihren Finger passen würde. Robert war kein Mann, der etwas dem Zufall überließ. Sie ahnte seine Frage eher, als dass sie die Worte hörte.
«Luise, willst du meine Frau werden?»
Luise kämpfte noch immer mit den Tränen, die zwar durchaus zu dieser Situation passten, jedoch nicht der Frage aller Fragen geschuldet waren. «Willst du gar nicht vor mir niederknien?», sagte sie bemüht scherzhaft, während sie sich die Tränen von der Wange wischte.
Mit ernster Miene schob Robert den Stuhl zurück und sank auf sein Knie. «Bitte, heirate mich», bat er, während er nach ihrer Hand griff.
Wieder drehten sich die Leute nach ihnen um, doch dieses Mal lag ein verklärtes Lächeln zumindest auf den Gesichtern der Damen. Der Kellner, der sich gerade ihrem Tisch näherte, blieb abrupt stehen.
Luise spürte, wie Robert sie erwartungsvoll anstarrte. Jetzt war es so weit. Jetzt musste sie sich entscheiden … Nein, die Zeit der Entscheidung war längst vorüber. Jetzt musste sie das tun, was die vielen Augenpaare um sie herum von ihr erwarteten. Also hauchte sie ein «Ja» und ließ sich den Ring über den Finger streifen, der wirklich perfekt passte.
Während Robert im Adlon um Luises Hand anhielt, langweilte sich Ilse an der Bar des Kakadu in der Joachimsthaler Straße. Es war ein exklusiver Laden, keine Frage, vielleicht sogar ein wenig protzig. Wer wie sie entsprechend gekleidet und auf hohen Hacken kam, wurde ohne Eintrittsgeld hereingebeten. Kleine Tische unter Palmen in künstlich rotem Sonnenuntergangsschein wie auf Tahiti oder so. Der blau-goldene Tresen der Bar wurde als einer der längsten von ganz Berlin beworben. Neben einer Jazzband und einem Kabarettprogramm – garantiert nicht politisch – warb die Bar mit einer einzigartigen Attraktion: Über einigen Tischen im Restaurant hingen Käfige mit je einem echten Kakadu, von denen manche gar die Worte «Die Rechnung!» krächzen konnten, wenn man mit dem Messer gegen ein Wasserglas klopfte. Allerdings kam es auch zu ungewollten Zwischenfällen, denn die Tiere erdreisteten sich zuweilen, ihre Hinterlassenschaft in die Gläser und auf die Teller zu verteilen. Während manche Gäste empört reagierten, fand Ilse das eher lustig – zumindest, solange es nicht ihr Cocktailglas betraf.
Ilse zündete sich eine Juno an und ließ ihren Blick über die jungen, hübschen Bardamen schweifen, die als die brillantesten von Berlin beworben wurden. Ansonsten gab es auch zahlreiche Frauen, die einem anderen Gewerbe nachgingen. Sie trugen meist etwas kürzere Kleider, hatten die Augen schwarz umrandet, den Mund zu einem knallroten Herzen geschminkt und auch mit Rouge nicht gespart.
«Trinken Sie einen Martini mit mir?», riss eine unbekannte männliche Stimme sie aus ihren Gedanken. «Schöne Frau, so alleine hier? Das kann ich gar nicht mit ansehen!»
Das war nun schon Nummer drei an diesem Abend, die Ilse einen Cocktail aufnötigte und sie dann nicht nur auf die Tanzfläche schleppen wollte. Ilse trank ihr Glas leer und drückte die halbgerauchte Zigarette aus.
«Entschuldigen Sie, ich muss leider gehen», log sie.
«Was? Es ist gerade einmal Mitternacht», protestierte der Mann. «Wir können hier bis um drei zusammen Spaß haben!»
«Nein danke», sagte sie fest, griff nach ihrer kleinen Perlentasche und rauschte in die Nacht hinaus. Draußen blieb sie unentschlossen stehen. In ihr Bett heimzukehren hatte sie noch keine Lust. Aber wohin dann? Eine Motordroschke hielt neben ihr.
«Na, Frollein, die Nacht is noch jung. Wo kann ich Se hinbringen?»
Ilse stieg ein und überlegte. «Hohenzollern-Café, Bülowstraße», entschied sie sich spontan.
«So? Sind Se sich da janz sicher?», hakte der Taxifahrer nach und betrachtete sie, als sei sie irgendein exotisches Tier.
«Ja, das bin ich!», behauptete Ilse, obgleich das ganz und gar nicht stimmte.
«Na gut, mir is et egal, von wem ick mein Geld krieg», brummte der Fahrer, fuhr in Richtung Nollendorfplatz und hielt dann bald darauf vor der Hohenzollern-Diele, die sich jetzt Café nannte.
«Ick hätt Se nich für so eine gehalten», brummte der Fahrer, als sie ihm das Geld in die Hand drückte.
Die Fenster waren alle geschwärzt, sodass man nicht hineinsehen konnte. Ilse fühlte sich ein wenig befangen, als sie die Tür öffnete und das sogenannte Café betrat. Sie blieb stehen und ließ die Atmosphäre auf sich wirken. Ilse konnte nicht sagen, was sie von einem Lesbenclub erwartet hatte, so jedenfalls hatte sie sich das nicht vorgestellt. Es gab verschiedene Räume mit Polsterstühlen, dabei fehlte der Glamour. Alles wirkte eher gediegen und ein wenig altmodisch, bis auf die Tatsache, dass ein offensichtlich schwules Duo an Klavier und Geige einen Box-Step spielte. Einige Paare tanzten. Die Bubis trugen Kragen und Krawatten zu konservativen Herrenjacketts. Wenn sie nicht tanzten, standen oder saßen sie in Gruppen beisammen und unterhielten sich ungeniert mit lauter Stimme.
Die Mädis trugen schicke kurze Kleider, Schmuck und hohe Absätze, waren geschminkt und nach der neuesten Mode frisiert. Die älteren der Frauen saßen still bei ihrer Tasse Kaffee zwischen den «Männern» oder unterhielten sich leise. Sie kamen Ilse wie alte Ehepaare vor. Die jungen Mädis dagegen tanzten oder standen in kleinen Gruppen kichernd beisammen. Ilse entdeckte auch zwei echte Männer, die hier offensichtlich geduldet wurden. Sie beobachtete, wie einer der Kavaliere sich vor einer der Mädis in einem silbrig glitzernden Kleid verbeugte, um sie zum Tanzen aufzufordern. Die Kleine schien nicht abgeneigt, doch ehe er sie auf die Tanzfläche entführte, bat er noch brav ihren Bubi um Erlaubnis.
Hinter Ilse ging die Tür auf, und eine Frau trat neben sie.
«Na, wat nu, rin oder raus?», fragte sie in burschikosem Ton.
Die Stimme ließ Ilse herumfahren. War sie das wirklich? «Claire Waldoff», hauchte sie beeindruckt.
Die Kabarettistin und Sängerin lachte. «Soso, Sie kennen mich, aber wer sind Sie?»
«Ilse, Ilse Rosenstein.»
Sie schüttelten einander die Hände.
«Wie schön. Sind Sie mit jemandem verabredet, meine Liebe? Sie haben sich so suchend umgesehen.»
Ilse schüttelte den Kopf. «Nein, ich, nun ja, ich bin zum ersten Mal hier.»
Claire nickte wissend. «Dann kommen Sie doch an unseren Tisch. Wie ich sehe, sind die anderen schon da.» Sie wandte sich noch einmal an Ilse und fragte neugierig: «Was ich treibe, muss ich Ihnen offensichtlich nicht sagen, doch verraten Sie mir, was Sie so machen!»
«Ich beschäftige mich mit Mode», sagte Ilse vage, fügte dann aber hinzu: «Ich entwerfe Modelle oder ändere Kleider von der Stange nach den Wünschen der Kundinnen. Ich habe mich nach meinem Studium selbständig gemacht und arbeite für verschiedene Modehäuser.»
Claire Waldoff pfiff durch die Zähne. «Sie sind also auch Künstlerin!» Sie schmunzelte. «Sie scheinen viel Geschick darin zu haben, wenn ich mir ihr Kleid so ansehe.» Bewundernd glitt ihr Blick über Ilses Kleid, das aus dunkelblauer Seide gefertigt war mit einer etwas tiefer angesetzte Taille und einer lässig geschnittene Jacke aus durchscheinendem Chiffon, die die nackten Schulten bedeckte.
Claire Waldoff war gut einen Kopf kleiner als Ilse, hatte ein rundes Gesicht und war mollig. Ihr rötliches, gewelltes Haar trug sie mit einem Seitenscheitel bis knapp über die Ohren. Sie war auch eher unscheinbar gekleidet, und man hätte sie bei einem flüchtigen Blick übersehen können, wären da nicht ihre Ausstrahlung und ihre Stimme, die den Raum mühelos durchdrang. Einige Gesichter wandten sich zu ihr um und grüßten fröhlich.
Claire stellte Ilse die Gruppe vor. Als Letzte kam Olga von Roeder an die Reihe.
«Meine Lebensgefährtin», fügte Claire ganz selbstverständlich hinzu, und auch dafür bewunderte sie Ilse. Wenn jemand seine für so viele Mitmenschen ungewöhnliche Neigung in Berlin offen und ohne jede Scham auslebte, dann war es das Paar Waldoff-von Roeder. Natürlich wurden die beiden Frauen dafür nicht von allen bewundert. Die rechte Presse wurde nicht müde, nach Claires Kabarettauftritten immer wieder über die «widernatürliche Lesbe» herzuziehen.
«Und das, meine Lieben, ist die Modeschöpferin Ilse Rosenstein, die ich gerade kennenlernen durfte und die, denke ich, wunderbar in unsere Runde passt.»
Nachdem alle Ilse willkommen geheißen hatten und auch vor ihr ein Glas Martini stand, stellte Ilse schnell fest, dass diese Frauen nicht gekommen waren, um nur ein paar Klatschgeschichten auszutauschen oder über ihre Garderobe zu reden. Vielmehr sprachen sie über die neuen Strömungen in der Kunst, von Kubismus und Picasso bis hin zur Neuen Sachlichkeit, wie sie auch das Staatliche Bauhaus in Weimar propagierte, das von Walter Gropius gegründet worden war. Dann widmete sich die Runde der Musik, sprach über den Jazz und die neuen Tänze, die von Amerika herüberschwappten. Nahtlos wechselten sie die Themen – und Ilse saß gespannt und innerlich strahlend dabei.
«Ich habe aus Neugier in Oswald Spenglers Buch über den Untergang des Abendlandes reingelesen», sagte eine junge Frau mit schmalem Gesicht, die Tatjana hieß und mit russischem Akzent sprach. «Seiner Meinung nach zeugen Kino, Expressionismus, Boxkämpfe und Niggertänze von der Unfruchtbarkeit des zivilisierten Menschen!»
Die zierliche Blonde, die links neben Ilse saß und Anna hieß, winkte ab und zitierte aus einem Artikel, der offensichtlich ihren Zorn erweckt hatte: «‹Die Übernahme der barbarischem Blut entsprungenen Negertänze Shimmy und Foxtrott zeigen, dass man in diesem Land nicht mehr von kulturellem Hochstand sprechen darf!› Das ist doch die Höhe, nicht wahr?», empörte sie sich.
«Wer schmeißt denn da mit Lehm, der sollte sich was schäm», zitierte Olga die Textzeile aus Claires bekanntem gleichnamigem Schlager.
Claire selbst lenkte das Thema noch einmal in Richtung Modedesign. Anna erkundigte sich nach Ilses Studium, und auch Tatjana war interessiert zu hören, in welchen Häusern Ilse ihre Entwürfe anbot.
Ilse erfuhr dagegen, dass sich die Frauen normalerweise zu einem kulturpolitischen Salon einmal in der Woche bei Claire daheim trafen, nach dem Bruch eines Wasserrohrs wäre es dort im Moment allerdings sehr ungemütlich, erzählte Claire und rollte in einer Mischung aus Verzweiflung und Komik mit den Augen.
Ilse war von der Frauenrunde fasziniert. Als sie zu später Stunde Claire Waldoff die Hand zum Abschied reichte, lächelte diese sie warm an. «Kommen Sie doch auch vorbei, wenn man bei mir daheim keine Gummistiefel mehr benötigt. Oder Sie gehen ins Romanische Café. Ich bin meist dienstags dort, am späten Nachmittag. Ich könnte Sie mit einigen interessanten Leuten bekannt machen – Frauen und Männern! Wir Lesben sind nämlich nicht halb so männerfeindlich, wie man uns nachsagt.»
Ilse sagte begeistert zu und versprach, sich so bald wie möglich dort einzufinden. Selten hatte sie sich so wohlgefühlt wie an diesem Abend. Hoffentlich meinte Claire Waldoff die Einladung ernst.
Robert lag in seinem Bett, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Er hatte es tatsächlich getan!, dachte er ein wenig ungläubig, aber auch mit Stolz. Er hatte Luise gefragt, und sie hatte «Ja» gesagt. Robert sah ihr Gesicht vor Augen. Ihren Blick, ihre ungewohnt kräftig rot geschminkten Lippen, die er vor der Wohnungstür geküsst hatte, ehe er sie wieder in die Obhut ihrer Mutter entließ, die wie so oft im Wohnzimmer halb wachend, halb schlafend auf die Rückkehr der Tochter gewartet hatte, obwohl Luise längst kein junges Mädchen mehr war. Robert wusste, dass Luise sich gerne irgendwo ein Zimmer zur Untermiete gesucht hätte, würde dies nicht bedeuten, ihre Mutter alleine in der großen Wohnung in Charlottenburg zurückzulassen. Leisten hätte sie es sich können, schließlich hatte sie eine Arbeitsstelle. Jeden Morgen fuhr sie mit der Elektrischen in die Rote Burg am Alex, um die Schreibarbeit für die Beamten der Sittenpolizei zu übernehmen oder bei Verhören zu stenographieren. Dass sie ausgerechnet für die Sitte arbeitete und dadurch häufig Kontakt mit Prostituierten, Zuhältern und allerlei sexuell verirrten Menschen hatte, fand Robert nicht sehr glücklich gewählt, doch vielleicht würde sie irgendwann in eine weniger anstößige Abteilung versetzt werden. Oder eine neue Arbeit in der Verwaltung irgendeines normalen Amtes finden.
Seine Gedanken wanderten von Luises Arbeit wieder zu ihrer Mutter. Nun würde sie diese doch bald verlassen müssen. Als Ehepaar würden sie sich eine eigene Wohnung suchen, das hatte er sich fest vorgenommen, auch wenn seine Mutter vermutlich dachte, das Paar würde zu ihr ziehen. Genügend Zimmer gab es ja, aber Robert konnte sich nicht vorstellen, Luise zu lieben und dann jeden Morgen mit seiner Mutter am Frühstückstisch zu sitzen. Außerdem hatte er so eine Ahnung, dass die beiden Frauen vermutlich nicht harmonisch in einer Wohnung leben konnten. Dazu war seine Mutter zu eigensinnig und altmodisch und Luise zu eigenständig und modern.
Nein, es kam nicht in Frage, gemeinsam im Haus ihrer Kindheit am Stuttgarter Platz zu leben – weder bei Luises Mutter noch bei seiner eigenen.
Gern wäre Robert in Gedanken bei der Planung ihres ersten eigenen Heims geblieben, doch als er schläfrig wurde, entglitten ihm seine Wunschgedanken und trugen ihn fort in den Albtraum, der ihn nachts so hartnäckig verfolgte.
Eben noch in seinem warmen Bett, fand er sich unversehens in einem schlammigen Graben wieder. Es war kalt. Die Nässe drang durch seine Stiefel, seinen Mantel, die Hose. Er presste sich im Tal der Somme irgendwo in der Nähe von Péronne in einem Unterstand an die rauen Bretter, die diesen Verhau bei Granateinschlägen stabilisieren sollten, doch er und Johannes hatten zu viele Semester an der Technischen Hochschule in Charlottenburg Architektur und Ingenieurwesen studiert, um daran glauben zu können. Und zu viele Männer waren schon in einstürzenden Unterständen tot oder lebendig begraben worden. Wenn es Lebewesen gab, die nach einem Angriff unversehrt wieder herauskamen, dann waren es die Ratten, die ihnen um die Füße wuselten. Auch jetzt knabberten sie an seinen Schuhsohlen, sobald er eine Weile saß oder auch nur still stand.
Der Hunger nagte in seinem Innern, und seine Gedärme wanden sich wie Gewürm. Es gab im dritten Kriegsjahr wohl keinen Soldaten, den nicht immer wieder ruhrartige Durchfälle plagten. Zwar war in der Etappe hinter der Frontlinie die Verpflegung besser als daheim in Berlin, aber was hieß das schon? Hungrig waren sie hier fast immer. Und erschöpft! Zudem zerrte das ständige Granatfeuer an den Nerven. Seit sieben Tagen dröhnte und schrie die Artillerie mal wieder ohne Unterlass, der Boden grollte und bebte … Robert begann sich stöhnend im Bett hin und her zu werfen. Er war am ganzen Körper schweißnass. Kriegte keine Luft. Musste die Gasmaske loswerden, jetzt SOFORT, sonst würde er ersticken.
In der Ferne hörte er den Feldwebel brüllen. Die Männer griffen nach ihren Gewehren und eilten den gewundenen Graben entlang. Leitern, Granatfeuer, Blitze am Himmel, dazwischen die Rufe des Offiziers, der sie vorwärtsdrängte. Robert kletterte hinter Johannes die Leiter hinauf und taumelte den anderen hinterher. Was vor wenigen Tagen noch Felder und Wiesen gewesen war, zog sich nun als schlammige Kraterlandschaft bis zum Horizont. Wie Sternschnuppen zogen die Geschosse flammende Bahnen über den Nachthimmel. Und dann die Explosion! Robert wurde in die Luft geschleudert und schlug irgendwo in einem Erdtrichter auf. Er sah Blitze vor seinen Augen, sein Kopf war erfüllt von einem Rauschen und Dröhnen. Er wusste nicht mehr, wo er war und was er hier zu suchen hatte.
Kurz darauf kam der Schmerz. Er tastete nach seinem Oberschenkel, nach seinen Lenden. Warmes, klebriges Blut durchnässte seine Uniform. Er versuchte, sich aufzurichten, doch er konnte sich nicht bewegen. So lag er zusammengekauert da, atmete gegen den Schmerz an und lauschte dem Artilleriefeuer und den Schreien der Männer, die getroffen wurden.
Irgendwann musste er das Bewusstsein verloren haben, denn als sein Kopf wieder klar wurde, konnte er im Osten die erste Helligkeit des Morgens erahnen. Um ihn herum war es verdächtig still. Nur ein anderer Verletzter stöhnte irgendwo in der Nähe. Dann schwieg auch er.
Noch nie in seinem Leben hatte sich Robert so verlassen gefühlt. Vielleicht hätte ein anderer in seiner Lage Trost im Gebet gefunden, aber er stammte aus keiner religiösen Familie. Trotz der Schmerzen versuchte er, sein Bein zu bewegen, doch es ging nicht. Sein Fuß hing irgendwo fest, hatte sich in etwas verkeilt, das ihn nicht losließ. Robert fluchte leise vor sich hin, auch um sich von seinem Schmerz und der zunehmenden Schwäche abzulenken, die nach ihm griff, doch es gelang ihm nicht, sich zu befreien.
Plötzlich spürte er, dass er nicht mehr allein war. Er hörte, wie sich jemand leise heranschlich. Hektisch drehte Robert den Kopf, konnte aber niemanden erkennen. Und doch war da eine Bewegung am Rand des Kraters.
Franzosen? Tommys? Kamen sie, um ihm den Rest zu geben? Er zog noch einmal mit aller Kraft an seinem Fuß, vergebens. Fluchend übertönte Robert jeden Schmerz und jede Vorsicht.
«Du weißt aber schlimme Worte», flüsterte ihm eine Stimme ins Ohr. Eine Hand legte sich auf seine Schulter.
«Johannes!» Die Todesangst fiel so plötzlich in sich zusammen, dass er in Tränen ausbrach.
«Natürlich bin ich es», erwiderte der Freund unangemessen heiter. «Ich hab deinen Eltern versprochen, dich in einem Stück wieder heimzubringen. Lass mal sehen, wie schlimm es dich erwischt hat.»
Seine Hände tasteten an Roberts Leib entlang. «Ich hab dem Krassmann die Hölle heißgemacht, als ich merkte, dass du fehlst. Der wollte niemanden mehr rauslassen, um Verletzte zu suchen, aber ich hab ihm keine Ruhe gelassen, er musste zustimmen. Jetzt lieg still, hier hast du einen Splitter drin.»
«Und mein Fuß steckt fest», stöhnte Robert.
Johannes tätschelte ihm die Wange. «Wir holen dich gleich da raus, und dann nimmst du dir einen schönen Krankenausstand in der Heimat.»
Er kroch zum Kraterrand hinauf, raunte einen Namen und kam kurz darauf mit einem Kameraden zurück. Rudi hieß er, ein Schweißer von einer Kieler Werft, der vermutlich auch einen Bullen aus der Grube herausgetragen hätte. Zusammen mit Johannes gelang es ihm, Roberts Fuß zu befreien und den Verletzten zum Unterstand zurück in Deckung zu schaffen.
Robert verlor das Bewusstsein und erwachte erst wieder, als er in das müde Gesicht einer Krankenschwester blickte.
Kapitel 2
Sie saßen im Kino. Luises Hand umklammerte Roberts Rechte, während ihr Blick geradezu an der Leinwand klebte, wo der unheimliche Doktor durch das Bild schlich und sich dann mit einer grausigen Grimasse dem Publikum zuwandte. Die fast schmerzhaft schrille Musik des Klavierspielers jagte Luise Schauder über den Rücken: Der Doktor scheint sie durch seine runde Brille mit dem dicken Rand direkt anzustarren. Sein dünnes weißes Haar quillt unter dem schwarzen Zylinder hervor. Franzis und Alan verfolgen ihn und erleben, wie der Somnambule erwacht. Sein weiß geschminktes Gesicht mit den schwarz umrandeten Augen lässt ihn wie einen Toten erscheinen. Er prophezeit Alan, dass er nur noch bis zum Morgengrauen zu leben hat.
Luise zuckte zusammen und drückte Roberts Hand noch fester. Das Cabinet des Dr. Caligari hatte am 26. Februar im Berliner Filmtheater Marmorhaus am Ku’damm Eck seine Premiere gefeiert. Seit Wochen war der Saal bei jeder Aufführung bis zum letzten Platz gefüllt. Auch heute, am 12. März.
Als die beiden gut eine Stunde später aus dem Kino auf die Straße traten, fiel ihnen die veränderte Atmosphäre auf. Menschen standen in Grüppchen dicht gedrängt, doch die Stimmung war nicht die eines gewöhnlichen Freitagabends. Roberts Blick fiel auf die Schlagzeilen der Abendzeitungen, die ein Zeitungsjunge in die Luft hielt. Er blieb stehen und drückte dem Burschen eine Münze in die Hand. Zusammen mit Luise beugte er sich unter einer Straßenlaterne über den Artikel. Von einem bevorstehenden Putsch war die Rede, die Brigade Ehrhardt wurde erwähnt. Es hieß, Reichswehrminister Noske ließe Regimenter der Sicherheitspolizei und der Reichswehr ins Regierungsviertel marschieren, um es zu schützen, doch die Reichswehr weigerte sich, gegen ihre Kameraden vorzugehen.
Luise sah Robert fragend an. Doch ehe er antworten konnte, drang Motorengeräusch an ihre Ohren. Schwarze Wagen rollten über den Kurfürstendamm in Richtung Westen.
«Da, seht, die Abgeordneten sind alle auf dem Weg in den Reichstag», rief ein Mann, der in ihrer Nähe stand. Auch er hielt eine Zeitung in den Händen.
Als Luise am nächsten Morgen mit der Stadtbahn von Charlottenburg Richtung Alex fuhr, herrschte große Aufregung in der Bahn. Jemand verkündete, die Regierung sei nach Dresden geflohen, andere behaupteten, nach Stuttgart. Militärische Einheiten mit weißen Hakenkreuzen auf den Helmen seien vor kaum einer Stunde durch das Brandenburger Tor marschiert. Das konnte doch nicht wahr sein, oder?
Am Bahnhof Friedrichstraße stieg Luise in die Straßenbahn um. Da fielen ihr mehrere offene Militärfahrzeuge auf, von denen aus Uniformierte Flugblätter verteilten. Am Alex angekommen, eilte sie zu einem der Zeitungsstände, zückte fünf Pfennige und nahm sich einen Berliner Lokal-Anzeiger, dessen Druckerschwärze noch nicht einmal getrocknet schien. Fett gedruckte Schlagzeilen stachen ihr ins Auge.
Umsturz in Berlin!
Aufrührer stellen ein Ultimatum an die Regierung.
Die Regierung aus Berlin geflüchtet.
Mit der Zeitung in der Hand erreichte Luise das Vorzimmer, in dem ihr Schreibtisch stand. Sie griff zum Telefon und rief Robert im Büro an.
«Hast du es schon gelesen? Dieser Kapp soll zum neuen Reichskanzler ernannt werden.»
Auch Robert hatte sich bereits informiert. «Ja, das Regierungsviertel ist umstellt. Aber Reichspräsident Ebert und Reichskanzler Bauer lassen sich nicht so einfach aus dem Amt jagen. Der Vizekanzler soll in Berlin geblieben sein und Flugblätter verteilen lassen. Mit einem Aufruf zum Generalstreik. Und die ersten Eisenbahner legen schon die Arbeit nieder. Sie stellen sich gegen die Putschisten.»
«Und was sollen wir jetzt machen?»
«Bleib in deinem Büro, Luise. Und bevor du Feierabend machst, fragst du am besten einen deiner Vorgesetzten, ob es sicher genug ist, nach Hause zu fahren. Sag mir auf alle Fälle Bescheid, ehe du die Burg verlässt.»
Luise versprach, vorsichtig zu sein und sich wieder zu melden.
Ella sah aus dem Fenster, obgleich es in dem düsteren Hinterhof nichts zu sehen gab. Kinderstimmen schallten zu ihr herauf. Wie jeden Tag spielten die Kinder, die nicht gerade in der Schule waren, im Hof oder draußen auf der Straße. Wie hätten sie es auch in den engen, überfüllten Wohnungen aushalten können, wo sie nur im Weg waren, wenn die Mutter bei ihrer Heimarbeit an der Nähmaschine saß. Oder sie war den ganzen Tag außer Haus, um Geld zu verdienen, und die Kinder blieben allein. Viele Frauen hatten ihre Ehemänner im Krieg verloren, oder die einst stolzen Soldaten waren als körperliche oder seelische Krüppel heimgekehrt und konnten höchstens noch bettelnd auf das Mitleid der Menschen hoffen. Die gesunden Männer hatten Arbeit in einer der Fabriken, aber häufig saßen sie abends lieber mit ihren Kollegen in der Kneipe, spielten Karten und gaben ihr Geld für Molle und Korn aus, statt zu ihrer Familie heimzukehren und die Haushaltskasse zu füllen.
Einen Vater, der das sauer verdiente Geld versaufen konnte, gab es in Ellas Familie nicht mehr. Er war an der Front geblieben und hatte die inzwischen sechsundzwanzig Jahre alte Ella mit der Mutter Rosa, ihrem Bruder Paul und der kleinen Minna zurückgelassen; die Schwester war allerdings noch vor Kriegsende am Fieber gestorben. Also gab es jetzt nur noch Rosa, die so gut wie keine Witwenrente bekam und darum in Heimarbeit Wäsche ausbesserte. Den achtundzwanzigjährigen Paul, der sich nachts auf der Straße herumtrieb und mal Geld hatte oder auch nicht. Und Ella, die nichts mehr hasste als die nach Schimmel und ranziger Suppe riechende Zweizimmerwohnung, in der sie aufgewachsen war.
Als Kind hatte sich Ella in der Schule angestrengt und die Volksschule mit einem guten Zeugnis verlassen. Das Gymnasium oder gar ein Studium waren jenseits ihrer Hoffnungen. Daher hatte sie eine Lehre in einem Lebensmittelladen begonnen und sich nach ihrem Abschluss in allen Kaufhäusern der Stadt beworben. Nun war sie seit zwei Jahren das stolze Fräulein Verkäuferin modischer Damenhüte im Kaufhaus von Hermann Tietz am Alex, der neben diesem und dem Haupthaus in der Leipziger Straße noch weitere Filialen in Berlin betrieb, die die Leute kurz Hertie nannten.
Mit ihrem ersten Geld hatte sich Ella eines der kleinen Zimmer unterm Dach im Seitenflügel des um verschiedene Höfe verschachtelten Hauses gemietet und sich ihr eigenes kleines Reich eingerichtet. Natürlich musste sie der Mutter ab und zu helfen oder Paul unterstützen, wenn der wieder einmal pleite war, aber ansonsten konnte sie sich nach der Arbeit in ihre eigene Kammer zurückziehen, die sie, wie ihre Kleidung, penibel sauber hielt.
Heute war Ella bei ihrer Mutter, die in dem abgewetzten Sessel neben dem kalten Herd saß und eine Schürze säumte. «Warum biste nich bei der Arbeit? Hab’n se dir rausgeschmissen?»
«Nee», wehrte Ella ab. «Alle streiken. Auch Hertie hat dichtgemacht. Die von der Reichswehr wollen unsern Kanzler absetzen und schießen auf die Roten.»
«Is der Krieg nich vorbei?», versicherte sich Rosa und legte grübelnd die Stirn in Falten.
«Schon», bekräftigte Ella. «Aber die Anhänger vom Kaiser wollen keine Republik mit den Sozialdemokraten. Und sie wollen einen von ihren Generälen als Präsident oder Kaiser oder so.»
«Und deswegen gehste nich auf Arbeit?»
«Mama, alle streiken! Niemand arbeitet. Wir müssen abwarten, wer gewinnt und wie’s dann weitergeht.»
Rosa Weber versuchte, diese Information zu verarbeiten. «Aber wo is dann der Paul? Wenn alle streiken, warum is er heut Nacht nich heimgekommen?»
«Weil bei dem, wat der macht, keiner streikt», wandte Ella ein.
«Wat macht er denn?», wollte die Mutter wissen. Sie schüttelte den Kopf. «Ick hab’s mal gewusst, aber jetzt fällt’s mir wieder nich ein.»
Ella rollte mit den Augen. «Is ganz gut, dass du det vergessen hast. Det willste gar nich so genau wissen!»
«Doch! Ick bin doch seine Mutter.»
Ella schwieg. Sie stellte ihrer Mutter einen Teller mit warmer Suppe auf den Tisch, legte einen Kanten Brot von vorgestern dazu.
«Willste nich mit mir essen?», rief Rosa ihrer Tochter nach, als diese hastig die Tür hinter sich schloss.
In ihrem kleinen Zimmer setzte Ella sich an ihren eigenen Tisch und öffnete eine Flasche Bier. Genüsslich trank sie Schluck für Schluck, während ihre Gedanken in die Zeit des Krieges zurückwanderten. Der Hunger, der tägliche Kampf um jedes Stückchen Brot, die anstrengende Arbeit in der Munitionsfabrik, in der sie die letzten beiden Kriegsjahre zusammen mit der Mutter hatte arbeiten müssen.
Wann eigentlich hatte das mit Rosas Vergesslichkeit angefangen? Mit Minnas Tod oder schon früher, als der Vater gefallen war? Nein, um ihn hatte die Mutter weit weniger gebangt als um ihren Paul, der dann aber glücklicherweise unversehrt zurückgekommen war, anders als so viele andere Freunde und Nachbarn …
April 1917. «Hast du schon gehört?», fragte Gertrud Richter ihre Tochter, als sie von ihrem täglichen Schlangestehen nach Lebensmitteln mit karger Beute nach Hause gekommen war. «Robert ist da.»
«Was redest du da?» Luise kam mit einem Handtuch um ihre nassen Haare aus dem Badezimmer. «Das kann nicht sein. Johannes hat mir geschrieben, dass sie vor Juli nicht auf Heimaturlaub hoffen dürfen.»
«Ich habe ihn aber gesehen», widersprach Gertrud. «Er sieht verdammt fesch aus in seiner Uniform. Was glaubst du, wie er erst in einer Offiziersuniform aussehen wird!»
Luise sah ihre Mutter strafend an. «Unsere jungen Männer tragen Uniform, um Franzosen, Engländer, Russen und wen sonst noch alles totzuschießen.»
«Die unsere Feinde sind und Deutschland die Luft zum Atmen genommen haben», ergänzte Gertrud erregt. «Wir wollten diesen Krieg nicht. Sie haben ihn uns aufgezwungen, und nun müssen wir uns verteidigen, wenn unser deutsches Volk nicht untergehen soll.»
«Ach, und das glaubst du noch immer?», kommentierte Luise in sarkastischem Tonfall. «Wobei … in einem hast du vermutlich recht. Momentan können wir nicht einfach aufhören und sagen: Wir behalten die eroberten Gebiete, und dabei belassen wir es. Wobei ich mich frage, ob die Alliierten einem Friedensvertrag zustimmen würden, wenn Deutschland bereit wäre, in seine alten Grenzen zurückzukehren.»
«Luise! Das wäre die Katastrophe und eine Blamage vor der ganzen Welt. Dann wären all die Soldaten und auch Roberts Vater umsonst gefallen. Dann wären alle unsere Entbehrungen sinnlos.» Ihre letzten Worte waren beinahe ein Schluchzen.
«Sind sie das nicht in jedem Fall?»
«Das darfst du nicht sagen! Was ist mit dem neuen Lebensraum, den das deutsche Volk braucht, um seinen Geist und seine Kultur auszubreiten?»
Luises Miene verdüsterte sich noch mehr. «Mama, du solltest nicht immer diese völkischen Blätter lesen. Sonst willst du womöglich irgendwann mit Johannes’ Familie nichts mehr zu tun haben.»
«Du meinst, weil die Großeltern Juden waren?» Gertrud wiegte den Kopf hin und her. «Ich weiß nicht recht. Ich habe nichts gegen die Rosensteins, aber ich habe immer das Gefühl, die scheinen sich als was Besseres zu fühlen und halten andere auf Abstand. Und wer ist nicht an der Front und stattdessen im Ministerium befördert worden? Samuel Rosenstein, der Vater von Johannes! Nein, getauft oder nicht, so richtige Deutsche sind sie einfach nicht und lassen lieber unsere Männer und Söhne ihre Haut zu Markte tragen.»
«Johannes ist mit Robert gemeinsam an der Front, und sein Vater ist deutlich älter als Roberts Vater!», verteidigte Luise die Familie von Johannes.
Gertrud zuckte mit den Schultern. «Mir jedenfalls sind die Wagenbachs lieber. Willst du nicht runtergehen, Robert begrüßen? Unser Beileid zum Verlust des Gatten habe ich Frau Wagenbach bereits versichert.»
Genau das tat Luise und stiefelte ein Stockwerk tiefer in die Beletage hinunter.
Obgleich das Telegramm schon einige Tage alt war, fand sie Margarete Wagenbach in Tränen aufgelöst, während Robert den Tod des Vaters tapfer hinnahm.
«Lass uns ein wenig rausgehen», schlug er vor, vermutlich, um der bedrückenden Atmosphäre und der leidenden Miene seiner Mutter zu entkommen.
«Es tut mir so leid», bekräftigte Luise. «Ich habe deinen Vater sehr gerne gemocht. Es ist schrecklich, wenn ein Elternteil so plötzlich stirbt. Du weißt, wie es mich damals getroffen hat, als mein Vater mit seinem Wagen verunglückt ist.» Sie drückte Roberts Hand und ließ es zu, dass er sie festhielt.
«Für dich war es vermutlich noch schlimmer», vermutete Robert. «Du warst ein paar Tage vorher gerade einmal siebzehn geworden.»