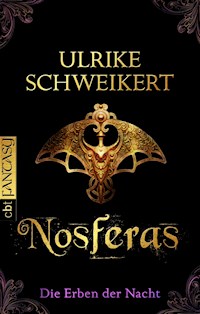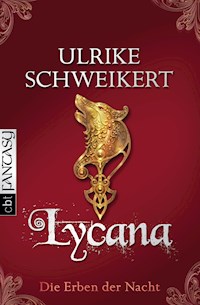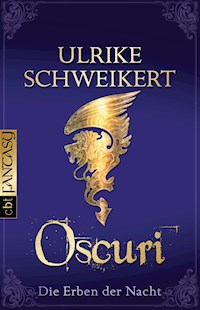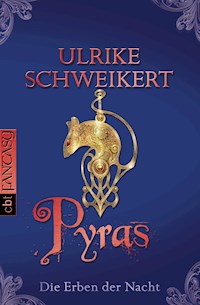9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Friedrichstraßensaga
- Sprache: Deutsch
Die große Familiensaga von Bestsellerautorin Ulrike Schweikert geht weiter. Zwei Schwestern, eine geteilte Stadt und ein Geheimnis, das eine Familie zu zerreißen droht . Zusammen sind sie in Berlin aufgewachsen: die Freunde Robert, Johannes, Ilse und Ella. Bis der Krieg sie trennte. Nun herrscht Frieden, doch die Wunden sind tief. Auch der Bahnhof Friedrichstraße wurde teilweise zerstört. Eines ist zum Glück geblieben: Johannes' Kiosk, der Fixpunkt der Freunde, die längst zu einer Familie geworden sind. Vor allem für Roberts Tochter Lilli ist er immer wieder Zuflucht. Hier lernte sie ihre große Liebe Michael kennen – doch er verschwand von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben. Und nun muss Lilli ihre Zwillingsmädchen Anne und Cornelia allein großziehen. Dabei merkt sie, dass es vor allem die Frauen sind, die in diesen ersten Nachkriegsjahren fest zusammenhalten, um zu überleben. In einer zunehmend geteilten Stadt wird der Zusammenhalt wichtiger als je zuvor. Und ausgerechnet der Bahnhof Friedrichstraße mit dem angrenzenden Tränenpalast wird zum Symbol der deutsch-deutschen Trennung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ulrike Schweikert
Berlin Friedrichstraße: Tränenpalast
Roman
Über dieses Buch
Zwei Schwestern, eine geteilte Stadt und ein Geheimnis, das eine Familie zu zerreißen droht
Zusammen sind sie in Berlin aufgewachsen: die Freunde Robert, Johannes, Ilse und Ella. Bis der Krieg sie trennte. Nun herrscht Frieden, doch die Wunden sind tief. Auch der Bahnhof Friedrichstraße wurde teilweise zerstört. Eines ist zum Glück geblieben: Johannes’ Kiosk, der Fixpunkt der Freunde, die längst zu einer Familie geworden sind. Vor allem für Roberts Tochter Lilli ist er immer wieder Zuflucht. Hier lernte sie ihre große Liebe Michael kennen – doch er verschwand von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben. Und nun muss Lilli ihre Zwillingsmädchen Anne und Cornelia allein großziehen. Dabei merkt sie, dass es vor allem die Frauen sind, die in diesen ersten Nachkriegsjahren fest zusammenhalten, um zu überleben. In einer zunehmend geteilten Stadt wird der Zusammenhalt wichtiger als je zuvor. Und ausgerechnet der Bahnhof Friedrichstraße mit dem angrenzenden Tränenpalast wird zum Symbol der deutsch-deutschen Trennung.
Die große Familiensaga von Bestsellerautorin Ulrike Schweikert geht weiter.
Vita
Ulrike Schweikert arbeitete nach einer Banklehre als Wertpapierhändlerin, studierte Geologie und Journalismus. Seit ihrem Romandebüt «Die Tochter des Salzsieders» ist sie eine der bekanntesten deutschen Autorinnen historischer Romane. Beide Bände ihrer Erfolgsreihe «Die Charité» standen in den Top 10 der Bestsellerliste und begeisterten zahlreiche Leser und Leserinnen. «Tränenpalast» ist der zweite Teil der Friedrichstraßensaga, die eine Berliner Familie begleitet vom Ersten Weltkrieg über die 1920er-Jahre bis zum Mauerbau und dem Leben in einer geteilten Stadt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Heike Brillmann-Ede
Karte Peter Palm, Berlin
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Ildiko Neer/Trevillion Images; Berlin, Postkarte, ca. 1900; Shutterstock
ISBN 978-3-644-00283-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In Liebe für Peter und zur Erinnerung an meine treue Chakira
Von der «Niemandszeit» sprach man, von der «Wolfszeit», in der «der Mensch dem Menschen zum Wolf» geworden war. Dass sich jeder nur um sich selbst oder sein Rudel kümmerte …
Harald Jähner
Prolog
Es war ein trüber Novembertag, seit fünf Jahren war Adolf Hitler Reichskanzler. Johannes stand vor den eben erst gelieferten Kisten, doch das Auspacken konnte er sich sparen. Schon wieder hatten sie mehrere Bündel Zeitungen unbrauchbar gemacht. Die letzten beiden Male hatten die rechten Rüpel Bier über die Zeitungen geschüttet, die auf dem Verkaufstresen ausgebreitet lagen, dieses Mal hatten sie sich etwas Neues überlegt. Johannes rümpfte die Nase. Dem Gestank nach zu urteilen, hatte jemand einen Eimer Jauche ausgekippt, und da Johannes nicht davon ausging, dass man die zufällig am Bahnhof Friedrichstraße mit sich rumtrug, musste er sich eingestehen, dass diese Anschläge auf ihn geplant waren. Vermutlich sollte er noch dankbar sein, dass sie ihn dieses Mal weder verprügelt noch den Kiosk angezündet hatten.
Johannes starrte auf die stinkende Bescherung zu seinen Füßen und überlegte, wie er diese am besten entsorgen könnte, ohne selber tagelang nach Schweinejauche zu stinken. Dann durchzuckte ihn ein zweiter Gedanke: Wo sollte er möglichst schnell neue Zeitungen herbekommen? Soweit er es überblicken konnte, war die Ausgabe der Berliner Morgenpost an diesem Tag verschmutzt sowie andere Zeitungen aus den jüdischen Verlagshäusern Ullstein und Mosse. Die Bündel aus dem rechten Verlagshaus Hugenberg, wo der Berliner Lokal-Anzeiger und die Tägliche Rundschau erschienen, waren nicht betroffen. Das passte, dennoch wunderte sich Johannes, dass die Schmutzfinken sich überhaupt die Mühe gemacht hatten, nachzusehen, was sie vernichteten. Wobei ihn der hingeschmierte Judenstern in Alarm versetzte.
Johannes seufzte tief. Zwar stand seit dem Brand vor einigen Jahren nicht mehr der Name JohannesRosenstein als Eigentümer auf dem Kioskschild, sondern Lilli Wagenbach, trotzdem war er selbst nur allzu bekannt. Zudem – was scherte es die Rechten, dass bereits sein Vater sich zum Christentum bekannt hatte und auch er selbst getauft war? Für die Nationalsozialisten blieb er der Jude und musste unter ihrem Rassenwahn leiden. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Und wo würde das enden?
Unbehagen breitete sich in ihm aus, als er an die Berichte dachte, die er in den vergangenen Tagen gelesen hatte: Tausende Juden wurden mit Sonderzügen an die polnische Grenze gebracht. Deportiert. Aus der Heimat vertrieben.
Ein ungutes Gefühl ergriff von ihm Besitz und breitete sich wie eine eiskalte Welle in ihm aus. Der Gedanke war ihm schon einige Male gekommen, und er hatte ihn stets rüde beiseitegeschoben: So schlimm würde es schon nicht werden. So schlimm durfte es nicht werden. Doch heute ließen sich seine innersten Befürchtungen nicht mehr unterdrücken: Es würde schrecklich werden, vermutlich schrecklicher, als es sich irgendeiner vorstellen konnte!
«Ich werde weggehen», sagte Johannes, als er am nächsten Abend am gediegenen Esszimmertisch in der großen Wohnung seines Freundes Robert Platz genommen hatte. «Aus Deutschland weggehen!»
Alle Augen richteten sich auf ihn. Fragend, verwundert, entsetzt. Robert, der Gastgeber, mit dem er schon zur Schule gegangen war und dann in den Großen Krieg, Roberts Tochter Lilli, die inzwischen zwölf Jahre alt war und das Gymnasium in Charlottenburg besuchte, und Johannes’ erfolgreiche ältere Schwester Ilse, deren Modeentwürfe bei den Reichen und Schönen Berlins noch gefragter waren als früher.
Lilli reagierte als Erste. Sie sprang von ihrem Stuhl auf, lief um den Tisch und schlang ihre Arme um Johannes. «Nein, Onkel Johannes, das darfst du nicht. Du wirst mich doch nicht alleine lassen.»
Johannes drückte einen Kuss auf ihr wie eine Kastanie glänzendes Haar und sah in ihre Augen, in denen Tränen zu schwimmen begannen. Es waren Luises Augen, deren Blick ihm bis ins Mark fuhr, selbst wenn Lillis Augen eher grünlich als blau waren. Auch das herrlich blonde Haar ihrer Mutter hatte sie nicht geerbt, war mit ihrer Lockenpracht aber nicht minder hübsch als Luise in diesem Alter.
«Und was ist mit mir?», schaltete sich Ilse ein. «Mich willst du auch so einfach hier sitzen lassen?»
Johannes schüttelte den Kopf. «Nein, ich möchte dich bitten, mit mir zu kommen.»
Robert machte eine abwehrende Handbewegung. «Unterlass solche Scherze. Was sollte denn dann aus dem Kiosk werden?»
«Vielleicht komme ich irgendwann wieder zurück.» Johannes hob die Schultern.
Roberts Augen weiteten sich. «Dir ist es wirklich ernst? Aber warum denn? Ich meine, ist etwas passiert?»
«Ein neuer Anschlag auf meine Zeitungen. Der Schaden hält sich in Grenzen, aber das ist es nicht. Nicht allein. Wir leben zunehmend in einem Klima von Misstrauen und Angst. Seht ihr denn nicht, was da läuft? Wer jemals dachte, die Nazis würden sich schon mäßigen, wenn Hitler erst einmal Reichskanzler ist, der hatte in den vergangenen Jahren genug Zeit, sich vom Gegenteil zu überzeugen. Die Hetze wird immer schärfer, inzwischen schrecken sie nicht einmal mehr davor zurück, Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben und gegen ihren Willen über die Grenze nach Polen zu schieben!»
«Ja, das ist schrecklich», stimmte Ilse ihrem Bruder zu. «Im Osten auf dem Land gehen seltsame Dinge vor sich, aber wir sind hier in Berlin!»
Sie schwiegen, als sich die Tür öffnete und Elfriede, die Haushälterin, den Servierwagen hereinschob. Sie verteilte die Platten mit Braten, Soße, Gemüse und Kartoffelklößen auf dem Tisch, wünschte den Herrschaften einen guten Appetit und zog sich wieder in die Küche zurück.
«Lilli, setz dich bitte auf deinen Platz», meldete sich die fünfte Person am Tisch zu Wort, die bisher geschwiegen hatte.
Widerstrebend löste sich Lilli von Johannes und kehrte zu ihrem Stuhl neben ihrer Großmutter zurück. Gertrud Richter hatte in diesem Jahr ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert. Der frühe Tod ihrer Tochter Luise hatte sie hart getroffen, dennoch hielt sie sich mit eisernem Willen aufrecht. Johannes war sich sicher, dass ihre Enkelin, von der sie ja nur ein Stockwerk entfernt wohnte und die die Zeit nach der Schule häufig bei ihr verbrachte, ihren Lebensmut aufrechterhielt. Zwar kümmerte sich auch Ilse um ihr Patenkind, doch sie war beruflich eingespannt und hatte längst nicht so viel Zeit wie Lillis Großmutter.
Nun übernahm Gertrud das Zepter und verteilte das Essen auf die Teller. Eine Weile aßen alle schweigend, bis Ilse ihre Gabel beiseitelegte und ihren Bruder fixierte.
«Und wohin willst du gehen?»
«Nach Frankreich.»
«Wohin in Frankreich?», erkundigte sie sich, während Robert gleichzeitig aufbegehrte: «Ausgerechnet zu den Franzosen? Sind wir nicht in den Schützengräben gelegen, um unsere Erbfeinde zu töten?»
«Das stimmt. Aber hast du je einen dieser Erbfeinde näher kennengelernt?»
Robert schnaubte. «Nicht im Krieg, denn wenn nicht ich geschossen hätte, hätten sie es getan, und du könntest mich das jetzt nicht mehr fragen.»
«Paris», murmelte Ilse, und plötzlich begannen ihre Augen zu funkeln. «Ja, Paris wäre nicht schlecht. Dort ließe sich etwas anfangen. Vielleicht sollte ich Französisch lernen?»
«Ich will auch mit!», rief Lilli und sah zwischen Johannes und ihrer Patentante hin und her.
Ilse sackte ein wenig in sich zusammen. «Nein, Schatz, das geht nicht. Außerdem willst du doch sicher bei deinem Papa und der Großmutter bleiben.»
Lilli schob die Unterlippe vor und verschränkte die Arme vor der Brust. «Ich will, dass alle bleiben!»
Erneut senkte sich betretenes Schweigen herab, während Elfriede die Teller abräumte, den Pudding mit eingemachten Kirschen servierte und Kaffee und Tee einschenkte.
Lilli blieb bockig und rührte ihren Pudding nicht an. «Ich will das nicht», beharrte sie.
«Es können sich aber nicht alle nach dir richten», bemerkte ihr Vater streng und fuhr dann, zu Johannes gewandt, fort: «Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es besser, wenn ihr für eine Weile weggeht und abwartet, bis der ganze Spuk vorbei ist. Es wird ja wohl nicht ewig so weitergehen! Irgendwann haben die Leute von Hitlers und Goebbels Kampfreden die Nase voll und werden wieder vernünftig.»
«Wenn es nur keinen neuen Krieg gibt», sagte Gertrud leise.
«Aber es wird Krieg geben!», behauptete Johannes. «Hört euch nur Hitlers Reden an.»
«Und was willst du mit dem Kiosk machen?», wollte Robert wissen. «Ihn verkaufen?»
«Das darfst du nicht!», begehrte Lilli auf. «Der Kiosk gehört mir. Da steht Lilli Wagenbach auf dem Schild!»
Johannes nickte. «Ich denke, ich werde mich nach einem Pächter umsehen.»
«Du willst tatsächlich gehen.» Ilse seufzte. Sie schob Lilli die verschmähte Puddingschale wieder hin. «Iss, du magst ihn doch so gerne. Ich bleibe ja bei dir.»
«Und Onkel Johannes?»
«Der schaut sich in Paris um, wie das dort so ist, und wenn er eine hübsche Wohnung gefunden hat, dann besuchen wir ihn und sehen uns zusammen den Eiffelturm an.»
«Versprochen?» Lilli schaute zu Johannes hinüber, bis dieser nickte. Erst dann griff sie nach ihrem Löffel und schaufelte sich Vanillepudding mit Kirschen in den Mund.
Am nächsten Tag schoss der polnische Jude Herschel Grynszpan auf den deutschen Botschafter in Paris, NSDAP-Funktionär Ernst vom Rath, nachdem Grynszpan erfahren hatte, dass seine Familie von Deutschen aus ihrem Haus vertrieben worden und mit vielen anderen Juden ins Niemandsland zwischen Deutschland und Polen deportiert worden war. Mit Schaudern las Johannes ein paar Zeilen aus dem Leitartikel des Völkischen Beobachters:
Es ist klar, daß das deutsche Volk aus dieser neuen Tat seine Folgerungen ziehen wird. Es ist ein unmöglicher Zustand, daß in unseren Grenzen Hunderttausende von Juden noch ganze Ladenstraßen beherrschen, Vergnügungsstätten bevölkern und als «ausländische» Hausbesitzer das Geld deutscher Mieter einstecken, während ihre Rassengenossen draußen zum Krieg gegen Deutschland auffordern und deutsche Beamte niederschießen.
Johannes fragte sich, ob er überhaupt noch nach einem Pächter suchen oder lieber sofort aufbrechen sollte.
In dieser Nacht brannten die ersten Synagogen, jüdische Einrichtungen und Friedhöfe wurden zerstört, Scheiben eingeschlagen und Läden verwüstet oder in Brand gesetzt. In Zivil gekleidete Männer zerrten Juden aus ihren Wohnungen und misshandelten sie auf offener Straße unter den Augen und dem Beifall der Umstehenden. Johannes war sich sicher, dass viele der aufgebrachten Bürger, die mit Hand anlegten und die Umstehenden anstachelten, üblicherweise die Uniformen von SA oder SS trugen. Er verrammelte seinen Kiosk, so gut es ging, und floh in Ilses Wohnung in die Kommandantenstraße. Während der Mob auf dem nahen Hausvogteiplatz tobte, hatten die Geschwister Glück und blieben in ihrer Wohnung unbehelligt.
Am nächsten Tag, dem 10. November 1938, bestieg Johannes einen Zug, der ihn nach Paris brachte. Weder Robert noch Ilse versuchten, ihn aufzuhalten.
Kapitel 1
Um genau 3:38 Uhr begann in den ersten Morgenstunden des 2. Februar 1945 das anschwellende Heulen der Sirenen. Fliegeralarm. Schon wieder.
Lilli fuhr aus ihrem kurzen, unruhigen Schlummer und schwang die dick bestrumpften Beine über die Bettkante. Sie fühlte eine tiefe Erschöpfung und war unendlich müde, gleichzeitig war sie hellwach und versuchte, neben dem an- und abschwellenden Warnton die Geräusche der Nacht einzufangen und zu sortieren. Eine der Zwillinge fing an zu schreien. Ihre Schwester stieg mit schrillem Geheul ein, das sogar die Sirenen übertönte. Rasch schlüpfte Lilli in ihre Schuhe und warf sich den Mantel über, der neben dem Bett bereitlag. Sie hatte sich eh vollständig angezogen ins Bett gelegt, was einerseits der Winterkälte und ihren kärglichen Kohlevorräten geschuldet war, andererseits bei nächtlichem Alarm kostbare Zeit sparte.
Alle Handgriffe waren vielfach eingeübt. Lilli schlüpfte in die Riemen ihres schweren Rucksacks und griff dann nach den Henkeln der beiden Weidenkörbe, die seit den zunehmend nächtlichen Bombenangriffen zu Bettchen für die nun drei Monate alten Zwillinge umfunktioniert worden waren. In jedem strampelte und schrie eines der Mädchen, lautstark gegen die nächtliche Störung protestierend.
«Ihr habt völlig recht», murmelte Lilli und wankte mit Rucksack und den Säuglingen Cornelia und Anne zur Wohnungstür. Gerade als sie den Treppenabsatz betrat, wurde auch gegenüber die Tür aufgerissen. Ein trüber Lichtschein schälte Wände, Treppenstufen und Geländer aus der nächtlichen Finsternis, während ihre Nachbarn ebenso eilig die Wohnung verließen: Mutter Erika mit Marie, ihrer Jüngsten, an der einen Hand, in der anderen den Kellerkoffer, gefolgt von der dreizehnjährigen Margret und dem bereits fünfzehnjährigen Rainer, der einen Rucksack mit einer aufgenähten Hakenkreuzfahne geschultert hatte.
«Hilf Lilli», drängte die Mutter, als Rainer schon die Hand nach einem der übergroßen Henkelkörbe ausstreckte. Dankbar überließ Lilli ihm eines der schreienden Kinder, griff mit der freien Hand nach dem Geländer und hastete hinter den Nachbarn die Treppe hinunter. Aus der Erdgeschosswohnung wankte Frieda Niedham, die den kleinen Laden direkt neben der Wohnung betrieb, der früher einmal ihrem Vater, Herrn Stöckler, gehört hatte. Nun ja, streng genommen war ihr Mann Reinhard jetzt der Chef über das nur noch spärliche Warenangebot, doch der kämpfte seit vielen Monaten, wie alle anderen Männer des Hauses auch, irgendwo an der Front.
Alle außer Friedas Onkel Werner Volkhardt, im letzten Krieg schwer verwundet, der als einziger Mann im Haus an der Kommandantenstraße den Posten als Luftschutzwart für diese Hausgemeinschaft übertragen bekommen hatte. Damit war er verantwortlich für die Einteilung weiterer wichtiger Posten. Da war, ganz wichtig, die Hausfeuerwehr: Marion, Gerda und Christa aus dem zweiten Stock, die beim Einsatz von Brandbomben Löschversuche unternehmen mussten, bis – wenn überhaupt – die richtige Feuerwehr eintraf. Da war aber auch Erika als Laienhelferin, die eine Schulung als medizinische Hilfskraft hatte besuchen müssen. Und dazu gehörte der sogenannte Melder, der bei Bombentreffern noch während des Angriffs sofort zum nächsten Polizeirevier laufen musste, um Bericht zu erstatten. Für diese Aufgabe hatte sich Rainer freiwillig gemeldet und wartete sehnlich darauf, endlich eine Heldentat vollbringen zu dürfen, wobei der Rest der im Keller Versammelten mit Inbrunst hoffte, dass ihr Haus auch dieses Mal von Treffern und Feuersbrünsten verschont bleiben möge.
Noch auf dem Weg in den Keller konnte Lilli beim Abschwellen des Sirenentons die ersten Flugzeugmotoren hören. Wieder die Briten, da war sie sich sicher. Es waren immer die Briten, die die Berliner mit ihren Bomben nachts aus dem Schlaf rissen; die amerikanischen Flieger griffen bei Tag an. Noch waren die Tommys weit genug weg – und sie mussten in ihrem nur spärlich beleuchteten Keller nicht beim Pfeifen der fallenden Bomben ängstlich die Köpfe einziehen. Die ersten Detonationen klangen wie fernes Gewitter, die Flak begann zu bellen.
Erschöpft stellte Lilli den Korb mit der weiter schreienden Cornelia auf den Boden, streifte den Rucksack ab und ließ sich auf ihren niederen gepolsterten Stuhl an der Wand fallen. Rainer stellte den anderen Korb, in dem Anne lag, daneben und setzte sich dann zu seiner Familie. Jeder hatte seinen festen Kellerplatz, den er sich so wohnlich wie möglich eingerichtet hatte. Lilli rückte sich zwei Kissen in ihrem schmerzenden Rücken zurecht und streichelte mit jeder Hand eines der vom Schreien erhitzten Kindergesichter, während ihr Blick durch den Raum wanderte. Die Petroleumlampe, die an einem Balken hing, spendete ein wenig Licht. Weiter hinten aus den Schatten leuchteten die auf Augenhöhe rundum mit Phosphor bestrichenen Balken in diffusem Grün, damit keiner mit dem Kopf dagegenstieß, sollte die Lampe verlöschen. Das Gas war sicher schon mit der ersten Vorwarnung abgestellt worden, und der Strom fiel sowieso häufig aus.
Lilli spürte die missbilligenden Blicke einiger der Kellergestalten auf sich ruhen. Und Luftschutzwart Volkhardt hatte tatsächlich gerade gesagt: «Stellen Sie das ab!»
Ja, Bomben und Kindergeschrei mitten in der Nacht waren für die Nerven vermutlich zu viel. Lilli sah nicht einmal zu ihm auf. Stattdessen nahm sie Cornelia aus dem Korb, griff nach der Decke, die das Mädchen weggestrampelt hatte, und wickelte sie darin ein. Unter ihrem halb offenen weiten Mantel knöpfte Lilli die Bluse auf und entblößte ihre Brust. Gierig schloss sich der Kindermund um ihre Brustwarze und saugte sich geradezu gewaltsam daran fest. Vermutlich war nicht mehr viel zu holen. Kein Wunder, wenn sie daran dachte, was sie in den vergangenen Wochen gegessen hatte: überlagerte Kartoffeln, Grießbrei, mit Wasser gekocht, oder Brotsuppe und die allgegenwärtigen Rüben, die nach allem oder nichts schmecken konnten. Doch mit was sollte man ihnen auch Geschmack verleihen? Alles war knapp und teuer oder einfach nicht zu bekommen, und zum Ende des Winters gab es nicht einmal mehr Kräuter zu sammeln, die noch im Sommer am Ufer des Kanals und in den Ruinen zerbombter Häuser zu finden waren. Löwenzahn und Brennnesseln gegen Skorbut! So weit waren sie schon gekommen!
Nun, da Cornelias Gebrüll verklungen war, konnte man neben den fernen Bombeneinschlägen und dem Bellen der Flak das Greinen ihrer zweitgeborenen Schwester Anne hören. Lilli spürte einen Anflug von schlechtem Gewissen. Von Anfang an hatte sich Cornelia, was ihr zustand, energisch erkämpft. Sie kam Lilli wie ein Kuckuckskind vor, das die Schwächere gnadenlos aus dem Nest drängt. Anne dagegen war zart und ruhig, weniger robust und kam immer ein wenig zu kurz, fürchtete Lilli. Sie schob Anne den alten Schnuller in den Mund, den sie selbst nach ihrer Geburt geschenkt bekommen hatte. Natürlich war der Schnuller mit dem Beißring alt, und es hatte in besseren Tagen modernere Dinge für ein Baby gegeben, doch Lilli hing mit zärtlichen Erinnerungen daran, die sie jedes Mal überfluteten, wenn sie den Ring in den Fingern hielt. Es war ihr dann, als könne sie die Stimme ihrer Mutter hören und spüren, wie die warme Hand über ihr Haar strich. «Den hat dir der liebe Onkel Johannes kurz nach deiner Geburt geschenkt», hatte Luise oft gesagt, und Lilli lauschte in Gedanken dem Klang ihrer Stimme, die in diesen Momenten anders klang. Zärtlich und traurig zugleich. So wie Lilli sich fühlte, wenn sie an ihre früh verstorbene Mutter dachte. Und an all die anderen, die sie mit so viel Liebe aufgezogen hatten und von denen sie sich auf die eine oder andere Weise verlassen fühlte. Ihren Vater, Ilse, Johannes und … Nein, an den Vater der Zwillinge wollte sie jetzt nicht denken.
Einsamkeit, das Gefühl, verlassen zu sein, teilte Lilli dieses Schicksal nicht mit fast allen Nachbarn hier unten im Keller? Berlin war eine Stadt der Frauen und Mädchen geworden. Väter, Ehemänner und Söhne waren an der Front, gefallen oder verschollen. Nur Alte und Versehrte wie Volkhardt oder Jungs wie Rainer waren noch da. Menschen eben, die Hitler in seinem Krieg nicht gebrauchen konnte. Wobei der Kreis derer, für die der Führer keine Verwendung fand, immer mehr schrumpfte, je schlechter die Lage auf den Schlachtfeldern rund um Deutschland zu werden schien. Im vergangenen September hatte der Führer propagandawirksam den Volkssturm ins Leben gerufen, in dem alle waffenfähigen Männer zwischen sechzehn und sechzig Jahren, die noch nicht der Wehrmacht dienten, zur Verteidigung des Heimatbodens eingesetzt werden sollten. Die ersten Verbände waren den Berlinern zum Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig im Oktober bei einer Parade vorgeführt worden, wie üblich begleitet von aufpeitschenden Reden des Reichspropagandaministers Goebbels. Ob er auch nur ein einziges Wort seiner Reden selbst glaubte? Die Leute, die Lilli kannte, misstrauten den tönenden Phrasen jedenfalls schon lange.
Dass man aus Zeitungen und dem Radio nicht die Wahrheit erfuhr, war nicht nur Lilli klar. Die Fetzen, die man aus verbotenen Flugblättern oder aus der Gerüchteküche vernahm, waren jedenfalls so niederschmetternd, dass kein vernünftiger Mensch mehr ernsthaft auf den Endsieg hoffen konnte, den die Partei so verbissen beschwor.
Endlich schien Cornelia zufrieden, und Lilli packte sie in ihren Korb zurück, ehe sie der kleinen Anne die andere Brust anbot. Ihr Blick streifte Volkhardt, der herüberstarrte, der alte Idiot. Und auch Rainer, der wie seine beiden Schwestern an einem belegten Brot kaute, sah immer wieder zu Lilli, die sich bemühte, ihren nackten Busen unter dem Mantel zu verbergen. Als sich ihre Blicke kreuzten, schaute der Junge rasch zu Boden. Vermutlich wurde er sogar rot, aber das konnte sie in dem trüben Licht nicht erkennen. Erika wühlte in ihrem Bunkerkoffer und brachte noch eine zusammengeklappte Brotscheibe zum Vorschein. Sie nickte Lilli mit einem Lächeln zu, und schon kam Margret mit dem Brot in der Hand und hielt es ihr hin. Dankend nahm Lilli an. Hunger hatte sie eigentlich immer. Kein Wunder, ihre beiden kleinen Vampire saugten sie ja förmlich aus. Das dunkle Brot war mit irgendeiner Paste aus Gott weiß was beschmiert, die aber gar nicht schlecht schmeckte.
Während irgendwo in einem der benachbarten Stadtviertel Bomben fielen, Dächer und Wände barsten und Dachstühle in Flammen aufgingen, lächelte Lilli zu Erika hinüber und ließ sich den sorgsam vorbereiteten Luftangriffsproviant schmecken. So saßen sie in ihrer Zwangsgemeinschaft beisammen, bis um 4:31 Uhr Entwarnung gegeben wurde. Alle schleppten sich und ihr Notgepäck in die Wohnungen zurück, um wenigstens noch zwei, drei Stunden Schlaf zu bekommen.
Einen Tag später stand Lilli gegen halb elf beim Bäcker an, um ihre Brotmarken einzulösen und vielleicht noch irgendetwas anderes Essbares zu ergattern, als die Sirenen erneut losheulten. Eine öffentliche Luftwarnung. Lilli fluchte laut. Jetzt stand sie schon über eine Stunde hier – Erika beaufsichtigte die Zwillinge –, und nun sollte sie ohne was nach Hause kommen? Die ersten Frauen rannten bereits in alle Richtungen davon. In der Innenstadt gab es öffentliche, unterirdische Bunker und riesige Hochbunker in den Flaktürmen, die bei einem Treffer viel eher Schutz boten als die meisten U-Bahnhöfe und heimischen Keller.
Lilli straffte die Schultern, schob sich in den Laden und ergatterte tatsächlich noch zwei Brote. Erst dann rannte sie, die Beute fest unter den Arm geklemmt, im Schatten der Häuserfronten zurück in ihre Straße, während die Flugzeuge weiter südlich, vermutlich Richtung Tempelhofer Feld, erste Bombenladungen herabregnen ließen. Die vielen Explosionen verschmolzen zu einem auf- und abschwellenden Dröhnen, das immer näher kam. Die Erde rumorte und bebte.
An einer Ecke blieb Lilli mit Seitenstechen kurz stehen und sah die Straße nach Süden runter. Vor Schreck bekam sie einen Schluckauf. Der Himmel schien übersät von Flugzeugen, ein Schwarm schwarzer Rieseninsekten tauchte über den Dächern auf und raste auf sie zu, als wollte er ganz Berlin verschlingen. Das mussten viele Hundert Maschinen sein! Lilli rannte weiter. Hoffentlich war Erika mit den Kindern schon im Keller. Das Pfeifen der herabfallenden Bomben schrillte in ihren Ohren. Das ohrenbetäubende Krachen der Explosionen, dann das Donnern zusammenstürzender Mauern. In Wellen umwehten sie der Rauch und der Geruch nach Brandbomben. Luftminen, Spreng- und Phosphorbomben regneten vom Himmel. Und dann traf nicht weit von Lilli entfernt einer der berüchtigten Wohnblockknacker, wie sie genannt wurden, die unvorstellbare Verwüstungen anrichteten.
Die Druckwelle der Explosion war so stark, dass Lilli gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Asche und Kalk hüllten sie ein, sie konnte nur noch husten. Blut rann ihr über die Hände, tropfte von Kopf und Gesicht. Sie hatte das Gefühl, taub zu sein, dennoch bestand ihr Kopf aus einem einzigen Fauchen und Brüllen. Die Hände an die Ohren gepresst, wankte sie auf den rettenden Eingang zu, stolperte und kullerte fast die Kellertreppe ihres Wohnhauses hinunter. Helfende Hände zogen sie hinein und führten sie zu ihrem Platz, neben dem bereits die Körbe mit den Zwillingen standen. Gott sei Dank!
Lilli sah Erika, die auf sie einredete, doch sie verstand kein Wort und konnte nur den Kopf schütteln. «Mir ist nichts passiert», versuchte sie zu sagen, während Erika ein Tuch in einen Wassereimer tauchte und damit Blut und Dreck aus Lillis Gesicht wusch. Bebend ließ sich Lilli auf ihren Stuhl sinken. Erika war hilfsbereit und lieb, dennoch sehnte sich Lilli plötzlich nach den Menschen, die ihr so vertraut waren und die sie aufgezogen hatten: nach ihrem Vater Robert und ihrer Patin Ilse, nach ihrer Großmutter Gertrud und nach Ella Weber, die auch draußen in Charlottenburg wohnte. Die treue Ella ihrer Kindertage aus dem Hinterhaus, die später mit ihrem Sohn Michael bei Großmutter zur Untermiete gewohnt hatte. Und sie sehnte sich nach Johannes, Ilses Bruder, der immer für sie da gewesen war und den sie sogar noch mehr liebte als ihren Vater.
Die Innenstadt von Berlin war nicht mehr wiederzuerkennen. Nicht einmal zwei Stunden hatte der Fliegeralarm am 3. Februar 1945 gedauert, bis der erlösende Entwarnungston in die Berliner Keller und Bunker drang. Und nicht einmal zwei Stunden waren nötig gewesen, um weite Teile des Zentrums und des unmittelbar angrenzenden Stadtbezirks Kreuzberg mit Sprengsätzen und Brandbomben zu zerstören. Fast eintausend amerikanische Bomber hatten den Angriff geflogen.
Als die Menschen aus den Kellern auf die Straßen hinausquollen, war die Luft von Staub und dichtem Qualm erfüllt, der den Himmel verbarg und den Stand der Sonne nur noch vage erahnen ließ. Lilli stand mit den Körben in beiden Armbeugen neben der Haustür und starrte ihre Straße hinunter, wo aus geborstenen Wänden und zerstörten Dächern Flammen in die Höhe schlugen. Von den Häusern, die bisher den Blick nach Süden verwehrt hatten, waren nur Trümmerhaufen geblieben. Auch Richtung Stadttheater und Reichsdruckerei stieg schwarzer Rauch auf. Zumindest waren die Feuerwehrleute der Hauptwache so nah dran, dass sie nicht einmal ihre Feuerwehrwagen besteigen mussten, zu zahlreichen anderen Bränden in der Stadt rückten sie mit jaulenden Sirenen aus. Kleinere Brände mussten die Hausgemeinschaften eh selbst bekämpfen. Dazu musste man – seit Goebbels Aufruf zur ständigen Luftschutzbereitschaft von 1943 – stets wassergefüllte Badewannen und Eimer vor allem in den oberen Stockwerken sowie Gartenschläuche bereithalten und, wenn kein Wasser da war, Sandsäcke und Feuerpatschen.
Warum haben wir nicht einen Gedanken daran verschwendet, was da auf uns zukommen könnte?, wunderte sich Lilli nicht zum ersten Mal, als sie jetzt mit ihren Kindern auf dem Gehweg stand. Dabei war bereits zwei Jahre vor dem Einmarsch in Polen der Polizeipräsident von Berlin auch zum Leiter des Luftschutzes ernannt worden. Zudem hatte eine Verordnung die Berliner Bevölkerung angewiesen, aus Brandschutzgründen alle Dachböden zu entrümpeln und das Holz mit Feuerschutzmittel zu behandeln. Und bereits im Mai 1939 war eine Verdunklungsverordnung erlassen worden.
Herr Volkhardt und Erika kamen von ihrer üblichen Hausinspektion nach jedem Angriff zurück und vermeldeten, dass die Schäden überschaubar waren. Die letzten intakten Scheiben waren zu Bruch gegangen und das Dach von einem Blindgänger durchschlagen worden, der nun im Dachboden steckte und mit einer nassen Decke gesichert worden war. Lediglich eine Ecke des Daches war eingestürzt, und infolgedessen fehlte auch ein Mauerstück im zweiten Stock, doch der Rest der Außenwand schien stabil zu sein.
«Wir haben mal wieder Glück gehabt», sagte Erika und nahm Lilli einen der Körbe ab.
«Ganz im Gegensatz zu vielen anderen», stellte Lilli fest.
Auch das Nachbarhaus hatte deutlich mehr abgekriegt. Die Fassade war fast vollständig eingestürzt, und die Trümmer versperrten die Eingangstür. Zum Glück hatten die beiden Hausgemeinschaften im zweiten Kriegsjahr gemäß der Aufforderung für Sicherungsmaßnahmen gegen Luftangriffe eine Wand zwischen beiden Kellern durchgebrochen und einen Zugang geschaffen, durch den die Nachbarn gerade auf die Straße traten. Die ersten Frauen begannen schon die Trümmer vor der Haustür wegzuräumen. Die Wohnungen waren vermutlich nur noch zum Teil bewohnbar. Die Südwand fehlte fast völlig, und an der Westseite klafften riesige Löcher, durch die man in die Zimmerreste sehen konnte. Im zweiten Stock ragte ein halbes Kinderbett mit einer hellblauen Decke gefährlich über die Bruchkante. Das dazugehörende Bürschchen kam zum Glück gesund und munter auf dem Arm seiner Mutter aus dem Keller.
«Lass uns hochgehen», schlug Erika vor. «Ich helfe denen oben beim Aufräumen, und du legst dich hin und ruhst dich ein bisschen aus.»
Lilli musste ihr die Worte von den Lippen ablesen, denn in ihren Ohren dröhnte und rauschte es noch immer, ihr Kopf schmerzte, und ihr war übel, daher widersprach sie nicht. Nachdem sich die Nachbarin verabschiedet und Lilli den Mädchen die Brust gegeben hatte, sank sie aufs Bett und fiel in einen ohnmachtstiefen Schlaf.
Später gab es Graupensuppe unten bei Frieda, die meist nach den Luftangriffen für alle im Haus einen großen Topf Suppe oder Eintopf kochte und dafür auf die Ladenvorräte zurückgriff. Ihr Vater, der alte Stöckler, hätte sicher nicht anders gehandelt. Bei Friedas Mann allerdings hatte Lilli so ihre Zweifel, und Volkhardt beschwerte sich eh über alles. Seine Kritik zu überhören, darin hatte Frieda Übung. Jedes Mal versuchte der Luftschutzwart durchzusetzen, dass die Hausbewohner ihre Suppe bezahlten, doch davon wollte seine Nichte nichts wissen. Dank Friedas Großzügigkeit blieb es ihnen erspart, sich in die Schlangen vor den städtischen Suppenküchen einzureihen, die nach Luftangriffen erstaunlich schnell in den Notunterkünften für Ausgebombte Essen anboten. Draußen in Hohenschönhausen hatte die Nationalsozialistische Wohlfahrt auf einem Fabrikgelände eine Großküche errichtet, von der aus das Stadtzentrum und die nahen Wohnviertel versorgt wurden.
Nun saßen sie also alle um Friedas Esstisch: Lilli und Erika mit ihren Kindern, Herr Volkhardt und seine Schwester, die verwitwete Lehrerin Johanna Förster, die zusammen die kleine Wohnung im zweiten Stock bewohnten, sowie die Familie Leonhardt aus der großen Wohnung über Erika. Dem dazugehörigen Großvater würden sie später eine Schüssel Suppe hochbringen müssen.
Frieda verschwand noch einmal in den Kellerräumen des Ladens und kam mit zwei Flaschen Wein zurück. «Dass wir diesen Tag so gut überstanden haben – na, wenn das kein Grund zum Trinken ist!», verkündete sie und griff nach einem Korkenzieher.
«Ja, wer weiß, wie lange wir noch trinken können», grummelte Johanna und stürzte den Inhalt ihres Glases in einem Zug hinunter.
«Auf die, die wir lieben», sagte Lilli und dachte an ihren Vater und all die anderen, die sie so lange schon nicht mehr gesehen hatte. «Auf dass sie alle gesund wiederkehren mögen.»
Wie betäubt saß Michael 1944 seiner Mutter am Tisch gegenüber. Sie streckte den Arm aus, um ihn zu berühren, doch er zog seine Hand so hastig zurück, dass der Stuhl, auf dem er saß, mit einem unangenehmen Geräusch über den Boden scharrte.
«Ich musst es dir sagen, bevor’s zu spät is», fügte Ella unsicher an.
«Ehe es zu spät ist», wiederholte Michael langsam. «Na ja, dann hält mich hier ja nichts mehr fest, oder? Dann brauche ich nicht im Untergrund mein Leben zu riskieren und ab und zu wie ein Verbrecher nachts zu Ilses Wohnung schleichen. Der Genosse wird sich freuen, wenn ich mich seiner Reise nach Moskau anschließe. Er sagt, dort können sie einen Mann wie mich mit solch einem ungewöhnlichen Gedächtnis und dem Blick für das Verborgene gut gebrauchen. Die KPD wird mein Talent schätzen! Ich werde studieren dürfen, denn dort muss man nicht die richtigen Eltern haben, um auf die Technische Hochschule zu gehen. Ich war in der Schule immer der Beste in Mathematik und Physik, und trotzdem hatte keiner den Einfall, ich solle Abitur machen!»
«Du hast doch zur Polizei wolln», erinnerte Ella.
Michael starrte sie an. «Ja, weil ich sonst keine Möglichkeiten hatte. Ich wäre gern Ermittler bei der Kripo geworden, und ich würde das gut machen! Ich sehe einfach Dinge und Zusammenhänge, die anderen nicht auffallen. Aber das Polizei-Institut hier in Charlottenburg wurde ja zu einer Führerschule der Sicherheitspolizei umgewandelt. Weißt du, was bei denen neben Kriminalwissenschaft und Rechtskunde noch auf dem Stundenplan steht? Zur Praxisnähe gehört der Besuch eines Konzentrationslagers. Hast du eine Ahnung, was die SD-Leute dort mit Menschen wie Johannes und Ilse machen?»
Ella war blass geworden und schüttelte wild den Kopf. Sie wollte das nicht hören – und lenkte ab. «Wirste ihr Bescheid sagen?»
«Ich? Warum ich? Nein, ich werde morgen nach Moskau abreisen und verschwinden. Für immer.»
Kapitel 2
An diesem Abend im März 1945 traf sich in Thüringen an den Südausläufern des Harzes eine Gruppe von Männern, um in einem der hübschen Fachwerkhäuser des mittelalterlichen Städtchens Nordhausen ein Glas zu heben.
«Willst du nicht mit?»
Robert schüttelte den Kopf.
«Ach, komm. Nur auf ein Bier. Die Kollegen treffen sich im Gasthaus Zum Kreuz, das wird sicher lustig. Ich denk, nach so einem Tag haben wir uns das verdient.»
«Nein, Karl, danke, aber ich bin müde», wehrte Robert ab. «Ich geh lieber ins Bett.»
«Schlafen kannst du, wenn du tot bist!», widersprach Karl, einer der Waffeningenieure und Experte für Raketenantrieb.
«Wenn ich tot bin, kann ich hoffentlich endlich durchschlafen.»
Karl verdrehte die Augen. «Sind dir die Nachrichten derart aufs Gemüt geschlagen? Der Führer glaubt an unseren Sieg, also sollten wir es auch tun. Schließlich bauen wir hier seine Wunderwaffe, die den ganzen Krieg wenden wird. Vertrau mir, ich hab das Ding mitentwickelt!» Karl grinste und klopfte Robert auf den Rücken. «Los jetzt. Trink mit uns auf den Führer, danach darfst du in dein Bett.»
Auf den Führer zu trinken war das Letzte, was Robert wollte, dennoch tappte er mit Karl die engen, gewundenen Gassen der Altstadt entlang. Nicht nur, dass Robert diesen Krieg nie befürwortet hatte, er hatte nicht einmal den Führer gewählt, der nichts Besseres im Sinn gehabt hatte, als das Reich in die Katastrophe zu stürzen.
Ohne mich!
Es war nur konsequent gewesen, nicht an die Front zu gehen. Nicht erneut auf Menschen zu schießen, die er nicht kannte und die ihm nichts getan hatten. Seitdem Krieg herrschte, kroch Robert in seinen Albträumen erneut durch die schlammigen Felder der Westfront, die ihm in der Blüte seines Lebens die Seelenruhe geraubt hatten. Heute vermischten sich die Bilder mit neuem Gräuel.
Ich bin Ingenieur, Statiker, sagte er sich. Wie kann das etwas Schlechtes sein? Trotzdem stöhnte Robert innerlich. Die Welt des Führers und seiner Partei hatte es geschafft, aus vielen Dingen, die ursprünglich gut und konstruktiv gewesen waren, etwas Schlechtes, Zerstörerisches zu machen. Und so klebte auch an seinen Händen das Blut vieler Menschen, obwohl er nie eine Waffe oder die Hand gegen sie erhoben hatte.
Aber er hatte auch niemals Nein! gesagt. War niemals den Schreien seines gequälten Gewissens gefolgt, hatte nie seine gute Stellung und sein Ansehen riskiert, um dem täglich erlebten Unrecht zu widersprechen. Er war einfach in diese Rolle hineingerutscht und darin stecken geblieben …
Zu Anfang hatte er nur den Wunsch, nie wieder eine Waffe tragen zu müssen. Und bei Lilli, seiner Tochter, in Berlin zu bleiben. Wie gut, dass er sich als erfahrener Ingenieur beim Bau unterirdischer Bahnhöfe und Tunnel unentbehrlich gemacht hatte. Das war nicht möglich gewesen, ohne einen gewissen gesellschaftlichen Umgang mit wichtigen Männern der Partei zu pflegen, seine eigene Meinung zu schlucken und mitzuschwimmen.
Dazu gehörte ebenfalls, der NSDAP beizutreten und den Kontakt zu Wissenschaftlern zu pflegen, die der Führer um sich scharte. Das waren keine Nazis im eigentlichen Sinn, das waren brillante Köpfe mit bahnbrechenden Ideen. Leider verhalfen diese Ideen auch dazu, modernere Waffen zu entwickeln, die noch mehr Menschen schneller und präziser töten konnten. Dennoch bewunderte Robert Männer wie Wernher von Braun, Robert Lusser oder Fritz Gosslau, die schon in Peenemünde auf Usedom die Raketenproduktion vorangebracht hatten. Die immer intensiver werdende Luftschlacht über deutschem Gebiet hatte es dann notwendig gemacht, die Produktion an einen sicheren Ort zu verlegen. Die Wahl war auf das Bergwerksstollensystem bei Nordhausen im Harz gefallen. Und in einer Zeit zunehmender Bedrängnis für die Wehrmacht, in der jeder waffenfähige Mann zur Verstärkung an die Front geschickt wurde, kam Robert mit seinen Erfahrungen ins Spiel.
Es ging um den Ausbau und die statische Sicherung der Bergwerksstollen für die Produktion der bahnbrechenden V2-Raketen. Bomben, die ohne Pilot von der Heimat aus bis an ihr Ziel gelenkt werden könnten, Hunderte Kilometer weit entfernt. Waffen, die keine eigenen Verluste fordern würden! Wie viele Opfer es geben würde, wenn diese Raketen ihr Ziel erreichten, darüber wollte Robert nicht nachdenken. Alle Waffen wurden gebaut, um dem Feind zu schaden. Das lag in der Natur des Krieges.
Also war Robert im September 1943 in den Harz gereist, zum Südhang des Kohnsteins, wo die deutsche Mittelwerk GmbH aufgebaut wurde. Ein teils staatliches, teils privatwirtschaftliches Rüstungsunternehmen, an dem auch das Rüstungsministerium und die SS unternehmerisch beteiligt waren.
Es war ein Pakt mit dem Teufel, bei dem er seine Seele verlieren würde, und tief in seinem Innern hatte Robert das auch gewusst, doch er wollte sich noch immer einreden, dass dies die beste Wahl gewesen war.
Für Lilli? Damit sie nicht auch noch ihren Vater verlieren würde, der ja, streng genommen, gar nicht ihr Vater war. Für ihn selbst? Damit er am Ende des Krieges unversehrt sein würde, nicht zum Krüppel geschossen wie sein Freund Johannes während ihres gemeinsamen Kriegseinsatzes 1917?
Robert betrachtete seine Hände, sah runter auf die Füße. Dieser Plan war bisher aufgegangen, er hatte noch alle seine Glieder. Die unterirdischen Tunnel hatten ihn und die anderen wichtigen Männer des Führers geschützt. All diejenigen jedoch, die die schwere Arbeit zu leisten hatten, starben zu Tausenden wie die Fliegen.
Natürlich, dachte Robert, Zwangsarbeiter hatte es immer schon gegeben, Gefangene, die beispielsweise im Straßenbau schuften mussten. Und sicher waren sie nie mit Samthandschuhen angefasst worden. Das Leben im Gefängnis oder im Arbeitslager war hart, es sollte ja eine Strafe sein und kein Vergnügen.
Für diejenigen, die gegen das Gesetz verstießen, Gewalt ausübten, jemanden beraubten oder gar ermordeten, fand Robert solch eine Strafe durchaus angemessen. Doch in den Lagern rund um die Mittelwerk GmbH traf das vermutlich nur auf wenige zu. Seit Hitler sich zum Reichskanzler hatte ernennen lassen, schienen Arbeitslager wie Pilze aus dem Boden zu schießen – das wusste auch Robert –, und zwar nicht, weil das Reich von immer neuen Verbrechenswellen heimgesucht wurde. Zumindest nicht von solchen, die man früher mit Zuchthaus bestrafte. Seit Hitler an der Macht war, genügte es schon, nicht die «richtige» Meinung zu vertreten oder von der «richtigen» Blutlinie abzustammen, um enteignet, verhaftet und in ein Lager verschleppt zu werden.
Auch wenn Zwangsarbeiter in den Straßen und Fabriken von Berlin längst ein alltägliches Bild geworden waren, begriff Robert das Ausmaß der Menschenverachtung erst, als er mit seiner Arbeit im Mittelwerk angefangen hatte. Der Stollenausbau, die Sicherung der Kavernen und die Produktion der Raketen stützten sich maßgeblich auf den Einsatz von Häftlingen, die aus dem KZ Dora-Mittelbau kamen, einer Außenstelle des KZ Buchenwald bei Weimar.
Die deutschen Kräfte waren hauptsächlich bei der Planung und Kontrolle der Produktion tätig und für die Beaufsichtigung der fünftausend Zwangsarbeiter verantwortlich, von denen viele beim Ausbau der Stollen eingesetzt wurden, um Raum für weitere Unternehmen zu schaffen, die hierher verlagert werden sollten, sicher vor den Luftangriffen der Alliierten.
Gebaut wurden die A4-Raketen, auch V2 genannt, aber zeitweise auch die Fieseler Fi 103, genannt V1. Ziel war es, London mit diesen Fernwaffen zu zerstören, um die Briten zu Verhandlungen zu zwingen und die Angriffe der Royal Air Force auf deutsche Städte und Fabriken zu stoppen. Seit Herbst 1944 wurde auch der sogenannte Volksjäger, die Heinkel He 162, im Harz gefertigt. Die Zwangsarbeiter trieben die benötigten Stollen ohne technische Geräte vor, nur mit dem Gebrauch ihrer Muskelkraft. Und bauten Stollen, die ursprünglich als Treibstofflager dienten, in eine Raketenfabrik um.
Die gesamte Anlage bestand aus zwei parallelen, zweihundert Meter voneinander entfernt verlaufenden Tunneln – in Nord-Süd-Richtung von einer Bergseite zur anderen mit einer Höhe von gut dreißig Metern. Diese sogenannten Fahrstollen wurden mit mehr als vierzig Querstollen verbunden, in denen die Produktion angesiedelt war. Eisenbahnschienen wurden verlegt, um zunächst die Einzelteile, dann die fertigen Raketen transportieren zu können. Die Häftlinge errichteten sogar einen Güterbahnhof, der über einen Gleisanschluss in Nordhausen an alle wichtigen Bahnstrecken des Reichs angebunden wurde.
Robert sah sie vor sich, die ausgemergelten Gestalten mit geschorenen Köpfen und knochigen Körpern. Die hohlwangigen Gesichter verrieten, wie armselig ihre Essensrationen sein mussten. Zum Leben zu wenig und ein Todesurteil angesichts der harten Arbeit. An jedem Tag brachen Arbeiter aus schierer Erschöpfung zusammen. Die Aufseher versuchten, sie mit Schlägen und Fußtritten zum Aufstehen zu zwingen und sie weiterzutreiben, doch viele blieben einfach liegen und starben. Mit Loren wurden die Leichen aus den Stollen transportiert, Tag für Tag, und irgendwo auf Haufen geworfen, um sie dann von anderen Häftlingen in Massengräbern verscharren oder verbrennen zu lassen. Nachdem man sie zuvor entkleidet und ihre Kittel, Hosen und Schuhe für die nächsten Zwangsarbeiter eingesammelt hatte.
Robert hatte nie einen Häftling geschlagen oder getreten, doch reichte das aus, um ein guter Mensch zu sein, vor sich selbst bestehen zu können? Hatte er solche Szenen nicht nahezu täglich mitangesehen und dazu geschwiegen? Was aber würde geschehen, wenn er widerspräche? Kein einziger Häftling würde dadurch gerettet. Viel wahrscheinlicher wäre es, dass Robert ihr Schicksal teilen müsste, bis zum Tod.
Die Bedingungen für die Häftlinge waren von Anfang an menschenunwürdig gewesen. Zuerst hausten sie in provisorischen Zelten, bis sie sich selbst einen vom Haupttunnel abzweigenden Schlafstollen gegraben hatten. Danach sahen sie das Tageslicht nicht mehr, hatten nie mehr frische Luft zum Atmen, waren nur noch umgeben vom Gestank verwahrloster Körper, von Exkrementen und dem lebensgefährlichen Staub nach den Sprengungen, der die Lungen schädigte und den Verfall beschleunigte. Erst 1944 «durften» sie draußen ein Lager errichten, umgeben von Wachtürmen und mit Hochspannung geladenem Stacheldraht …
«Robert? Hast du mir überhaupt zugehört?» Karl blieb stehen und wandte sich dem Kameraden zu.
«Oh ja, klar», log Robert und versuchte sich an einem Lächeln. Sie hatten den Gasthof erreicht. Vor ihnen betraten gerade zwei SS-Offiziere das Lokal.
«Das erste Bier geht auf mich», sagte Robert, um Karl auf andere Gedanken zu bringen.
Wie erwartet schlug ihm dieser grinsend auf die Schulter. «Du bist ein braver Kamerad.»
In der rauchgeschwängerten Gaststube mischten sich schwarze Totenkopfuniformen mit grauen und braunen Anzügen. Herrenmenschen unter sich, dachte Robert. Er fühlte, wie die Übelkeit in ihm aufstieg, und hoffte, dass er sein Bier nicht gleich wieder von sich geben würde.
Ende März ließ Lilli die Zwillinge nachmittags bei Erika und machte sich auf den Weg in die Friedrichstraße. Die Brände des letzten Großangriffs der Amerikaner waren gelöscht, die Aufräumarbeiten hatten begonnen, aber noch verkehrten keine Straßenbahnen. Also lief Lilli über den Hausvogteiplatz und den Gendarmenmarkt zur Friedrichstraße hinüber, der sie bis zum Bahnhof folgte. Von den Warenhäusern rund um den Hausvogteiplatz stand nicht mehr viel, das Kirchenschiff des Französischen Doms auf dem Gendarmenmarkt war bereits im Frühling des vergangenen Jahres ausgebrannt, die Kuppel wenig später eingestürzt.
Lilli umrundete den Bahnhof Friedrichstraße, dessen Fassade ebenfalls Schaden genommen hatte. Zwei kleine Trupps magerer Männer und Frauen in blau-weiß gestreifter Sträflingskleidung waren dabei, den Platz und die Halle von Trümmern zu befreien. Vermutlich waren es Zwangsarbeiter aus dem Lager Am Zirkus, das nur zwei Minuten entfernt auf der anderen Spreeseite lag.
Lilli strebte direkt auf den Kiosk zu, der, seit Johannes abgereist war, bereits drei Pächter gesehen hatte. Der aktuelle war offensichtlich heute nicht aufgetaucht, denn es lag noch ein verschnürtes Bündel Zeitungen vor dem geschlossenen Rollladen. Lilli entriegelte das Schloss und schob den Laden hoch. Die Regalbretter waren fast leer, und das Hinterzimmer bot auch nicht viel. Lilli packte einige Schachteln Zigaretten und zwei Flaschen Schnaps in ihren Rucksack und schrieb einen Zettel, den sie unter die Kasse klemmte. Dann schloss sie sorgsam wieder ab. Sie musste unbedingt Milch für die Zwillinge organisieren sowie Haferflocken oder Grieß und ein wenig gutes Fett. Mit Lebensmittelmarken kam sie momentan nicht weit, so blieb nur der Schwarzmarkt, und dort waren Zigaretten und Alkohol die beste Währung.
Lilli durchquerte die Bahnhofshalle, um sich auf den Rückweg zu machen, als ihr Blick plötzlich an einer Gestalt hängen blieb, die ihr vertraut schien. Sie blieb abrupt stehen und betrachtete die Frau, die auf einem verschlissenen Koffer saß. Sie trug einen alten Mantel, unter dem ein graues Kleid hervorschaute, dazu dicke Strümpfe, robuste Schuhe und ein Kopftuch, unter dem graue Haarsträhnen vorlugten. Unbeweglich saß sie da, die Arme um die angezogenen Beine geschlungen, den Blick auf die Schuhspitzen gerichtet. Bilder ihrer Kindheit tauchten aus Lillis Erinnerungen auf. Ihr Herz krampfte sich zusammen.
«Ella?», rief sie ungläubig.
Die Frau hob die Lider. Aus ihrem Blick sprach ein Leben voller Arbeit und Leid, doch dann glomm eine Wärme in ihnen auf, die Lilli berührte.
«Lilli?»
Die Frau rappelte sich auf, öffnete die Arme und ließ sie mit verlegener Miene sogleich wieder sinken. Dennoch eilte Lilli auf sie zu und drückte sie an sich.
«Ella, du bist es wirklich! Wir haben uns die letzten Male nicht gesehen, als ich Großmutter in Charlottenburg besucht habe.»
Nun schossen Tränen in Ellas Augen. «Es is heut ganz früh passiert, es war noch dunkel, das Haus, der ganze Block – wir wurden schwer getroffen. Is alles ausgebrannt.»
Lilli spürte, wie sie blass wurde und die Knie weich. «Wir hatten auch Alarm und einige Treffer in der Nähe. Heute Nacht so gegen halb vier?», fragte sie.
Ella nickte. «So viele Bomben! Das Haus is einfach zusammengekracht. Dabei hatten wir Glück, ein Kellerzugang war nich verschüttet.»
«Und … Und Großmutter?», stieß Lilli hervor.
Ella schüttelte den Kopf. «Es war zu viel für ihr Herz. Als wir sie aus dem Keller gezogen ham, hat sie sich umgesehen. All die Zerstörung, das Feuer. Sie is einfach zusammengeklappt. Wir konnten sie nich mehr wach kriegen, und ein Arzt war auch nich da. Sanitäter ham sie dann mitgenommen, aber da war nix zu machen. Frau Richter is tot!»
«Oh Gott, Großmama. Nein!» Lilli klammerte sich an Ella. «Ich habe versucht, sie zu erreichen, und gedacht, nur die Leitung sei kaputt.» Tränen stürzten in ihre Augen.
«Ich wollt zu dir und es dir sagen, aber ich war so erschöpft. Ich wusst nich sicher, ob du noch in Ilses Wohnung bist und wie ich es mit dem Koffer bis zu dir schaffen soll. Ich kann ihn nirgends lassen, is alles, was ich noch hab. Ich sollt mich wohl erst bei der Volkswohlfahrt melden, um in ’ne Sammelunterkunft reinzukommen. Aber ich weiß nich, ob es klug is, meine Sachen dort zu lassen. So unbeobachtet.»
Lilli sah zwischen Ella und dem ramponierten Koffer hin und her. Viel konnte nicht drin sein. Wichtige Papiere, vielleicht ihre Marken, ein paar Lebensmittel, Kleidungsstücke, was man halt in einem Luftschutzkoffer transportierte. Sie griff nach Ellas Hand. «Komm erst mal mit zu mir. Wir können deinen Koffer zusammen tragen.»
«Biste sicher? Ich mein, du brauchst den Platz für euch – für dich und die Kinder. Es sind doch nur zwei Zimmer.»
«Und in wie vielen Zimmern hast du früher mit deiner Familie gelebt?»
Ella schüttelte den Kopf. «Das is was anderes. Ich komm aus’m Hinterhaus. Du bist in ’ner großen Wohnung vorn an der Straße aufgewachsen.»
«In so einer hast du inzwischen viele Jahre bei Großmutter gelebt. Und du hast dich, als ich noch ein Kind war, um mich gekümmert und mich genauso gut behandelt wie deinen Michael.» Lilli brach ab und schluckte.
Ella sah zu Boden.
«Dieser Krieg hat die alte Ordnung zerstört», fuhr Lilli fort. «Nun, man könnte fast sagen, er sei gerecht. Es trifft die Reichen wie die Armen, keiner ist vor den Bomben sicher. Es genügt ein Augenblick, um alles, was Generationen aufgebaut haben, zu verlieren. Wir müssen uns gar glücklich schätzen, solange wir mit dem nackten Leben davonkommen.» Lilli bückte sich und hob den Koffer auf. «Komm mit, ehe es wieder Alarm gibt.»
Schweigend gingen sie nebeneinanderher, bis Ella sich nach Johannes erkundigte.
«Haste was von ihm gehört?»
«Nicht in letzter Zeit. Er hat Ilse geschrieben, als er Paris verließ. Wer hätte gedacht, dass die SS ihn auch dort kriegen könnte?» Ella wartete, bis Lilli weitersprach. «Wir kennen den Ort nicht, an den er geflüchtet ist. Er hat nur geschrieben, er sei dort, wo er schon einmal Trost und Hilfe gefunden hätte.»
«Aveline», sagte Ella, und Lilli wunderte sich, dass sie den Namen der Frau kannte, die Johannes zum Ende des ersten Großen Krieges gepflegt hatte, sodass er zwar ohne Hand und mit einem steifen Bein, aber ansonsten gesund hatte heimkehren können.
«Ja, stimmt. Eine Frau des Feindes beschützt den uns so lieben und wichtigen Menschen. Ist das nicht verrückt?»
Ella schüttelte den Kopf. «Verrückt is, dass die Deutschen sich alle zum Feind machen. Dass sie so viele Leben zerstören und trotzdem sagen, Gott wär auf ihrer Seite.»
Überrascht blieb Lilli stehen. «Ich wusste nicht, dass du gläubig bist.»
«Bin ich nich.» Ella hob die Achseln. «Es is nur, ich weiß nix andres, das vielleicht Hoffnung gibt. Also versuch ich zu beten, dass er den Wahnsinn übersteht und lebend zurückkommt.»
Lilli war klar, dass Ella nicht mehr nur von Johannes sprach, sondern auch von ihrem Sohn Michael, der im vergangenen Frühjahr das letzte Mal in Berlin gewesen war. Zumindest hatte Lilli seitdem nichts mehr von ihm gehört. Sie brachte es nicht über sich, Ella zu fragen, seit wann sie keinen Kontakt mehr zu ihm hatte.
Die beiden Frauen erreichten das Haus und trugen den Koffer die Treppe hinauf.
«Hier wohnste also noch immer», stellte Ella fest, als sie die Wohnküche betraten. Auf dem Herd stand ein Kessel mit Windeln, und so roch es auch. Lilli entschuldigte sich und öffnete die mit Brettern und Pappe notdürftig reparierten Fenster, um so etwas wie frische Luft hereinzulassen.
Ella trat heran und sah hinaus auf die geschwärzten Ruinen. So weit das Auge reichte. «Ilse is schon lange fort, oder? Ich hatte immer Angst, dass die Gestapo sie holt. Nich nur, weil sie Rosenstein heißt.»
Lilli wusste genau, was Ella meinte. «Anders zu sein ist zu einem lebensgefährdenden Verbrechen geworden.»
«Ja, jeder, der den Nazis nich passt, wird ins Lager gesteckt.»
«Oder Schlimmeres», sagte Lilli düster und dachte erleichtert daran, dass Ilse in Sicherheit war. «Dabei wollen wir doch alle nur leben und glücklich sein.»
Kapitel 3
Es war an einem Frühlingstag 1939, als Ilse wie angewurzelt vor einem Plakat stehen blieb. Der Name der Sängerin sprang ihr ins Auge. Sie wusste nicht, ob sie eher Freude oder Schmerz empfand. Clara Brandel.
Wie lange hatten sie nichts voneinander gehört! Seit sie nach Wien gegangen war, um berühmt zu werden. Und es war Ilses Schuld, dass der Kontakt abgebrochen war. Sie liebte Clara zu sehr, um sich mit einer Brieffreundschaft und wenigen Besuchen begnügen zu können. Ilse hatte gehofft, mit der Zeit vergessen zu können, doch jetzt, als sie vor dem Plakat stand, riss alles wieder auf, die Sehnsucht nach Clara und ihrer gemeinsamen Zeit brach sich Bahn.
War es klug, den wiedererwachten Schmerz zu nähren? Ilse wusste es nicht, aber sie musste sie sehen und ergatterte tatsächlich noch eine Karte in einer der letzten Reihen.
Gut sah Clara aus, um keinen Tag gealtert, noch immer schlank und zierlich und so begehrenswert, noch mehr berührte ihre Stimme, Ilse musste ihre aufsteigenden Tränen wegblinzeln.
Sie sang viele altbekannte Stücke, die Erinnerungen aufsteigen ließen, aber auch beliebte Schlager wie Lale Andersens Lilli Marleen und Nur nicht aus Liebe weinen von Zarah Leander.
Nur nicht aus Liebe weinen
Es gibt auf Erden nicht nur den einen
Es gibt so viele auf dieser Welt
Ich liebe jeden, der mir gefällt
Am Ende des Konzerts blieb Ilse unentschlossen in der Eingangshalle stehen. Sollte sie Clara in ihrer Garderobe aufsuchen? Wollte Clara sie überhaupt sehen, oder würden ein kühler Blick und ein peinliches Schweigen ihren Schmerz noch vertiefen?
Da erklang hinter ihr die Stimme, die sie eben noch auf der Bühne gehört hatte. «Ilse? Bist du das?»
Langsam wandte Ilse sich um und sah in Claras so geliebtes Gesicht. «Ich dachte, ich höre mir mal an, wie du dich entwickelt hast.»
Clara zögerte, dann trat sie näher. «Ilse.» Es hörte sich an, als müsse sich ihr Mund erst wieder an den Klang dieses Namens gewöhnen. Einige Augenblicke suchte sie sichtlich nach Worten, dann sagte sie in neutral höflichem Tonfall: «Wie schön, dass du gekommen bist. Ich wollte in den nächsten Tagen bei dir vorbeischauen. Wohnst du überhaupt noch in der Kommandantenstraße?»
Ilse nickte, ging aber nicht darauf ein. «Hast du in Wien gefunden, was du gesucht hast?»
Nun wurde Claras Blick feucht. «Ja und nein. Auf der Bühne hatte ich den Erfolg, von dem ich geträumt habe.»
«Ich habe davon gelesen», murmelte Ilse, doch Clara fuhr schon fort: «Aber … Aber das allein hat mich nicht glücklich gemacht. Ich hätte dir schreiben sollen, doch ich habe mich davor gefürchtet, dass es alles noch schwerer machen würde. Ich dachte, es sei besser für uns beide, zu vergessen. Es tut mir so leid. Das war ein Fehler.»
«Dass du dich nicht gemeldet hast?»
«Dass ich dich verlassen habe!»
Sie starrten einander an.
«Ich wollte schon lange nach Berlin zurück, richtig, nicht nur für ein einzelnes Konzert, und nun endlich habe ich ein Engagement in einer Operette im Großen Schauspielhaus.»
«Theater des Volkes heißt das jetzt», korrigierte Ilse und zog eine Grimasse.
«Ja, ich weiß, es wurde modernisiert und eine Führerloge eingebaut. Nächste Woche beginnen die Proben zum Vogelhändler.»
Noch immer standen sie zwei Meter voneinander entfernt, und Ilse war es, als würde eine unsichtbare Mauer zwischen ihnen stehen.
«Und warum wolltest du bei mir vorbeischauen? Damit wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben?» Ilse war selbst erstaunt, wie schroff ihre Worte klangen.
Clara stürzten Tränen aus den Augen und rannen über ihre Wangen.
«Ach, Kleines, nicht weinen, das wollte ich nicht», rief Ilse und zog die Schluchzende in ihre Arme.
Clara presste sich an ihre Brust. «Ich war so dumm. Ich liebe dich. Immer noch. Ich kann und will dich nicht vergessen, aber ich habe so lange nicht gewagt, dich zu besuchen. Ich dachte, ich könne es nicht ertragen, wenn du mich wegschickst. Ich dachte, du hast längst eine andere …»
Ilse küsste erst Claras Stirn, dann ihre nasse Wange und zuletzt ihren Mund.
«Ach, Clara, nein, ich habe keine andere. Ich liebe dich. Nur dich!»
Clara wischte sich ihre Tränen aus dem Gesicht und lächelte zu Ilse hoch. «Komm, lass uns gehen!»
Ilse eilte den Ku’damm entlang. Ein eisiger Wind fuhr ihr um die Beine und zerrte an ihrem Mantel. Sie dachte an Clara und an ihre gemütliche Wohnung und freute sich, wie jeden Tag, zu ihr nach Hause zu kommen. Doch jetzt war sie sicher noch nicht daheim. Die Proben würden noch einige Stunden andauern.
Wie eine Erlösung drang unterhalb des in den Abendhimmel ragenden Turms der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche warmes Licht durch die Fenster des Romanischen Cafés. Das heimelige Gefühl, das sie überkam, verflog umgehend, als sie sich näherte und einen Blick nach drinnen warf.
Nein, dieses Café war nicht mehr das Heim der Künstler, das Außenbüro von Journalisten und Schriftstellern, ein Ort der freien Diskussion, wo junge Frauen wie sie selbst hingeströmt waren, um sich fürs Theater oder den Film entdecken zu lassen. Heutzutage trafen sich hier diejenigen Künstler, die sich für die Rassenideologie der Nationalsozialisten begeisterten und sich unter den Augen zahlreicher Gestapoleute wohlfühlten.
Angewidert glitt Ilses Blick über schwarze SS-Uniformen und rote Hakenkreuzarmbinden. Die Lust auf eine Tasse Kaffee war ihr vergangen, zumindest an diesem Ort. Schaudernd wandte sie sich ab und hielt das nächste Taxi an.
«Fahren Sie mich bitte zum Kabarett der Komiker am Lehniner Platz», sagte sie zu dem Fahrer. Als er kurz darauf vor dem Café hielt, drückte sie ihm einen Geldschein in die Hand und sprang aus dem Wagen. Mit einem Seufzer der Erleichterung trat sie ins Warme. Ein Kellner half ihr aus dem Mantel, als ihr Blick an einer bekannten Gestalt hängen blieb.
Ilse spürte, wie sich ein warmes Lächeln in ihr ausbreitete. Sie steuerte auf den Herrn zu, der alleine an einem Tisch saß, ein schulheftgroßes Notizbuch aufgeschlagen vor sich, das er offenbar eifrig Zeile für Zeile füllte.
«Einen schönen guten Abend, Herr Kästner, darf ich mich ein wenig zu Ihnen setzen?»
Sein Blick huschte zu ihr hoch, und sie sah, dass auch er sie wiedererkannte. «Fräulein Ilse, was für eine Freude! Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Setzen Sie sich! Was möchten Sie trinken?»
Er winkte einen Kellner herbei und bestellte Kaffee mit viel Zucker und Sahne.
Ilse leckte sich die Lippen, nahm Platz und sah den Autor an, dessen Kinderbücher sie Lilli so gerne vorlas. Ihr Patenkind mochte Emil und die Detektive und ganz besonders Das fliegende Klassenzimmer.
«Ja, es sind tatsächlich schon einige Jahre seit unserem letzten Treffen vergangen, dennoch habe ich häufig an Sie gedacht. Wenn ich Ihre Texte und Gedichte aus dem Regal ziehe und lese, fühle ich mich mit Ihnen verbunden. Ihnen gelingt es, meine diffusen Gefühle in Worte zu fassen. Und ich liebe Ihren Fabian! Wie haben Sie die Zeit verbracht, Herr Kästner? Wie geht es Ihnen?»
Kästner lächelte fein. «Nun, liebes Fräulein Ilse, den Umständen entsprechend gut. Ich arrangiere mich.»
«Heißt das, Sie schreiben weiter?» Bei ihrem letzten Zusammentreffen waren seine Werke auf dem Berliner Opernplatz verbrannt worden, darunter auch der Großstadtroman Fabian. Kästner war einer der verfemten deutschen Dichter und Denker!
«Ein wenig, ich kann nicht anders.» Er zwinkerte ihr zu. «Und hier in meinem Arbeitszimmer lässt es sich aushalten.»
«Ganz im Gegensatz zum Romanischen Café, nicht wahr?», gab Ilse zurück. «Dort hat uns die Kabarettistin Claire Waldoff vor vielen Jahren miteinander bekannt gemacht.»
Kästner nickte. «Ja, das Leon ist mein zweites Heim geworden. Und natürlich ist mir nicht entgangen, was für Leute heutzutage im Romanischen verkehren.»
Sie sahen einander an, und Ilse entdeckte Traurigkeit in seinem Blick. Ohne darüber nachzudenken, legte sie die Hand auf seinen Arm. «Dass Sie überhaupt noch hier leben», sagte sie. «Wo doch die meisten Ihrer entarteten Kollegen Deutschland längst verlassen haben. Woran arbeiten Sie denn?»
Kästner hob die Schultern. «Ich habe ein paar Gedichte geschrieben, die ich an einen Schweizer Verlag gegeben habe. Mit meinem Zauberlehrling, einem weiteren Roman für Erwachsene, komme ich allerdings nicht so recht voran. Aber ich texte nach wie vor ein wenig für die Komiker hier im Haus.»
«Stimmt, Sie haben doch auch vor Jahren das Programm für Trude Hesterberg geschrieben», erinnerte sich Ilse. «Ich habe mal eine ihrer Vorstellungen hier im Kabarett der Komiker gesehen.»
«Ach, Sie kennen die Trude?»
«Wir wurden einander von Claire Waldoff vorgestellt, bei einem gemeinsamen Treffen mit Kurt Tucholsky. Er hat für beide Künstlerinnen Texte geschrieben.»
Wieder hob Kästner die Schultern. «Ja, das war alles noch, bevor unsere Bücher auf dem Scheiterhaufen in Flammen aufgegangen sind.» Er beugte sich vor und meinte leise: «In diesen schlimmen Zeiten muss man sich eben neu erfinden – oder seinen neuen Werken einen neuen Autorennamen aufdrucken lassen.»
«Dass man zu so einer Verstellung gezwungen wird!» Mit Nachdruck schüttelte Ilse den Kopf. «Das Leben bei uns wird immer schwieriger. Mein Bruder ist nach Paris gegangen. Er will, dass ich nachkomme.»
«Werden Sie’s tun?»
«Ich weiß nicht. Berlin ist mein Zuhause. Berlin war immer mein Zuhause, manchmal erkenne ich es gar nicht wieder.»
Kästner blätterte gedankenvoll in seinen beschriebenen Notizbuchseiten.
«Was wird das?», erkundigte sich Ilse. «Falls Sie mir das verraten wollen.»
«Das ist eine Art Tagebuch. Manchmal denke ich, ich müsse festhalten, was hier alles passiert.» Er schlug die erste Seite auf und drehte das Buch so, dass sie ein paar Sätze lesen konnte.
In jener Nacht fuhr ich, im Taxi auf dem Heimweg, den Tauentzien und Kurfürstendamm entlang. Auf beiden Straßenseiten standen Männer und schlugen mit Eisenstangen Schaufenster ein. Überall krachte und splitterte Glas. Es waren SS