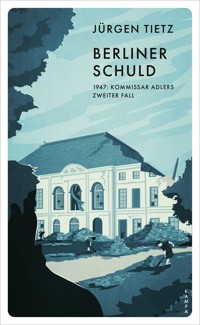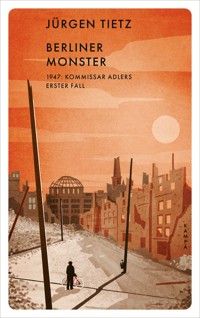
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1947 liegt Berlin in Trümmern, und der Winter scheint nicht enden zu wollen. Als aus dem noch halb zugefrorenen Landwehrkanal eine nackte Kinderleiche geborgen wird - das dritte misshandelte und erwürgte Kind innerhalb weniger Monate -, ist Kommissar Hans Adler fassungslos. Hat der Krieg nicht genug Grauen verursacht?Adler, der ohne seinen linken Arm von der Front zurückgekehrt ist und seitdem in einer Laube in Wilmersdorf wohnt, steht bei seinen Ermittlungen vor etlichen Problemen: Niemand kennt die Kinder; wie Hunderte andere müssen sie ihre Eltern im Krieg verloren haben - die überfüllten Flüchtlingsunterkünfte und Kinderheime nach Zeugen zu durchkämmen gleicht einer Nadelsuche im Heuhaufen. Und im Polizeipräsidium herrscht ein Klima des Misstrauens: Der Polizeipräsident scheint aus Moskau gesteuert zu werden, und auch die alten Parteigenossen sind längst wieder da. Eines Nachts wird Adler auch nochvon amerikanischen GIs entführt, die sich Informationen von ihm erhoffen. Wem kann Adler noch vertrauen? Wer wird ihm helfen, den brutalen Kindermörder zu stoppen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Tietz
Berliner Monster
1947: Kommissar Adlers erster Fall
Kampa
Nachkrieg
Zwischen den staubgrauen Ruinen sprossen erste Holunderbüsche hervor und kleine Essigbäume. Junge Akazien mit stachligen Stämmen machten sich breit. Wer konnte, zupfte den frischen Löwenzahn aus dem Boden, ehe es jemand anderes tat. Junge Brennnesseln geben einen köstlichen Salat. Giersch schmeckt würzig. Dazu etwas Öl auf Lebensmittelkarte. Oder vom Schwarzmarkt. Mit etwas Essig und einer Prise Salz – was für eine Delikatesse.
Der Krieg war vorbei.
Doch hinter dem Vorhang des Friedens dauerte er noch an. Der Krieg war leiser geworden, unsichtbarer, kälter. Der Krieg hatte sich neue Orte gesucht. Die Schützengräben und Frontlinien zogen sich nicht mehr sichtbar durch das Gelände. Der Krieg war nach innen gewandert. In die Köpfe der Menschen. Er zog mitten durch ihre Herzen. Nur manchmal zeigte er auf den staubigen Straßen der Stadt unvermittelt wieder seine Fratze. Dann zerrissen Donner die Stille des Tiergartens.
Wir zuckten zusammen.
Waren das wirklich Detonationen?
Passierte das nur in unseren Köpfen?
Oder waren es die Sprengungen der Aufräumarbeiten in den zahllosen Ruinen? Eine einstürzende Hauswand?
Panzer rasten durch die blasse Ruinenlandschaft am Landwehrkanal. Wir ängstigten uns. Warfen fragende Blicke umher. Dann herrschte plötzlich wieder Stille. Nachkriegstotenstille.
Hatte es schon wieder begonnen, das große Schießen? Das endlose Sterben? Waren die jüngsten Verhandlungen in Moskau gescheitert?
Wer wusste das schon?
Gerüchte waren die vage Währung des Alltags. Der Handel mit Zigaretten beherrschte den Schwarzmarkt. Doch erst die Gerüchte waren es, die ihren Wert steigen oder fallen ließen. Die Zeiten waren unsicher. Die Zukunft war ungewiss. Die Vergangenheit war kein Thema. Sie war ein dunkler Abgrund. Ein Nichts. Ein Alles. Ein Wimpernschlag. Ein Vergessen. Ein Verlust. Darüber strahlte ein blauer Frühlingshimmel, so blau, als wäre nichts geschehen. So blau, als wäre alles möglich. So blau wie bei der Olympiade. So blau wie vor Stalingrad. So blau wie über dem Lazarett in Bayern. So blau. So blau. So endlos blau.
Tag eins
Kommissar Hans Adler schaute die Reihe der kahlen Kastanien am Reichpietschufer entlang. Er gierte nach Sonne, gierte nach Wärme. Alle Berliner gierten in diesen Tagen nach Frühling. Zaghaft trauten sich erste Knospen aus den schweren braunen Ästen hervor. Erst seit wenigen Tagen war es in Berlin etwas wärmer geworden. Bis tief in den März hinein hatte der Winter die Stadt fest umklammert gehalten. Der Eiswinter. Der Hungerwinter. Der Todeswinter. Der Winter, in dem das große Sterben weiterging und einfach nicht mehr aufhören wollte. Das Sterben war jetzt ganz leise geworden. Es war kein lärmender Tod mehr in tosendem Bombenhagel und zerfetzenden Maschinengewehrsalven. Jetzt kroch er über Nacht in die frierenden kranken Körper. Es war ein stummer Tod der Erschöpfung. Bis auf die Knochen abgemagerte Leichen hatten sie in den vergangenen Monaten reihenweise aus Wohnungen und Verschlägen geholt. Verhungert. Oder erfroren. Wer konnte das schon so genau sagen? Wen interessierte das überhaupt?
Der graue Winter in Berlin war noch nie ein Vergnügen gewesen. Umso grausamer war er ohne Holz, ohne Kohlen, ohne Essen, ohne Medizin. Kein Wetter jedenfalls zum Baden in der Spree oder für die Schifffahrt. Auf dem Landwehrkanal trieben noch lange dicke Eisschollen. Deshalb hatte es wohl auch gedauert, ehe die Leiche des Jungen entdeckt wurde. Blass, aufgedunsen. Angefressen und ohne Augen lag der kleine Körper jetzt auf der Uferböschung des Kanals. Verloren in der Welt. Eine eilends herbeigeholte Decke verhüllte nur notdürftig den kindlichen Körper. Sie vermochte den Jungen nicht mehr zu wärmen.
Adler ging vorsichtig die steinernen Stufen der Böschung hinab und schaute auf das Kind. Zehn mochte der Bub gewesen sein, elf vielleicht. Noch vor der Pubertät jedenfalls. Noch bevor sein eigentliches Leben begonnen hatte. Gezeugt im Sommer der Olympiade vielleicht, hatte er kaum mehr erlebt als Not und Bomben, als Hunger und Ruinen und tausendfachen Tod. Um den Hals des Knaben zog sich eine dunkle Verfärbung. Würgemale. Über die Todesursache musste also nicht lange spekuliert werden.
Schwieriger war festzustellen, wie lange das Kind bereits im Wasser lag. Adler schloss die Augen. Er versuchte, sich das Gesicht des Kindes ohne die Entstellungen vorzustellen. Ein kleiner Junge, blond und schmächtig. Unter dem rechten Knie war eine Narbe. Vom Fußballspielen vielleicht?
Spatzen flatterten hektisch um die Kastanien, als wollten sie die Bäume zur Eile mahnen. Es ist Zeit zum Brüten, raunten sie. Wir brauchen Geäst. Wir brauchen Blätter als Schutz, schlagt endlich aus.
»Schon wieder ein Bub. Dachte mir, Sie wollen das bestimmt gleich sehen.«
Wachtmeister Hoffmann trat neben Adler.
Spielende Kinder hatten die Leiche entdeckt und ihren Eltern Bescheid gegeben.
Was für ein grausiger Fund, dachte Adler.
Aber wer wusste schon, welches Grauen diese Kinder schon zuvor erlebt hatten. Im Luftschutzkeller. In der Dunkelheit. Die Sirenen beim Fliegerangriff, die Müdigkeit, wenn sie aus dem Bett hetzen mussten. Nacht für Nacht die Koffer greifen. Das Nötigste gepackt. Für den schlimmsten Fall. Treppab. Los, schnell, schnell, beeilt euch. Dann die Angst im Bunker. Der Schweiß, der ohrenbetäubende Lärm, das Stöhnen und Jammern der Erwachsenen, das Weinen und Schluchzen, wenn die Angriffe und Bombeneinschläge immer näher rückten. Und dann die letzten Tage vor dem Ende. Gewehrsalven wechselten sich ab mit unerträglicher Stille. Wann wohl der Russe kommt? Pst. Sei still. Bloß nichts riskieren. Nicht jetzt, in letzter Minute, von einem Hundertzehnprozentigen aufgeknüpft werden. Aber vielleicht auch besser, als dem Russen in die Hände zu fallen. Die Angst. Die lähmende Angst des nahen Untergangs.
Die beiden Kinder lehnten an einer Kastanie am Ufer und schauten neugierig hinab, was die Erwachsenen da bei dem toten Kind wohl machten.
»Sie wohnen mit den Eltern gleich um die Ecke in einem der Flüchtlingslager«, fuhr Hoffmann fort.
Bett an Bett, nacktes Leben an nacktem Überleben. Gerettet vor dem Russen und darauf warten, dass irgendetwas wieder begann. Nur was sollte beginnen? Es war ja nichts mehr vorhanden. Etwas, das zumindest den Anschein von Normalität besaß. Von Arbeit und Alltag. Von Geldverdienen und kleinem Glück. Das war das Leben in all den überquellenden Berliner Flüchtlingsunterkünften. Ach was, das war ja gar kein Leben. Das war ein Vegetieren. Wer Verwandte im Westen hatte oder Freunde, der zog weiter und ließ die eingekesselte Stadt hinter sich. Wer konnte schon sagen, was als Nächstes mit Berlin passieren würde?
»Die Familie kommt aus Ostpreußen. Allenstein. Die Eltern suchen nach Arbeit in Berlin. Vergebens bisher.«
Ein Sonnenstrahl fiel Hoffmann ins Gesicht. Er wischte ihn mit der Hand fort wie eine lästige Mücke und drehte sich zur Seite weg.
»Wollen Sie mit ihnen sprechen, Herr Kommissar?«
»Mit den Kindern?«
»Mit den Eltern, dachte ich.«
»Sie haben sie schon vernommen?«
»Jawoll, Kommissar Adler.«
»Und?«
»Haben nichts mit dem toten Jungen zu tun, war mein Eindruck. Auch die Kinder nicht. Niemand kennt den Buben bisher. Scheint nicht von hier zu sein.«
»Gut gemacht, Hoffmann«, lobte Adler den Wachtmeister. »Bringt den Jungen in die Charité. Vielleicht fällt Frau Dr. Fischer ja etwas an ihm auf.«
Doch was sollte das sein?, fragte sich Adler.
Keine Kleider, kein Name, keine Herkunft, kein Hinweis. Nur ein totes nacktes Kind. Es war bereits das dritte, das sie im letzten Vierteljahr so bloß wie tot aufgefunden hatten. Zwei Jungen, ein Mädchen. Alle etwa im selben Alter, etwa zehn Jahre alt. Alle erwürgt. Bei keinem Kind gab es auch nur den Hauch einer Spur, woher es stammte, wie es hieß, wer seine Mutter gewesen sein mochte, wer der Vater. Nichts. Drei unbekannte tote Kinder. Namenlose.
Vorsichtig ging Adler die glitschigen Stufen der Uferböschung wieder hoch zur Straße. Er strauchelte kurz, konnte sich aber fangen, ohne zu stürzen. Das Gleichgewicht war noch immer sein Feind.
»Alles in Ordnung, Herr Kommissar?«
»Danke schön, Hoffmann. Alles gut gemacht. Wir sehen uns nachher im Präsidium.«
Damit ging er zu den beiden Kindern hinüber, um mit ihnen zu sprechen.
Das Mädchen schien etwa im Alter des toten Jungen zu sein. Herausfordernd schaute es den Kommissar aus seinen großen blauen Augen an. Die struppigen blonden Haare, die sie im Seitenscheitel trug, waren nackenlang. Ihr Bruder stand ängstlich neben ihr. Seine Finger umschlangen krampfhaft die Hand seiner großen Schwester. Er mochte zwei Jahre jünger als das Mädchen sein, schätzte Adler.
»Ihr habt den Jungen gefunden?«, begann Adler das Gespräch und ging in die Hocke, um den Kindern in die Augen schauen zu können.
»Ja«, antwortete das Mädchen, während der Junge schwieg und zu Boden blickte.
»Habt ihr ihn vorher schon einmal gesehen?«
»Nein.«
»Es ist keiner eurer Spielkameraden?«
»Wir haben keine Spielkameraden.«
»Ach so, warum denn nicht?«
Adler schob seine Hand in die Tasche seines alten grauen Mantels und holte eine Papiertüte mit Maiblättern hervor. Grüne saure Bonbons, die er den Kindern entgegenhielt.
Der Junge wollte schon zugreifen, überlegte es sich dann aber noch einmal.
»Wir dürfen nichts von Fremden annehmen«, ließ er Adler wissen.
»Das ist sehr vernünftig. Ich denke, bei der Polizei könnt ihr allerdings eine Ausnahme machen, wenn ihr wollt.«
Der Junge schaute zu seiner Schwester hoch. Sie nickte, und beide nahmen sich ein Maiblatt aus der Tüte.
»Wollen wir uns dort drüben hinsetzen? Dann könnt ihr mir erzählen, was ihr gesehen habt, einverstanden?«
Er zeigte auf die Stufen vor dem berühmten Shell-Haus, das wie eine Welle am Ufer des Kanals vor- und zurückschwappte. Doch die Eleganz des Bauwerks hatte schwer gelitten. Aus der Fassade hatten die Bomben riesige Stücke herausgebrochen. Die Fensterscheiben waren sämtlich geborsten. Adler stand auf, und die Kinder folgten ihm über die Straße und ließen sich neben ihm nieder.
»Fritz hat ihn zuerst gesehen«, sprudelte es aus dem Mädchen heraus, kaum dass sie saßen.
»Du bist also Fritz, und wie heißt du?«
»Marie.«
»Und was habt ihr dann gemacht, Marie?«
»Nix.«
Marie zögerte.
»Wir haben bloß geguckt«, traute sich jetzt auch Fritz, etwas zu sagen.
»Der hatte ja keine Augen mehr, dass der tot war, war klar wie Kloßbrühe.«
Adler schauderte über die welterfahrene Gewissheit der Kinder, die schon in ihrem Alter auf den ersten Blick zwischen Tod und Leben zu unterscheiden wussten. Was würde in zehn oder zwanzig Jahren mit ihnen sein? Wie würden ihre Seelen das Erlebte, das Gesehene verarbeiten? Würden sich alle Toten in ihrer Erinnerung festsetzen? Würden sie nachts in ihren Träumen herauskriechen – böse Fratzen, die sie in ihrem unruhigen Schlaf quälten?
»Und dann seid ihr zu euren Eltern gelaufen?«
»Ja, und die Mutti ist mitgekommen und hat geguckt und immer wieder gerufen: ›Der arme Junge, der arme Junge!‹«
»Ja, und dann hat Onkel Ewald die Polizei gerufen«, rief Fritz.
»Wer ist denn Onkel Ewald?«, fragte Adler leise.
»Das ist doch der Hausmeister von da, wo wir wohnen«, klärte ihn Fritz auf, verblüfft über Adlers Unwissenheit.
»Ach so, Onkel Ewald. Und der ist dann auch hergekommen?«
»Nee, der kann doch nicht mehr richtig laufen. Der ist ganz dick und hat nur noch ein Bein. So wie du nur einen Arm hast.«
Marie knuffte ihren Bruder in die Seite.
»Lass mal, Marie. Der Fritz hat ja recht. Ich hab halt nur noch einen Arm. Und wisst ihr, was ich immer sage? Lieber nur noch einen Arm als gar keinen mehr. Stimmt doch, oder?«
Marie grinste.
»Unser Lehrer in Allenstein, der Dr. Krüger, hatte auch nur noch einen Arm. Der andere sei auf dem Schlachtfeld in Tannenberg geblieben, hat er gesagt. Und wenn er besonders gute Laune hatte, dann schleuderte er den leeren Ärmel seiner Jacke umher und zauberte etwas daraus hervor.«
»Was denn?«
»Das Heft mit dem besten Diktat.«
»Ui.«
»Und weißt du was? Das war meistens mein Diktat«, erzählte Marie stolz. Sie strahlte Adler mit ihren riesigen blauen Augen an. Glücklich versunken in der Erinnerung an ihre Schulstunden in Allenstein, von denen sie noch nicht wusste, dass sie nur in ihrer Erinnerung fortleben würden. So wie das Bild von Dr. Krüger mit dem schleudernden Jackenärmel. Einer Erinnerung, die immer blasser werden würde.
»Ja dann«, sagte Adler. »Hilfst du mir mal hoch, Fritz?«
Er stützte sich behutsam auf die Schulter des Jungen und richtete sich langsam auf. Mit der rechten Hand schlug er sich den Staub von der Hose.
»So, und weil ihr der Polizei so prima geholfen habt, bekommt ihr noch meine restlichen Maiblätter. Und falls euch noch etwas anderes einfällt, was ihr gerade vergessen habt, mir zu erzählen, dann sagt ihr mir Bescheid. In Ordnung? Der Onkel Ewald oder der Wachtmeister Hoffmann dort vorne, die wissen, wo ihr mich finden könnt.«
Adler schüttelte den Kindern formell die Hand. Marie machte einen Knicks und Fritz einen Diener. Dann drückte Adler zwinkernd Marie die Papiertüte in die Hand. Nicht ohne sich zuvor selbst ein Bonbon aus der Tüte zu fischen.
Wackelig, mit einer Hand am Lenker, radelte Adler durch das Diplomatenviertel, das die Nazis am Rand des Tiergartens angelegt hatten. Vorbei an den Ruinen, die von den mächtigen Botschaften der Italiener und Japaner übrig geblieben waren, und weiter durch den Tiergarten. Oder besser durch dessen Reste. Dort, wo einst ein üppiger Wald zum Spazieren eingeladen hatte, ragten jetzt nur noch einzelne Baumstümpfe in die Luft. Im letzten Winter hatten die Berliner alles geklaut und verheizt, was nach dem Kampf um Berlin 1945 noch vorhanden war. Anstelle von Blumenrabatten wurde jetzt Gemüse zur Selbstversorgung angepflanzt. Dazwischen ragten die »Puppen« der »Siegesallee« empor. Kaiser Wilhelms traurige Ahnengalerie sah ziemlich mitgenommen aus. Hier fehlte eine Nase, dort ein Bein. Manche Sockel waren vollkommen leer. Vorbei am ausgebrannten Reichstag mit dem kahlen Kuppelgerippe auf dem Dach fuhr Adler durch das zerschossene Brandenburger Tor. Immer weiter nach Osten führte sein Weg. Die Linden hoch. Das Hohenzollernschloss sah erstaunlich gut erhalten aus. Vom ehemaligen Berliner Polizeipräsidium, der legendären Roten Burg am Alex, konnte man das dagegen nicht behaupten. Von ihr war nur noch Schutt und Asche übrig geblieben.
Nicht weit entfernt, in der Keibelstraße, hatte die Berliner Polizei neue Räume bezogen.
Im Flur stieß Adler auf Johannes Stumm, den stellvertretenden Berliner Polizeipräsidenten.
»Nehmen Sie mal Ihr kostbares Fahrrad von der Schulter, Adler. Das klaut Ihnen hier schon keiner.«
»Weiß man’s?«
»Nun machen Sie mal halblang. Wir sind hier schließlich bei der Polizei.«
Stumm grinste und winkte den Kommissar in sein Büro.
Adler lehnte sein Rad an die Flurwand und folgte ihm.
»Zigarette?«
Stumm nahm eine Blechdose mit Garbátys vom Schreibtisch und hielt sie Adler hin.
»Ich weiß, dass Sie nicht rauchen, Adler. Aber nehmen Sie sich mal zwei. Ist schon in Ordnung.«
Adler nahm die angebotenen Zigaretten und steckte sie sich in die Brusttasche seiner Jacke.
»Was macht der Fall des toten Jungen?«, fragte Stumm besorgt.
»Ich komme gerade erst vom Landwehrkanal. Wir wissen noch nichts.«
»Ich möchte, dass Sie den Fall vordringlich bearbeiten, Adler. Drei tote Kinder … Das sorgt für Unruhe in der Bevölkerung, sobald die Leute spitzbekommen, dass wir es mit einem Mehrfachmörder zu tun haben.«
»Meinen Sie, dass es sich um denselben Täter handelt?«
Stumm ging um den Schreibtisch herum und ließ sich auf dem Bürostuhl nieder. Die qualmende Zigarette in der rechten Hand, wies er Adler den freien Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches zu.
Adler setzte sich, zupfte umständlich mit der verbliebenen Hand die Hosenbeine hoch.
»Möglich, dass wir es mit einem Serientäter zu tun haben. Wahrscheinlich sogar. Aber bisher fehlen uns ja konkrete Anhaltspunkte. Da müssen Sie ran, Adler.«
»Wir sind dran, Herr Polizeivizepräsident. Aber wir haben leider so gut wie nichts in der Hand. Die Kinder waren wahrscheinlich alle schon länger tot, als wir sie gefunden haben«, berichtete Adler.
Alle drei Kinder waren erwürgt worden. Vermutlich mit bloßen Händen. Wie der Kleine vom Kanal zu Tode gekommen war, würde Frau Dr. Fischer untersuchen. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass auch er brutal erwürgt worden war. Der Mord an den Kindern war grausam gewesen. Völlig verroht, hemmungslos. Alle Kinder hatten in etwa das gleiche Alter gehabt, um die zehn Jahre. Alle waren unbekleidet gewesen, als man sie auffand. Alle wirkten stark vernachlässigt. Sie waren unterernährt. Das traf in dieser Zeit allerdings auf fast alle Kinder zu. Und nicht nur auf Kinder.
Adler hielt inne.
Die Erinnerung an den Anblick der Kinder machte ihm zu schaffen.
Es war nur schwer auszuhalten sich vorzustellen, welches Martyrium die drei wohl durchlitten hatten, ehe man sie einfach weggeworfen hatte wie Müll. Das waren kleine Kinder gewesen. So wie Fritz, mit dem er heute Morgen gesprochen hatte. So wie Marie.
»Welche Bestien machen so etwas? Was sind das für Menschen?«
Ratlos blickte Adler zu seinem Vorgesetzten.
»Das müssen Sie herausfinden, Adler. Und zwar schnell. Ich will keine weiteren toten Kinder in unserer Stadt mehr auffinden müssen.«
»Ebenso verstörend ist es, dass niemand die Kinder als vermisst gemeldet hat. Jedenfalls konnten wir sie nicht zuordnen. Wir sind im Kontakt mit dem Suchdienst des Roten Kreuzes. Bisher vergeblich.«
»Wundert Sie das? In diesem Chaos, Adler?« Stumms Blick war nachdenklich. »Aber dass die Kinder nicht als vermisst gemeldet wurden, ist schon sehr, sehr merkwürdig. Nehmen Sie die Kinderheime unter die Lupe.«
»Was sagt Markgraf zu der ganzen Angelegenheit?«, fragte Adler.
Die internen Besprechungen zwischen Stumm und Adler hatten in den letzten Wochen immer häufiger stattgefunden. Ein kurzer Austausch auf kurzem Weg. Die Stimmung im Präsidium war in dieser Zeit immer angespannter geworden. Jeder überlegte sich sehr genau, mit wem er sich offen unterhalten konnte.
Stumm hatte Adler nach dessen Zeit an der Front und der schweren Verwundung zurück zur Berliner Kriminalpolizei geholt. Beide Männer einte ihr Misstrauen gegenüber dem Berliner Polizeipräsidenten Paul Markgraf. Markgraf war schließlich alles andere als ein Demokrat. Er war ein unangenehmer Lauttöner von Moskaus Gnaden. Genauso verhasst waren ihnen die alten Parteigenossen. Trotz der Bemühungen um Entnazifizierung waren sie noch überall in der Gesellschaft gegenwärtig. Auch hier bei der Berliner Polizei. Sie sorgten dafür, dass die alten Strukturen weiterhin funktionierten. Im Hintergrund zogen einige bereits wieder die Fäden. Andere blieben lieber in Deckung.
»Markgraf ist da ganz auf meiner Linie«, antwortete Stumm schmunzelnd auf Adlers Frage.
»Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen«, murmelte Adler.
»Das will ich jetzt aber mal nicht gehört haben.«
Stumm drückte seine Zigarette auf dem Kopf eines geschwungenen roten Drachens aus, der kunstvoll in die Mitte des großen chinesischen Porzellanaschenbechers gemalt war. Irgendwie war es Stumm gelungen, ihn aus der Roten Burg hierher zu retten.
»Ernsthaft, Adler. Augen und Ohren auf. Gehen Sie auch die Kartei mit allen Sexualstraftätern noch einmal durch. Schauen Sie, wer von denen überhaupt noch am Leben ist. Das kann uns auch später für andere Ermittlungen helfen. Und hören Sie sich in den einschlägigen Etablissements einmal genauer um. Vielleicht bekommen Sie da etwas mit. Mit Markgraf ist abgesprochen, dass Sie zusammen mit Frau von Dedowsky jetzt ausschließlich die Sonderkommission ›Kalter Winter‹ leiten. Das klingt unverfänglich genug. Vom kalten Winter wollen die Berliner schließlich nichts mehr hören. Sowjets, Briten und Amerikaner wissen Bescheid.«
Kalter Winter, wirklich?, dachte Adler. Berliner Monster wäre treffender gewesen.
»Und die Franzosen?«
Anstatt zu antworten, zog Stumm die Augenbrauen hoch und machte eine wegwischende Handbewegung.
»Die haben doch eh kaum etwas zu sagen. Ich erwarte einen täglichen Bericht von Ihnen. Die Sache hat Priorität.«
»Jawohl, Herr Polizeivizepräsident.«
Adler stand auf, schüttelte Stumm die Hand und wandte sich zur Tür.
»Noch was, Adler: Haben Sie endlich eine ordentliche Wohnung gefunden?«
»Bin auf der Suche«, wich Adler aus.
»Machen Sie mal hinne, Adler. Mit der Laube, das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes auf Dauer. Sie brauchen eine ordentliche Unterkunft.«
»Kümmere mich darum, Herr Polizeivizepräsident.«
Seit seiner Rückkehr aus dem Lazarett in Bayern lebte Adler in einer Laube in Wilmersdorf, gleich neben dem Gelände der ehemaligen Gasanstalt. Es war ein einfacher Bretterverschlag, der Fritz Winter gehört hatte. Winter war Kollege bei der Kriminalpolizei gewesen. Bevor er eingezogen wurde, hatte er Adler den Schlüssel zur Laube zugesteckt.
»Für alle Fälle. Kannst du mir ja um sechs nach dem Krieg wiedergeben«, grinste er ihn an.
Doch daraus war nichts geworden. Winter war wie Adler an die Ostfront gekommen. Doch er hatte weniger Glück gehabt als sein Freund. 1944 war Winter bei Orscha gefallen. Seine Frau Babette und die beiden Kinder Friedrich und Franziska überlebten ihn nur kurze Zeit. Sie starben bei einem Volltreffer auf ihre Charlottenburger Wohnung. Außer einem Haufen Trümmer war von dem Haus nichts übrig geblieben. Eine ganz Familie war ausgelöscht. Ihr Leben. Ihre Geschichte. Ihre Zukunft.
Das Holz für den Allesbrenner, mit dem er seine Hütte im Winter etwas aufwärmen konnte, sammelte Adler auf dem Heimweg. Im letzten Sommer hatte er auf dem kleinen Grundstück vor der Laube Kartoffeln angebaut. Sein Nachbar, der dicke Loose, der ebenfalls ausgebombt worden war, passte tagsüber auf, dass niemand die Kartoffeln klaute. Manchmal saßen Adler und Loose abends schweigend vor ihren Hütten und schauten der Sonne beim Untergehen zu. Irgendwoher hatte Loose hin und wieder eine Flasche Korn. Adler fragte nicht nach, und sie tranken, bis es stockdunkel war. Ein Bett, ein Ofen und eine Wasserpumpe im Garten, die im Winter zufror. Das war mehr, als die meisten anderen in dieser Zeit hatten. Der dicke Loose und Adler hatten überlebt. Das war kein Verdienst, nur Zufall. Ob es Glück war? Da war Adler sich manchmal nicht so gewiss. In jedem Fall bedeutete es für ihn die Verpflichtung weiterzumachen. Irgendwie.
»Was hat Stumm gesagt?«, fragte Ruth von Dedowsky, kaum dass Adler die Tür zu ihrem gemeinsamen Büro geöffnet hatte. Zusammen mit den beiden jungen Kollegen Erwin Volgmann und Harry Raade hatte sie zwei Stockwerke höher ungeduldig auf Adlers Bericht gewartet.
Erschöpft ließ sich Adler auf seinen Schreibtischstuhl fallen.
»Also, Volgmann …«, begann er. »Sie gehen als Erstes die Kartei mit den uns bekannten Sexualstraftätern durch. Schauen Sie, wer von denen überhaupt durch den Krieg gekommen ist und wo sie heute wohnen. Anschließend statten Sie den Herren mal einen Besuch ab. Wenn Sie Unterstützung brauchen, holen Sie sich ein paar von den jungen Kollegen ran. Wir haben für unseren Fall die volle Rückendeckung von Stumm und Markgraf.«
Volgmann stöhnte auf.
»Das sind Hunderte Personen.«
»Ja, ich weiß. Aber die Hälfte von denen lebt wahrscheinlich gar nicht mehr. Die müssen Sie natürlich nicht mehr besuchen. Also, ran an die Bouletten. Wir brauchen Ergebnisse, die wir Stumm präsentieren können.«
»Das wird Wochen dauern.«
»Wird es nicht. Nein, auf keinen Fall. Spätestens Ende der Woche will ich von Ihnen Ergebnisse sehen! Wie gesagt, Volgmann: Holen Sie sich Unterstützung ran.«
»Kann das nicht Raade machen?«
»Bin ich hier auf einem Basar gelandet?«, donnerte Adler. »Entweder machen Sie jetzt verdammt noch mal Ihre Arbeit, wie man es Ihnen sagt, oder Sie können nach Hause gehen.«
Volgmann schluckte.
So verärgert hatte er Adler noch nie erlebt.
»Ist ja schon gut, Chef. Hole mir ein paar Jungs, und dann gehen wir die Kartei durch.«
»Gut.«
Adler wandte sich an Raade.
»Und Sie machen eine Tour durch die Kinderheime.«
»Abends?«
»Nee, morgen Vormittag natürlich. Hören Sie sich um, was man so erzählt. Irgendwo müssen unsere toten Kinder ja vorher gewohnt haben.«
»In Ordnung. Wen soll ich mitnehmen?«
Adler schaute zu Ruth von Dedowsky.
»Soll er den alten Arthur Kunert mitnehmen? Was denkst du?«
»Kann nicht schaden«, antwortete sie und öffnete ihr Zigarettenetui, das auf dem Fensterbrett lag.
»Gut, dann nehmen Sie Kunert mit. Noch Fragen?«
»Nein, Herr Kommissar, wir klappern die Heime ab.«
Raade wandte sich um, blieb aber doch noch einmal stehen.
»Was ist, wenn keiner da ist?«, fragte Raade.
»Das wird schon nicht passieren, wo sollen die denn alle sein? Im Freibad etwa?«
»Nee.« Raade grinste. »Aber in der Schule.«
»Musste das gerade sein mit Volgmann?«
Von Dedowsky stand am offenen Fenster und blies den Rauch ihrer Zigarette in die kühle Luft hinaus, die nach Frühling duftete.
»Wieso macht der Junge nicht einfach mal das, was man ihm sagt?«, beschwerte sich Adler.
»Wir sind hier bei der Polizei, nicht bei der Wehrmacht. Schon vergessen?«
»War mir glatt entfallen«, antwortete Adler und schlenkerte mit seinem leeren Ärmel umher. »An der Front habe ich mich immer so wohlgefühlt.«
»Witzig«, stöhnte von Dedowsky. »Also, was hat denn Stumm nun gesagt?«
»Stumm will offenbar vor Markgraf glänzen. Deshalb möchte er, dass wir den Fall zügig lösen. Für Markgraf dürfte die ganze Sache dagegen uninteressant sein. Schließlich hat sie keine politische Dimension, die ihm weiterhilft.« Adler zögerte.
»Eine schnelle Lösung ist aber überhaupt nicht in Sicht«, merkte von Dedowsky an. »Im Gegenteil. Wenn wir ehrlich sind, stochern wir völlig im Trüben.«
»Außerdem befürchtet Stumm, dass die Berliner wegen des Kindermörders in Panik geraten. Deshalb will er, dass möglichst nichts von unseren Ermittlungen nach außen dringt.«
»In Panik sollten die Berliner lieber wegen ganz anderer Dinge sein«, wandte von Dedowsky ein. Sie schnippte die Asche ihrer Zigarette weg. Eine Windböe wirbelte sie ein Stück durch die Luft und ließ sie dann langsam auf den Gehweg absinken.
»Sie sollten längst in Panik geraten sein …«, wiederholte sie leise, während sie auf das Trümmerfeld vor dem Polizeipräsidium hinabschaute.
Das war einmal die Berliner Altstadt gewesen.
Hier hatten E.T.A. Hoffmann und Theodor Fontane gelebt und geschrieben. Hier hatte Max Liebermann gemalt.
»Da hast du vollkommen recht«, bestätigte Adler.
Seit Monaten verschlechterte sich das Klima zwischen den drei westlichen Alliierten und den Sowjets. Wenn das so weiterging, steuerten alle auf eine direkte Konfrontation zu. Und wie die ausgehen würde, wollte sich Adler nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki nicht vorstellen. Das wäre das Ende Berlins. Hunderttausende Tote wären die Folge. Tote, von denen nicht einmal eingebrannte Schatten in den Wänden übrig bleiben würden. Es gab ja fast keine Wände mehr in der Stadt, in die sie sich hätten einbrennen können.
Doch die meisten Berliner nahmen die neue Bedrohung kaum wahr. Sie waren damit befasst zu überleben. Sie kämpften um Lebensmittel und Heizmaterial. Forschten nach vermissten Freunden und Verwandten. Für die Gefahr, die sich über ihren Köpfen zusammenbraute, hatten sie keinen Blick. Ihren Alltag zu meistern forderte all ihre Kraft. Und dann war noch dieser eisige Winter dazugekommen. Als wäre das Überleben nicht schon davor schwierig genug gewesen … In den zwanziger Jahren hatte Berlin lässig auf dem Vulkan getanzt. Mein Gott, ist das lange her, dachte Adler. Jetzt tanzten die ersten Berliner wieder am Kurfürstendamm. Und gleich wieder am Rand eines Vulkankraters. Sein nächster Ausbruch würde wohl der letzte sein. Er würde Berlin unter sich begraben, wie die Asche des Vesuvs einst Pompeji unter sich begraben hatte.
»Also?«
Ruth von Dedowsky riss Adler aus seinen trüben Gedanken.
»Also?«, wiederholte Adler ihre Frage.
»Bist du jetzt mein Papagei, der alles wiederholt?«
»Nein, ich bin und bleibe dein Adler.«
»Könntest du mal wieder ernst sein?«
»Mit dem größten Vergnügen.«
Von Dedowsky stöhnte.
»Zieh den Mantel an, wir gehen zur Fischer.«
»Endlich mal eine ordentliche Idee von dir«, flachste Adler.
Sie drückte ihre Zigarette auf dem Fensterbrett aus und schnippte den Stummel auf die Straße. Dann schloss sie das Fenster, von dessen Rahmen die weiße Farbe in großen Platten abplatzte, und knuffte ihren Kollegen gegen den rechten Arm.
»Autsch«, beschwerte sich Adler gespielt. »Soll ich den jetzt auch noch verlieren?«
»Besser, als wenn ich den Verstand verliere. Komm jetzt und schließ das Büro ab.«
»Jawohl, Frau General.«
»Ich knuff dich gleich noch mal, wenn du dich nicht benimmst.«
Er schloss hinter sich ab.
»Rita, Sie können für heute auch Schluss machen«, rief von Dedowsky ihrer Sekretärin zu.
»Gerne, Frau von Dedowsky, vielen Dank. Ich sortiere noch fix die Akten weg und mach mich dann auch auf den Heimweg.«
Der Himmel hatte sich zugezogen. Der zarte Hauch von Frühling, der in der Luft gelegen hatte, war wieder im Berliner Grau versunken.
Seine rechte Hand an der Lenkerstange, schob Adler das Rad neben von Dedowsky her. Der Weg vom Berliner Polizeihauptquartier entlang der Torstraße zur Charité war nicht weit. Für die Ruinen rechts und links der Straße hatten die beiden kaum noch einen Blick übrig. Zu vertraut waren ihnen die leeren Fensteraugen und die Ziegelberge, die für Not und Elend in der Stadt standen. Notdürftig hatten sich Menschen in den Häuserresten einquartiert. Einige der Fensteröffnungen ohne Rahmen und Glas waren provisorisch mit Pappe verkleidet. Von manchen Wohnungen fehlten ganze Wände. Wie auf einer Theaterbühne breitete sich vor den Passanten der Blick in möblierte Zimmer aus. Vor den Häusern sortierten Trümmerfrauen Steine. Andere klopften die Mörtelreste ab und luden die bearbeiteten Steine auf Handwagen, damit sie irgendwo in der Stadt wiederverwendet werden konnten. Es war eine mühsame Arbeit, die die Frauen verrichteten. Immerhin waren so zwischen all den Ruinen einige Grundstücke bereits von Trümmern freigeräumt worden.
Vor einem kleinen Laden im Souterrain eines Hauses, dem die oberen Etagen fehlten, hatte sich eine Warteschlange gebildet. Abgemagerte graue Menschen standen in viel zu weiter Kleidung in einer Reihe hintereinander an. Die Anspannung war ihren Gesichtern anzusehen. Ob es heute genügend zu verteilen gab, bis sie mit ihren Essensmarken an der Reihe waren? Oder mussten sie hungernd wieder unverrichteter Dinge abziehen? Bei ihrem elenden Anblick konnte einem angst und bange werden um die Zukunft Berlins.
Wie sollte es mit der Stadt nur weitergehen?
Unter den Bombenangriffen hatte Berlin seine Form verloren. Die stolze Stadt, ihre prächtigen Häuser, waren in sich zusammengesackt. Nur schwer fand man zwischen den Ruinen die alten Wege wieder. Viele Häuser, an denen man sich jahrzehntelang unwillkürlich orientiert hatte, gab es nicht mehr. An ihre Stelle waren Berge von Schutt und Staub getreten oder eine große Leere. So wie die Stadt ihre Form verloren hatte, hatten auch die Menschen ihre Form verloren. Sie waren abgemagert an Körper und Seele. Nur noch Schatten ihrer selbst. Sie waren sich selbst so fremd, wie ihnen ihre Stadt fremd geworden war und die Zeit, in der sie lebten. Nichts war mehr, wie es gewesen war. Und doch ging das Leben weiter. Irgendwie. Auch wenn man nicht wusste, wie oder warum. Das war vielleicht das Erstaunlichste. Die Stadt atmete weiter. Ganz flach. Aber sie atmete noch. Am schwersten hatten es die Kinder. Und am einfachsten. Chocolate und Chewing Gum lauteten die Zauberworte, die ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnten, sobald sie auf amerikanische oder britische Soldaten trafen. Und die gaben, was sie bei sich hatten. Nicht weil sie mussten. Sondern weil sie es konnten.
Am Rosenthaler Platz setzte ein unangenehmer fisseliger Nieselregen ein. Adler blieb stehen, stützte sein Rad mit der Hüfte und schlug sich den Kragen seines Mantels hoch, ehe sie weiterliefen.
»Hast du gar keinen Schirm dabei?«, fragte von Dedowsky süffisant.
»Nein, kein Schirm. Gott sei Dank. Sonst müsste ich mich ja entscheiden, ob ich mit meinem einen Arm das Fahrrad fallen lasse, damit ich dir den Schirm halten kann, oder ob ich das Fahrrad behalte und dich dafür im Regen stehen lasse.«
»Na, da sieht man mal wieder, was für ein Glückspilz du doch bist«, lachte von Dedowsky.
Adler schmunzelte dankbar für die Aufheiterung.
Er mochte es, wenn sich auf der rechten Wange seiner Kollegin beim Lächeln dieses Grübchen bildete. Ohnehin mochte er von Dedowsky. Seit einem Jahr arbeiteten sie nun schon zusammen. Dass sie gebürtige Kölnerin war, hörte man ihrer Aussprache nicht an. Glücklicherweise. Ganz im Gegensatz zu dem Rheinländer Konrad Adenauer. Sobald Adler den quiekenden Singsang des Politikers im Radio hörte, schüttelte es ihn. Aber dafür konnte der Adenauer ja nichts.
Von Dedowsky war schon vor dem Krieg mit ihren Eltern nach Berlin gekommen. Hier hatte sie eine Stelle bei der Berliner Polizei gefunden. Viele Frauen gab es dort nicht, die die Position einer Kommissarin bekleideten. Von Dedowsky hatte Glück – und einen Onkel, der Verbindungen zur Polizeiführung hatte. Walter von Dedowsky war vor 1939 anerkannter Jurist mit eigener Kanzlei in Düsseldorf gewesen. Gleich nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt war, hatte er die Entnazifizierung durchlaufen und konnte seine Arbeit wieder aufnehmen. Nicht einmal Pg war von Dedowsky gewesen. Der einzige Satz, den seine Nichte Ruth je von ihrem Onkel über seine Kriegserlebnisse hörte, lautete:
»Monte Cassino.«
Und nach einer längeren Pause setzte er unter Kopfschütteln hinzu:
»Ihr könnt euch das nicht vorstellen.«
Dann verfiel Walter von Dedowsky stets wieder in Schweigen.
Kein Nachfragen seiner Nichte, kein aufmunternder Blick konnten ihn zu irgendeiner weiteren Auskunft bewegen. Mit diesem einen Satz war für ihn alles gesagt. Mit ihm war die Vergangenheit abgehakt. Endgültig.
»Dagegen bist du eine regelrechte Plaudertasche«, pflegte sie Adler zu necken, der über seine eigenen Kriegserlebnisse ebenso ausführlich schwieg wie Ruths Onkel.
Was hätte man auch erzählen sollen?
Jeder, der nicht mit dabei sein musste, war zu beneiden. Und niemand, der nicht dabei gewesen war, würde es sich je vorstellen können, was die Front bedeutete. Die Dämonen würden nie mehr verschwinden. Sie würden die Überlebenden im Schlaf begleiten und bis in den Tod. Insofern erübrigte sich jedes weitere Wort. Das, was gewesen war, war ein Kapitel für sich. Und es war abgeschlossen, befand Adler.
Als Ruth von Dedowsky die Stelle bei der Berliner Polizei erst einmal innehatte, war das Vitamin B, das ihr geholfen hatte, schnell nicht mehr wichtig. Jeder merkte, dass sie es überhaupt nicht benötigte. Von Dedowsky war klug. Sie war gewandt. Sie war beredt. Weit mehr als die meisten ihrer männlichen Kollegen. Und sie besaß kriminalistischen Spürsinn. Sie besaß die Gabe, Zusammenhänge zu erkennen und in Strukturen zu denken. Dass sie in jeder freien Minute zu einem Buch griff, um zu lesen, was ihr in die Finger kam, stieß bei Adler auf Interesse. Lion Feuchtwanger und Franz Werfel, Irmgard Keun und die wunderbare Mascha Kaléko.
»Alles Sachen, die du in den letzten tausend Jahren nicht lesen durftest«, hatte sie einmal zu Adler gesagt. Ein besseres Gütesiegel für ein Buch konnte es nicht geben.
Obwohl der Regen dünn war, kamen sie völlig durchnässt am Institut für Rechtsmedizin in der Hannoverschen Straße an. Sie froren erbärmlich. Dennoch freute sich Adler, dass sie sich auf den Weg gemacht hatten. Er freute sich auf Frau Dr. Karin Fischer. »Die schöne Frau Fischer«, wie sie im Präsidium genannt wurde und die Adler heimlich anhimmelte. Doch sein Anflug von guter Laune im Berliner Grau verschwand schnell wieder. Der Portier ließ die beiden Polizisten nicht in das Institut vor.
»Ja, der tote Junge is anjekommen«, erklärte er. »Aber Frau Dr. Fischer hat ihm noch nicht anjeguckt.«
Mit Generaldirektorenmine verkündete er:
»Die Frau Doktor is heute schon janz früh aus’m Haus jejangen. Hatte irjend’n wichtjen Termin, hatte se jesart. Tut ma ja nu ufrichtich leid, dass Se sich janz umsonst herbemüht ham. Warum ham Se denn nicht vorher anjerufen?«
Bedröppelt standen Adler und von Dedowsky vor dem Haus.
Ja, warum hatten sie nicht vorher angerufen?
»Dann also morgen«, maulte von Dedowsky.
»Und dann rufen wir vorher an.«
Adler und von Dedowsky verabschiedeten sich knapp. Beide waren verärgert wegen des überflüssigen Wegs durch den Regen. Adler setzte sich vor dem Institut vorsichtig auf sein Rad, holte mit den Füßen Schwung und rollte los. Eine gute halbe Stunde würde er von der Charité nach Wilmersdorf benötigen. Einmal quer durch die Stadt. Viel kürzer war der Heimweg für von Dedowsky auch nicht. Glücklicherweise fuhr die Stadtbahn am Lehrter Bahnhof wieder, sodass sie bis Zoo fahren konnte und nicht den ganzen Heimweg laufen musste.
Der Regen fiel jetzt in dünnen Fäden herab. Doch trotz des schlechten Wetters schoben sich Menschenmassen aus dem Lehrter Bahnhof. Wie das Skelett eines Dinosauriers aus dem nahen Naturkundemuseum wölbten sich über ihnen die stählernen Dachträger der Bahnhofshalle in den Himmel. Einige Passanten hielten schwere Körbe in den Händen, andere pressten volle Beutel eng an den Körper. Es waren Rückkehrer von den Hamsterfahrten ins Umland. Wer Glück hatte, kam mit einem vollen Rucksack zurück: ein paar Kartoffeln, eine Kohlrübe, ein paar Möhren, vielleicht sogar einen Knochen für die Suppe. Eingetauscht gegen kostbare Dinge ohne Wert: silberne Serviettenringe, die Taschenuhr des Vaters oder ein paar Zigaretten. Eingetauscht wurde alles, was vom einstigen Familienschatz noch übrig geblieben war. Wer nichts zum Tauschen hatte und keine Arbeit fand, dem blieb nichts anderes übrig, als zu hungern. Von dem, was man auf Essensmarken bekam, wurde niemand satt. Was also tun, wenn der Hunger zu groß wurde? Immer mehr Frauen verkauften sich im Schatten der Ruinen an die Soldaten der Alliierten. Das war zwar verboten. Dennoch florierte die Prostitution in der kaputten Stadt. Und mit ihr florierten der Tripper und die Syphilis.
Keine Frage, Berlin war am Ende.
Quer durch den kahlen Tiergarten führte Adlers Heimweg. Schaukelnd, mit seiner verbliebenen Hand fest den Lenker umklammernd, fuhr er vorbei an der weiten Brachfläche, die einmal der alte Westen gewesen war. Die schmucken Villen des Tiergartenviertels waren verschwunden. Über den Kurfürstendamm hoch zum Hohenzollerndamm ging es weiter bis zur gleichnamigen Ringbahnstation. Deren herrschaftliche Pracht war im Krieg in sich zusammengesunken. Der bekrönende Adler lag zerrupft vor dem alten Eingang. Das hohe Dach der Wartehalle war eingestürzt. Neben den Geleisen reihten sich dicht an dicht die Nissenhütten aus Wellblech. Flüchtlinge und Ausgebombte waren hier notdürftig untergebracht worden. Viel besser geht es dem kleinen Fritz und seiner Schwester Marie in ihrem Flüchtlingsheim auch nicht, dachte Adler. Längst war der Regen durch seinen dicken Wollmantel gedrungen. Er zitterte vor Kälte.
Hinter den Nissenhütten schlossen sich beim ehemaligen Gaswerk Wilmersdorf die Schrebergärten an. Bald würden sie alle die Anlage verlassen müssen, denn Tag für Tag brachten die Laster mehr Trümmerschutt, der auf dem ehemaligen Industrieareal zu einem künstlichen Berg aufgeschüttet wurde.
»Wenn dit so weitajeht, könn wa nechsten Winta in Berlin och Schi fahrn«, hatte Loose hilflos gescherzt. Mehrere solcher Trümmerberge wurden in Berlin derzeit aufgeschüttet, aus dem Schutt und den Steinen, die nicht mehr für den Wiederaufbau verwendet werden konnten. Der größte wuchs über der ehemaligen Wehrtechnischen Fakultät der Nazis empor. Gleich hinter dem Olympiastadion. Ein richtiger Berg! Der Trümmerberg, der hier am Lochowdamm zwischen Schöneberg und Wilmersdorf aufgeschüttet wurde, sollte im Vergleich dazu nur ein Hügel werden.
Adler würde sich also bald wirklich eine neue Wohnung vom Amt zuweisen lassen müssen. Die Tage in seiner Laube waren gezählt. Vielleicht hatte er ja Glück und ergatterte sogar ein möbliertes Zimmer am Ku’damm?
Mit dem Regen und dem Abend war die stechende Kälte zurückgekommen. In den Regen mischten sich sogar vereinzelte Schneeflocken.
Die letzten Kilometer auf dem Rad waren für Adler eine Qual. Die Fahrt zog sich endlos in die Länge. Der Stumpf seines linken Arms brannte und juckte grässlich. Jeder Tritt in die Pedale schien ihm dadurch noch anstrengender zu sein. Zitternd, müde und durchnässt schloss er das Tor zur Kleingartenanlage hinter sich. Aus den Schornsteinen der kleinen Hütten stieg ein beißender Qualm von feuchtem Holz und erdiger Braunkohle in die Luft.
Endlich öffnete er die knarzende Holztür zu seiner Laube. Mühsam entledigte er sich seiner nassen Kleider. Das An- und Ausziehen mit nur einem Arm war ein Balanceakt, den er inzwischen leidlich gut bewältigte, doch mit den nassen Kleidern blieb es eine Herausforderung. Erst nachdem er sich ein trockenes Hemd angezogen und die Haare mit einem Handtuch etwas trocken gerubbelt hatte, bemerkte er den Topf auf dem Tisch. Dick eingewickelt in eine Decke. Looses Frau Erna hatte für ihn mitgekocht. Wieder einmal. Adlers Herz ging auf. Behutsam wickelte er den Topf aus der Decke, um ja nichts von der kostbaren Speise zu verschütten. Der Duft von Kartoffelsuppe erfüllte den Raum. Mit letzter Kraft zwang sich Adler dazu, noch den Allesbrenner zu befeuern, damit seine Wäsche trocknete und er es in der Nacht weniger kalt hätte. Er hängte seine klamme Kleidung auf eine Leine, die er quer durch den Raum spannte. Dann zündete er eine Kerze an. Als er endlich den Deckel des Topfes anhob, konnte er sein Glück kaum fassen. Da schwamm doch wirklich ein Würstchen in der Suppe! Ach, Erna Loose! Was für ein Geschenk nach diesem Tag. Mit jedem Löffel, den er von der warmen Suppe aß, wurde auch ihm wieder etwas wärmer, ließen das Jucken und Brennen in seinem linken Arm etwas nach, gegen das kein Kratzen helfen konnte. Das Würstchen hob er sich bis ganz zum Schluss der Mahlzeit auf. So hatte er es schon als Kind gemacht. Ganz langsam verzehrte er es dann. Bissen für Bissen, mit Genuss.
Der Regen trommelte immer noch gleichmäßig auf das Dach seiner Laube.
Hoffentlich blieb es dicht!
Mehrfach hatte er es mit Dachpappe abdichten müssen. Looses Kinder hatten sie von einem der Trümmergrundstücke mitgehen lassen. Ohnehin wurde geklaut, was nicht niet- und nagelfest war. Man wusste ja nie, ob man irgendetwas nicht doch noch gebrauchen oder eintauschen konnte. Das waren die Gesetze der Nachkriegswirtschaft in Berlin.
Satt und trocken, zufrieden aufgewärmt hüllte sich Adler in seine Bettdecke ein. Das Brennen in seinem verlorenen Arm war nur noch als schwaches Glühen zu spüren. Der Ofen bollerte jetzt voll und verbreitete seine Wärme. Allerdings stank die mit Sand und Schlacke überzogene Braunkohle furchtbar.
Zum Lesen im dünnen Kerzenschein konnte sich Adler heute Abend nicht mehr überwinden. Also blieb der Stapel mit den Büchern unberührt, die Ruth von Dedowsky an ihn weitergereicht hatte. Keine Mascha Kaléko heute, kein Lion Feuchtwanger. Im vergangenen Sommer hatte Adler bei einer Radtour durch den Grunewald einmal vor Feuchtwangers alter Villa gestanden. Dort also hatte der erfolgreiche, der weltgewandte Lion Feuchtwanger gewohnt! Die Nazis hatten ihn ins Exil verjagt, aber er hatte den Ungeist überlebt und konnte weiterschreiben. »Exil zerrieb, machte klein und elend: aber Exil härtete auch und machte groß, reckenhaft«, hatte Feuchtwanger geschrieben. Erst war er nach Frankreich geflohen, später in die USA. So wie Thomas Mann und Bertolt Brecht. Feuchtwanger und Mann waren bisher im Ausland geblieben. Was würde wohl Brecht machen? Würde wenigstens er nach Berlin zurückkehren?
Adler schloss die Augen.
Unmittelbar tauchte das Gesicht des toten Jungen vor ihm auf. Die leeren Augenhöhlen, der maskenhafte Blick. Der kleine zerbrechliche Körper, die furchtbaren Spuren der Gewalt am Hals. Der Kopf, der in einem seltsamen Winkel zum Hals stand.
Von fern hörte Adler einen lärmenden Donner. Er schüttelte sich. Ihn fror wieder am ganzen Körper. Maschinengewehrsalven spritzten in die Wand neben ihm. Der Putz flog auf ihn nieder. Ohne nachzudenken, rollte er sich auf den Boden, drückte sich auf die Seite. Neben ihm sank sein Kamerad zu Boden. Die Detonation hatte Fritz Winter den Kopf weggerissen. Da lag sein Körper. Wo war nur sein Kopf geblieben? Da war nur ein Klumpen aus rotem Fleisch und Dreck. Im Rhythmus des verklingenden Herzschlags quoll das Blut aus Fritz’ zuckendem Hals. Adler drehte sich zur anderen Seite und erbrach sich. Er wollte sich gerade seinen Mund abwischen, doch er konnte seinen Arm gar nicht anheben. Verwundert schaute er an sich herab. Da lag er ja. Da lag ja sein linker Arm auf dem Boden. Gleich neben dem, was der Kopf vom Fritz gewesen war. Blut schoss aus seiner Schulter. War das überhaupt sein Blut? Oder war es das Blut von Fritz? Granatsplitter fegten über ihn hinweg. Von irgendwoher hörte er Schreie, ein Würgen. Er spürte, wie der Tod langsam von Fritz zu ihm hinübergekrochen kam. Adler stürzte. Er fiel immer tiefer. Die Welt um ihn herum glühte. Flammen schlugen empor. Seine Stirn war heiß. Die Kälte war wieder verflogen. Fieberheiß trat ihm stattdessen der Schweiß auf die Stirn.
»Ruhig«, ermahnte er sich.
Der Stahlhelm schien ihm seinen Schädel zu zerdrücken. Er zwang sich, langsam zu atmen. Ganz langsam.
»Bleib ruhig«, ermahnte er sich erneut und versuchte, sich in dem Chaos um sich herum zu orientieren.
Langsam robbte er voran. Die Schmerzen in seiner linken Seite drohten ihn zu zerreißen. Er schrie. Nur weg, weg von hier. Flammen züngelten immer dichter neben ihm empor. Weg, weg von hier. Tonlos formte der Mund des toten Jungen Worte. Da lag es, das nackte tote Kind. Adler kroch immer dichter an den Buben heran. Vielleicht konnte er ja verstehen, was der Junge sagte. Doch je mehr sich Adler mühte heranzukommen, desto weiter entfernte sich das Kind von ihm. Adler robbte immer schneller, nahm seine ganze Kraft zusammen. Die Schmerzen in seiner Seite brüllten unerbittlich. Doch es half alles nichts. Das Kind versank hinter den Flammen. Es verschwand aus seinem Sichtfeld. Das Grauen seines Todes blieb für Adler nur eine stumme Bewegung der Lippen. Ein Klopfen, ein Trommeln, ein wortloser Lärm, ein Hämmern.
Das Trommeln des Regens auf dem Dach hatte aufgehört.
Das Feuer im Ofen war erloschen, und die spätwinterliche Kälte kroch zurück in den Raum. Dennoch war Adler schweißgebadet. Mühsam setzte er sich im Bett auf, versuchte, den Albtraum wegzuwischen. Er begleitete ihn schon seit Jahren. In immer neuen Variationen, mit wechselnder Besetzung. Heute hatten Fritz Winter und der tote Junge eine Rolle darin erhalten.
Doch das Hämmern hatte nicht zum Traum gehört.
Es klopfte erneut an der Tür. Dieses Mal energischer.