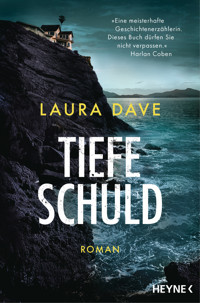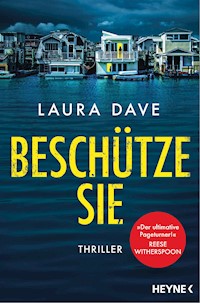
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Beschütze sie
- Sprache: Deutsch
Wir alle haben Geheimnisse, die wir niemandem erzählen ...
"Beschütze sie" steht auf dem Zettel, den Hannah eines Vormittags von einer Unbekannten in die Hand gedrückt bekommt. Er stammt von ihrem Ehemann Owen, der am Morgen wie jeden Tag zur Arbeit gegangen ist. Hannah kann ihn nicht erreichen, er ist spurlos verschwunden — und von einer Sekunde auf die andere verändert sich ihr Leben für immer. Denn ab heute hat sie nur noch zwei Aufgaben: die Liebe ihres Lebens wiederzufinden. Und Owens Tochter Bailey zu beschützen. Doch zu welchem Preis?
"Der ultimative Pageturner!" Reese Witherspoon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Man sieht es ständig im Fernsehen. Es klopft an der Haustür, und auf der anderen Seite steht jemand, der dir eine Nachricht bringt, die alles verändert. Im Fernsehen ist es normalerweise ein Polizeiseelsorger oder jemand von der Feuerwehr. Aber als ich die Tür öffne – als ich erfahre, dass mein ganzes Leben sich verändern wird –, stehe ich keinem Cop mit Bügelfaltenhose gegenüber. Sondern einem zwölfjährigen Mädchen im Fußballtrikot. Mit Schienbeinschonern und allem Drum und Dran.
Sie streckt mir einen gefalteten Bogen gelbes Briefpapier entgegen. Hannah, steht in Owens Handschrift darauf. Ich nehme das gefaltete Blatt und schaue ihr in die Augen. »Bis dann«, sagt sie und geht in Richtung der Docks. Ich sehe, wie sie kleiner und kleiner wird.
Ich will nicht wissen, was auf dem Zettel steht. Ein Teil von mir möchte sich an diesen letzten Moment klammern – den Moment, bevor man weiß, dass etwas begonnen hat, das sich nicht mehr aufhalten lässt.
Ich falte das Papier auseinander.
Owens Nachricht ist kurz.
Eine einzige Zeile, ein Rätsel.
Beschütze sie.
Die Autorin
Laura Dave wurde in New York City geboren. Ihre Begeisterung fürs Schreiben begann schon in der Grundschule. Sie studierte Englische Literatur und Kreatives Schreiben. Nach dem Studium arbeitete sie als freiberufliche Journalistin für namhafte Magazine und Zeitungen. Seit 2006 widmet sie sich zunehmend dem Romanschreiben; »Beschütze sie« stand über 30 Wochen auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Dave ist mit Drehbuchautor Josh Singer verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Sohn leben sie in Los Angeles.
LAURA DAVE
BESCHÜTZE
SIE
THRILLER
Aus dem Amerikanischen
von Stefan Lux
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe THELASTTHINGHETOLDME erschien erstmals 2021 bei Simon & Schuster, New York City.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 10/2022
Copyright © 2022 by Laura Dave
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Kerstin Kubitz
Umschlaggestaltung: Bürosüd
unter Verwendung von Steve Panton (cover design)
und Getty Images/Mardis Coers/Kontributor
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29158-7V003
www.heyne.de
INHALT
PROLOG
FREMDE VOR DER HAUSTÜR
GREENE STREET
FRAG NUR, WENN DU DIE ANTWORT ERTRÄGST
DENK, WAS DU WILLST
VIERUNDZWANZIG STUNDEN ZUVOR
DIE SPUR DES GELDES
HILFE NAHT
DAS SIND NICHT DEINE FREUNDE
WERFEN SIE MIR DAS NICHT VOR
VOR SECHS WOCHEN
BAILEYS MISTIGER SCHEISSTAG
AN WAS WILLST DU DICH NICHT ERINNERN?
AUSTIN SOLL SCHRÄG BLEIBEN
WER BRAUCHT EINEN FREMDENFÜHRER?
VOR DREI MONATEN
KLEINE WEISSE KIRCHEN
NICHT JEDER TAUGT ZUM HELFER
VOR ACHT MONATEN
SORRY, WE’RE OPEN
DIESES SPIEL KÖNNEN ZWEI LEUTE SPIELEN
VOR EINEM JAHR
DIE CHRONIK LÖSCHEN
DAS IST WISSENSCHAFT, STIMMT’S?
MANCHE STUDENTEN SIND KLÜGER ALS ANDERE
VOR VIERZEHN MONATEN
WENN MAN DEN BALLKÖNIG HEIRATET …
DAS THE NEVER DRY
PASS AUF, WAS DU DIR WÜNSCHST
VOR ACHTZEHN MONATEN
DER GUTE ANWALT
ALS WIR JUNG WAREN
JEDER SOLLTE INVENTUR MACHEN
THE NEVER DRY, TEIL 2
AM SEE
VOR ZWEI JAHREN
MANCHES MACHT MAN BESSER ALLEIN
DER TEUFEL STECKT IM DETAIL
ZURÜCK ZU IHR
VOR ZWEI JAHREN UND VIER MONATEN
MANCHMAL GIBT ES EINEN WEG ZURÜCK
FÜNF JAHRE SPÄTER. ODER ACHT. ODER ZEHN.
DANKSAGUNG
Für Josh und Jacob,
meine süßesten Wunder,
und
Rochelle und Andrew Dave,
für jede einzelne Sache
(lass uns gehen sagte er
nicht zu weit sagte sie
was ist zu weit sagte er
dort wo du bist sagte sie)
e. e. cummings
PROLOG
Owen hat mich gern damit aufgezogen, dass ich alles Mögliche verliere, dass ich, auf meine ganz eigene Weise, das Verlieren zu einer Kunstform erhoben habe. Sonnenbrillen, Schlüssel, Handschuhe, Baseballkappen, Briefmarken, Kameras, Handys, Colaflaschen, Stifte, Schnürsenkel. Socken. Glühbirnen. Eiswürfelbehälter. Ganz unrecht hat er nicht. Ich hatte wirklich den Hang, Sachen zu verlegen. Mich ablenken zu lassen. Zu vergessen.
Bei unserem zweiten Date habe ich das Ticket fürs Parkhaus verloren, in dem wir vor dem Essen unsere Autos abgestellt hatten. Wir waren beide mit unseren eigenen Wagen gekommen. Später hat Owen sich darüber lustig gemacht – darüber, dass ich darauf bestanden hatte, selbst zu diesem zweiten Date zu fahren. Sogar in unserer Hochzeitsnacht hat er sich darüber amüsiert. Ich habe damit gekontert, wie er mir an dem Abend auf den Zahn gefühlt, wie er endlose Fragen über meine Vergangenheit gestellt hat – über die Männer, die ich verlassen hatte, und über die, die mich verlassen hatten.
Er hat sie die Beinahe-Boys genannt. Hat sein Glas erhoben und feierlich erklärt, er sei ihnen – wo immer sie sich inzwischen herumtreiben mochten – dankbar, dass sie nicht das gewesen waren, was ich gebraucht hatte, sonst würde er mir jetzt schließlich nicht gegenübersitzen.
Du kennst mich doch kaum, sagte ich.
Er lächelte. Aber so fühlt es sich nicht an, oder?
Da hatte er nicht unrecht. Es war überwältigend, was sich vom ersten Moment an zwischen uns abspielte. Ich rede mir gern ein, dass ich deswegen abgelenkt war. Dass ich deswegen das Parkticket verloren habe.
Wir standen in der Tiefgarage des Ritz-Carlton im Zentrum von San Francisco. Und der Parkwächter schrie, es sei ihm ganz egal, wenn ich behauptete, ich sei nur zum Essen dagewesen.
Die Gebühr für ein verlorenes Ticket betrug hundert Dollar. »Sie könnten das Auto hier schon seit Wochen stehen haben«, erklärte der Parkwächter. »Woher soll ich wissen, dass Sie mich nicht bescheißen? Hundert Dollar plus Steuer für jedes verlorene Ticket. Lesen Sie einfach das Schild.« Hundert Dollar plus Steuer, um nach Hause fahren zu dürfen.
»Bist du sicher, dass du es verloren hast?«, fragte Owen. Aber er lächelte dabei, als wäre es das Tollste, was er am ganzen Abend über mich erfahren hatte.
Ich war sicher. Ich hatte jeden Quadratzentimeter in meinem Volvo abgesucht. Und in Owens schickem Sportwagen (in dem ich überhaupt nicht gewesen war). Und auf dem hässlichen grauen Boden der Tiefgarage. Kein Ticket, nirgends.
In der Woche nach Owens Verschwinden habe ich geträumt, wie er in dieser Garage stand. Er trug denselben Anzug, dasselbe verzückte Lächeln. Im Traum nahm er seinen Ehering ab.
Schau nur, Hannah, sagte er. Jetzt hast du mich auch verloren.
TEIL I
Ich habe wenig Geduld mit Wissenschaftlern, die ein Brett nehmen, nach der dünnsten Stelle suchen und da, wo es am leichtesten geht, eine Menge Löcher bohren.
ALBERTEINSTEIN
FREMDE VOR DER HAUSTÜR
Man sieht es ständig im Fernsehen: Es klopft an der Haustür, und auf der anderen Seite der Tür steht jemand, der dir eine Nachricht bringt, die alles verändert. Im Fernsehen ist es normalerweise ein Polizeiseelsorger oder jemand von der Feuerwehr, vielleicht auch ein uniformierter Offizier der Streitkräfte. Aber als ich die Tür öffne – als ich erfahre, dass mein ganzes Leben sich verändern wird –, stehe ich keinem Cop oder FBI-Beamten mit Bügelfaltenhose gegenüber. Sondern einem zwölfjährigen Mädchen im Fußballtrikot. Mit Schienbeinschonern und allem Drum und Dran.
»Mrs. Michaels?«, fragt sie.
Ich zögere, bevor ich antworte, wie so oft, wenn ich gefragt werde, wer ich bin. Die Antwort lautet Ja und Nein. Ich habe meinen Namen nicht geändert. Ich war achtunddreißig Jahre lang Hannah Hall. Als ich Owen kennengelernt habe, sah ich keinen Grund, plötzlich zu einer anderen zu werden. Aber Owen und ich sind jetzt seit einem guten Jahr verheiratet. In dieser Zeit habe ich gelernt, die Leute nicht zu korrigieren, egal, welchen Namen sie benutzen. Denn was sie eigentlich wissen wollen, ist, ob ich Owens Frau bin.
Jedenfalls will diese Zwölfjährige es offenbar wissen, was mich zu der Frage bringt, woher ich die Sicherheit nehme, dass sie zwölf ist, wo ich die Menschen doch die meiste Zeit meines Lebens in zwei große Kategorien eingeteilt habe: Kinder und Erwachsene. Diese Veränderung verdanke ich den letzten anderthalb Jahren, genauer gesagt: Ich verdanke sie Bailey, der Tochter meines Mannes, sechzehn und mit der alterstypischen erstaunlichen Gabe, rund um die Uhr abweisend zu wirken. Ich verdanke sie meinem eigenen Fehler, schließlich habe ich der zurückhaltenden Bailey bei unserer allerersten Begegnung erklärt, sie sehe jünger aus, als sie ist. Der schlimmste Patzer, den ich mir hätte leisten können.
Vielleicht auch der zweitschlimmste. Der Schlimmste war vermutlich, dass ich ihn mit dem dämlichen Witz zu kaschieren versucht habe, ich würde mir selbst wünschen, für jünger gehalten zu werden. Seit diesem ersten Moment scheint Bailey mich kaum ertragen zu können, obwohl ich inzwischen gelernt habe, gegenüber Sechzehnjährigen völlig auf Witze zu verzichten. Und auch sonst nicht zu viel zu reden.
Aber zurück zu meiner zwölfjährigen Freundin vor der Haustür, die von einem schmutzigen Stollenschuh auf den anderen tritt.
»Mr. Michaels wollte, dass ich Ihnen das gebe«, sagt sie.
Dann streckt sie mir einen gefalteten Bogen gelbes Briefpapier entgegen. HANNAH, steht in Owens Handschrift darauf.
Ich nehme das gefaltete Blatt und schaue ihr in die Augen. »Tut mir leid, aber irgendetwas kapiere ich nicht. Bist du eine Freundin von Bailey?«
»Wer ist Bailey?«
Mit einem Ja hatte ich nicht gerechnet. Zwischen zwölf und sechzehn liegt ein ganzer Ozean. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zusammen. Warum hat Owen mich nicht einfach angerufen? Warum spannt er dieses Mädchen ein? Mein erster Gedanke wäre gewesen, dass Bailey etwas passiert ist und Owen nicht von ihr wegkann. Aber Bailey ist zu Hause und geht mir wie üblich aus dem Weg. Ihre dröhnende Musik (heute: Beautiful: The Carole King Musical) pulsiert die Treppe herunter, als ständige Erinnerung, dass ich in ihrem Zimmer nicht willkommen bin.
»Es tut mir leid. Ich bin etwas verwirrt … Wo hast du ihn gesehen?«
»Er ist auf dem Flur an mir vorbeigelaufen«, sagt sie.
Einen Moment lag denke ich, sie spricht von unserem Hausflur, gleich hinter mir. Aber das ergibt keinen Sinn. Wir wohnen in einem schwimmenden Haus, einem Hausboot, wie die meisten sagen würden, nur nicht hier in Sausalito, wo es eine ganze Siedlung davon gibt. Vierhundert schwimmende Häuser, so heißen sie hier – mit viel, viel Glas und toller Aussicht. Unser Bürgersteig ist ein Anleger, gleich hinter der Tür liegt kein Flur, sondern das Wohnzimmer.
»Dann hast du Mr. Michaels also in der Schule gesehen?«
»Hab ich doch gesagt.« Wo denn sonst?, fügt ihr Blick unausgesprochen hinzu. »Meine Freundin Claire und ich waren auf dem Weg zum Training. Und er hat uns gebeten, das hier abzugeben. Ich hab gesagt, das geht aber erst nach dem Training, und er meinte, prima. Er hat uns Ihre Adresse gegeben.«
Demonstrativ zeigt sie mir ein zweites Stück Papier.
»Er hat uns auch zwanzig Dollar gegeben«, sagt sie.
Das Geld hält sie nicht hoch. Vielleicht denkt sie, ich würde es ihr wieder abnehmen.
»Sein Handy war kaputt oder so was, und er konnte Sie nicht erreichen. Keine Ahnung. Er ist nicht mal richtig stehen geblieben.«
»Dann … dann hat er gesagt, sein Handy wäre kaputt?«
»Woher sollte ich es wohl sonst wissen?«
In diesem Moment klingelt ihr Telefon – das glaube ich jedenfalls, bis sie das Gerät von ihrem Gürtel abnimmt. Es sieht eher nach einem Hightech-Beeper aus. Sind Beeper wieder in Mode?
Songs von Carole King. Hightech-Beeper. Wahrscheinlich ein Grund mehr, warum Bailey keine Geduld mit mir hat. Die Teenagerwelt ist voller Dinge, von denen ich absolut keine Ahnung habe.
Das Mädchen tippt zweimal auf sein Gerät und scheint Owen und seinen Zwanzig-Dollar-Auftrag schon vergessen zu haben. Ich zögere, sie gehen zu lassen, bin immer noch unsicher, was hier eigentlich läuft. Vielleicht geht es um irgendeinen abgedrehten Streich. Vielleicht findet Owen das Ganze witzig. Ich finde es nicht witzig, jedenfalls bis jetzt nicht.
»Bis dann«, sagt sie.
Sie geht in Richtung der Docks. Ich sehe, wie sie kleiner und kleiner wird, über der Bucht geht die Sonne unter, eine Handvoll frühe Sterne leuchten dem Mädchen den Weg.
Ich trete nach draußen. Halb rechne ich damit, dass Owen (mein wunderbarer, alberner Owen) irgendwo am Kai auftaucht, umringt vom Rest eines kichernden Fußballteams, und dass sie mich in den Spaß einweihen, den ich offenbar nicht kapiere. Aber da ist kein Owen. Und auch sonst niemand.
Also schließe ich die Haustür. Und betrachte das gelbe, immer noch zusammengefaltete Briefpapier in meiner Hand.
Hier draußen in der Stille wird mir bewusst, wie sehr ich es nicht auseinanderfalten will. Ich will nicht wissen, was auf dem Zettel steht. Ein Teil von mir möchte sich an diesen letzten Moment klammern – den Moment, wo man etwas noch für einen Scherz hält, einen Irrtum, ein großes Nichts. Den Moment, bevor man weiß, dass etwas begonnen hat, das sich nicht mehr aufhalten lässt.
Ich falte das Papier auseinander.
Owens Nachricht ist kurz.
Eine einzige Zeile, ein Rätsel.
Beschütze sie.
GREENE STREET
Ich habe Owen vor etwas mehr als zwei Jahren kennengelernt.
Damals wohnte ich noch in New York. Dreitausend Meilen von Sausalito entfernt, dem kleinen Städtchen in Nordkalifornien, das ich jetzt meine Heimat nenne. Sausalito liegt gegenüber von San Francisco auf der anderen Seite des Golden Gate, könnte vom Großstadtleben aber nicht weiter entfernt sein. Es ist ruhig, charmant. Verschlafen. Owen und Bailey wohnen hier schon seit über zehn Jahren. Sausalito ist auch der absolute Gegenpol zu meinem früheren Leben, das sich mitten in Manhattan abgespielt hat, in einem Loft an der Greene Street in SoHo – einer kleinen Wohnung mit astronomischer Miete, bei der ich immer ein wenig das Gefühl hatte, ich könnte sie mir nicht leisten. Ich habe dort meine Werkstatt und meinen Ausstellungsraum gehabt.
Ich bin Drechslerin. Das ist meine Arbeit. Normalerweise verziehen die Leute das Gesicht, wenn ich ihnen von meinem Beruf erzähle. Selbst wenn ich ihnen zu beschreiben versuche, was genau ich mache, kommen bei ihnen unweigerlich Bilder aus dem Holzbearbeitungskurs der Highschool hoch. Das Drechseln hat damit eine vage Ähnlichkeit, ist aber doch etwas ganz anderes. Ich vergleiche es gern mit der Arbeit einer Keramikerin, nur, dass mein Material Holz statt Ton ist.
Ich habe ganz natürlich zu meinem Beruf gefunden. Mein Großvater war Drechsler – ein exzellenter übrigens –, und seine Arbeit hatte schon immer eine zentrale Rolle in meinem Leben gespielt.
Mein Vater Jack und meine Mutter Carole (der es am liebsten war, wenn ich sie beim Vornamen nannte) hatten kein besonderes Interesse an Kindererziehung. Sie hatten praktisch an nichts Interesse, ausgenommen an der Fotografenkarriere meines Vaters. Als ich klein war, hat mein Großvater versucht, meine Mutter dazu zu bringen, sich ein bisschen um mich zu kümmern, aber meinen Vater, der an zweihundertachtzig Tagen im Jahr verreist war, habe ich kaum gekannt. Wenn er ausnahmsweise mal Freizeit hatte, verbrachte er die lieber auf der Ranch seiner Familie in Sewanee, Tennessee, statt die zwei Stunden zum Haus meines Großvaters in Franklin zu fahren und sich mit mir zu beschäftigen. Dann, kurz nach meinem sechsten Geburtstag, verließ mein Vater meine Mutter wegen seiner Assistentin, einer Frau namens Gwendolyn, die gerade einundzwanzig geworden war. Von dem Moment an kam auch meine Mutter nicht mehr nach Hause. Sie stellte meinem Vater so hartnäckig nach, bis er sie zurücknahm, und ließ mich mit meinem Großvater allein.
Es mag melodramatisch klingen, aber so empfinde ich es nicht. Natürlich ist es nicht ideal, wenn die eigene Mutter mehr oder weniger aus deinem Leben verschwindet. Es war kein schönes Gefühl, bei dieser Entscheidung nicht mitreden zu dürfen. Aber im Rückblick glaube ich, dass meine Mutter mir einen Gefallen getan hat, als sie auf diese Art und Weise ging – ohne Entschuldigung, ohne Zögern. Zumindest ließ sie keinen Zweifel: Es gab nichts, was ich hätte tun können, um sie zum Bleiben zu bewegen.
Als sie erst einmal aus meinem Leben verschwunden war, ging es mir besser. Mein Großvater war zuverlässig, er hat jeden Abend für mich gekocht, er hat gewartet, bis ich aufgegessen hatte und dann erklärt, es sei Zeit fürs Geschichtenvorlesen und fürs Schlafengehen. Außerdem durfte ich ihm bei der Arbeit zusehen.
Ich habe es geliebt, ihn arbeiten zu sehen. Er fing mit einem riesigen Stück Holz an, das er auf einer Drechselbank in Bewegung brachte und aus dem er etwas Magisches erschuf. Und wenn das Ergebnis einmal nicht magisch war, überlegte er sofort, was er beim nächsten Versuch besser machen würde.
Wahrscheinlich waren das meine liebsten Momente, wenn ich ihm bei der Arbeit zusah. Wenn er die Hände hochwarf und sagte: »Na, das müssen wir wohl anders machen, stimmt’s?« Dann suchte er nach einem neuen Weg, um das, was ihm vorschwebte, zu erreichen. Ich würde sagen, jede Psychologin, die ihr Geld wert ist, wäre zu dem Schluss gekommen, dass es mir Hoffnung gegeben hat – dass ich geglaubt haben muss, mein Großvater würde mir helfen, für mich dasselbe zu erreichen. Neu anzufangen.
Ich selbst glaube allerdings eher, dass ich Mut aus einem ganz anderen Aspekt geschöpft habe. Meinem Großvater zuzuschauen hat mich gelehrt, dass eben nicht alles auf Anhieb funktioniert. Man kann bestimmte Dinge aus verschiedenen Richtungen angehen, aber man gibt sie nie einfach auf. Man tut, was nötig ist, was die jeweilige Aufgabe von einem verlangt.
Ich habe nie erwartet, mit dem Drechseln Erfolg zu haben – oder mit dem Projekt, das sich daraus entwickelt hat, nämlich Möbel herzustellen. Ich habe mehr oder weniger damit gerechnet, nicht davon leben zu können. Mein Großvater hatte seine Einkünfte regelmäßig mit Bauarbeiten aufgebessert. Nachdem einer meiner gelungeneren Esstische im Architectural Digest vorgestellt wurde, ist es mir relativ schnell gelungen, eine bestimmte Klientel von New Yorkern als Kunden zu gewinnen. Wie ein Innenarchitekt, mit dem ich gern zusammengearbeitet habe, es formuliert hat: Meine Kunden legen gern viel Geld auf den Tisch, damit ihre Wohnungen und Häuser so aussehen, als hätte die Einrichtung praktisch nichts gekostet. Meine rustikalen Arbeiten bringen sie diesem Ziel auf jeden Fall näher.
Im Laufe der Zeit hat sich der treue Kundenkreis auf andere Küstenstädte und Erholungsorte ausgedehnt: Los Angeles, Aspen, East Hampton, Park City, San Francisco.
So haben Owen und ich uns kennengelernt. Avett Thompson – Geschäftsführer der IT-Firma, in der Owen schon damals gearbeitet hat – war mein Kunde. Avett und seine Frau, die irrsinnig gut aussehende Belle, gehörten sogar zu meinem treuesten Abnehmerkreis.
Belle kokettierte gern damit, Avetts Vorzeigefrau zu sein, was vielleicht lustig gewesen wäre, wenn es den Nagel nicht auf den Kopf getroffen hätte. Sie war ein ehemaliges Model, zehn Jahre jünger als seine erwachsenen Kinder, geboren und aufgewachsen in Australien. Meine Stücke standen in jedem Zimmer ihres Stadthauses in San Francisco (wo sie zusammen mit Avett wohnte) und ihres neu gebauten Hauses in St. Helena, einer Kleinstadt am nördlichen Ende des Napa Valley, in das Belle sich gern für sich allein zurückzog.
Ich war Avett nur wenige Male begegnet, bevor Owen und er in meiner Werkstatt auftauchten. Sie waren zu einem Investorentreffen nach New York gereist, und Belle wollte, dass sie sich einen Beistelltisch mit hochgezogenen Kanten ansahen, den ich für ihr Schlafzimmer anfertigen sollte. Avett wusste nicht genau, worauf er achten sollte, irgendwie ging es darum, wie der Tisch zusammen mit dem Bettgestell aussehen würde – dem Bettgestell, auf dem ihre Zehntausend-Dollar-Biomatratze liegen würde.
Avett interessierte es nicht die Bohne. Als er und Owen eintraten, trug er einen schrillen blauen Anzug, seine ergrauenden Haare knisterten vor lauter Gel, das Handy klebte ihm am Ohr. Er war mitten im Gespräch. Nach einem schnellen Blick auf den Beistelltisch legte er die Hand kurz aufs Mikrofon.
»Sieht toll aus«, sagte er. »Sind wir uns einig?«
Ehe ich antworten konnte, war er auf dem Weg nach draußen.
Owen dagegen war fasziniert. Er machte einen langsamen Rundgang durch die Werkstatt und blieb vor jedem einzelnen Stück stehen.
Ich sah ihm bei seiner Besichtigungstour zu. Sein Anblick war ziemlich verwirrend: dieser Kerl mit langen Armen und Beinen, mit struppigen blonden Haaren und sonnengetränkter Haut. Er trug ausgelatschte Converse-Sneaker, die nicht zu seinem schicken Sportsakko passen wollten. Es schien, als wäre er geradewegs vom Surfbrett in das Sakko und das gestärkte Hemd gestolpert.
Ich merkte, dass ich ihn anstarrte, und wollte mich gerade in dem Moment abwenden, als Owen vor meinem Lieblingsstück stehen blieb – einem Landhaustisch, den ich als Schreibtisch benutzte.
Mein Computer, die Zeitungen und verschiedene kleine Werkzeuge bedeckten den größten Teil der Tischplatte. Das eigentliche Möbelstück nahm man nur wahr, wenn man richtig hinschaute. Das tat er. Er betrachtete das stabile Redwood-Holz, das ich mit dem Beitel bearbeitet hatte, wodurch der gelbliche Farbton hervorgetreten war, und an dessen Ecken ich rostigen Stahl geschweißt hatte.
War Owen der erste Kunde, der den Tisch bemerkt hatte? Nein, natürlich nicht. Aber er war der Erste, der sich hinunterbeugte, so wie ich es oft tat, und mit den Fingern über das scharfkantige Metall strich.
Er drehte den Kopf und sah zu mir hoch: »Autsch«, sagte er.
»Versuchen Sie mal, mitten in der Nacht dagegen zu stoßen«, erwiderte ich.
Owen richtete sich wieder auf und tätschelte den Tisch zum Abschied. Er kam auf mich zu, bis wir irgendwie eng beisammenstanden – zu eng, als dass ich mich nicht gefragt hätte, wie es dazu gekommen war. Wahrscheinlich hätte ich mich wegen meines Tanktops und der mit Farbe verschmierten Hose befangen fühlen sollen, wegen des nachlässigen Buns auf meinem Kopf, aus dem sich ungewaschene Locken gelöst hatten. Stattdessen spürte ich, als ich merkte, wie er mich ansah, etwas ganz anderes.
»Und?«, fragte er. »Was soll der Tisch kosten?«
»Tatsächlich ist der Tisch das einzige Stück im Raum, das unverkäuflich ist«, erklärte ich.
»Weil man sich daran verletzen kann?«
»Genau«, erwiderte ich.
Das war der Moment, in dem er lächelte. Als Owen lächelte. Es klingt fast wie der Titel eines schlechten Popsongs. Nur um das klarzustellen: Er strahlte nicht übers ganze Gesicht. So sentimental oder explosiv war die Sache nicht. Eher ließ das Lächeln – dieses großzügige, kindliche Lächeln – ihn liebenswürdig erscheinen. Auf eine Art liebenswürdig, wie sie für die Greene Street in Downtown Manhattan nicht alltäglich war. Es wirkte herzlich, und ich hatte schon zu zweifeln begonnen, dass mir diese Herzlichkeit auf Manhattans Greene Street je begegnen würde.
»Dann ist beim Tisch also wirklich nichts zu machen?«, fragte er.
»Ich fürchte nicht, aber ich kann Ihnen gern ein paar andere Stücke zeigen.«
»Wie wäre es stattdessen mit einer Lektion? Sie zeigen mir, wie ich mir selbst einen Tisch in dieser Art bauen kann, vielleicht mit nicht ganz so scharfen Kanten … Ich unterschreibe eine Verzichtserklärung, mögliche Verletzungen gehen auf mein eigenes Risiko.«
Ich lächelte noch immer, fühlte mich aber verwirrt. Denn plötzlich hatte ich das Gefühl, wir sprächen nicht mehr über den Tisch. Ich war sogar ziemlich sicher, dass wir es nicht taten. So sicher, wie eine Frau sein kann, die zwei Jahre lang mit einem Mann verlobt gewesen war, bis sie merkte, dass sie ihn nicht heiraten konnte. Zwei Wochen vor der Hochzeit …
»Hören Sie, Ethan …«, sagte ich.
»Owen«, korrigierte er mich.
»Owen. Es ist nett, dass Sie fragen, aber ich gehe grundsätzlich nicht mit Kunden aus.«
»Na, dann ist es ja gut, dass ich mir Ihre Möbel sowieso nicht leisten kann«, sagte er.
Trotzdem machte er einen Rückzieher. Er zuckte die Schultern, wie um zu sagen, vielleicht ein anderes Mal. Dann drehte er sich zur Tür und zu Avett um, der auf dem Bürgersteig auf und ab ging und immer noch seinen Gesprächspartner anbrüllte.
Er war schon fast zur Tür hinaus. War beinahe weg. Aber ich spürte sofort – und sehr deutlich – den Drang, ihn zurückzuhalten und zu sagen, ich hätte es nicht so gemeint. Ich hätte etwas anderes gemeint. Ich hätte gemeint, er solle bleiben.
Ich behaupte nicht, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Ich sage nur, dass etwas in mir ihn davon abhalten wollte, einfach so zu gehen. Ich wollte dieses breite Lächeln noch eine Weile genießen.
»Warten Sie«, sagte ich. Auf der Suche nach einem Vorwand, unter dem ich ihn aufhalten könnte, sah ich mich um. Mein Blick fiel auf ein Stück Stoff, das für eine andere Kundin bestimmt war. Ich hielt es hoch und sagte: »Das ist für Belle.«
Es war nicht meine stärkste Szene. Und wie mein Ex-Verlobter sicher bestätigen würde, war es völlig untypisch, dass ich auf jemanden zuging, anstatt mich vor ihm zurückzuziehen.
»Ich sorge dafür, dass sie es bekommt«, sagte er.
Er nahm den Stoff, wobei er meinem Blick auswich.
»Nur fürs Protokoll: Ich gehe auch grundsätzlich mit niemandem aus. Ich bin alleinerziehender Vater, das ist der Grund …« Er machte eine Pause. »Aber meine Tochter ist ein Theater-Junkie. Und ich bekomme dicke Minuspunkte, wenn ich nach New York fliege und mir kein Stück ansehe.«
Er deutete auf Avett, der immer noch wütend auf dem Bürgersteig herumbrüllte.
»Ein Theaterstück ist nicht unbedingt Avetts Sache, so überraschend es klingen mag …«
»Sehr überraschend«, sagte ich.
»Also … Was meinen Sie? Möchten Sie mitkommen?«
Er kam nicht näher, aber er sah auf. Mir direkt in die Augen.
»Betrachten wir es nicht als Date«, sagte er. »Sondern als einmalige Sache. Darauf einigen wir uns im Vorhinein. Nur Abendessen und ein Theaterstück. Schön, Sie kennenzulernen.«
»Wegen unserer Grundsätze?«, fragte ich.
Das Lächeln kehrte zurück, offen und großzügig. »Genau«, sagte er. »Deswegen.«
*
»Was ist das für ein Geruch?«, fragt Bailey.
Ich werde aus meinen Erinnerungen gerissen und sehe Bailey in der Küchentür stehen. Sie trägt einen unförmigen Pulli, über der Schulter eine Kuriertasche, unter deren Riemen ihr mit lila Strähnen durchzogenes Haar hervorschaut. Sie wirkt gereizt.
Ich lächle sie an, das Handy unters Kinn geklemmt. Ich habe versucht, Owen zu erreichen. Vergeblich, ich bin auf der Mailbox gelandet. Wieder und wieder.
»Tut mir leid, dass ich dich nicht bemerkt hab«, sage ich.
Sie antwortet nicht, kneift nur den Mund zusammen. Ich lege das Handy weg und ignoriere ihren permanent missmutigen Blick. Sie ist eine Schönheit, trotzdem. Sie ist so schön, dass die Leute aufblicken, wenn sie einen Raum betritt. Sie ähnelt Owen nicht besonders. Ihre natürliche Haarfarbe ist kastanienbraun, ihre Augen sind dunkel und leidenschaftlich. Intensiv. Ihre Augen ziehen einen magisch an. Owen sagt, sie hat sie von ihrem Großvater (dem Vater ihrer Mutter), weshalb sie auch nach ihm benannt wurde. Ein Mädchen, das Bailey heißt. Einfach Bailey.
»Wo ist mein Dad?«, fragt sie. »Er sollte mich zur Theaterprobe fahren.«
Ich versteife mich, plötzlich spüre ich Owens Nachricht in der Tasche wie ein schweres Gewicht.
Beschütze sie.
»Er ist sicher auf dem Weg«, sage ich. »Lass uns zu Abend essen.«
»Ist es das Essen, das so riecht?«, fragt sie.
Sie rümpft die Nase, nur für den Fall, dass ich nicht begriffen habe, dass der Geruch ihr nicht sonderlich gefällt.
»Es sind die Linguine, die du bei Poggio hattest«, sage ich.
Sie schaut mich ausdruckslos an, als wäre Poggio nicht ihr Lieblingsrestaurant hier im Ort, als wären wir nicht vor wenigen Wochen noch dort gewesen, um ihren sechzehnten Geburtstag zu feiern. Bailey hat etwas von der Abendkarte bestellt – hausgemachte Mehrkornlinguine in brauner Buttersoße. Und Owen hat sie dazu von seinem Glas Malbec probieren lassen. Ich hatte den Eindruck, sie fand die Nudeln toll. Aber vielleicht fand sie es nur toll, mit ihrem Vater Wein zu trinken.
Ich schaufele eine Riesenportion auf einen Teller und stelle ihn auf die Kücheninsel.
»Probier ein bisschen«, sage ich. »Sie werden dir schmecken.«
Bailey starrt mich an und scheint zu überlegen, ob sie es auf eine Machtprobe ankommen lassen will, ob sie es darauf ankommen lassen will, ihren Vater zu enttäuschen, wenn ich ihm von ihrem schnellen Abgang ohne Essen erzähle. Sie entscheidet sich dagegen, schluckt ihren Ärger herunter und setzt sich auf ihren Hocker.
»Na gut«, sagt sie. »Ich probiere.«
Bailey gibt sich beinahe Mühe mit mir. Das ist das Schlimmste. Sie ist kein böses Mädchen, keine Nervensäge. Sie ist wirklich okay und bloß in eine Situation geraten, die ihr gewaltig gegen den Strich geht. Diese Situation bin ich.
Es gibt offensichtliche Gründe, warum ein Mädchen im Teenageralter ein Problem mit der neuen Ehefrau des Vaters haben kann. Das gilt besonders für Bailey, die glücklich war, solange sie nur zu zweit waren, beste Freunde, Owen ihr größter Fan. Aber diese Gründe sind keine Erklärung für Baileys vollständige Ablehnung meiner Person. Es liegt auch nicht nur daran, dass ich mich bei unserer ersten Begegnung so verschätzt habe, was ihr Alter anging. Entscheidender war wohl ein Nachmittag kurz nach meinem Umzug nach Sausalito. Ich sollte sie bei ihrer Freundin abholen, wurde aber vom Anruf einer Kundin aufgehalten – und bin fünf Minuten zu spät gekommen. Nicht zehn Minuten. Fünf. Die Uhr hat 17:05 angezeigt, als ich am Haus ihrer Freundin vorfuhr. Es hätte genauso gut eine Stunde sein können. Bailey ist ziemlich anspruchsvoll. Owen wird Ihnen sagen, dass wir diese Eigenschaft gemeinsam haben. Sowohl seine Frau als auch seine Tochter wissen nach fünf Minuten über einen anderen Menschen Bescheid. Länger brauchen wir nicht. Und in den fünf Minuten, in denen Bailey damals ihr Urteil über mich gefällt hat, bin ich dummerweise ans Telefon gegangen.
Bailey dreht ein paar Nudeln auf ihre Gabel und betrachtet sie prüfend. »Die sehen nicht so aus wie bei Poggio.«
»Sollten sie aber. Ich habe den Souschef gebeten, mir das Rezept zu geben. Er hat mich sogar zum Ferry Building geschickt, wo es das Knoblauchbrot gibt, das er dazu serviert.«
»Du bist wegen einem Brot nach San Francisco gefahren?«, fragt sie.
Vielleicht gebe ich mir zu viel Mühe mit ihr.
Sie beugt sich vor und schiebt sich den ganzen Bissen in den Mund. Ich beiße mir auf die Unterlippe, kann es kaum erwarten, dass sie das Essen lobt – dass ihr wider Willen ein leises »Lecker!« über die Lippen kommt.
In diesem Moment beginnt sie zu würgen, buchstäblich zu würgen. Schnell greift sie nach einem Glas Wasser.
»Was hast du da reingetan?«, fragt sie. »Das schmeckt wie … Holzkohle.«
»Aber ich habe es probiert«, sage ich. »Es ist perfekt.«
Ich nehme selbst noch mal einen Bissen. Sie hat nicht unrecht. In meiner Verwirrung über die zwölfjährige Besucherin und Owens Nachricht habe ich die Buttersoße mit ihrer eigentlich leicht malzigen, schaumigen Geschmacksfülle anbrennen lassen. Sie schmeckt bitter. Als würde man ein Lagerfeuer essen.
»Ich muss sowieso los«, sagt sie. »Vor allem, wenn Suz mich fahren muss.«
Bailey steht auf. Ich male mir aus, wie Owen hinter mir steht, sich hinunterbeugt und mir ins Ohr flüstert, einfach abwarten. Das sagt er immer, wenn Bailey mich zurückweist. Einfach abwarten. Was heißen soll, sie wird irgendwann von selbst einlenken. Was auch heißt, dass es nur noch zweieinhalb kurze Jahre sind, bis sie aufs College geht. Aber Owen begreift nicht, dass das kein Trost für mich ist. Für mich bedeutet es nur, dass die Zeit knapp wird, die mir bleibt, um sie für mich zu gewinnen.
Und ich will sie für mich gewinnen. Ich will, dass wir eine Beziehung aufbauen, und nicht nur wegen Owen. Da ist noch etwas anderes, das mich selbst dann zu Bailey hinzieht, wenn sie mich von sich wegstößt. Zum Teil liegt es daran, dass ich bei ihr etwas wiedererkenne, das passiert, wenn man die Mutter verliert. Meine ist freiwillig gegangen, Bailey hat ihre durch eine Tragödie verloren, aber man wird so oder so davon geprägt. Man findet sich in der befremdlichen Situation wieder, dass man versucht, in der Welt zurechtzukommen, ohne dass die wichtigste Person von allen ein Auge darauf hat.
»Ich gehe rüber zu Suz«, sagt sie. »Sie kann mich fahren.«
Suz, ihre Freundin Suz, die auch in dem Stück mitspielt. Suz, die auch im Hafen wohnt. Bei Suz ist sie sicher, oder?
Beschütze sie.
»Ich kann dich hinbringen.«
»Nein.« Sie schiebt sich die lilafarbenen Haare hinters Ohr und wirft im Spiegel einen prüfenden Blick auf die Tönung. »Geht schon. Suz fährt doch sowieso …«
»Wenn dein Vater nicht rechtzeitig zurück ist«, sage ich, »komme ich dich abholen. Einer von uns wird vor der Tür auf dich warten.«
Sie wirft mir einen bohrenden Blick zu. »Warum sollte er nicht zurück sein?«
»Wird er schon. Ganz sicher. Ich meinte nur … Wenn ich dich abhole, darfst du auf dem Rückweg fahren.«
Bailey hat gerade ihren Lernführerschein gemacht. Sie darf ein Jahr lang nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren. Und Owen hat es nicht gern, wenn sie im Dunkeln fährt, auch wenn er dabei ist. Das versuche ich mir zunutze zu machen.
»Klar«, sagt Bailey. »Danke.«
Sie geht zur Tür. Sie will raus aus dem Gespräch, raus in die frische Luft von Sausalito. Dafür würde sie alles sagen, aber ich verbuche es als Verabredung.
»Dann bis später?«
»Bis dann«, sagt sie.
Ich bin glücklich, zumindest für eine Sekunde. Dann knallt die Haustür hinter ihr zu. Und ich bin wieder allein mit Owens Nachricht, mit der ganz speziellen Stille in der Küche und mit genug verbrannten Nudeln für eine zehnköpfige Familie.
FRAG NUR, WENN DU DIE ANTWORT ERTRÄGST
Es ist 20 Uhr, Owen hat noch immer nicht angerufen.
Ich biege links auf den Parkplatz vor Baileys Schule und finde eine freie Lücke direkt am Haupteingang.
Dann stelle ich das Radio leiser und versuche es noch mal. Mein Herz beginnt zu rasen, als ich direkt auf der Mailbox lande. Es ist zwölf Stunden her, seit er zur Arbeit aufgebrochen ist, zwei seit dem Besuch der Fußballerin, achtzehn Nachrichten an meinen Mann sind unbeantwortet geblieben.
»Hey«, sage ich nach dem Piepton. »Ich weiß nicht, was los ist, aber du musst mich anrufen, sobald du das hier hörst. Owen? Ich liebe dich. Aber ich bringe dich um, wenn du dich nicht bald meldest.«
Ich beende den Anruf und starre auf mein Handy, als könnte ich es hypnotisieren. Als könnte ich Owens Anruf herbeizwingen, der mich mit einer guten Erklärung besänftigt. Dass Owen immer eine gute Erklärung parat hat, ist einer der Punkte, weshalb ich ihn liebe. Egal, was passiert, er strahlt immer Ruhe und Rationalität aus. Ich möchte glauben, dass es auch jetzt so läuft. Obwohl es nicht danach aussieht.
Ich rutsche auf den Beifahrersitz, damit Bailey sich hinters Steuer setzen kann. Und ich schließe die Augen, gehe in Gedanken verschiedene Szenarien durch, die sich abgespielt haben könnten. Harmlose, vernünftige Szenarien. Er hängt in einer endlosen Besprechung im Büro fest. Er hat sein Handy verloren. Er überrascht Bailey mit einem verrückten Geschenk. Er überrascht mich mit irgendeiner Reise. Er denkt, das alles ist witzig. Er denkt überhaupt nicht.
In diesem Augenblick höre ich im Radio den Namen des Technologieunternehmens, in dem Owen arbeitet – The Shop.
Ich drehe lauter und denke zuerst, ich habe es mir nur eingebildet. Vielleicht war es der Nachhall meiner eigenen Worte auf Owens Mailbox: Hält The Shop dich auf? Möglich wäre es. Aber dann geht der Bericht weiter, ich höre die professionelle, resolute Stimme der Sprecherin auf NPR.
»Die heutige Durchsuchung war der vorläufige Höhepunkt der seit vierzehn Monaten laufenden Ermittlungen des FBI und der Börsenaufsicht SEC. Wir können bestätigen, dass der Geschäftsführer von The Shop, Avett Thompson, festgenommen wurde. Es wird mit einer Anklage wegen Veruntreuung und Betrug gerechnet. Von Quellen im Umfeld der Ermittler hat NPR erfahren, dass – Zitat – es Beweise dafür gibt, dass Thompson außer Landes fliehen wollte und bereits ein Haus in Dubai gekauft hat. Mit weiteren Anklagen gegen leitende Mitarbeiter wird in Kürze gerechnet.«
The Shop. Sie redet von The Shop.
Wie kann das sein? Owen fühlt sich geehrt, dort zu arbeiten. Den Begriff hat er tatsächlich benutzt. Geehrt. Er hat mir erzählt, dass er Gehaltseinbußen hingenommen hat, um dort arbeiten zu können. Fast alle seiner Kollegen haben Gehaltseinbußen hingenommen und bei größeren Firmen gekündigt – Google, Facebook, Twitter. Sie haben auf viel Geld verzichtet und sich bereit erklärt, einen Teil ihres Gehalts in Form von Aktienoptionen zu erhalten.
Hat Owen mir das alles nicht erzählt, weil er an die Technologie geglaubt hat, die The Shop entwickelt? Wir reden nicht von Enron. Oder Theranos. Sondern von einer Softwarefirma. Sie haben an Softwaretools gearbeitet, die das Online-Leben privater machen sollten – die Menschen sollten die Kontrolle darüber haben, was sie im Netz preisgeben wollen, es sollte kinderleicht werden, ein peinliches Foto zu löschen, eine Website praktisch verschwinden zu lassen. Sie wollten zu einer Revolution in Sachen Privatsphäre beitragen. Sie wollten etwas Positives bewirken.
Wo soll da der Betrug liegen?
Im Radio kommt ein Werbespot, ich schnappe mir mein Handy und rufe Apple News auf.
Doch als ich gerade auf die Wirtschaftsseiten von CNN gehe, kommt Bailey aus der Schule. Sie hat eine Tasche über der Schulter und sieht so hilfsbedürftig aus, wie ich sie kaum je gesehen habe, und schon gar nicht, wenn wir beide allein sind.
Instinktiv schalte ich das Radio aus und lege das Handy weg.
Beschütze sie.
Bailey steigt schnell ins Auto. Sie lässt sich auf den Fahrersitz fallen und schnallt sich an. Sie sagt weder Hallo noch dreht sie den Kopf in meine Richtung.
»Alles in Ordnung?«, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf, die hinter die Ohren geschobenen lilafarbenen Haare lösen sich. Ich rechne mit einer höhnischen Bemerkung. Sehe ich etwa so aus? Aber sie sagt nichts.
»Bailey?«, versuche ich es.
»Ich weiß nicht«, sagt sie. »Ich weiß nicht, was los ist …«
Jetzt erst fällt mir auf, dass die Tasche, die sie dabeihat, nicht ihre übliche Kuriertasche ist, sondern eine Sporttasche. Eine große schwarze Sporttasche, die sie sanft in ihrem Schoß wiegt, wie ein Baby.
»Was ist das?«, frage ich.
»Schau rein«, sagt sie, und die Art, wie sie es sagt, macht mir klar, dass ich lieber nicht reinschauen würde. Aber ich habe keine Wahl. Bailey wirft mir die Sporttasche herüber.
»Mach schon. Schau rein, Hannah.«
Ich öffne den Reißverschluss ein kleines Stück. Sofort quellen Geldscheine heraus. Rollen und noch mehr Rollen. Hunderte von Hundert-Dollar-Scheinen, zusammengehalten von Bindfäden. Schwer, sie nicht zu zählen.
»Bailey«, flüstere ich. »Wo hast du das her?«
»Mein Vater hat die Tasche in meinen Spind gelegt.«
Ich sehe sie ungläubig an, das Herz schlägt mir bis zum Hals. »Woher weißt du das?«
Bailey reicht mir einen Zettel oder besser gesagt: Sie wirft ihn in meine Richtung. »Nicht schwer zu erraten«, sagt sie.
Ich nehme den Zettel von meinem Schoß, einen Bogen gelbes Briefpapier. Owens zweite Nachricht auf diesem gelben Papier.
Das Gegenstück zu meiner Nachricht. Vorn drauf steht BAILEY, doppelt unterstrichen.
Bailey,
ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir so leid. Du weißt, worauf es mir ankommt.
Und du weißt, worauf es dir selbst ankommt. Bitte halt dich daran fest.
Hilf Hannah. Tu, was sie dir sagt.
Sie liebt dich. Das tun wir beide.
Du bist mein ganzes Leben,
Dad
Ich starre auf das Papier, bis mir die Wörter vor den Augen verschwimmen. Und ich kann mir vorstellen, was vor Owens Begegnung mit der Zwölfjährigen in Schienbeinschonern passiert ist. Ich kann mir Owen vorstellen, wie er durch die Gänge des Schulgebäudes läuft, an den Spinden vorbei. Er war dort, um die Tasche für seine Tochter zu deponieren. Solange es noch möglich war.
Mir wird heiß, ich bekomme kaum Luft.
Ich sehe mich gern als die Unerschütterliche. Wenn man bedenkt, wie ich aufgewachsen bin, war das vermutlich nötig. Ich kann mich nur an zwei Momente in meinem Leben erinnern, in denen ich mich so gefühlt habe wie jetzt: am Tag, als mir klar wurde, dass meine Mutter nicht zurückkommt, und am Tag, als mein Großvater starb. Jetzt, wo ich zwischen Owens Nachricht und der obszönen Menge Geld hin und her blicke, ist es wieder so. Wie soll ich dieses Gefühl erklären? Es ist, als ob mein Inneres nach außen müsste. Egal, wie. Und falls es je einen Moment geben sollte, in dem ich mich hemmungslos übergeben muss, dann jetzt.
Und genau das tue ich.
*
Wir fahren auf unseren Parkplatz am Anleger.
Während der Fahrt haben wir die Fenster offen gelassen, und ich halte mir immer noch ein Papiertaschentuch vor den Mund.
»Meinst du, du musst noch mal kotzen?«, fragt Bailey.
Ich schüttele den Kopf, womit ich mindestens so sehr mich selbst überzeugen will wie sie. »Geht schon«, sage ich.
»Denn das hier könnte helfen …«, sagt Bailey.
Ich schaue hinüber und sehe, wie sie einen Joint aus der Tasche ihres Pullis zieht. Sie streckt ihn mir auffordernd entgegen.
»Wo hast du den her?«, frage ich.
»In Kalifornien ist es legal«, sagt sie.
Ist das eine Antwort? Und stimmt sie überhaupt, wenn es um Sechzehnjährige geht?
Vielleicht will sie meine Frage auch gar nicht beantworten, vor allem, wenn sie den Joint von Bobby hat. Bobby ist mehr oder weniger ihr Freund. Er ist in der letzten Klasse an ihrer Schule und oberflächlich betrachtet ganz in Ordnung, vielleicht ein bisschen nerdig. Er ist Schülersprecher und will an die University of Chicago. Keine lilafarbenen Haare. Aber er hat etwas an sich, das Owen misstrauisch macht. Ich versuche, diese Abneigung mit Owens übertriebener Fürsorglichkeit zu erklären, allerdings scheint Bobby zu Baileys Geringschätzung meiner Person noch zusätzlich beizutragen. Wenn sie bei ihm war, begrüßt sie mich beim Nachhausekommen manchmal mit einer beleidigenden Bemerkung. Ich versuche, es nicht persönlich zu nehmen, aber Owen fällt das nicht leicht. Letzte Woche hat er sich mit Bailey über Bobby gestritten und ihr gesagt, sie würde ihn seiner Ansicht nach zu oft treffen. Es war eins der wenigen Male, dass Bailey ihm einen der geringschätzigen Blicke zugeworfen hat, die sie sich normalerweise für mich aufhebt.
»Wenn du ihn nicht willst, dann lass es«, sagt sie. »Ich hab nur versucht, nett zu sein.«
»Es geht schon. Aber danke.«
Sie steckt sich den Joint wieder in die Tasche, ich zucke innerlich zusammen. Ich versuche nach Möglichkeit, mich Bailey gegenüber nicht als Erzieherin aufzuspielen. Das gehört zu den wenigen Punkten, die sie an mir zu mögen scheint.
Ich nehme mir vor, die Sache später mit Owen zu besprechen, wenn er nach Hause kommt – soll er entscheiden, ob sie den Joint behalten darf oder nicht. Dann trifft mich die Erkenntnis, dass ich keine Ahnung habe, wann Owen nach Hause kommt. Ich könnte nicht mal sagen, wo er jetzt ist.
»Weißt du was?«, sage ich. »Ich nehme ihn doch.«
Sie verdreht die Augen, reicht mir den Joint aber rüber. Ich lege ihn ins Handschuhfach und greife nach der Sporttasche.
»Ich hab angefangen zu zählen …«, sagt sie.
Ich schaue sie fragend an.
»Das Geld«, erklärt sie. »Jede Rolle enthält zehntausend Dollar. Ich bin bis sechzig gekommen. Dann hab ich nicht weitergezählt.«
»Sechzig?«
Ich schnappe mir die losen Rollen, die auf die Sitze gefallen sind, und stecke sie wieder in die Tasche. Dann ziehe ich den Reißverschluss zu, damit sie nicht mehr an die riesige Summe darin denken muss. Damit wir beide nicht daran denken müssen.
Sechshunderttausend Dollar. Mehr als sechshunderttausend Dollar.
»Lynn Williams hat die ganzen Daily Beast-Tweets in die Insta-Story gepostet«, sage sie. »Über The Shop und Avett Thompson. Dass er wie Madoff ist und solche Sachen.«
Schnell gehe ich noch einmal durch, was ich weiß. Owens Nachricht an mich. Die Sporttasche für Bailey. Der Bericht im Radio, in dem von Veruntreuung und Betrug die Rede war. Avett Thompson als führender Kopf hinter etwas, das ich noch nicht verstehe.
Ich fühle mich wie in einem dieser schrägen Träume, die man nur hat, wenn man zur falschen Zeit schlafen geht. Wenn man beim Aufwachen von der Nachmittagssonne oder der mitternächtlichen Kühle begrüßt wird. Wenn man sich desorientiert fühlt und Klarheit bei dem Menschen neben einem sucht, bei dem Menschen, dem man am meisten vertraut. Es war nur ein Traum: Unter dem Bett ist kein Tiger. Du bist nicht durch die Straßen von Paris gejagt worden. Du bist nicht vom Willis Tower gesprungen. Dein Mann ist nicht ohne jede Erklärung verschwunden, er hat seiner Tochter keine sechshunderttausend Dollar zurückgelassen. Oder mehr.
»Das wissen wir noch nicht«, sage ich. »Aber selbst wenn es stimmt, dass The Shop in irgendetwas verwickelt ist oder Avett etwas Illegales getan hat, bedeutet das noch nicht, dass dein Vater etwas damit zu tun hat.«
»Wo ist er dann? Und wo hat er das ganze Geld her?«
Sie brüllt mich an, weil sie ihn anbrüllen will. Ein Wunsch, den ich gut nachvollziehen kann. Ich bin genauso wütend wie du, würde ich am liebsten sagen. Und Owen soll diese Wut zu spüren bekommen.
Ich schaue sie an. Dann wende ich mich ab, sehe aus dem Fenster auf die Anleger, die Bucht, die abendlich beleuchteten Häuser in dieser seltsamen kleinen Siedlung. Ich kann direkt ins schwimmende Haus der Hahns schauen. Mr. und Mrs. Hahn sitzen nebeneinander auf dem Sofa, essen ihr abendliches Eis und sehen fern.
»Was soll ich jetzt machen, Hannah?«, fragt sie mich. Mein Name hängt wie eine Anklage zwischen uns.
Bailey schiebt sich die Haare hinters Ohr, und ich sehe, wie ihre Unterlippe zu zittern beginnt. Das ist so seltsam und unerwartet – Bailey hat nie in meinem Beisein geweint –, dass ich fast den Arm ausstrecke und sie an mich ziehe, als wäre es unsere Art, miteinander umzugehen.
Beschütze sie.
Ich löse meinen Sicherheitsgurt. Dann beuge ich mich hinüber und löse ihren. Einfache Schritte.
»Lass uns ins Haus gehen, dann rufe ich ein paar Leute an«, sage ich. »Irgendjemand wird schon wissen, wo dein Vater ist. Damit fangen wir an. Zuerst müssen wir ihn finden, dann kann er alles erklären.«
»Okay«, sagt sie.
Sie öffnet die Tür, um auszusteigen. Aber im letzten Moment dreht sie sich noch einmal um und sieht mich mit glühendem Blick an.
»Bobby muss rüberkommen«, sagt sie. »Ich sage kein Wort darüber, was mein Vater mir abgeliefert hat, aber ich will ihn wirklich hier haben.«
Es ist keine Frage. Und selbst wenn, welche Wahl hätte ich? »Ihr bleibt aber unten, okay?«
Sie zuckt die Achseln, was einer Zustimmung ziemlich nahe kommt. Bevor ich mir noch weitere Gedanken darüber machen kann, sehe ich ein Auto, das sich nähert. Die Scheinwerfer blinken auf, grell und fordernd.
Mein erster Gedanke ist: Owen. Bitte lass es Owen sein. Aber mein zweiter Gedanke ist präziser, und ich wappne mich innerlich. Es ist die Polizei. Es muss die Polizei sein. Wahrscheinlich suchen sie Owen – um Informationen über seine Beteiligung an den kriminellen Aktivitäten der Firma zu sammeln, um sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, was ich über seine Rolle und über seinen augenblicklichen Aufenthaltsort weiß.
Aber auch damit liege ich falsch.
Die Lichter gehen aus, ich erkenne den leuchtend blauen Mini Cooper und weiß, dass es Jules ist. Meine älteste Freundin Jules. Hastig steigt sie aus dem Wagen und rennt auf mich zu, die Arme weit ausgebreitet. Sie drückt uns an sich, Bailey und mich, so fest sie kann.
»Hallo, meine Lieben«, sagt sie.
Bailey erwidert die Umarmung. Sogar Bailey liebt Jules, obwohl sie durch mich in ihr Leben gekommen ist. Daran sieht man, was Jules den Menschen bedeutet, die das Glück haben, sie zu kennen. Sie bedeutet Trost und Verlässlichkeit.
Vielleicht ist das der Grund, warum ihre erste Bemerkung mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt.
»Alles ist meine Schuld«, sagt sie.
DENK, WAS DU WILLST
Ich kann’s immer noch nicht glauben«, sagt Jules.
Wir sitzen in der Küche, am kleinen Frühstückstisch im Sonneneckchen, und trinken mit Bourbon aufgepeppten Kaffee. Jules ist beim zweiten Becher. Ihr übergroßes Sweatshirt verbirgt ihre schmale Gestalt, die Haare hat sie zu zwei tief gebundenen Zöpfen zusammengenommen, mit denen sie frech aussieht, als wollte sie heimlich noch ein bisschen Bourbon in ihren Kaffee kippen. Fast sieht sie aus wie damals mit vierzehn, wie das Mädchen, das ich am ersten Highschool-Tag kennengelernt habe.