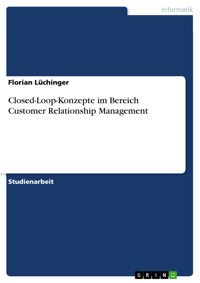Bestimmungsmerkmale für ausgewählte Geschäftsmodelle im Bereich Open Source Software (OSS) E-Book
Florian Lüchinger
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 5 (entspr. deutscher Note 2), Universität Bern (Institut für Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Aus Sicht von IT-Anbietern stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob Open Source Software (OSS) grundsätzlich eingesetzt werden soll, sondern wie mit solchen Anwendungen und Dienstleistungen erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Die vorliegende Arbeit versucht aufbauend auf den Software-Merkmalen und insbesondere der Grundlagen und Besonderheiten von OSS mögliche Bestimmungsfaktoren für Geschäftsmodelle im Bereich OSS aufzuzeigen. Die Geschäftsmodell-Ontologie mit den vier Hauptelementen Produkt, Kundenmanagement, Infrastrukturmanagement und finanzielle Aspekte und den jeweiligen Ausprägungen bildet dazu die Basis für sog. Analyseraster. Mit Hilfe dieser Analyseraster werden die Bestimmungsfaktoren von ausgewählten OSS-Geschäftsmodellen beschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass dank des Internets digitale Informationen praktisch beliebig oft ausgetauscht und ohne grosse Berücksichtigung von Eigentumsrechten verbreitet werden können, entwickelten sich mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven für die Vermarktungsweise von Software. Die erste fokussierte sich auf einen verbesserten Schutz der Urheberrechte von digitalen Informationen mit Hilfe von Lizenzen. Denn eine Software-Lizenz ist eine Art Vertrag, in dem eine Partei (Lizenzgeber) einer anderen (Lizenznehmer) bestimmte Nutzungsrechte an einer urheberrechtlich geschützten Software überlässt oder beschränkt. Nichtsdestotrotz ermöglichen die einfachen Kopiermöglichkeiten von digitalen Gütern das leichte Erstellen und Weiterverbreiten von unrechtmässigen Kopien, insbesondere von proprietärer Software. Gemäss Business Software Alliance (BSA) hat Softwarepiraterie im Jahre 2002 weltweit Verluste von 13,08 Milliarden Dollar verursacht. Die zweite Betrachtungsweise hingegen setzte sich zum Ziel, die freie Verbreitung von digitalen Informationen im Bereich Software unter den Begriffen „Free Software“ (FS) oder Open Source Software (OSS)“ zu fördern. Im Gegensatz zu proprietärer Software geht es bei FS und OSS nicht darum, Rechte einzuschränken, sondern darum, möglichst vielen Menschen eine Veränderung des Codes zu gestatten und damit u.a. eine langfristige Verbesserung der Software zu ermöglichen. Eine Ausnahme bildet das sog. „Dual License“-Modell. Bestimmte OSS-Anbieter (z.B. MySQL und Trolltech) vertreiben ihre Software einerseits kostenlos unter einer OSS-Lizenz und andererseits kostenpflichtig unter einer weniger restriktiven Lizenz mit kommerzieller Verwendungsmöglichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Page 2
Inhalt
Aus Sicht von IT-Anbietern stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob Open Source Software (OSS) grundsätzlich eingesetzt werden soll, sondern wie mit solchen Anwendungen und Dienstleistungen erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Die vorliegende Arbeit versucht aufbauend auf den Software-Merkmalen und insbesondere der Grundlagen und Besonderheiten von OSS mögliche Bestimmungsfaktoren für Geschäftsmodelle im Bereich OSS aufzuzeigen. Die Geschäftsmodell-Ontologie mit den vier Hauptelementen Produkt, Kundenmanagement, Infrastrukturmanagement und finanzielle Aspekte und den jeweiligen Ausprägungen bildet dazu die Basis für sog. Analyseraster. Mit Hilfe dieser Analyseraster werden die Bestimmungsfaktoren von ausgewählten OSS-Geschäftsmodellen beschrieben.
Contenu
Du point de vue des fournisseurs IT, la question n’est plus réellement de savoir s’il est opportun d’utiliser des logiciels „Open Source“ (Open Source Software ou OSS), mais comment de tels applications et services peuvent permettre de développer des concepts commerciaux viables.
Le présent travail essaie de préciser les facteurs déterminants des concepts commerciaux dans le secteur des OSS sur la base des caractéristiques des logiciels et en particulier des OSS.
Les quatre éléments principaux des concepts commerciaux sont le produit, la gestion de clientèle, la gestion d'infrastructure et les aspects financiers. Ces éléments, ainsi que leurs particularités respectives, forment la base du modèle d'analyse à l’aide duquel nous décrirons les facteurs déterminants de certains concepts commerciaux des OSS.
Page 3
Content
From the perspective of IT suppliers, the question is no longer whether Open Source Software (OSS) should be used or not, but how successful business models can be developed with such applications and services.
Based on characteristics of software, and in particular of OSS, this paper aims at identifying possible determination factors for business models within the scope of OSS.
The business model ontology, whose four main elements are product, customer interface, infrastructure management and financial aspects, as well as their respective specifications, represent the basis for so-called analysis patterns. Based on these analysis patterns, we describe the determination factors of selected OSS business models.
Page 4
We Open the Source®1
Vorwort
„We Open the Source®“ ist der Slogan des Open Source Software (OSS)-Dienstleisters und OSS-Anwendungs-Anbieters foresite Systems. Ein IT-Unternehmen, welches sich einerseits auf die Erbringung von Dienstleistungen im Web-Bereich mittels OSS und andererseits auf die Entwicklung von OSS-Software spezialisiert hat.
Durch die Tätigkeit im Unternehmen foresite Systems sah ich mich inspiriert, das Thema „Bestimmungsfaktoren für ausgewählte Geschäftsmodelle im Bereich Open Source Software (OSS)“ aufzugreifen und dazu die wissenschaftlichen Grundlagen zu erarbeiten.
Nach einer arbeitsintensiven Zeit in den vergangenen sechs Monaten habe ich über OSS, Geschäftsmodelle und die Bestandteile von OSS-Geschäftsmodellen einiges gelernt. Etliche Erkenntnisse werden direkt in die Geschäftstätigkeit der Firma foresite Systems einfliessen.
An dieser Stelle möchte ich mich zudem für die Unterstützung von Prof. Dr. Thomas Myrach bedanken.
Bern, Juli 2004 Florian Lüchinger
1We Open the Source®ist eine eingetragene und geschützte Wortmarke des Unternehmens foresite Systems.
Page 2
____________________________________________________________________
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Mit der Entwicklung und Verbreitung des Internets ergab sich die Möglichkeit, digitale Informationen praktisch beliebig oft auszutauschen und dies ohne grosse Berücksichtigung von Eigentumsrechten. Shapiro/Varian heben einerseits die Vorteile des Internets als neues, schnelles Distributionsmedium von digitalen Informationen hervor, sehen aber andererseits Probleme in der Tatsache, dass durch das Internet eine unkontrollierbare Kopiermaschine in Gang gesetzt wurde: „Digital information can be perfectly copied and instantaneously transmitted around the world, leading many content producers to view the Internet as one giant, out-ofcontrol copying machine“.2
Aufgrund dieser Tatsache entwickelten sich mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven für die Vermarktungsweise von Software.3Die erste fokussierte sich auf einen verbesserten Schutz der Urheberrechte von digitalen Informationen mit Hilfe von Lizenzen. Denn eine Software-Lizenz ist eine Art Vertrag, in dem eine Partei (Lizenzgeber) einer anderen (Lizenznehmer) bestimmte Nutzungsrechte an einer urheberrechtlich geschützten Software überlässt oder beschränkt.4Nichtsdestotrotz ermöglichen die einfachen Kopiermöglichkeiten von digitalen Gütern das leichte Erstellen und Weiterverbreiten von unrechtmässigen Kopien, insbesondere von proprietärer Software. Gemäss Business Software Alliance (BSA) hat Softwarepiraterie im Jahre 2002 weltweit Verluste von 13,08 Milliarden Dollar verursacht.5
Die zweite Betrachtungsweise hingegen setzte sich zum Ziel, die freie Verbreitung von digitalen Informationen im Bereich Software unter den Begriffen „Free Software“ (FS) oder Open Source Software (OSS)“ zu fördern.6Im Gegensatz zu proprietärer Software geht es bei FS und OSS nicht darum, Rechte einzuschränken,
2Shapiro/Varian (1999), S. 4.
3Vgl. auch Nuss (2002a), S. 1.
4Vgl. FOKUS (2004a).
5Vgl. Business Software Alliance (2003), S. 3.
6Für eine detailliertere Betrachtung der beiden Bezeichnungen vgl. Kapitel 3.
Page 3
____________________________________________________________________
sondern darum, möglichst vielen Menschen eine Veränderung des Codes zu gestatten und damit u.a. eine langfristige Verbesserung der Software zu ermöglichen. So sind in den letzten paar Jahren diverse freie Software-Projekte entstanden, welche mit herkömmlichen proprietären Software-Anwendungen direkt vergleichbar sind. Im Server- und vermehrt auch Desktop-Bereich ist dies z.B. Linux mit K Desktop Environment (KDE) oder Gnome als grafische Benutzeroberflächen. Aber auch ganze Büroanwendungen (OpenOffice), Webserver und Webbrowser (Apache7und Mozilla8) sind Beispiele für erfolgreiche und z.T. stark verbreitete OSS-Anwendungen.
Das Problem von illegalen Software-Kopien stellt sich bei OSS nicht, da gemäss Open Source Definition (OSD)9ein freier Zugang zur Software und unbeschränkte Kopiermöglichkeiten gar vorgeschrieben sind.
Aus Sicht der Nachfrager wird proprietäre und urheberrechtlich geschützte Software durch die Erhebung von sog. Lizenzgebühren entgolten, welche einmalig oder wiederkehrend fällig sind. Bei OSS besteht keine Möglichkeit, Software-Lizenzgebühren zu verlangen, da sonst die freie Verbreitung gefährdet ist.10Es braucht deshalb andere Ansätze, damit auf Basis von OSS echte Geschäftsmodelle entstehen können.
Eine Ausnahme bildet das sog. „Dual License“-Modell. Bestimmte OSS-Anbieter (z.B. MySQL und Trolltech) vertreiben ihre Software einerseits kostenlos unter einer OSS-Lizenz und andererseits kostenpflichtig unter einer weniger restriktiven Lizenz mit kommerzieller Verwendungsmöglichkeit.
7Laut Netcraft.com (2004) besitzt der Apache Webserver einen weltweiten Marktanteil von rund 67%.
8Gemäss OneStat (2004) hat der Open Source Internet Browser Mozilla innerhalb von zwei Jahren einen Marktanteil von 1.8% erreicht.
9Vgl. Kapitel 3.
10Vgl. Abschnitt 3.2.2, Punkt 1.
Page 4
____________________________________________________________________
1.2 Zielsetzung
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine Übersicht über mögliche Bestimmungsmerkmale für Geschäftsmodelle im Bereich OSS zu geben. Es soll anhand der Definition und typischen Eigenschaften des digitalen Gutes Software aufgezeigt werden, welche Merkmale der Software-Markt aufweist. Anschliessend dienen die Ausführungen über die Grundlagen von OSS als Vorbereitung für das Verständnis von bestehenden OSS-Geschäftsmodellen.
Wie sich ein Geschäftsmodell zusammensetzt, zeigt die Geschäftsmodell-Ontologie nach Osterwalder.11Diese dient denn auch als Analyseraster für die Beschreibung von Bestimmungsmerkmalen, bzw. Bausteinen für OSS-Geschäftsmodelle.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in 6 Kapitel gegliedert. Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht.
11Vgl. Osterwalder (2004).
Page 5
____________________________________________________________________
In Kapitel 1 werden einleitende Erläuterungen zur Problemstellung, Zielsetzung und zum Aufbau der Arbeit dargelegt.
Im 2. Kapitel folgen die theoretischen Grundlagen von digitalen Gütern. Zudem werden die angebots- und nachfrageseitigen Merkmale von Software aufgezeigt. Mit den Grundlagen von Open Source Software (OSS) beschäftigt sich das 3. Kapitel. Der erste Abschnitt enthält eine Zusammenstellung der wichtigsten historischen Entwicklungen. Anschliessend werden im zweiten Abschnitt die Unterschiede der Begriffe Free Software (FS) und Open Source Software (OSS) aufgezeigt. Zudem werden die Open Source Definition (OSD) und die GNU / General Public License (GPL) erläutert. Der dritte Abschnitt führt eine
Begriffsabgrenzung zwischen proprietärer Software, Shareware, Freeware, Shared Source Software und Public Domain Software durch. Im letzten Abschnitt werden heutige OSS-Projekte aufgeführt und kurz beschrieben.
Das 4. Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Geschäftsmodell-Ontologie nach Osterwalder. Zuerst wird das Geschäftsmodell nach Osterwalder kurz definiert und anschliessend werden die vier Hauptelemente Produkt, Kundenmanagement, Infrastrukturmanagement und finanzielle Aspekte der Geschäftsmodell-Ontologie betrachtet. Jedes der vier Hauptelemente wird mit den entsprechenden Ausprägungen, bzw. Bestimmungsfaktoren zu einem Analyseraster zusammengefasst.
Auf allen vorangehenden Kapiteln aufbauend, ist das 5. Kapitel geschrieben. Die Analyseraster werden für die Beschreibung der wichtigsten OSS-Geschäftsmodelle verwendet und veranschaulichen die Bestimmungsmerkmale, bzw. Bausteine von OSS-Geschäftsmodellen.
Begonnen wird mit dem bekanntesten und ältesten OSS-Geschäftsmodell, den Linux-Distributoren. Nach Abschluss der Detailanalyse dient die Verdichtung aller Merkmale in einer einzigen Tabelle als Übersicht über die einzelnen Bestimmungsfaktoren. Es folgt eine Analyse von weiteren OSS-Geschäftsmodellen. Das 6. und letzte Kapitel fasst die wichtigsten Grundlagen und Ergebnisse nochmals zusammen und enthält einen kurzen Ausblick.
Page 6
____________________________________________________________________
2 Digitales Gut Software
In diesem Kapitel werden die Definition und die für diese Arbeit zentralen Merkmale von digitalen Gütern behandelt.
2.1 Definition digitales Gut
Für das Verständnis des Begriffs digitales Gut ist es wichtig, zuerst zu verstehen, was genau mit dem Begriff Information gemeint ist. Für Shapiro und Varian ist alles Information, was digitalisiert werden kann.12Das heisst, die Information muss in Form eines Bitstreams13codierbar sein. Damit gelten Film-, Musik- und Bilddateien, elektronische Dokumente, Websites, Datenbanken und grundsätzlich auch Software als sog. Informationsgüter, bzw. digitale Güter. Da die Übergänge zwischen Information, Informationsgut und digitalem Gut relativ fliessend sind, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit die drei Begriffe zusammen unter der Bezeichnung digitales Gut verwendet. Hinzu kommt, dass die wichtigsten Merkmale von Informationen auch für Informationsgüter gelten. Die Digitalisierung von Informationen führte zur Erstellung, Nutzung und Reproduktion von digitalen Inhalten wie Ton, Bild, Text und Software etc.14Durch die Vernetzung von Personal Computern mit Hilfe des Internets haben sich neue Arten der Informationsverbreitung über Datennetze eröffnet.15Digitale Güter können mit geringem Aufwand und vor allem ohne Qualitätsverlust kopiert und verbreitet werden. Die Transaktions- und Distributionskosten gehen dabei gegen Null.16Es fällt jedoch auf, dass digitale Güter bezüglich ihrer Art und Verwendung differenzierter betrachtet werden müssen. Denn Inhalte wie Ton und Bild (u.a.
12Vgl. zum Folgenden Shapiro/Varian (1999), S. 3.
13Ein Bitstream ist eine zeitliche Abfolge von Bits und wird in den Computer- und Informationswissenschaften verwendet. Die Bezeichnung Bit stammt von Binary Digit und stellt die
kleinste Informationseinheit zur Speicherung von Daten dar. Ein Bit bezeichnet zwei sich gegenseitig
ausschliessende Zustände z.B. in Form von 0 oder 1 oder wahr oder falsch. (Vgl. Wikipedia [2004]).
14Vgl. auch Grassmuck (2002), S. 33.
15Vgl. zum Folgenden Nuss (2002c), S. 1; Vgl. Shapiro/Varian (1999), S. 4.
16Vgl. Grassmuck (2002), S. 36.