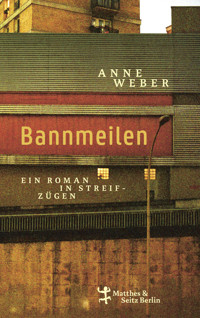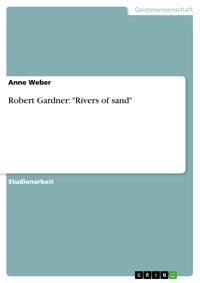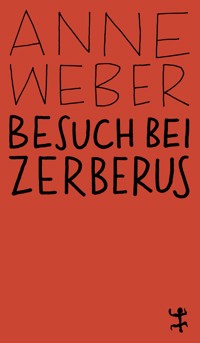
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann es sein, dass der Hölleneingang auf der Karte Frankreichs eingezeichnet ist? Tausende durchqueren Cerbère – Zerberus – auf dem Weg nach Süden, kaum jemand macht hier halt. Sie alle fahren die Küstenstraße am Mittelmeer bis nach Spanien hinein weiter und kommen nach Port Bou, an einen Ort, der für den Übergang zwischen Leben und Tod, zwischen Lebenwollen und Aufgeben, zwischen Flucht nach vorn und endgültigem Innehalten steht. Die Reisende, die hier von sich erzählt, bleibt hingegen in Cerbère – der kleinen Vorhölle. Sie fühlt sich an einem schonungslos Bilanz fordernden Endpunkt angelangt, steht sich selbst als einer Unbekannten gegenüber. Da erreicht sie eine Nachricht aus der deutschen Heimat: Der Vater, der bis dahin wie unantastbar, körperlos und somit unsterblich erschien, ist lebensgefährlich erkrankt. Der erinnerten Kindheit entsteigt die Welt des immer schon abwesenden Vaters als eine ersehnte, unerreichbare, zu der man nur hochschauen, aber in die man nicht vordringen kann. Gegen diese Welt der großen Geister den eigenen Kosmos zu schaffen und zu behaupten ist eine Aufgabe, der sich die Erwachsene stellen muss und endlich stellen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Weber
BESUCH BEI ZERBERUS
Matthes & Seitz Berlin
Es ist Tag. In den Fenstern hängen statt Moskitogittern klebrige Spinnweben. Es gibt eine Eiche, es gibt einen See, es gibt Zwiebeldächer, die dem Haus wie graue Sahnehauben aufgedreht sind. In der hochsommerlichen Hitze backt der Backstein immerfort, schon bröckeln die Balkone. Von meinem hängt ein dünner, gerissener Strick. Vorstellen kann man sich vieles, die Selbstmörder werden aufgelesen in dem Rhythmus, in dem sie fallen. Aus dem Stein wachsen Blumen in die warme Luft, träge nicken sie mir zu und ermutigen mich, es ihnen nachzutun und auf dem unfruchtbaren Papierboden Fuß zu fassen, aber ich kann nicht: Wenn ich die Augen aufschlage, blendet mich das Leben. Halte ich sie geschlossen, platze ich aus allen Nähten, in meinem Kopf klappern Kiefer, hämmern Schreibmaschinen, krächzen Krähen.
Warum schiebt mir eigentlich niemand eine Botschaft unter der Tür durch, denke ich, und in demselben Augenblick sehe ich den weißen Zettel schräg aus dem Türschlitz zeigen. Ich falte ihn auf und lese:
Auf dieser Welt leben Nashörner und Flusskrebse mit durchsichtigem Panzer, es gibt Pfauen, die ihre Augen auffächern zu einem bunt aufgerissenen Augenrund, kochende Berge, die Steine ausspucken wie Kirschkerne und aus denen sich glühend die Erde erbricht, Uniformen, in denen Menschen kniehochreißend durch Prachtavenuen marschieren, Giraffen, die, des irdischen Treibens überdrüssig, danach trachten, sich in höhere Sphären zu verziehen. Du aber sitzt und verwächst mit deinem Stuhl zu einem mythologischen Zwitterwesen.
Mit den Lidern klappe ich mir die Welt auf und nehme mir vieles vor, was nicht zu halten ist: lächelnden Auges in die Gegenwart zu blicken und über alle Fallgruben zu hüpfen, als seien es Pfützen; Mund, Nase und Ohren nicht weiter zuzustöpseln, sondern zu weiten für Eindrücke jeglicher Art, damit das Schauspiel nicht umsonst aufgeführt werde und das Bühnenbild die verdiente Beachtung erfahre. All die Tiere und Menschen fliegen und rennen einem ja nicht aus Jux ins Blickfeld, und auch die Wolken quellen nicht ohne Hintergedanken ins Bild.
Sei froh, dass sich so viele Fragen stellen, endet der Brief. Glaubst du vielleicht, dass du auch nur einen einzigen Tag leben könntest in einer fraglosen Welt?
Ich falte das Blatt zu einem Flieger zusammen und schicke es auf Reisen. Vielleicht kann es noch anderen Mutlosen den ersehnten Ruck geben. Die Luft trägt es weit.
Auf dem See fahren Schiffe, auf denen eine Flughafenstimme den Besuchern ihre Umgebung in Zahlen ummünzt: 120 Meter hoch ist der Fernmeldeturm, der Wannsee ist an dieser Stelle 25 Meter tief und das Schiff 77 Meter lang. So ordnet sich alles zu einem vertrauten Brettspiel oder zu einer mathematischen Formel ohne Unbekannte, und die Passagiere legen wohlbehalten in einer durch und durch vermessenen Umgebung wieder an.
Nachts blinzelt der Fernmeldeturm mir zu. Auf dem Balkon stehend, blinzle ich zurück. So vergehen die Nächte.
Unten am Wasser heben Scheinwerfer die zarten Wellenschläge in die Bäume. Derart aufs raschelnde Laub verlagert, zittert die Seeoberfläche doppelt; in dem Grau der Blätter plätschert still der Widerschein des Sees.
Kaum bin ich im Zimmer zurück, schaukelt der See mir hinterher. Wir setzen uns an den Schreibtisch und legen los. Zu einer Geschichte wird es wieder einmal nicht langen, das spüren wir schnell, obwohl es zweifellos sehr angenehm und bequem wäre, sich von einer Begebenheit zur anderen zu hangeln, die Marquise geht aus, die Marquise kehrt heim, und dazwischen steigt sie in Kutschen oder bricht sich ein Bein. Man weiß, wohin man will, oder, noch besser, man weiß es selber nicht und lässt sich von den Figuren, die man sich zwar die Mühe gemacht hat zu erfinden, die aber so freundlich sind, sich bereits im zweiten Kapitel zu verselbstständigen, zu einem für jedermann überraschenden Ende geleiten. Stattdessen sitzen wir hier, der See und ich, und warten auf eine Flaschenpost mit den nötigen Anweisungen zum Schreiben eines dicken, den Schreibenden erlösenden, den Leser nicht mehr loslassenden Buches. Die Flaschenpost taucht tatsächlich bald auf, und zwar in Form einer Whiskey-Flasche, die unerklärlicherweise auf meinen Schreibtisch gespült worden sein muss. Zu dieser Whiskey-Flasche gehört eigentlich eine ganz andere, eine viel härtere Prosa als die meine, auch lässt man sich als Whiskey-Trinker nicht derart gehen und von der Sprache entführen, im Gegenteil, man hält ihr stand, man setzt sich durch, man lässt sich von ihr nicht an der Nase herumführen. Eine Whiskey-Flasche stellt man neben eine alte mechanische Schreibmaschine, eine Olympia vielleicht, man spannt einen Bogen Papier ein und hämmert darauf ein. Die Zigarette hat man im Mundwinkel klemmen, hin und wieder fällt einem ein Aschenstängel aufs weiße Hemd (man ist männlichen Geschlechts), aber man hat die Augen auf das von rechts nach links wandernde Papier gerichtet und bemerkt es nicht. Am besten ist man Amerikaner. Ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen, ruft man den Agenten an und sagt: Ich brauche dringend fünfhundert Dollar. Statt, wie ich, weich im Geben zu sein, ist man hart im Nehmen. Morgens wacht man mit einem Brummschädel auf, nachts verharrt man im Lichtkegel einer metallenen Schreibtischlampe und zerrt an dem roten Faden, der sich immer wieder verheddern und verknoten will, die Erzählstränge werden sorgfältig und zielstrebig miteinander verflochten, und wenn der Morgen graut, ist das Ende offen. So soll es auch bleiben: weiterhin steigt der Wert des offenen Endes. Derweilen arbeite ich an einem Buch mit offenem Anfang, ein Genre, das an der Börse bislang noch nicht geführt wird.
Auf dem Flaschengrund wartet dann der blaue Himmel auf mich. An Schlaf ist nicht zu denken, besser gesagt, an Schlaf ist schon zu denken, es ist sogar an nichts anderes zu denken, so erschöpft ist man von dem krampfhaften Versuch, nicht nachzudenken, und vom vielen Trinken (man verträgt ja nichts), aber der Schlaf stellt sich nicht ein, statt dessen stellen sich Worte ein, unzählige wäre übertrieben, aber immerhin, ein paar Bataillone sind es schon, und so gibt ein Satz den anderen, die Buchstaben nehmen sich an der Hand und bilden innerhalb kürzester Zeit eine Wortkette, die ich um den erstbesten Hals schlinge und zuziehe zu einem mitleidlosen Exekutions-Kalligramm.
Was mir eigentlich vorschwebt, ist allerdings nicht etwa ein Buch in Galgenform, sondern eines, in dem die Sprache umgestülpt wäre wie ein Strumpf. Die Welt nach links zu drehen, das wäre eine Beschäftigung, an der ich dauerhaft Freude haben könnte. Nun finge es natürlich schon damit an, dass die deutsche Sprache, wenn sie nach links drehen sagt, in Wahrheit das Innere nach außen kehren meint. So geht es dann immer weiter, ein Missverständnis gibt das andere, und wenn man der Sache nicht auf den Grund geht, gibt es bald keine Sache mehr, sondern nur noch Worte, die sich ihre eigene, autonome Welt zusammenspinnen, in der es sich natürlich auch leben lässt, wo aber jeder Schritt bereits vorgestanzt ist. Da kann man auch gleich aufs Sofa sinken und sich mit Hilfe der Fernbedienung festzurren, da gibt es keine Überraschung mehr, der Hahn hockt im Korb, der Apfel fällt keine zehn Zentimeter vom Stamm, und um sich dann noch zu rühren und freizuschaufeln, braucht es Kräfte, über die man nicht verfügt.
Draußen bringt der Wind Bewegung in die Welt, die alten Bäume halten mit letzter Kraft ihre Blätter fest, deren Rauschen drohend anschwillt und dann wieder zu leisem Säuseln zusammenfällt. Ich sitze vor einer von erschlagenen Insekten gesprenkelten Wand und spüre an der Wange die Luft, die sich an mir vorbei auf ein unbekanntes Ziel hin bewegt. Dieser ganze bis in eine unsichtbare Ferne reichende Raum, der uns umgibt, hält niemals still, immer peitscht er unwillig vorantrottende Wolken durch die Luft. Ich bin zu schwer, um mich treiben zu lassen, wohin der Wind mich gerade schiebt. Sich einem Element überlassen zu können oder dagegen ankämpfen zu müssen schenkt den Vögeln in der Luft und den Fischen im Wasser eine Geborgenheit, um die ich sie beneide. Wir hingegen müssen uns, ohne jegliche Hilfe oder richtungweisende Stütze, einen begehbaren Weg suchen, unsere schweren Glieder auf einen Berg hieven, zum Beispiel, oder auf einen Baum, um einen Happen Landschaft zu sehen und den Tag nicht zu vertun.
Alles hat zwei Seiten, unterbricht mich der Volksmund oder wer auch immer. Bei näherer Überlegung ergibt sich dann, dass die allerwenigsten Dinge zwei Seiten haben: ein Blatt Papier, eine Tür, ein Vorhang vielleicht gerade noch, aber schon ein so schlichter Gegenstand wie ein Würfel hat immerhin mindestens sechs Seiten, und bei einem so kantenlosen Geschöpf wie dem Menschen gehen die Seiten derart fließend ineinander über, dass sie gar nicht mehr zu unterscheiden sind.
Der See tarnt sich heute als Mittelmeer, da fällt es schwer, unbeirrt die Fernsehröhre zu fixieren. Über dem See geht das Blau immer weiter, auch mich hat es bald erfasst; nur der Backstein, von der Sonne zur Feuerwand entfacht, hält noch dagegen. Ich warte, bis die Erste ausgefranste Wolke vorübergehetzt ist, und gehe endlich ernsthaft an die Arbeit. Gleich zu Anfang verliere ich viel Zeit damit, mir ein passendes Genre auszusuchen: für den Roman bin ich zu kurzatmig, für die Novelle zu einfallslos, für den Aphorismus zu weit von jeder Wahrheit entfernt. Das Theater wird einem von jedem x-beliebigen aus der Hand genommen und nach zeitgemäßer Verdauung wieder vor die Füße gespuckt. Das Gedicht klumpt sich innere Landschaften zu Bronzereliefs zusammen. Ehrfürchtig betrachte ich sie, die kunstvollen Gebilde: haftet mir auch etwas von diesem Hochmut an?
Der Himmel wird grau und schluckt die Spinnweben, aber nicht ihre Bewohnerin, die jetzt am Himmel klebt als unbewegliche Vogel-Spinne. Eine Schwalbe streift sie mit ihrem elegant nach hinten gebogenen Flügel. Hinter Spinne und Vogel durchquert ein Flugzeug das Bild. In seinem Inneren sitzen Mensch an Mensch, Arm an Arm, Knie an Knie. Mit angewinkelten Beinen holpern sie durch die Luft, und in den Kurven halten sie der Erde bald die rechte, bald die linke Wange hin. Bei plötzlichem Unterdruck fallen ihnen Sauerstoffmasken auf den Kopf, die binden sie sich auf die Nase, und dann ist erst einmal Ruhe, und keiner verlangt mehr ein Gläschen Sekt. Im Falle einer Wasserlandung legen sich ihnen die Schwimmwesten automatisch um den Leib und pusten sich auf; Rutschen fahren zu beiden Seiten ins Wasser, wie man sie sich in den abenteuerlichsten Erlebnisbädern nicht zu erträumen wagt. Bis es soweit ist, klammert sich jeder an seiner Zeitung fest. Draußen wölbt sich die Erde noch lange nicht, dazu ist sie viel zu nah. Im Cockpit sitzen Männer, die fliegen können. Sie sind ein Muster an Ausgeglichenheit und haben eine Sonnenbrille auf.
Von diesen fliegenden Menschentrauben hängen wohl täglich fünf- bis zehntausend gleichzeitig in der Luft. Dicht aneinandergepresst surrt man durch eine Atmosphäre, in der ewiges Schönwetter herrscht. Die Stewardess bringt jedem Passagier einen Schnuller und ein Bilderbuch; so läuft man durch die wolkenlose Leere der Zeit hinterher oder davon.
Nur die Tiere lassen sich von den vorbeirasenden Sekunden und Minuten und Stunden nicht beirren; ruhig grasen sie an sanften Hängen oder krabbeln über moosige Waldböden. Ihnen kann die Zeit nicht viel anhaben; sie sind mit ihr vertraut und lassen sich von ihr wie von einem hilfsbereiten Weggefährten durchs Leben schleppen. Am Ende verziehen sie sich in die Büsche und sterben, während unsereins in Reanimationskliniken auf eine Auferstehung wartet. Vom Tod wissen sie zweifellos mehr als wir, dabei flößt er ihnen weniger Angst ein: erst wenn er naht, verschwenden sie den ersten Gedanken an ihn. Im Himmel sind sie dann ganz allein; kein Mensch wurde je fern von der Erde und außerhalb eines Raumschiffs gesehen. Vielleicht holen die Ängste im Himmel die Tiere ein.
Dann ist es Mitternacht. Ich schreibe alles auf, woran ich mich erinnere, mein ganzes früheres Leben. Auf dem weißen Papier heben sich dick die Jahreszahlen ab; einsilbig verweisen sie auf Augenblicke, die zusammengenommen keine Zeitspanne ergeben.
Wozu sitze ich nun hier? Weiß ich nicht schon lange: hinter Buchstaben konnte sich noch keiner verbergen. Behutsam strecke ich die Hand aus bis zum nächsten Menschen oder Planeten. Alle Stricke längst gerissen, denke ich, doch im gleichen Moment berührt mein Daumen etwas, was sich anfühlt wie eine getreue Nachbildung der Ewigkeit.
Ich weiß nicht, was Du denkst, ich weiß nicht, wer Du bist. An allen Poren meiner Haut findest Du Gefallen, auch an dem Weiß in meinen Augen, solange der Abend es zum Leuchten bringt mit seinem Dämmerlicht. Was Du bedeutest, weiß ich nicht. Über mir hängst Du in unsicherer Pose, streckst Deine langen Durstfinger nach mir aus, aber bis Du nach mir gefasst hast, bin ich Dir schon lange entwichen ins andere Land. Hier flattern keine Fahnen im Wind; wenn ich durch die Wiesen gehe, stieben keine Heuschrecken auseinander bei jedem Schritt. Hier bin ich Zwergin unter Zwergen, alle Zwischenräume sind mir eine Herberge, alle Rinnsale ein mächtiger Fluss. Hier kenne ich mich aus, hier will ich bleiben. Hier schütteln sich die Bäume nicht vor Lachen, wenn sie mich erblicken. Am Ende weist man mir auch hier einen langen Gang, und die Freiheit, von der man so gerne spricht, ist eingeklemmt zwischen diesen beiden furchterregenden Mauern. Ich renne los: da bricht das Eis unter mir ein, und ich stürze in kaleidoskopische Zonen. Später liest Du mich auf. In jeder Hand einen Splitter Ich, sammelst Du die geborstenen Jahrhunderte in eine flache Schale.
Unter den Tränen weicht mein Gesicht auf wie ungebackener, feuchter Teig. Ich ziehe die Hand zurück, schlage mein Adressbuch auf und suche nach irgendeinem Menschen, dessen Telefonnummer ich wohl wählen könnte in meiner Not (détresse-Buch?). Ich finde keinen. Wohl sind da allerhand Menschen verzeichnet, doch hauptsächlich solche, die man nicht behelligen kann mit wässriger Stimme, schon gar nicht mitten in der Nacht, und die man unter Umständen behelligen könnte, will man nicht behelligen. An verständnisvollen Ohren mangelt es allerdings rein rechnerisch nicht.
So schlage ich mir des Nachts verständnisvolle Ohren um die Ohren und frage mich: Wozu dienen eigentlich Namensverzeichnisse? Alles, was existiert, hat einen Sinn, heißt es doch manchmal noch, oder hieß es wenigstens, in früheren, zuversichtlicheren Zeiten. Also auch das Adressbuch. Aber welchen?
Draußen heult eine Sirene; drinnen heule ich. Vergeblich suche ich die Leidensgefährtin in meinem Adressbuch und im Branchenverzeichnis (unter Heulsusen). Wie ein langgezogener Triumphschrei fährt das Sirenengeheul noch einmal über den See, bevor es unmittelbar unter meinem Fenster erstirbt.
Über mir singt der Himmel sein stilles Nachtlied. Ich gehe zu Bett mit den matt glänzenden Sternen und den im Seegrün heimischen Fischen. Auf dem Kopfkissen neben meinem funkeln brüderlich Sternschnuppen und Fischschuppen. Wenn ich im Morgengrauen die Augen aufschlage, ist der Zauber schon ein gestriger (Umschreibung des Lebens). Metaphorische Kurzfassung meines eigenen Lebens: Jemand sagt etwas. Ich lausche aufmerksam und gebe vor, verstanden zu haben, worum es geht.