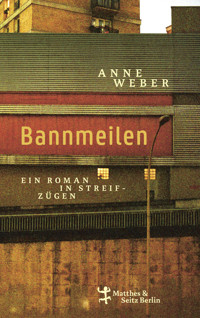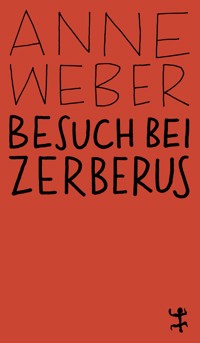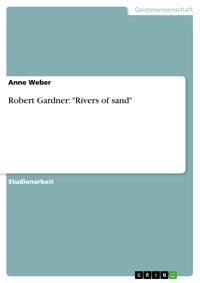Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit liegt vor uns als ein fremdes, fernes Land. Anne Webers nachdenkliche Erkundungsreise in die Vergangenheit führt in die faszinierende Welt ihres genau hundert Jahre vor ihr geborenen Urgroßvaters Florens Christian Rang, zu dessen Freunden und Korrespondenzpartnern Walter Benjamin, Martin Buber und Hugo von Hofmannsthal zählten. Sie führt uns schließlich bis in ein Dorf bei Posen, in dem der protestantische Theologe, Jurist, Philosoph und Schriftsteller eine Zeit lang als Pfarrer tätig war. Anne Weber spürt den Widersprüchen und Krisen, den Abrechnungen und Aufbrüchen ihres Urgroßvaters, der hier unter dem Namen Sanderling auftritt, nach, indem sie seine Schriften liest, seine Briefe und Tagebücher entziffert, und schließlich eine Reise auf seinen Spuren nach Polen unternimmt. Auf dem Weg zu diesem leidenschaftlichen und gespaltenen Menschen durch das »Dickicht der Zeit« stellt sich immer wieder ein gewaltiges Hindernis in den Weg: die deutsche und familiäre Vergangenheit, wie sie nach Sanderlings Tod 1924 weiterging. Und damit die Frage, wie es sich lebt mit einer Geschichte, die man nicht loswerden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Weber
Ahnen
Inhalt
Ahnen
Es fängt damit an, dass mein Passwort »Panzerdivision« ist. Ich habe es vor Jahren gewählt, als ich das letzte Mal eine Dauerkarte für die untere, den Forschern vorbehaltene Etage der Bibliothèque nationale beantragt hatte. Für Platzreservierungen und Buchbestellungen im Internet braucht man dort ein Pseudonym. Nun hätte ich natürlich Lindenblüte oder Seidenwurm wählen können. Ich hatte Panzerdivision gewählt. Es war der Kosename, den mir einmal ein äußerst charmanter, in der hohen, wenn auch in meiner Wertschätzung seither gesunkenen Kunst der Ironie unschlagbarer Franzose gegeben hatte und der mit möglichst nasalem Akzent, weichem »s« und Betonung auf der letzten Silbe ausgesprochen gehört: Pansèredivisión. Dieser Name, der nicht etwa nur mir als Deutscher galt, sondern gewisse, mir ganz persönliche Eigenschaften treffen sollte und vermutlich auch trifft, war mir einst komisch erschienen. Im Zusammenhang mit den Nachforschungen, die ich mit Hilfe dieses Passwortes betreiben will, hört er sich nicht mehr so komisch an. Es soll um einen Deutschen gehen, der einige Jahre in Polen verbracht hat. Um meinen Urgroßvater.
Um es gleich zu sagen: Mein Urgroßvater ist nicht in Polen einmarschiert. Die Gegend um Poznań, in der er lebte, war schon 1815 Preußen zugeschlagen worden.
Trotzdem. Ich will das Bibliothekspseudonym ändern. Das ist unmöglich. Ein einmal gewähltes Kennwort, ein sogenannter Alias, erklärt mir unwirsch die für die Karten-Erstellung zuständige Dame, bleibe für immer bestehen. Panzerdivision.
Es ist mit diesem Namen wie mit der Vergangenheit selbst, vor der man bekanntlich nicht davonlaufen kann. Das scheint zu stimmen: Da geht man, wie ich, in ein fremdes Land, lässt sich dort nieder, lernt die Sprache sprechen und schreiben, bis man, manchmal zumindest, mit einer Einheimischen verwechselt wird. Man glaubt, untertauchen zu können. Aber wo man auch hinkommt und wie lange man auch schon in der Fremde lebt: alle haben dort schon längst unseren Steckbrief gelesen. Und lachen oder fauchen einen an: Panzerdivision!
Also: Das Passwort bleibt bestehen. Und letztlich kann ich auch nicht ausschließen, dass in das Buch, das ich meinem Urgroßvater widmen will, früher oder später nicht doch die deutschen Invasoren einfallen werden.
Ich werde damit anfangen, auch ihm eine Art Passwort oder Namen zu geben, denn weder will ich ständig »mein Urgroßvater« schreiben, was schließlich nicht seine wichtigste Rolle ist im Leben, noch seinen vollen Namen, Florens Christian Rang, noch Florens Christian, wie ich es in meiner Familie väterlicherseits, wo man einen altvertraut-respektvollen Umgang mit ihm pflegt, immer gehört habe, und noch weniger »unser Held«, was mir weder im ironischen noch im eigentlichen Sinn gefällt. FCR (wie JFK) wäre praktischknapp, lässt aber eindeutig zu sehr an einen Fußballclub denken. Also: Welches Kennwort würde ich für ihn aussuchen, wenn ich heute in der Nationalbibliothek eine Jahreskarte für ihn beantragen müsste? Viele Eigenschaftswörter würden auf ihn passen: der Suchende, der Wahnsinnige, der Haltlose, der Radikale, der Unbändige, der Stürmische. Wonach ich suche, ist aber ein Name, ein Passwort eben. Ich wähle – nach einem Vogel, den ich an französischen Küsten oft dem Vor und Zurück des Wassersaumes habe folgen sehen – Sanderling.
Das Erste, was mich für den Mann erwärmte, als er anfing, mich innerlich in Anspruch zu nehmen, war, dass sein unveröffentlichtes, nie vollendetes und nur in Fragmenten überliefertes Hauptwerk den Titel Abrechnung mit Gott tragen sollte; es sollte hauptsächlich eine umfassende Geschichte und Kritik des Christentums und den Entwurf einer zukünftigen Religion enthalten, und es sollte von der Schilderung seines eigenen Glaubensweges oder vielmehr seiner Glaubensirrwege illustriert oder untermauert werden.
Abrechnung mit Gott: Er meinte es ernst mit diesem Titel, wie mit allem, was er im Leben anfing. Und ich? Ich überlege. Doch, ich meine es ernst, immer ernster sogar, wenn mein Ernst auch sicher ein anderer ist als Sanderlings. Wer es jedoch nicht ernst meint, das ist die Zeit. Abrechnung mit Gott: Allein die zeitliche Verschiebung ins 21. Jahrhundert nimmt dem Titel, so scheint mir, etwas von seiner Ernsthaftigkeit. Ohne mein Zutun, nur durch den Zeitsprung, ist ein (wenigstens auch) komischer Titel daraus geworden. Der Ernst, wie er zu Sanderlings Zeit noch verbreitet war, ist aus der Welt verschwunden, zumindest aus unserer unmittelbaren, vertrauten Umgebung. Aber vielleicht doch nicht ganz?
Der Größenwahn dieses ernstgemeinten Titels verschlägt die Sprache. Ich sehe einen kleinen Mann vor mir – ich stelle ihn mir klein vor, nicht für seine Zeit, aber für unsere –, aber natürlich hätten zwanzig oder sogar dreißig zusätzliche Zentimeter nichts geändert an seiner Winzigkeit im Angesicht dessen, mit dem er abrechnen wollte. Ich sehe ihn also vor mir, einen kleinen Mann, allein auf weiter Flur, wie er die Fäuste zum Himmel reckt und sich seine Wut aus Leib und Seele brüllt, ich sehe ihn, er hat es selbst so erzählt, seinen Hut vom Kopf reißen und darauf herumtrampeln und dabei in die weiten Wälder schreien: Hund, Schurke, und immer wieder Hund, Schurke, und damit meint er Gott den Quälgeist, den ›Vater‹, der mir vom Himmel aus das angetan. Ich höre, wie seine Worte schon in wenigen Metern Höhe verschluckt werden von einer tauben, noch nicht einmal höhnischen Unendlichkeit.
Er glaubte, dass jemand, also ein Gott, mit ihm persönlich befasst war, hatte noch nicht das Gefühl, in einer unübersichtlichen Masse zu verschwinden. Der mir das angetan! Wie Hiob fühlte er sich höchst ungerecht behandelt, doch wie sah das Unglück aus, in das er unverschuldet gestürzt worden war? Hatte er wie Hiob seine Frau, seine zehn Kinder und seinen gesamten Besitz verloren, war er wie Hiob vom Scheitel bis zur Sohle von bösartigen Geschwüren zerfressen? Was war es also, was ihm angetan wurde? Es ist ungewiss, ob sich das mehr als hundert Jahre später noch wird herausfinden lassen.
Abrechnung mit Gott: Hier hat sich jemand nicht einschüchtern lassen, scheint es. Oder: Hier hat jemand zu viel Nietzsche verschlungen? Womöglich beides. Ich will dem Ernst und dem Größenwahn nachgehen, mit dem diese Worte vor hundert Jahren notiert und doppelt unterstrichen wurden.
Statt wie seine Urenkelin mit einem Allerweltsnamen geschlagen zu sein, trug dieser Ernste einen Namen, der fast schon Gesinnung ist: Rang. Der Rang bezeichnet im Deutschen, dem Grimm’schen Wörterbuch zufolge, die Stufe, die ein Mensch innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung innehat; er setzt eine Hierarchie voraus. Mir scheint, jemand, der Rang heißt, müsse sich anders fühlen als einer, der Müller, Weber oder Schubert heißt. Ob wohl einer mit Namen Rang auf die Idee käme, es könnte vielleicht der letzte, der hinterste Rang gemeint sein? Aber natürlich verraten diese Überlegungen nichts, außer meiner eigenen Voreingenommenheit. Vermutlich fühlt sich ein Herr Groß nicht viel anders als ein Herr Klein.
Wie aber steht es mit Magnus? In der Familie Rang werden von Generation zu Generation, immer an den ältesten Sohn, mehrere in Öl gemalte Ahnenporträts weitervererbt, von denen das eine einen Magnus Rang darstellt. Dieser Magnus hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ludwig XIV., was an der gepuderten Perücke, einer sogenannten Allongeperücke, deren weiße Rollen den Kopf lockenwickelartig umgeben, und am Doppelkinn liegen mag. Ich stelle mir vor, einer, der Magnus heißt, müsse sich anders fühlen als ein Kurt oder ein Franz, und damit habe ich, glaube ich, recht.
Der Rang, um den es hier gehen soll, bekam den Vornamen Christian. In späteren Jahren, als er das Christentum, wie es die Kirchen seiner Zeit lebten, leid war, legte er sich noch einen zweiten, aus heutiger, aber vielleicht schon aus damaliger Sicht, recht hochtrabenden Vornamen zu, der nicht dazu angetan war, seinen Träger in der Rangordnung zurückzustufen: Florens. Der Blühende. Das Christentum schien ihm mit einem Mal welk und öde. Er warf es von sich und blühte auf. Florens Christian Rang.
Es ist ein weiter Weg von Florens zu Panzerdivision. Es ist der mit Worten gepflasterte Weg, auf dem sich dieses Buch vor- und rückwärts bewegen wird, wenn es nicht gerade auf Umwegen und Abzweigungen unterwegs ist.
Irgendwo an dieser Strecke, nein, schon ganz zu Anfang, noch bevor es mit dem Urgroßvater überhaupt richtig losgeht – für Ungeduldige wird das Buch sich nicht eignen –, liegt die Station boche oder Bosch.
Du solltest unbedingt das Grenzgänger-Stipendium der Bosch-Stiftung beantragen, sagt jemand, dem ich von meinem Vorhaben, Sanderling nach Polen nachzureisen, erzähle. Ich bin nicht weiter erstaunt zu hören, diese Grenzgänger-Sache sei wie auf mich zugeschnitten: Bekanntlich gibt es in Deutschland für so gut wie jedes Vorhaben eine passende Unterstützung. Warum nicht, wenn sie denn auf dich zugeschnitten ist, sage ich mir. Und gleich darauf: Brauchst du denn dieses Geld? Kannst du nicht ohne fremde Unterstützung nach Polen reisen? Am Ende musst du einen Dank an die Robert-Bosch-Stiftung, also Reklame für die Firma Bosch, in dein Buch drucken lassen. Ein stolzer Verzicht auf solche Förderung, finde ich, würde mich ehren. Während ich noch nachdenke, zwischen Ehre und Geld schwankend, merke ich, dass ich meine Reise schon begonnen habe und mich plötzlich auf halbem Weg befinde zwischen Florens und Panzerdivision, zwischen Sanderling und mir.
Boche ist eines der geläufigen Schimpfwörter, mit denen die Franzosen die Deutschen benennen; übrigens wird es in unseren Tagen häufig in mitzuhörenden Anführungszeichen, also mit einer gewissen Ironie gebraucht, die in seltenen Fällen wie diesem auch dazu dienen kann, eine Boshaftigkeit nicht zu verschärfen, sondern zu lindern. Da das Wort genauso ausgesprochen wird wie der deutsche Firmenname Bosch, ging ich viele Jahre lang davon aus, es leite sich von diesem ab. Seit mich jemand auf meinen Irrtum hinwies, habe ich die Sache überprüft, und tatsächlich: dass der Firmenname phonetisch mit dem Schimpfwort übereinstimmt, scheint nur ein eigentümlicher Zufall zu sein. Woher kommt also das Schmähwort? Angeblich von alboche, was eine Zusammenziehung von allemand und caboche sein soll und so viel wie »deutscher Dickschädel« bedeutet. Das klingt wie ein freundlicher Pleonasmus; freundlicher jedenfalls, als sich das Wort boche anhört, wenn man es an den eigenen Dickkopf geworfen bekommt. Weniger freundlich allerdings als das Wort rigolboche, das es im Französischen auch gibt und das einen Spaßvogel bezeichnet, anders gesagt: das Gegenteil eines Deutschen. Die Etymologie des Wortes boche habe ich dem Trésor de la langue française entnommen, und ich will mir Mühe geben, sie für richtig zu halten. War es deshalb aber völlig abwegig, die Firma Bosch jahrelang mit dem Schimpfwort »boche« in Verbindung gebracht zu haben?
Über Bosch ist höchst Widersprüchliches in Erfahrung zu bringen. Nehmen wir es als Vorzeichen dafür, dass auf dem Weg dieses Buches fast so viele Widersprüche wie Worte liegen werden. Manche sehen in dem Firmengründer Robert Bosch einen großartigen Retter von Menschenleben, einige gar einen im politischen Widerstand Engagierten. Das Gemeinwohl, besonders das gesundheitliche Wohl seiner Mitmenschen, war ihm ein Anliegen; unter anderem ließ er in Stuttgart ein Krankenhaus bauen. Andererseits ordnete Hitler für Robert Bosch ein Staatsbegräbnis an. Und vor allem: Über die Hälfte der Arbeiter der Firma Dreilinden-Maschinenbau, einer Tochtergesellschaft des Bosch-Konzerns, die hauptsächlich für die deutsche Luftwaffe produzierte, waren Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge, die in das KZ-Außenlager Kleinmachnow verschleppt worden waren. Dreilinden ist ein Ortsteil von Kleinmachnow, wo die Tochterfirma ansässig war. Einerseits, andererseits? Unumstritten scheint, dass sich die Leitung des Unternehmens nicht aus begeisterten Nazis zusammensetzte, dass man sich aber, um eine Enteignung zu verhindern, mit dem Regime arrangierte. Und an dem von ihm angezettelten Krieg gut verdiente.
Also: Geld von Bosch?
Ich beschließe, den Antrag zu stellen; schon, weil er mich so unmittelbar auf den Weg des Buches bringt. Bekomme ich die Förderung zugesprochen, werde ich sie, so sage ich mir zu meiner vorläufigen Rechtfertigung, immer noch mit demonstrativ-theatralischer Geste zurückweisen können: Ich, von Ihnen Geld annehmen? Niemals! Oder mein Antrag wird abgelehnt, und ich vermeide jedes moralische Dilemma. Warten wir’s ab.
Von der Wort-Station Bosch oder boche ist es nicht weit bis zu einer anderen, an der ich anhalten werde, bevor ich mich Sanderling zuwende. Das Wort, das sich mir aufdrängt, ist eines, das er vielleicht nie gehört hat. Mit dem er nichts verband. Es hatte zu seiner Zeit keine besondere Bedeutung. Es ist ein Wort, das ich selbst schon hundertfach, nein, tausendfach gehört und gelesen, aber so gut wie nie ausgesprochen habe. Und auch jetzt werde ich es nicht aussprechen, sondern niederschreiben. Es ist nicht das einzige Wort, das eine Leere um sich schafft, bei weitem nicht das einzige, das mir nicht über die Lippen will. Bei diesem aber ist das Mir-nicht-über-die-Lippen-Wollen keine Redewendung, sondern ein deutlich von mir verspürtes Gebot: das Wort will von mir nicht ausgesprochen werden. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ausgesprochen werden will, und wenn ja, wie und von wem. Es ist der Name eines Ortes in Polen, von dem spätestens jetzt jeder weiß, wie er lautet.
Vor einiger Zeit habe ich im französischen Radio eine Sendung gehört, in der das Wort ausgesprochen wurde. Nicht, dass dies selten vorkäme; im Gegenteil. Es ist, wie ich schon schrieb, ein Wort, das sehr häufig zu hören ist, woraus zu schließen ist, dass andere nicht die gleiche Scheu verspüren wie ich. In besagter Sendung war es die Moderatorin, die das Wort eher beiläufig erwähnte. Wie alle Franzosen sprach sie das »Au« wie ein »O« aus. Und wie ich es ebenfalls schon einige Male mit Befremden aus französischen Mündern gehört habe, verschob sie das »sch« ans Ende des Wortes. Sie sagte also ein Wort, das sich in etwa anhörte wie »Oswitsch«. Übrigens ging es, wenn ich mich recht entsinne, in dieser Sendung gar nicht um das, womit dieses Wort fortan verbunden ist, sondern um Poesie, und das Wort kam nur als Teil der Floskel gewordenen Frage »Kann man nach A. noch Gedichte schreiben?« vor. Aber es kann sein, dass mich hier meine Erinnerung trügt.
Sie trügt mich nicht, was den weiteren Verlauf der Sendung angeht. Es ist schon Monate her, dass sie gesendet wurde, und seither habe ich immer wieder darüber nachgedacht. Unter den Gästen der Sendung war eine französische Jüdin. Sie redete als Erste, nachdem das Wort gefallen war. Mit einer Stimme, deren Schärfe sich mir eingeprägt hat, bat sie die Moderatorin – doch diese Bitte klang eher wie eine Zurechtweisung, ja, wie ein Befehl –, das Wort nie mehr so zu sagen, wie sie es soeben getan hatte, und sie sprach ihr vor, wie es richtig auszusprechen sei. Die von ihr bemängelte, als falsch bezeichnete Aussprache schien in ihren Augen eine unerlaubte Nachlässigkeit und mangelnde Ehrfurcht vor dem Wort und vor dem, wofür es steht, auszudrücken. Das sagte sie zwar nicht, aber es war ihrem gereizten, feindseligen Tonfall anzumerken. Die Moderatorin entschuldigte sich und fuhr scheinbar ungerührt in ihrer Rede fort.
Während ich jetzt dem, was mir damals und seither durch den Kopf ging, schreibend auf den Grund zu gehen versuche, spüre ich einerseits deutlich, mit welcher Vorsicht ich meine Worte wählen muss, andererseits bin ich mir, und war ich mir damals schon, meiner widersprüchlichen Wahrnehmung dieses Zwischenfalls bewusst. Mir scheint, als spiegele sich in dieser kleinen Begebenheit, die nur ein paar Sekunden gedauert hat, die ganze Schwierigkeit und Komplexität des Verhältnisses zwischen Juden und Nicht-Juden seit – dem.
Ich konnte verstehen, dass die Frau diesen schroffen Ton anschlug; es war offenkundig, dass sie die von ihr als nachlässig und falsch empfundene Aussprache nicht ertrug. Gleichzeitig regte sich in mir ein Widerstand gegen diese Maßregelung. Obwohl ich das Wort, um das es ging, fast nie ausspreche, war es mir, als wäre mir diese Zurechtweisung selbst widerfahren. Meine undeutliche Empfindung war und ist, dass ich als Nicht-Jüdin und zudem noch als Deutsche, auch wenn ich mir noch so viel Mühe gebe, das Wort gar nicht richtig aussprechen kann. Ist das vielleicht einer der Gründe, warum ich es meide?
Später denke ich darüber nach, was wohl »richtig« und »falsch« in diesem Zusammenhang bedeuten könnten. Was die französische Jüdin in der Radiosendung für richtig hielt, war, wie sie selbst sicher am besten wusste, die im Französischen geläufige Aussprache der deutschen Form des polnischen Ortsnamens Oświęcim. So nüchtern betrachtet, erscheint ihre Verärgerung über die falsche oder ihr unerträgliche Aussprache des Wortes nicht gerechtfertigt. Doch war ihre Reaktion keine der Vernunft gemäße, sondern eine von undeutlichen und unterschiedlichen Gefühlen hervorgebrachte, und für eine solche sind das Wort, um das es ging, und alles, was es beinhaltet, eine mehr als genügende Rechtfertigung. Es ist aber auch eine Reaktion, deren wir, und mit diesem »wir« meine ich die Nicht-Juden und allen voran die deutschen, immer gewärtig sein müssen und der wir nichts entgegenzusetzen haben. Es ist uns verboten, gefühlsmäßig darauf zu antworten; beinahe noch »verbotener« ist uns aber eine distanzierte und nüchterne Erwiderung. Doch schreibe ich dies alles nicht, um mich über etwas oder jemanden zu beschweren, noch gar um mich oder »uns« als bedauernswert darzustellen, sondern einzig, um einmal wenigstens in meinem Leben der wunden Stelle näherzukommen, die ich bisher immer versucht habe zu meiden.
Was also wäre die »richtige« Aussprache des Wortes gewesen? Am ehesten doch wohl eine möglichst akzentfrei polnische, könnte man denken, auch wenn außer den Polen selbst wohl kaum jemand wissen dürfte, wie eine solche sich anhören müsste. Ich entdecke, dass man nicht unbedingt einen Polen kennen muss, den man fragen kann, sondern dass man es im Internet sehr leicht herausfinden kann. Es genügt, das Wort selbst und zudem etwa »Aussprache« oder »pronounciation« einzugeben. Auf meinem Bildschirm öffnet sich ein großes schwarzes Fenster. Womöglich hätte sich dasselbe schwarze, wie auf eine sternenlose Nacht hinausgehende Fenster geöffnet, wenn ich die Aussprache des Wortes krzeslo (Stuhl) oder dziękuję (danke) hätte wissen wollen. Ich habe es nicht versucht. Ich weiß nur, wie sonst die Fenster aussehen, die sich in der digitalen Welt den Bildschirmmenschen öffnen: Sie sind angefüllt mit Bildern, kein Fleck ist frei von Bild oder Schrift, und diese Bilder und manchmal auch die Schriftzüge sind in ständiger Bewegung. Das Fenster aber, von dem ich rede, ist reglos und einförmig schwarz. Nur in der Mitte ist ein schmaler grauer Streifen zu sehen, links daneben ein Pfeil, und rechts die Ziffer 0:01 und ein Lautsprechersymbol. Ich klicke auf den Pfeil und höre eine Männerstimme das Wort auf Polnisch sagen. Es ist keine leiernde Automatenstimme, wie ich sie erwartet habe, sondern eine ernste, warme Männerstimme. Ich höre das Wort wieder und wieder, erst leise, dann ein bisschen lauter. Was ich vernehme, lässt sich phonetisch ungefähr so wiedergeben: Oschwientschim. Es hört sich an, als wäre dies die richtige, wenn auch in einem Gespräch nicht verwendbare Aussprache.
Warum nun diese lange Passage zu diesem Wort und seiner Aussprache am Anfang eines Buches, in dem es um meinen 1924 gestorbenen Urgroßvater gehen soll?
Ich denke mir die Zeit, die zwischen uns beiden liegt, als einen Weg. Wir sind zwei Wanderer, die auf derselben Strecke unterwegs sind, ohne einander je zu begegnen. Der Weg, der sich zwischen uns hinzieht und den keiner von uns je betreten wird, verbindet uns und trennt uns zugleich voneinander. Will ich nun, ausgerüstet mit allerlei Kenntnissen über die Umstände dieses besonderen Lebens, über seine Zeit insgesamt und einige der geistigen Strömungen und Haltungen, die in ihr anzutreffen waren, mich aufmachen, um wenigstens in Gedanken jene weite Wegstrecke zu durchlaufen, so kann ich, scheint mir, das Binde- und Trennungsglied nicht einfach überspringen, indem ich so tue, als gäbe es kein Dazwischen; als wäre ich etwa nicht die Urenkelin, sondern die Tochter jenes Mannes.
Auf der Suche nach einem möglichen Zugang zu diesem fremden Leben beschließe ich deshalb, mich vor allem der Jahrhundertwende und damit seinen im Osten, in Poznań, damals Posen, später in zwei Dörfern der Umgebung verbrachten Jahren zuzuwenden. Denn lässt sich nicht das, was uns trennt und zugleich verbindet, wenn überhaupt, dann mit einem Wort fassen, nämlich mit dem obengenannten, von mir so hartnäckig vermiedenen, oder eben mit jenem anderen, zu ihm gehörigen: Polen?
Würde ich Sanderling heute begegnen, in einem von mir oder sonstwem heraufbeschworenen Reich der Toten – und was ist die Vergangenheit anderes als ein unzugängliches Totenreich? –, und er würde mich befragen dazu, was geschehen ist in der Welt, die die seine war, seit er sie verlassen hat – würde ich da nicht zuerst das gefürchtete Wort auszusprechen haben?
All diese Zusammenhänge sind wohl selbstverständlich und bräuchten nicht eigens erwähnt zu werden. Doch wie alles Selbstverständliche lösen sie sich in Luft auf, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit von Menschen gedacht und im Innersten verspürt, also ihrer Selbstverständlichkeit entrissen werden.
Als Lebendiger, als Erinnerung an einen lebendigen Menschen, ist Sanderling aus dem Gedächtnis der Heutigen verschwunden. Die letzten, die ihn noch gekannt haben, sind in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gestorben, und mit keinem von ihnen habe ich je gesprochen. Was bleibt, ist unendlich viel mehr, als meist über lange Verschwundene noch in Erfahrung zu bringen ist. Es gibt einen umfangreichen Nachlass, der unter günstigsten Aufbewahrungsbedingungen in einem Archiv lagert; es gibt veröffentlichte und unveröffentlichte Schriften und Briefwechsel; es gibt einige Beschreibungen seiner Person, darunter solche aus der Feder von Walter Benjamin und Hofmannsthal. Es gibt Fotografien. Es gibt die Orte, an denen er lebte.
Das meiste davon ist mir heute noch unbekannt. Mein Weg in die Vergangenheit wird über eine Fülle von Papieren, Plätzen und Begegnungen führen. Es wird der Weg dieses Buches sein. Denn nicht nur von Menschen und Ereignissen, von Bewegungen der Gedanken und des Gemüts, sondern auch vom Dickicht der Zeit soll dieses Buch erzählen. Es soll das Journal einer Erkundungsreise werden.
Ein Geheimnis scheint die Person dieses Mannes zu umgeben; etwas, was sich jedem, der ihm begegnet ist, sofort offenbart zu haben scheint, das aber mit seinem Tod womöglich für immer verschlossen ist. Etwas, was ihn, den Lebendigen, unübersehbar umfangen hat, was sich aber selbst von solchen »Köpfen« und »Federn« wie den obengenannten nur unzulänglich beschreiben und folglich von denen, die ihm nie begegnet sind, nur schwer nachempfinden lässt. Womöglich sind die Beschreibungen aber auch gerade insofern gelungen, als sie die Unmöglichkeit spüren lassen, das Wesentliche dieses Menschen einzufangen. Wird das geschriebene Wort, vor dem er so große Ehrfurcht hatte, wo es auf ihn selbst gemünzt war, zum toten Buchstaben? Ob es gelingen kann, diesen toten Buchstaben zum Leben zu erwecken?
Versuchen wir es erst einmal mit einem einfachen kleinen Satz, sagen wir: Als kleiner Junge ist er brav. Aber nein, das stimmt so schon nicht. Brav ist ein Kind aus Angst vor Strafe oder einfach, weil es keinerlei Bedürfnis danach verspürt, Unerlaubtes zu tun. Keines von beidem trifft auf ihn zu. Wenn man ihm glauben will, und das will ich, fürchtet er bei seinem durchaus häufigen Übertreten von Verboten nicht die Strafe, nicht den Schmerz der Prügel, sondern entblößt zu stehn als einer, der Verbotes Heiligkeit erkannte und dennoch übertrat. Die Eltern sind höhere Wesen, deren Wille zu geschehen hat. In dem Jungen ist der auratische, respekteinflößende Mann im Keim schon enthalten. Er selbst nennt das: autoritär-passiv sein. Die Autorität steckt schon in ihm, kann sich aber zunächst nur passiv, womit gemeint ist, in ihrem Gegenstück, dem Gehorsam, ausdrücken: ich war den Eltern aufs Stärkste untergeben.
Liegt darin etwas von dem sturen, dem sogenannten »blinden« Gehorsam, auf den wir gewohnt sind das Schlimmste zu schieben? Wir, damit meine ich uns, die wir im Leben nicht daran gedacht hätten, uns gegen Gott aufzulehnen. Für die Gott eine ähnlich verflossene Gestalt oder Institution ist wie der deutsche Kaiser. Uns, für die es nie eine Autorität gegeben hat.
Wie stand es um den Gehorsam dieses Jungen?
In der Fülle von Erzählungen, Papieren und Zeugnissen, mit deren Hilfe ich mich diesem vergangenen Leben zu nähern versuche, blitzt hin und wieder ein Wort, ein Satz oder eine Auskunft auf, die eine besondere Bedeutung haben oder von mir verliehen bekommen. Dazu gehört der Nebensatz, der Vater habe den 1864 geborenen Jungen katholisch taufen lassen, aber in der evangelischen Religion erzogen, aus Protest gegen das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, das während des 1.Vatikanischen Konzils proklamiert wurde. Tatsächlich drohte fortan jedem, der die Unfehlbarkeit des Papstes öffentlich anzweifelte, die Exkommunikation. Hier war aber nun ein Mann, der nur einen einzigen Unfehlbaren anerkannte, und das war Gott selbst. Er weigerte sich, seinen Sohn im Glauben zu erziehen, ein Mensch könne unfehlbar sein, sei es auch nur auf dem beschränkten Gebiet der religiösen und sittlichen Fragen. Und überhaupt (füge ich selbst hinzu): Was ist eine Unfehlbarkeit wert, über die erst einmal abgestimmt werden muss? Und die man, nachdem die Bischöfe abgestimmt haben, selbst proklamiert? Könnte da nicht jeder kommen?
Ich will in der Weigerung meines Urahnen, den Papst als unfehlbar anzuerkennen, und in seiner, wenn auch nicht-öffentlichen, nicht gerade die Exkommunikation herausfordernden Ablehnung dieses neuen Dogmas eine Aufmüpfigkeit sehen, die nicht mit gedankenlosem Gehorsam zu vereinbaren ist. Er wusste, dass weder der Papst als Oberhaupt der Kirche noch er selbst als Oberhaupt der Familie unfehlbar sein konnte. Wenn er trotzdem von seinem kleinen Sohn tiefste Untergebung verlangte, so geschah das womöglich einfach, weil er sich vorläufig für vernünftiger und lebenskundiger hielt.
»Aufmüpfigkeit« ist sicher das falsche Wort. Immerhin scheint zu stimmen: dieser Mann schluckte nicht alles, er hatte seinen eigenen Kopf. Er war misstrauisch einem gegenüber, der seine persönlichen Entscheidungen als absolut und nicht anzweifelbar betrachtet haben wollte. Wenn ich an später denke (also für mich an früher), und ich denke oft daran in diesen Tagen, beruhigt es mich, das von einem meiner Urahnen schreiben zu können.
Der Sohn ist autoritär in einem heute nicht mehr gebräuchlichen Sinne; das Wort hat jegliches Fluidum verloren und stattdessen etwas von einer Militärdiktatur bekommen; nach dem neuesten Stand des Dudens ist es in etwa gleichbedeutend mit: totalitär. Er ist also autoritär zu einer Zeit, als noch ein Mensch in der eisernen Rüstung steckte. Zunächst passiv; später, mit seinen eigenen Kindern und wohl auch Untergebenen, vielleicht auch mit seiner Frau, aktiv.
In Form von Gegensätzen ist die Zukunft in ihm angelegt: Ordnung und Anarchie, Langsamkeit und Plötzlichkeit, Gehorsam und Aufbegehren, Ideal und Wirklichkeit.
Vater und Mutter waren auch Idealisten, aber sehr andere als ich. Optimisten. Sozusagen: Sie hatten Ideale, häusliche, moralische, soziale, die sie erfüllten und erfüllt wissen wollten. Mein Idealismus war unerfüllbar, ich meinem Wesen nach unordentlich. Träumen hinaus in ein unklares Jenseits ging gegen meiner Eltern Art.
Wer Optimist ist und bleiben will, sucht sich besser erfüllbare Ideale. Ein erfüllbares Ideal ist ein Widerspruch in sich. Die Eltern hatten eine genaue Vorstellung davon, wie ein Mensch sich verhalten muss.
Sanderling sieht sich selbst als einen, dem das Ideal etwas Vorschwebendes, ein Luftgebilde und deshalb per definitionem unerreichbar ist. Das Eigentliche geschah für ihn von jeher außerhalb der Sphäre des Sichtbaren, in einer von der Sonne durchbrochenen Nebellandschaft, die in nichts dem reinlichen, wohlgeordneten Wohnzimmer der Eltern glich. Wenn sich der Nebel verzieht und die wirklichen Dinge, Verhältnisse und Menschen sichtbar werden, ist Optimismus schwierig zu bewerkstelligen.
Optimisten, Idealisten, Autorität, Ideale – ist denn seit jener nicht sehr fernen Zeit noch ein Wort auf dem anderen geblieben? Die Bücher über die Vergangenheit verwenden die Wörter, die damals schon gebräuchlich waren, und welche anderen sollten sie auch benutzen? Aber es ist, als hätte ihnen jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Jeder Schritt trifft daneben, oder er trifft nur noch den Rand der wegtreibenden Bedeutungsscholle. Und nicht nur die abstrakten Begriffe sind davongeschwommen. Sind nicht »Straße«, »Schule«, »Brief« auch schon fast außer Sicht? Mit wackeligen Beinen bewegen wir uns fort.
Polen und das Pastorenamt sind noch weit. Das Kind, der junge Mann, trägt als Erbschaft Beamtenberuf in sich. Auch dieses Wort ist weit abgedriftet: Beamter. Entstammt denn noch jemand einem Beamtengeschlecht? Der eine oder andere vermutlich schon – angefangen mit mir selbst, die ich in der Rang’schen Ahnenreihe die erste Nicht-Beamten-Generation vertrete –, aber es sieht dies niemand mehr ernsthaft als anzutretende Erbschaft an. Dabei war der Beamtenberuf in den besseren deutschen Familien einmal, was im französischen Adel das Priestertum und das Militär waren: ein Stand, dem man einen Sohn entsandte (Stand: wohin ist dieses Wort nun wieder unterwegs? kaum noch zu erkennen am Horizont). Sanderlings Vater und er selbst tragen am Ende ihrer Laufbahn den Titel des Geheimen Rats.
Das letzte Jahrhundert hat dem Beamtentum nicht nur alles Prestige, sondern auch jedes Gefühl einer Berufung geraubt. Ein Häuflein Elend ist von ihm übriggeblieben: ein immer schütterer werdender Unterschlupf für ängstliche Gemüter, die sich Sicherheit vor Kündigung, Chefarzt-Behandlung und eine ordentliche Pension versprechen. Was hat den Beamten vom Himmelsgewölbe und zuletzt noch von seinem Sockel heruntergerissen?
In der geistigen Entleerung dieses Berufsstandes, die sich schon ankündigt, sieht Sanderling ein ungeheures weltgeschichtliches religiöses Problem: den Ersatz der Religion durch unpassionierte Administration, durch unfreie schwunglose Unleidenschaft.
In einem Buch mit dem Titel Der verwaltete Mensch beschreibt H.G. Adler die Verwaltung als Spiegel der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Genaugenommen sagt die Verwaltung nichts, sie schreibt (eine radikale Spielart der realistischen, möglichst treu widerspiegelnden Literatur?). Der Mensch scheine in ihr auf als Vorgang, als Abstraktion. Als Nummer.
Adler erklärt, wie die Verwaltung in Abhängigkeit von den drei Staatsgewalten ursprünglich ein buchhalterisches Spiegeldasein führt, schließlich aber während des Nationalsozialismus selbst zur Gewalt wird, also den Menschen nicht mehr nur betrifft, sondern trifft.
Die Herren der Verwaltung aber, und zugleich ihre Diener, sind die Beamten. Ein Heer von Beamten – dessen Sinn für Gehorsam dem eines Soldatenheeres in nichts nachstand – ordnete, verwaltete, rechnete, verschob Zahlenkolonnen nach Osten. Legte ad acta.
»Kein Staat ist mehr als Fabrik verwaltet worden als Preußen seit Friedrich Wilhelm des Ersten Tode.« Diesen Satz von Novalis zitiert Adler aus dem Grimm’ schen Wörterbuch, wo er die Etymologie des Wortes »verwalten« erläutern soll. Gemeint war er nicht als düstere Prophezeiung, sondern vermutlich als Kritik an der Regierung Friedrichs II.
Wir sehen die Worte davonschwimmen. Keines von ihnen ist mehr einzuholen; kein Satz kann mehr so verstanden werden, wie er gemeint war, und nur so. Man müsste vergessen – nein, wir wissen ja, wie es mit dem Vergessenen steht, dass es nämlich keineswegs verschwunden ist, sondern zusammengeknüllt hinter den sorgsam gebügelten Laken im Wäscheschrank liegt –, man müsste die Zeit unvergangen machen können. Noch einmal neugeboren, noch einmal jung und unschuldig oder anders schuldig sein. Hundert Jahre früher zur Welt kommen. 1864. Sein eigener Urgroßvater müsste man sein. Florens Christian Rang.
Von Generation zu Generation wurde man in dieser Familie, in diesem Geschlecht, höherer, hoher Beamter, ein ehrwürdiger, wenn auch schon damals für leidenschaftliche Temperamente wenig sich eignender Beruf. Und Sanderling hatte ein leidenschaftliches, heißblütiges Temperament; vieles ist ungewiss, doch das lässt sich mit Sicherheit über ihn sagen. Doch ist er ein folgsamer, ehrerbietiger Sohn, und so schlägt er die Erbschaft des Berufes nicht aus und studiert die darauf zuführenden Rechtswissenschaften. Es folgen einige Jahre, die nicht im Flug vergangen sind, wie es hier aussehen wird. Was ihn innerlich bewegt, sind nicht die Rechtswissenschaften. Es ist – aber woher will ich, woher will jemand das wissen. Ich wollte schreiben: Es ist die warme, die zartheiße Haut der Frauen. Blitzartig trifft mich sein Blick von ganz nahe, und es ist, als würde ich einem lebendigen Menschen gegenüberstehen. Er verbietet mir jede Erwähnung seiner leiblichen Existenz. Er verbietet mir jegliche Form der Annäherung. Lieber will er weiter unerkannt im Schatten Benjamins und Bubers dahinvegetieren, als in das diffuse Licht meiner Vorstellungwelt gezerrt zu werden. Er erkennt mich nicht als seine Urenkelin an. Eine solche wie mich hat er sich nicht gewünscht. Und ich kann nicht anders, als in diesem Augenblick an meine Geburtsurkunde zu denken, auf der geschrieben steht: Die Vaterschaft ergibt sich aus einem Randvermerk.
Ich richte mich auf und sehe in seine hellen Augen: Ich bin deine letzte Chance, sage ich mit fester Stimme. Außer mir und einem italienischen Doktoranden, der für seine Forschungen eine finanzielle Unterstützung bräuchte, die er nicht bewilligt bekommt, interessiert sich kein Mensch mehr für dich. Du Fußnote, schreie ich ihn an. Du Randvermerk.
Wenigstens in der eigenen Phantasie gönne ich mir gerne hin und wieder solch imponierende Auftritte.
Wie aber weiter?
Andere können Sätze schreiben wie: er muß ein erotisch und aggressiv triebstarker Mensch gewesen sein, oder: er wurde sexuell aktiv, lebte über seine finanziellen Verhältnisse und wurde immer wieder von Schuldgedanken niedergeworfen. Ich bleibe dabei: Was ihn im Innersten bewegt, was ihn nicht loslässt, ist die warme, die zartheiße Haut der Frauen.
Er liest Schopenhauer und Gerhart Hauptmann, geht ins Theater. Manches reißt ihn mit, und das Mitgerissen-Werden ist es, wonach es ihn mehr als nach allem anderen verlangt und wofür er zudem eine ausgesprochene Begabung hat.
Die Mädchen und Frauen aber reißen ihn aus sich heraus. Das Gefühl der Schlechtigkeit, der Schuld drückt ihn zu Boden. So etwas schreibt sich hin, und jeder meint zu wissen, was damit gemeint ist, jeder erinnert sich: Das Beisammensein von Frau und Mann war bis vor kurzem nur innerhalb der Ehe nichts Schlechtes. Aber wie kann ich, von der die Zeit dieses Gewicht längst genommen hat, mir bewusstmachen, was Schuld und Sünde einmal bedeutet, wie sie auf jedem Einzelnen gelastet haben? Ist es, als fühlte ich ein starkes Verlangen, andere zu quälen, ihnen körperliche Schmerzen zuzufügen, und ich könnte davon nicht lassen, obwohl ich wüsste, wie schlimm und böse das ist, und obwohl ich mich selbst dafür verabscheute?
Derartige Vergleiche können nie stimmen; vielleicht können sie helfen bei dem Versuch – der unternommen werden, aber nie gelingen kann –, sich um hundert Jahre zurückzukatapultieren. Er fühlt sich wie ein Aussätziger, denke ich, wie ein von einem Dämon Besessener, gegen den anzukämpfen er zu schwach ist. Und er verachtet sich dafür.
Es wohnt in ihm ein wildes Tier. Er kann es halbwegs zähmen, aber er wird es nicht los.
Ich hatte nicht den Mut, zu meinem Unternehmen mich an die schönen, stolzen Erscheinungen zu wagen, und das Geschöpf, das ich an mich zog und zweimal wöchentlich ins Bett nahm, hatte nur einen Arm. Der andere war eine Hülse von Bandagisten … Nichts hielt mich bei ihr als mein Mangel an Mut, der das gutmütige Ding durch Wegjagen nicht kränken wollte, und das Bedürfnis, den wilden Bildern meiner Fantasie nicht nur passiv preisgegeben zu sein … Jetzt schnitt ich aus Papier ein Kreuz aus und hing es an die Wand über mein Bett. Kam die Kleine, so tat ich’s ab; ebenso wenn Besuch kam.
Geisteswissenschaftliche Forscher werden vielleicht einst in die Gedankenwelt dieses Mannes tiefer eindringen. Mir ist der andere, der mit dem einarmigen Mädchen zusammenliegt, als Erbe zugefallen. Und darüber bin ich froh, denn aus diesen Zeilen scheint ein Mensch hervor, und diesem bin ich zugetan.