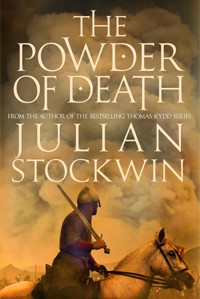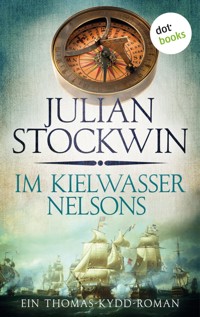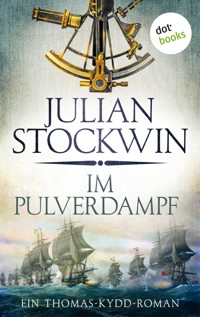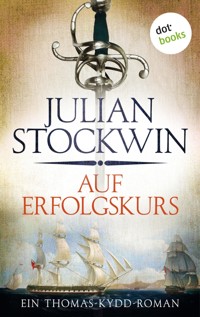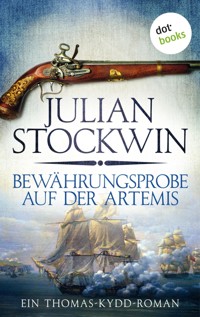
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Thomas-Kydd-Roman
- Sprache: Deutsch
Exotische Orte und ein unbesiegbarer Feind: Der abenteuerliche Seefahrerroman »Bewährungsprobe auf der Artemis« von Julian Stockwin als eBook bei dotbooks. England, 1794: Dank seiner Heldentat werden Thomas Kydd und sein bester Freund Renzi als Vollmatrosen auf die »Artemis« versetzt – eine der besten Fregatten der Royal Navy. Schon bald erhalten sie eine wichtige Mission: Sie sollen den königlichen Gesandten nach China eskortieren. Für Kydd ist es der Beginn einer Reihe von Abenteuern, die ihn bis in die entlegensten Winkel der Welt führt. Auf den Philippinen erwarten ihn Prüfungen, die seine Stärke, seinen Mut und seine Loyalität auf die Probe stellen: Das gefürchtete Gelbfieber rafft die Crew dahin, immer mehr tapfere Männer wollen desertieren und die Ureinwohner der Insel hüten ein blutiges Geheimnis … Jetzt ist es an Kydd und Renzi, die Besatzung der »Artemis« zu retten! Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin wurde zum Bestsellerautor, weil er seine Leser mitten zwischen die Männer stellt, die vor dem Mast fuhren.« Daily Express Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der marinehistorische Roman »Bewährungsprobe auf der Artemis« von Julian Stockwin – Band 2 der Erfolgsreihe um Thomas Kydd und seinen Aufstieg vom einfachen Matrosen zum Helden der See. Ein Lesevergnügen für alle Fans von Patrick O'Brian und C. S. Forester. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Nachwort des Verfassers
Lesetipps
Über dieses Buch:
England, 1794: Dank seiner Heldentat werden Thomas Kydd und sein bester Freund Renzi als Vollmatrosen auf die »Artemis« versetzt – eine der besten Fregatten der Royal Navy. Schon bald erhalten sie eine wichtige Mission: Sie sollen den königlichen Gesandten nach China eskortieren. Für Kydd ist es der Beginn einer Reihe von Abenteuern, die ihn bis in die entlegensten Winkel der Welt führt. Auf den Philippinen erwarten ihn Prüfungen, die seine Stärke, seinen Mut und seine Loyalität auf die Probe stellen: Das gefürchtete Gelbfieber rafft die Crew dahin, immer mehr tapfere Männer wollen desertieren und die Ureinwohner der Insel hüten ein blutiges Geheimnis … Jetzt ist es an Kydd und Renzi, die Besatzung der »Artemis« zu retten!
Über den Autor:
Julian Stockwin wurde 1944 in England geboren und trat bereits mit 15 Jahren der Royal Navy bei. Nach achtjähriger Dienstzeit verließ er die Marine und machte einen Abschluss in Psychologie und Fernöstliche Studien. Anschließend lebte er in Hong Kong, wo er als Offizier in die Reserve der Royal Navy eintrat. Für seine Verdienste wurde ihm der Orden des MBE (Member of the Order of the British Empire) verliehen, bevor er im Rang eines Kapitänleutnants aus dem Dienst ausschied. Heute lebt er als Autor in Devon und arbeitet an den Fortsetzungen der erfolgreichen Thomas-Kydd-Reihe.
Julian Stockwin im Internet: https://julianstockwin.com/
Bei dotbooks erscheint in der Thomas-Kydd-Reihe von Julian Stockwin außerdem:
Bei dotbooks erscheint in der Thomas-Kydd-Reihe von Julian Stockwin außerdem:
»Zur Flotte gepresst«
»Verfolgung auf See«
»Auf Erfolgskurs«
»Offizier des Königs«
»Im Kielwasser Nelsons«
»Stürmisches Gefecht«
»Im Pulverdampf«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2019
Copyright © der englischen Originalausgabe 2002 Julian Stockwin
Die englische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Artemis« bei Hodder & Stoughton, London.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2002 Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/solar lady, Abstractor, sich und eines Gemäldes von Louis Philippe Crépin
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (as)
ISBN 978-3-96148-844-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Bewährungsprobe auf der Artemis« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julian Stockwin
Bewährungsprobe auf der Artemis
Ein Thomas-Kydd-Roman
Aus dem Englischen von Matthias Jendis
dotbooks.
Der Herrin meines Herzens
Kapitel 1
Thomas Kydd stand verlegen auf dem Deck der Fregatte, seine wenigen Sachen neben sich auf den Planken. Kaum eine Stunde zuvor war er noch ein gewöhnlicher Leichtmatrose auf dem alten Linienschiff Duke William gewesen, irgendwo vor der feindlichen Küste des revolutionären Frankreich. Nun blickte er als frischgebackener Vollmatrose vom Deck einer der besten britischen Fregatten auf den Dreidecker zurück. Mit anderen war er als Ersatz für eine Prisenmannschaft an Bord gekommen.
Eine Hand hob sich zum Abschiedsgruß in dem Boot, das zum großen Dreidecker zurückpullte: Whaley. Kydd schnürte es die Kehle zu, als ihm klar wurde, daß er dieses breite Lächeln wahrscheinlich nie wieder sehen, nie wieder Rum mit seinen alten Bordkameraden trinken würde. Der Anfang war hart gewesen. Kydd, ein junger Perückenmacher aus Guildford, war ein halbes Jahr zuvor von dem Preßtrupp ergriffen und an Bord verschleppt worden, doch obwohl er viel hatte durchmachen müssen, bewunderte er inzwischen den Mut und das Können der Seeleute. Nun war er selbst ein Seemann und nahm Abschied von dem Schiff, das so lange sein Zuhause gewesen war.
Er winkte zurück, dann zwang er sich, den Blick innenbords zu richten.
Mehrere Männer warteten an Deck: ein wettergegerbter älterer Seemann in schlichtem Schwarz, der einen abgewetzten Dreispitz trug, ein Leutnant im praktischen Marineblau, ein kindlich wirkender Fähnrich ohne Hut sowie der Mann am Steuerrad, der stur seinen Pfriem kaute. Neben Kydd verzog Renzi das Gesicht zu einer verschwörerischen Miene. Sein Freund und er hatten gemeinsam viele Abenteuer bestanden. Die anderen in der kleinen Gruppe wirkten genauso verwirrt: Stirk, der Stückführer, ein harter Mann; Doud, der tollkühne Toppgast; Doggo, ein abstoßend häßlicher Vollmatrose; Pinto, ein adretter und äußerst gefährlicher Portugiese, sowie Wong, der unergründliche starke Mann aus dem Zirkus. Beschwerden waren allerdings nicht zu erwarten, denn der Dienst auf einer schnellen Fregatte, die auf der Suche nach Beute und Prisengeld die Weltmeere durchstreifte, war unendlich viel verlockender als die langweilige Routine eines Dickschiffs im Blockadedienst.
»Braßt rund das Marssegel da, nun macht schon, ihr verdammten Faultiere!« Die harsche, bellende Stimme hinter ihm ließ Kydd zusammenfahren. »Aufentern, ihr alten Waschweiber! Legt aus und laßt fallen!« Der Offizier trug schlichtes See-Zeug; nur der verblichene Spitzenbesatz verriet, daß dies der mächtigste Mann an Bord war: ein Vollkapitän der Königlichen Marine, der Kommandant dieser Fregatte.
Die Männer gehorchten sofort. Kydd sah, daß sie eifrig und blitzschnell aufenterten, ganz anders als auf dem Linienschiff, das er kannte, wo sich die Männer schwerfällig und bedächtig bewegt hatten. Manche machten einen Wettkampf daraus, indem sie auf der schwankenden Rah bis zur Nock rasten, um sich dann in einem kühnen Bravourakt seemännischen Könnens auf das Fußpferd fallen zu lassen.
Artemis sprach sofort an. Die gurgelnden Wellen unter ihrem Bug trugen jetzt Schaumkronen; Tauwerk und Blockscheiben knarrten, als Segel für Segel dichtgeholt wurde, und bald stürzte sie sich begierig in die lange atlantische Dünung. Kydd spürte, wie schnell die Fregatte reagierte, und das Herz ging ihm auf. In ihrem Luv waren die schwerfälligen Spieren der Duke William noch immer nicht herumgeschwungen, doch die Fregatte stand schon ungeduldig hinaus auf die funkelnde See, als könne sie es kaum erwarten, alles hinter sich zu lassen.
Der Kommandant drehte sich um und brüllte: »Verholt euch nach achtern, Männer!«
Er stand hinter dem Steuerrad. Da es auf einer Fregatte keine Poop gab, erstreckte sich das Spierendeck vom Schiffsschnabel am Bug in einer anmutigen, ungebrochenen Linie bis zur Heckreling ganz achtern.
Kydd und die anderen nahmen die Beine in die Hand, denn das war Black Jack Powlett, der berühmte Fregattenkapitän, der bereits fünf Prisen unter seinem Namen sicher in englische Häfen gebracht hatte. Daß er etwas Besonderes war, ließ sich nicht übersehen: Da waren der scharfe, durchdringende Blick, der kampflustig vorgebeugte Körper.
Powlett musterte die Männer nachdenklich, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Ihr wollt also allesamt Vollmatrosen sein?« Er warf einen raschen Blick auf den mächtigen Dreidecker, der achteraus schnell verschwand. »Verdammt noch mal, ich glaub' einfach nicht, daß Caldwell nur erstklassige Leute erübrigen kann.« Kühl klang das, doch seine ganze Art verriet Rastlosigkeit, eine angespannte Energie, die auf die Umstehenden auszustrahlen schien. Er strich sich über sein glatt rasiertes, blauschwarzes Kinn, während er versuchte, aus dem unerwarteten Geschenk klug zu werden. »Sie da, Sir!« fauchte er Doud voller Sarkasmus an. »Seien Sie so gut und legen Sie Hand an den Block vom Außenklüverbaum.«
Doud gaffte ihn an, machte dann auf dem Absatz kehrt und lief nach vorne. Sein Befehl lautete, die äußerste Spitze des Bugspriets zu berühren, die achtzig Fuß weit über die See hinausragte.
Powlett zog eine silberne Uhr hervor. »Nun Sie, Sir.« Damit wandte er sich Renzi zu. »Die beiden Leesegelbaumeisen der Fockbramrah!« Sein hektischer Blick erfaßte Kydd, der sofort erstarrte. »Sie werden, wenn's beliebt, den Flaggenknopf vom Großmast berühren.«
Das war der allerhöchste Punkt auf dem ganzen Schiff. Kydd wußte, daß die nächsten Minuten über seinen Stand als Seemann entschieden.
Geschmeidig schwang er sich in die Großmastwanten, zog sich Hand über Hand an den Webleinen hoch, vorbei an den Püttingswanten; höher und höher kletterte er, die Marswanten hinauf, und schonte dabei seine Kräfte noch für das letzte Stück. Im Großbramtopp endeten die Webleinen. Er trat hinaus auf die Dwarssaling und schaute hinab. Höher als jetzt, hundertdreißig Fuß über dem Deck, war er noch nie gewesen. Aber über ihm ging es noch höher hinauf, bis zur Oberbramrah, und darüber weiter zur Mastspitze mit dem Flaggenknopf.
Fest griff er die Bramstengewanten, einzelne, nicht durch Webleinen verbundene Taue. In dieser Höhe schwankte der Mast durch das Stampfen und Rollen des Schiffes heftig; Kydd wurde schwindelerregende siebzig Fuß hin- und hergeschleudert. Er hakte die Füße in das geteerte Tau und zog sich mit den Händen hinauf zur dünnen Oberbramrah, dann weiter zu den Zeisingen des Großoberbram-Backstags. Der Flaggenknopf, eine Rundung am obersten Ende des Masts, war bloß noch wenige Fuß entfernt, aber nun hatte er nur noch die nackte Maststenge vor sich.
Die Oberbramstenge schwankte erschreckend stark, schwang weit durch die Luft, wippte federnd nach und schwang dann ebensoweit wieder zurück. Sie war nur wenige Zoll dick. Er schlang seine Beine fest um das Holz, bevor er umgriff und sich an der Stenge nach oben zog. Hinabzuschauen wagte er nicht; er sah zum Flaggenknopf hinauf, der näher und näher kam, bis er in Reichweite war. Über ihm, hinter der Stenge, klirrte etwas. Als er genau hinsah, entdeckte er eine kräftige Kette, die am Flaggenknopf belegt war: Das war einer dieser neuartigen Blitzableiter. Einer verrückten Eingebung folgend, griff er um, faßte die Kette und zog sich an ihr zum Flaggenknopf hoch. Über der Mastspitze ragte ein dicker Kupferstab einige Fuß in die Luft.
Binnen weniger Sekunden war Kydd oben, vorbei am Flaggenknopf – dann stand er aufrecht auf dem vogelkotverschmierten Masthaupt und umklammerte die Stange des Blitzableiters, so fest er nur konnte, zitternd vor Erschöpfung und vor wilder Freude. Er hob den Arm, zum Zeichen, daß er es geschafft hatte, und warf einen Blick hinab, bevor er sich an den Abstieg machte. Jeder Teil des Schiffes lag jetzt tiefer als er: die Decks, die Masten, die Segel. Nichts hinderte den freien Blick.
Vorsichtig ließ er sich die wenigen Fuß an der Maststenge bis zum Oberbramstag hinab, griff um von der Stenge auf das Stag und glitt Hand über Hand an der Leine hinunter zum Deck.
»Ich muß gestehen, ich bin verblüfft. Was wir hier haben, Mr. Spershott, das sind keine tolpatschigen Landratten«, bemerkte Powlett zu dem schlanken Offizier an seiner Seite.
Es dauerte ein Weilchen, bis Kydd begriff, was hier an dem Mannschaftsdeck so anders war: die gleichen Backschaftstische, die gleichen Halter an der Bordwand für Besteck und Meßgeschirr, doch es fehlten die mächtigen Kanonen, die auf dem Linienschiff, auf dem er früher gefahren war, in regelmäßigen Abständen an beiden Seiten des Decks standen. Auf dem Dreidecker hatte Kydd sich daran gewöhnt, sich zwischen einem Paar gewaltiger Zweiunddreißigpfünder häuslich einzurichten und seine Welt mit Kanonen zu teilen, die Feuer und Pulverqualm spien. Hier dagegen diente das Deck nur einem einzigen Zweck.
Gerade war die mittägliche Rumration ausgegeben worden, überall im Mannschaftsdeck wurde geredet und gelacht. Ein Schiffsjunge hatte den Neuen ihre Messen gezeigt: eine an Steuerbord für die eine Hälfte, eine an Backbord für die andere Hälfte. Verlegen standen alle da.
»Wie ich höre, woll'n sie uns 'n paar anständige Kriegsschiffsfahrer schicken«, sagte ein schmächtiger älterer Mann, der an der Bordwand saß.
Kydd wußte genug über die ungeschriebenen Backschaftssitten, um zu begreifen, daß dieser Mann der Dienstälteste der Messe war. Wie die anderen tat auch er so, als bemerke er die Neuankömmlinge nicht.
Ein gutaussehender, geschniegelter Seemann antwortete: »Solang wie sie nich' von 'nem Linienschiff kommen, soll mir's recht sein. Dickschiffahren is' anders – auf diesem kleinen Kahn is' kein Platz fürs 'rumspazieren.«
Der Ältere schnaubte verächtlich: »Un' wir haben auch nich' die ganze Zeit all diese Flaggen un' Wimpel weh'n. Außerdem darfste auf'm Dickschiff nich' fix sein im Kopp, sonst fault dir das Hirn weg, wenn du wartest, bis der Pott endlich gehalst hat.«
»Muß aber 'n Dickschiff gewesen sein«, erwiderte der andere, »für all die neuen Gepreßten – da müssense nämlich die Luks verschalken, wennse einlaufen, sonst kommen die noch auf Gedanken un' laufen nach Hause.«
Der ältere Mann fuhr zusammen, so als nähme er die Neuen zum ersten Mal wahr. »Na sieh mal an ... Wenn das nich' Royal Billys1 sind! Setzt euch schon hin, Grog kommt gleich.«
Schüchtern rückte Kydd zu einem gut getrimmten, schmächtigen Matrosen auf, der ihm freundlich lächelnd die Hand reichte:
»Wir werden euch wohl an Bord nehmen müssen, weil wir so unterbemannt sind«, sagte der Mann. »Adam – Nathan Adam.«
»Kydd, Tom Kydd«, er errötete vor Freude, denn er wußte gar nicht, was für einen prächtigen Seemann er mittlerweile abgab. Sein dunkles Haar, seine markanten Gesichtszüge paßten gut zu der kurzen blauen Jacke, den weißen Leinenhosen und dem roten Halstuch, das er lässig geknotet über einer blaugestreiften Weste. trug. Sein schwarzer, glänzender Pferdeschwanz war zu einem festen Seemannsknoten hochgebunden, und auf seinem gebräunten, offenen Gesicht lag ein breites Lächeln, das seine weißen Zähne zeigte.
Renzi glitt geschmeidig auf den Platz gegenüber von Kydd. Die Männer um die Back musterten ihn neugierig, denn mit seinen klugen dunklen Augen, denen nichts entging, und einem Gesicht, dessen scharf geschnittene Züge gefährlich und geheimnisvoll wirkten, hob er sich deutlich von den gewöhnlichen Kriegsmatrosen ab. Renzis fast mönchisch kurzes, schwarzes Haar deutete zudem auf eine Selbstdisziplin hin, die dem sorgenfreien Seemann ganz fremd war. Er kam neben einem muskulösen Schwarzen zu sitzen.
Der Mann drehte sich um und begrüßte ihn: »Bin selber nie nich' auf 'nem Linienschiff gefahr'n«, sagte en »Gibt sicher 'ne Menge mehr Platz auf diesen Dickschiffen, was?«
»Weiß schon, wo ich lieber bin«, erwiderte Kydd.
Der Ältere schaltete sich ein. »Haste dein Geschirr dabei?«
Kydd suchte in seinem Seesack herum und zog seinen alten, hölzernen, mit Messing eingefaßten Humpen hervor. Einst hatte er einem Freund und Bordkameraden gehört, der jedoch gestorben war.
»'Tschuldigung wegern dem Rotspon.« Dabei leerte der Mann eine Flasche in den Humpen. »Käpten hat uns das gegeben, statt dem richtigen Zeug.« Er zuckte die Achseln. »Hat letzte Woche 'nem Franzmann tausend Boddeln abgenommen.«
Renzi machte große Augen, griff hastig nach der Flasche und las das Etikett. »Herrgott!« entfuhr es ihm, »ein Haut Brion, premier cru, und noch dazu ein Neunundsiebziger!« Seine angenehm modulierte Stimme, die vornehme Aussprache verblüfften die anderen nicht weniger als seine Worte, doch nahmen sie, wie bei Seeleuten üblich, von dieser kleinen Eigenheit keine Notiz.
»Sieh mal an, dein Kamerad mag also unsern Grog!« stellte der Schwarze zufrieden fest.
Der ältere, ein Mann reiferen Alters, schon mit Falten im Gesicht und einer seltsam sanften Stimme, schlug mit dem Grogbecher auf die Back, so daß er ein bißchen von dem schweren, dunkelroten Wein verschüttete: »Männer, wir haben Zugang bekommen«, verkündete er. Die anderen merkten auf. »Mein Name is' Petit, Elias Petit, un' Nathan kennt ihr ja schon. Drüben der große, rabenschwarze Mohr, den nennen wir Quashee – und wenn ihr mal 'ne anständige Fischpastete essen wollt, is' er euer Mann.«
Kydd nickte. »Tom Kydd un' Nicholas Renzi.« Er zeigte auf Renzi, bemerkte, daß Renzi einige Neugier erregte, fuhr aber fort: »Und das is' Pinto, äh ...«
»Fernando da Mesouta Pinto, stets zu Diensten«, unterbrach ihn der Südländer elegant, ohne eine Miene zu verziehen.
»Pinto is' Portugiese«, sagte Kydd, »und Renzi ein enger Freund von mir«, setzte er betont hinzu.
Ein junger, strohblonder Bursche brachte zwei Schüsseln mit Essen, die er unsanft auf die Back stellte.
»Dank' dir, Luke«, sagte Petit. Der Junge drehte ein Holzfaß um, setzte sich darauf und musterte die Neuen mit der unverhohlenen Neugier der Jugend. Petit lüpfte den Deckel von einer Holzschüssel. »Is' armseliger Fraß, leider«, bemerkte er, als müsse er sich dafür entschuldigen, und teilte das Essen aus.
Kydd wollte seinen Augen nicht trauen: richtige Porzellanteller statt der Vierecke aus dunklem Holz, dazu ein Zinnlöffel und sogar eine Gabel! Und das Essen erst – nicht nur, daß der Haferbrei mit Kräutern gewürzt war; die Fleischeinlage bestand aus Schweinsfüßen mit richtigen Fleischbrocken daran. Ein echtes Festessen!
Petit musterte Kydd neugierig. »Unser Fraß schmeckt dir also auch«, stellte er fest.
Kydd dachte an die eine Kombüse auf dem Linienschiff, die achthundert Mann versorgen mußte. Man konnte alles haben, was man wollte, solange es in den riesigen Kupferkesseln gekocht werden konnte. »Aye, Sir!« sagte er. »Auf der Royal Billy hatten wir 'n Spruch, den einer immer aufsagen mußte, bevor wir uns über das Pökelfleisch hergemacht haben.« Er setzte ein andachtsvolles Gesicht auf.
»Mein alter Gaul, was machst du hier?Du trugst mich lange, braves Tier!Jetzt bist du nicht mehr zu gebrauchen, Da tun sie dich in Lake tauchen, Sie pökeln dich in Fässern ein, Und fressen dich, du armes Schwein!Sie nagen deine Knochen ab, Der Rest versinkt im Seemannsgrab!«
Lachend machten sich alle über das Essen her. Kydd warf einen kurzen Blick quer durch das Deck in die gegenüberliegende Messe. Offenbar genossen auch Doggo, Wong und die anderen, was ihnen das Schicksal beschert hatte, und Stirks bedächtiges Zwinkern belebte die Starre seines wie aus Eiche geschnitzten Gesichts.
»Hab' gehört, euer Black Jack ist 'n ganz harter Hund«, brummelte Kydd mit vollem Mund.
»Eigentlich nich'«, sagte Petit. »Die Katze hat seit fünf Wochen oder so kein Tageslicht mehr geseh'n. Der Käpten weiß, daß wir's sind, wo an den Stücken steh'n, wenn's zum Kampf kommt, also behandelt er uns anständig, jawohl.«
»Und was is' mit dem Ersten?« fragte Kydd. Dabei klopfte er gedankenlos ein Stück Schiffszwieback auf der Back aus. Zu seiner Überraschung krochen keine schwarzköpfigen Maden hervor.
»Spershott? Sagt nich' viel. Hält sich immer hinterm Käpten«, sagte Petit verächtlich. »Parry, auf den mußte aufpassen. Der Zweite. Denkt, er kann Eindruck schinden, indem er Rowley kleinmacht, den Dritten – is' wie Teufel gegen Beelzebub, un' das den ganzen verfluchten Tag lang.«
»Un' Neville«, soufflierte Quashee.
»Un' Neville«, wiederholte Petit. »So 'ne Art Vierter, aber zusätzlich an Bord – hat uns der Admiral aufgedrückt, weil er ihm 'nen Batzen Prisengeld zuschustern will, denk' ich.« Er grunzte abfällig und setzte hinzu: »Is' aber 'n anständiger Kerl, das muß ich sagen.«
Kydd nahm noch einen Schluck aus seinem Humpen. Der Wein war süffig und vollmundig, doch Adam schien ihn nicht zu mögen. »Nich' dein Geschmack, Nathan?« fragte Kydd freundlich.
Der Mann antwortete so verbindlich wie zuvor: »Christus hat auch nicht getrunken.«
»Is' 'ne Blüse2.« Petit fuhr sich über den Mund. »Aber mit uns wagt er's nich', den Prediger raushängen zu lassen.«
Kydd nickte. Mit Blick auf Adam fuhr er lächelnd fort: »Aye, aber Christus hat dafür gesorgt, daß die Hochzeit schön feucht blieb, hab' ich recht?«
Adam sah ihn unverwandt an und nippte an seinem Wasser.
»Wohin steuern wir, was glaubt ihr?« wollte Renzi wissen.
»Wo immer 'n Franzmann noch schwimmt.« Quashee lachte leise vor sich hin. Er äffte einen Prisenagenten nach, der widerwillig die Guineen auf den Tisch zählt. Der Anblick dieses massigen Mannes bei seiner Pantomime war so lächerlich, daß die Männer hilflos vor Lachen unter die Back fielen.
Petit klopfte ihm auf die Schulter.
»Recht haste, du schwarzer Hundesohn. Was bedeutet, wir überfallen Kauffahrer, un' das wiederum heißt, daß alles, wo auf See steht, uns zum Gruß die Marssegel ausschütteln muß – un' wir haben die erste Wahl.«
Der schrille Pfiff der Bootsmannsmaatenpfeife am Backsniedergang beendete das gesellige Beisammensein. Widerwillig standen die Seeleute auf.
Wenn Artemis auf See war, wurde jeden Abend nach der Musterung eine Gefechtsübung gefahren. Um vier Glasen in der zweiten Hundewache machte die gesamte Besatzung das Schiff klar zum Gefecht, während Trommler und Pfeifer das mitreißende Hearts of Oak anstimmten.
Leutnant Rowley, der das Kommando auf dem Kanonendeck führte, stand unbeweglich am Backsniedergang. Kydd bemerkte die weißen Rüschen, die aus den Ärmeln hervorlugten, und das üppige Haar, das sorgfältig nach der neuesten romantischen Mode frisiert war. Seine zynischen Manierismen verliehen ihm etwas Hochnäsiges, was durch die tadellos geschnittene Uniform noch verstärkt wurde. Doch seine Befehle waren klar und deutlich: »Geschützdrill an den großen Kanonen – Stückführer, feuern nach eigenem Ermessen!«
Stirk ließ seine Stückmannschaft zur Musterung antreten. Aufgrund seiner Borderfahrung war er zum Stückführer befördert worden, und in seiner Mannschaft standen neben Kydd und Renzi drei weitere Royal Billys: Wong, Pinto und Doggo.
Damit stammten nur zwei seiner Leute aus der ursprünglichen Besatzung der Fregatte – Gully, ein stark behaarter Matrose mit Vollmondgesicht, sowie Colton, der Zweite Stückführer, ein gerissener, aufbrausender Mann.
Der Zwölfpfünder ging ihnen nur bis zum Bauch, während die großen Zweiunddreißigpfünder im unteren Kanonendeck der Duke William bis zur Brust gereicht hatten. Ansonsten unterschieden die Kanonen sich kaum; der einzige wirkliche Unterschied lag, wie Kydd erkannte, in der Größe der jeweiligen Stückmannschaft. Es brauchte bis zu zwanzig Mann, die großen Kanonen zu bedienen. Hier waren es dagegen nur drei, dazu der Stückführer, sein Stellvertreter und der Pulverjunge.
Stirk nahm die Herausforderung an. »Gut: anderes Schiff, anderer Spleiß. Dieser Kahn hat's mit den Nummern, also machen wir 's folgendermaßen.« Er musterte seine Männer. »Doggo, du bis' Nummer eins: Pfropf un' Kugel laden. Kydd, Nummer zwei, du wischst aus und rammst fest. Renzi, Nummer drei, du kommst klar mit Pfropf un' Kugel für Nummer eins. Gully, nich' wahr? Nummer vier, am Seittakel, wenn ich bitten darf, Mann – mit Pinto un' Wong, Nummer fünf und sechs, am Blocktakel. Ach ja – fünf un' sechs richten mit der Handspake, un' jeder faßt mit an, wenn wir das Stück an den Takelfallen ausrennen!«
»Und ich, Mr. Stirk?« rief der schlaksige Junge von den Lukgrätings mittschiffs herüber.
»Un' Mr. Luke, der erweist uns die Ehre mit dem Pulver«, fügte er mit ernster Miene hinzu.
Er trat zurück, stieß gegen Colton. Ein kurzer Moment der Spannung, bis Colton Stirks Blick nicht mehr standhalten konnte. »Un' der zweite Stückführer holt das Blocktakel über.«
Den Ablauf des Ladens und Schießens zu drillen war nicht weiter schwierig: Das Stück wurde ausgerannt, abgefeuert und rollte durch den Rückschlag Innenbords zurück; dann wurde das Rohr ausgewischt, eine Kartusche samt Wergpfropf hineingerammt, die Kugel ins Rohr eingeführt, darauf noch ein Pfropf, beides festgerammt und die Kanone für den nächsten Schuß wieder ausgerannt. Was zählte, war die Zusammenarbeit aller in der Mannschaft, denn nicht nur war es gefährlich, Pulver offen in der Nähe einer feuernden Kanone zu haben – die ganze Wirkung eines Schusses hing davon ab, daß alle wußten, was sie zu tun hatten, und bei ihrer Arbeit den anderen nicht im Weg waren.
»Das erste Mal langsam, Männer«, befahl Stirk.
Kydd hatte nie zuvor den Ladestock handhaben müssen. Verwirrend war, daß sich Ansetzer und Auswischer an verschiedenen Enden derselben dicken Holzstange befanden. Er legte den Stock mit dem Auswischer innenbords ab und zog mit den anderen am Seittakel. Sie rannten das Stück aus: eher ein mächtiges Rattern als das tiefe Baßrumpeln der drei Tonnen schweren großen Kanonen.
»Stück hat gefeuert«, bemerkte Stirk lakonisch.
Er sah Colton bedeutungsvoll an, doch Wong und Pinto drängten sich vorbei und pullten an dem Blocktakel am Verschluß der Kanone, um den Rückstoß nachzuahmen. Kydd hatte den Auswischer schon in der Pütz getränkt, hob nun das tropfnasse Schaffell hoch, steckte das Ansetzerende durch die Stückpforte, um mehr Platz zu haben, und schob den Auswischer in die Mündung.
Gegenüber wartete Renzi mit einer imaginären »Kartusche« sowie einem »Wergpfropf«. Doggo tat so, als nehme er sie entgegen und stopfe sie in die Mündung. Sofort rammte Kydd das becherartige Ende des Ansetzers tief ins Rohr hinab; Doggo nahm die »Kugel« sowie einen weiteren »Pfropf«, stopfte sie in das Maul des Stückes, dann führte Kydd erneut den Ansetzer ein, und die gesamte Stückmannschaft pullte gemeinsam an den Takelfalls, um die Kanone wieder auszurennen. Stirk schüttete das Zündpulver auf, richtete das Stück – damit war der Durchgang beendet.
»Jetz' nochmal, aber schnell!« knurrte er.
Sie wiederholten das Ganze, doch diesmal stöhnte Stirk bald nur noch entnervt. Kydd in seinem Übereifer rammte seinen Ansetzer sofort nach Doggos Kartusche ins Rohr, bevor dieser den Wergpfropf hinterherschieben konnte, und Wong, der an die mächtigen, völlig unbeweglichen größeren Stücke gewöhnt war, stürzte am Seittakel, worauf die Männer auf seiner Seite allesamt fluchend zu Boden gingen. In diesem Augenblick ertönte ein schriller Pfiff aus der Bootsmannsmaatenpfeife.
»Ruhe im Deck!«
Rowley eilte nach achtern. Der Kommandant und sein Erster Offizier betraten das Deck. Rowley zog seinen Hut. Die Männer erstarrten.
»Mr. Rowley, wo, bitte, sind unsere Royal Billys?« fragte Powlett.
»Hier entlang, Sir«, antwortete Rowley, zeigte höflich nach vorn und ging voran.
Kydd sah die Offiziere kommen: Rowley war klein genug, um unter Deck aufrecht stehen zu können; er ging vorsichtig, als müsse er aufpassen, wohin er trat. Powlett dagegen schritt leicht gebückt wie ein hellwacher Löwe. Spershott folgte ihnen auf dem Fuße.
»Wir sin' von der Duke William, Sir. Tobias Stirk, Stückführer.«
Kydd spürte die kalte Wildheit in Powletts Blick. Unwillkürlich nahm er Haltung an.
»Haben Ihre Leute das Zeug dazu, auf einer Fregatte zu dienen, Stirk?« ranzte Powlett ihn an.
Stirk zögerte.
»Na gut, wir werden ja sehen, was sie können.« Powlett zog seine Uhr hervor, drehte sich zu dem nächsten Zwölfpfünder um und sagte: »Symonds!«
»Aye, Sir?« kam die vorsichtige Antwort des Stückführers.
»Sie und die Royal Billys drillen gemeinsam!« Er wandte sich wieder Stirk zu. »Stück ausrennen. Auf mein Kommando!«
Stirk spuckte in die Hände und warf seinen Männern einen finsteren Blick zu.
Powlett sah auf die Uhr: »Los!«
Sein Arm senkte sich, und die Männer warfen sich ins Zeug.
Mit Wongs gewaltiger Kraft am Blocktakel wurde der »Rückstoß« rasch bewältigt. Aufgeregt wischte Kydd das Rohr aus, zog das Schaffellende heraus, und schon stand Doggo mit der Kartusche bereit. Kydd wollte den Stock schon wieder einführen, als Doggo wütend zischte: »Der Ansetzer, du Vollidiot!«
Kydd hatte einen dummen Fehler gemacht: Er hatte die Stange nicht umgedreht; das nasse Schaffell des Auswischers zeigte immer noch innenbords, der Ansetzer ragte in aller Unschuld durch die Stückpforte nach draußen. Er versuchte, die Stange außerhalb der Stückpforte umzudrehen, verhaspelte sich aber, sie fiel ihm aus den Händen, schlug klappernd gegen die Bordwand und versank achteraus im Kielwasser.
Symonds und seine Mannschaft lachten sie schallend aus.
Spershott eilte entrüstet herbei. »Das ist Eigentum der Krone! Wir werden dir das von deinem Sold abziehen, Bursche!«
Powlett hob die Hand. »Nein. Die Royal Billys machen weiter mit dem Drill, der Rest sichert die Stücke und kann wegtreten.« Mit einem einzigen Blick auf den vor Wut kochenden Stirk ging er zum Niedergang und begab sich zurück an Deck.
Die nun dienstfreien Besatzungsmitglieder der Artemis versammelten sich um die Kanone, denn diese Unterhaltung wollten sie sich nicht entgehen lassen. Der Rest der Hundewache verging damit, daß Stirk, hochrot im Gesicht, seine Leute gnadenlos voranpeitschte, begleitet vom grölenden Gelächter der anderen.
Die folgenden Tage waren nicht einfach für die Männer von der Duke William. Auf einer Fregatte wehte ein anderer Wind als auf einem Linienschiff; man mußte schneller auf den Beinen sein, und es brauchte einiges Geschick, auf eine dieser viel dünneren Rahen hinauszubalancieren und wieder zurückzulaufen. Außerdem war sogar Stirk überrascht, wie schnell das Schiff auf das Ruder ansprach. Es war Seemannschaft auf einer anderen, höheren Ebene, die den Männern mehr abverlangte, aber sie paßten sich rasch an.
Seit sechs Wochen fuhr Kydd nun auf der Artemis, und mittlerweile wußte er, wie der Hase lief. Die Mittelwache zog sich zäh dahin. Als Ausguckwache konnte Kydd sich nicht gemütlich die Zeit mit Renzi vertreiben, sondern mußte eine Stunde lang angestrengt in die Nacht hinausstarren. Kydd zog seinen Griego enger um sich. Der grobe, ungeschorene Wollstoff hielt seinen Leib warm und den scharfen Nachtwind ab. Der launische Mond verbarg sich zumeist hinter Wolken, und dann konnte er in der undurchdringlichen Dunkelheit nicht einmal den Rudergänger ausmachen, der ganz in der Nähe stand. Kydd blickte hinaus auf die dahinziehenden Wogen und kämpfte gegen die Müdigkeit an.
Da: Weit draußen auf der nächtlichen See fiel ihm etwas auf, etwas Fahles, Helles, das am Rande seines Blickfelds kurz aufschien, doch sogleich wieder verschwand. Angestrengt starrte er hinüber, fand es aber nicht mehr. Doch, da war es wieder! Ein bleicher, unbeweglicher Fleck, der über der Kimm auftauchte und wieder verschwand.
»Meldung an den wachhabenden Offizier, Sir!« rief Kydd.
Jemand antwortete von der anderen Seite des Decks, dann stand eine dunkle Gestalt neben ihm.
»Kydd, Sir – achterner Backbordausguck. Hab' weit draußen in Lee 'was weiß aufleuchten seh'n.«
»Welche Richtung?« kam Parrys harte Stimme.
Das fragliche Objekt tat ihnen den Gefallen und schien ungefähr dort, wohin Kydd gezeigt hatte, einige Sekunden lang bläßlich auf. Dann verschwand es wieder.
Parry suchte sofort mit dem Nachtglas danach. »Verdammt ... Da, ich hab's!« Er setzte das Glas ab. »Meldung an den Kommandanten: Meine Empfehlung – Schiff in Sicht.«
Bei einem Mann wie Powlett konnte es nur eine Antwort geben: Sie würden das Schiff aufbringen und auf ihr Glück vertrauen.
In der kurzen Zeit, bevor Powlett in aller Eile das Deck betrat, hatte Artemis umgebraßt und stand bereits auf das fremde Schiff zu.
»Wenn Sie bitte die Marssegel einholen würden, Mr. Parry. Wir wollen die da drüben doch nicht unnötig beunruhigen.«
Der fahle Fleck war nun stets über der Kimm sichtbar.
»Wir halten uns in ihrem Luv. Bis zum Morgengrauen werden wir auf und ab stehen.«
Eine Stunde später war klar, daß der Fremde sie gesichtet hatte: Er änderte Kurs und hielt auf sie zu. Artemis folgte entsprechend, um den Luvvorteil zu halten. Der Fremde wurde das Spiel bald leid, fiel ab vom Wind, und die beiden Schiffe verbrachten die verbliebenen dunklen Stunden vor Tagesanbruch damit, unter losen Segeln auf Parallelkurs zu laufen.
Der erregende Trommelwirbel erstarb, jeder Mann stand auf seinem Posten, alle warteten, daß der Morgen graute. Artemis begrüßte den neuen Tag stets mit ausgerannten Kanonen und einer Musterung auf Gefechtsstation – ihr würde es nie passieren, daß sich im ersten Licht ein feindliches Schiff längsseits liegend zeigte, bereit, sie aus dem Wasser zu pusten.
Bei Tagesanbruch war das fremde Segel immer noch da, fünf Seemeilen im Lee. Träge malte die Sommersonne die Farben des Tages, hellte die dunkle See zu einem lebhaften Kobaltblau, den lila Himmel zu einem makellosen Himmelblau auf, vor dem sich im Süden hohe, schneeweiße Wolken türmten. Sie offenbarte außerdem die schlanken Linien einer schwarzgelb gestrichenen Fregatte, genauso groß wie Artemis, die gerade die Segel kürzte.
Artemis nahm Kurs auf das fremde Schiff. Jedes Glas an Bord war darauf gerichtet.
Auf dem Achterdeck stieg die Spannung.
»Sie hißt ihr Geheimsignal nicht, verdammt noch mal!« knurrte Powlett.
Sollte es sich um ein Schiff der Königlichen Marine handeln, so mußten die Kommandanten wegen des Saluts feststellen, wer von beiden dienstälter war. Andererseits konnte es durchaus sein, daß der Fremde die dwars auf ihn zustoßende Fregatte, die ihm den Bug zeigte, für einen Franzosen hielt und sie nicht verschrecken wollte, indem er zu früh seine Farben setzte.
Der Segelmeister, Mr. Prewse, nahm seinen Hut ab und kratzte seinen spärlich behaarten Kopf. »Sieht mir gar nicht nach 'nem Schiff des Königs aus.«
Der Bootsmann nahm ein Fernrohr zur Hand und musterte den Fremden eingehend. »Könnte 'n Schwede sein, aber ich würd' wetten, sie ist 'n Franzmann.«
Powlett fragte blitzschnell zurück: »Wieso das?«
»Weil nämlich, Sir, erst'mal hat sie 'ne gerade Gillung, dann is' ihr Sprung an Deck viel flacher, un' wie Sie seh'n können, Sir, geht bei ihr die Backsreling nur bis zum Kattdavit – sie is' französisch, das steht mal fest.«
»Danke, Mr. Merrydew«, sagte Powlett leise.
»Gestatten, Sir.« Parry wartete geduldig vor Powlett, steif und hölzern wie immer.
»Ja, Mr. Parry?«
Der Zweite Offizier schob einen Seemann vor.
»Was ist, Boyden?«
»Sir, das dort drüben, das is' die Si-to-jäng«, verkündete er entschieden.
»Die was?«
»Die Si-to-jäng. Hab' sie in Toulong geseh'n. Wir lagen längsseits, übernahmen Wein, Sir – war'n die letzten Tage vorm Krieg, un' wie sie mit der Tide 'rausging, nahm sie 'n Stück von uns mit.«
Powlett erstarrte. »Die Citoyenne meinen Sie. Sind Sie sicher? Was trägt sie?«
»Sechsunddreißig lange Zwölfer, Sechser auf dem Achterdeck, mehr weiß ich nich' mehr. Ach ja – ist 'n großer Pott mit reichlich Besatzung ...«
Powlett nickte. Anders als die weltweit operierenden britischen Fregatten konnten französische Schiffe jederzeit die Vorräte ergänzen, deshalb waren sie bis an das Schanzkleid mit Kriegsmatrosen gefüllt. Dieser Franzmann war außerdem selbstbewußt und nicht auf den Kopf gefallen; wahrscheinlich hatte er noch keine Männer an Prisen verloren, die bemannt werden mußten.
»Eins noch, Sir.«
»Ja?«
»Ihr Käpten is' 'n richtiger Hunne, Sir, 'n ganz Scharfer – verzeih'n Sie meine Sprache. Unser Zweiter hat gehört, wie er gesagt hat, wenn die neue Besatzung nich' ganz schnell auf Vordermann kommt, dann würd' er sie ruckzuck auf die Galeeren schicken – un' das is' mehr wie sechs Monate her.«
Leutnant Neville räusperte sich und bemerkte beiläufig: »Dann können wir uns ja auf eine herzliche Begrüßung gefaßt machen.«
Powlett lächelte nicht einmal.
»Eher wohl auf die Augen der Welt, denk' ich mit« Rowley hatte zur unpassenden Zeit laut gedacht. Nun aber ignorierte er Powletts finstere Miene und spann den Faden weiter: »Zum ersten Mal in diesem Krieg haben wir zwei gleich starke Schiffe im Gefecht. Den Ausschlag wird also einzig und allein der Kampfgeist der beiden Nationen geben. Wird der heißblütige Eifer der Revolutionäre über die Herren der Meere triumphieren? Oder wird das Recht sich durchsetzen? Es wird ein ritterliches Duell geben, dessen Ausgang für unser Land, so denke ich, mehr bedeuten wird als eine einsame Schlacht weit draußen auf dem Meer.«
Party fuhr Rowley an: »Zweifeln Sie etwa am Ausgang des Treffens, Sir?«
»Ich wäre ein Narr, wenn ich nicht dächte, daß es einen erbitterten Kampf geben wird – aber die Heimat wird es hart ankommen, sollte uns Fortuna den Sieg versagen.«
Powlett löste sich aus der Gruppe. »Mr. Parry, einen Schuß vor den Bug, und zeigen Sie denen, wer wir sind.«
An der Luvseite krachte eine Kanone. Über den Köpfen wurde die gewaltige Kriegsflagge gehißt und wehte stolz in der steifen Brise.
Powlett fletschte die Zähne. »Splitternetze riggen, Mr. Party. Und Brustwehren in die Toppen.« Mit einem Blick auf die schwere Fregatte, die vor ihnen die Dünung abritt, fuhr er fort: »Heute müssen wir uns unsere Lorbeeren richtig verdienen.«
Kydd und Stirk beugten sich aus der Stückpforte und beobachteten das vor ihnen segelnde Schiff.
»Das is' 'n Froschfresser, un' wir laden ihn zum Tee.« Stirk zog seinen Kopf zurück. »Wie's aussieht, werden wir mächtig viel Spaß haben, denn der Pott schmeißt wenigstens soviel Eisen wie wir.«
Kydd warf einen Blick auf den Feind. Die Franzosen eilten an die Brassen, die Fregatte änderte den Kurs. Als sie vom Wind abfiel, wirkte sie perspektivisch verkürzt, denn sie bot das reich verzierte Heck. Mit zunehmender Fahrt stand sie davon. Kydd konnte es nicht glauben. »Sie läuft weg!«
Hinter ihm versetzte Renzi kühl: »Und genau das sollte sie natürlich auch, mein Lieber. Ihr Kommandant kennt seine Aufgabe: Er soll über unsere Kauffahrer herfallen, unseren Handel stören – einen größeren Schaden kann er uns nicht zufügen. Beide Schiffe sind gleich stark. Wenn er sich stellt, kann er bestenfalls eine blutige Schlacht erwarten. Sein Schiff wird Schaden nehmen, und er kann sich nicht mehr seiner eigentlichen Aufgabe widmen. Der Mann muß aber verhindern, daß sein Schiff Schaden nimmt.«
Stirk sah ihn verächtlich an. »Sein Schiff? Pah, seine Ehre nimmt Schaden, wenn er Fersengeld gibt, und wenn er auch 'n Franzmann is'!«
Renzi zuckte die Achseln.
»Alle Mann klarmachen zum Segelsetzen!« Powlett wollte die Oberbramsegel sehen.
Die Citoyenne steuerte einen Kurs, bei dem sie mit raumem Wind segeln konnte, doch Artemis galt nicht umsonst als Windhund. Straff und trimm schoß sie dahin.
Kydd schloß sich den anderen an, die vom Vordeck aus die Jagd verfolgten. Schäumende Gischt stob vom Steven empor, der die Wogen teilte; der Wind sang im Rigg, daß es eine Lust war. Das Wetter war genau richtig für Artemis, und sie holte Kabel für Kabel auf. Der Franzose segelte einige wenige Meilen vor ihr unter dem Wind.
Ohne jede Vorwarnung drehte die Citoyenne auf sie zu, ging so dicht an den Wind, wie sie konnte. Artemis folgte sofort, hielt ihre Luvposition, und die beiden Schiffe jagten versetzt über die Wellen. Powlett ließ sofort Bulinen an den Luvlieks anschlagen, um die vorderen Kanten der Segel so weit wie möglich nach vorne zu ziehen und aus jedem Zoll Leinwand das meiste herauszuholen.
»Besatzung auf Gefechtsstation!«
Kydd lief den Backsniedergang hinunter, trat mit klopfendem Herzen an seine Kanone, riß den Ladestock aus seinen Klampen unter der Decke und trat zurück, während Stirk das Gerät prüfte.
Renzi wirkte ruhig. Er lockerte seine Schultern, andere schlugen ihre Halstücher um und banden sie sich über die Ohren. Die meisten entkleideten sich bis zur Taille; einige prüften auf dem nassen, sandbestreuten Deck, ob sie barfuß besseren Halt hatten.
Stirk machte viel Aufhebens davon, Luke die Ohrenschützer umzubinden. Der Junge stand mit weit aufgerissenen Augen auf der Gräting des Niedergangsluks. Kydd schloß aus Stirks leisem Gemurmel, daß er tat, was er konnte, um dem Jungspund die Furcht zu nehmen. Er fragte sich, was er wohl unter solchen Umständen sagen könnte. Das Kanonendeck kam langsam zur Ruhe; die Stücke waren schon lange ausgerannt, bereit für die erste Breitseite. Stirk wartete geduldig am Verschlußblock, die Abzugsleine aufgerollt in der Hand.
Nach den langen Stunden des Drills war Kydd seiner Aufgabe bestens gewachsen, aber nun wurde ihm eiskalt bewußt, daß dies kein Übungsschießen war. Er erinnerte sich an seine erste Feindberührung, doch das war auf einem mächtigen Linienschiff gewesen – er hatte Blut und Leichen gesehen, aber es hatte sich um ein kurzes, brutales Treffen gehandelt. Nun fragte er sich, wie er auf einem viel kleineren Schiff Rahnock an Rahnock seinen Mann stehen würde. Erschauernd sah er sich um: Doggo lehnte vorne an der Kanonenmündung, auf seiner Gefechtsstation, beugte sich aus der Stückpforte und schaute unverwandt nach vorn. Renzi stand mit verschränkten Armen da, die Andeutung eines Lächelns auf den Lippen. Auf der Kiellinie mitten im Deck wartete Luke mit der Kartusche in den Händen, den Blick ängstlich auf Stirk gerichtet. Kydd ahnte, daß er mehr Angst davor hatte, seinen Helden zu enttäuschen, als versehrt oder getötet zu werden.
Es war merkwürdig ruhig im Kanonendeck. In der Stille klangen die gelegentlichen Schiffsgeräusche übermäßig laut, und da sie so dicht am Wind segelten, gab das straff gespannte Tauwerk einen schönen, hohen, sirrenden Ton von sich. Kydd wurde der Mund trocken. Er ging zu dem Wasserfaß mitten im Deck und trank eine Kelle voll Essigwasser.
Weil Artemis nicht mit der vollen Sollstärke fuhr, konnte sie im Gefecht nur die Stücke auf einer Seite bemannen. Allerdings war das bei einem einzelnen Gegner kein Nachteil. Rowley schlenderte mit der Nonchalance eines Londoner Dandys vorne im Kanonendeck auf und ab. Sein Gefechtszeug war deutlich schlichter als seine gewöhnliche Uniform, doch Kydd bemerkte den Spitzenbesatz, der unter den Ärmeln seines Rockes hervorlugte, und die golden schimmernden Knöpfe. Sein Degen dagegen wirkte eindeutig praktisch und kriegstauglich.
»Was zum Teufel soll das?« rief Doggo.
Alle stürzten zur Stückpforte.
Die Citoyenne hatte die Segel gekürzt und verlor an Fahrt. Vor ihren Augen fiel sie vom Wind ab, so daß sie nun mit achterlichem Wind bequemer dahinsegelte, und glitt kurz darauf nur unter Marssegeln ruhig dahin. Sie war bereit, ihren hartnäckigen Verfolger anzunehmen.
»Nein. Sie warten auf meinen Befehl!« Powletts Brüllen galt Parry, der seinen Degen gezogen hatte und wie ein wildes Tier im Käfig auf und ab lief. Artemis hielt weiter auf den Feind zu, die Entfernung schrumpfte nun schnell. »Mr. Prewse, lassen Sie die Segel kürzen. Nur Marssegel bitte. Und legen Sie mich auf Pistolenschußweite längsseits von ihr«, befahl er.
Die großen Untersegel wurden unter den Rahen aufgegeit. Die Seeleute arbeiteten fieberhaft, denn sie wollten nichts von den aufregenden Ereignissen verpassen, die ihnen bevorstanden. Artemis glitt nur noch langsam voran.
Näher und näher kamen sie der Fregatte.
»Zum Teufel, warum versucht der Franzmann es nich' mit 'ner Breitseite durch den Bug?« brummte Merrydew.
Während nämlich Artemis auf die Citoyenne zuhielt, um sich neben sie zu legen, bot sie dem Feind notwendigerweise den Bug. In diesen Minuten würde selbst eine einzige Kugel, die das Schiff von vorn bis achtern durchschlug, schlimmen Schaden anrichten, eine Kanone nach der anderen treffen und unaufhaltsam eine blutige Bahn der Vernichtung durch das Deck ziehen, die Tote und zermalmte Glieder hinterließ.
Doch der Franzose feuerte nicht. In völliger Stille glitt Artemis auf die feindliche Fregatte zu. Die eigene Breitseite hielt sie gerade noch zurück, bereit, jeden Moment zu feuern. Parry sah hinüber zu Powlett, der breitbeinig auf dem Achterdeck stand und die Citoyenne nicht aus den Augen ließ. Beide Schiffe liefen nun Parallelkurs.
»Erst auf mein Zeichen!« fauchte Powlett.
Mit nicht mehr als zwei Knoten hatte die französische Fregatte gerade noch genug Ruderfahrt im Schiff. Die Decks wimmelten von Männern. Auf dem Achterdeck war die Gruppe der Offiziere klar zu erkennen. Drohend ragten die Mäuler der Kanonen aus den offenen Stückpforten, bereit zum vernichtenden Schlag. Aber immer noch schwiegen sie.
»Da, ihr Kommandant!« flüsterte Parry.
Der Mann in Blau und Gold stand stolz und aufrecht da. Er hob den Arm, zog seinen Hut und verbeugte sich formvollendet.
»Mein Gott!« entfuhr es Parry.
»Halten Sie den Mund!« bellte Powlett. Er zog seinerseits den Hut mit einer großen Geste und machte einen eleganten Diener, dann reckte er sich gebieterisch zur vollen Höhe empor. »Lang lebe Seine Majestät König Georg!« brüllte er. »Ein Hurra für den König!«
Verblüfft zogen die Offiziere die Hüte, während überall an Bord unbändiger Jubel erklang.
Gegenüber wartete der französische Kommandant geduldig, bis der Lärm verklungen war. Die beiden Schiffe segelten nun gemächlich eine Kabellänge entfernt auf Parallelkurs. Der Franzose drehte sich zu einem Mann aus einer Stückmannschaft um, der neben ihm stand, nahm dessen Mütze und hielt sie in die Höhe: eine Jakobinermütze, das Symbol der Freiheit. »Vive la République!« Selbst über die Entfernung war die Begeisterung in seiner Stimme nicht zu überhören.
Ein Sturm heiseren Gebrülls brach los. Der Kommandant preßte die Mütze an seine Brust, dann drückte er sie einem Seemann in die Hand. Unter dem Jubel der Besatzung enterte der Matrose über die Großwanten auf und nagelte sie an die Mastspitze.
Powlett stand kerzengerade. »Genug von diesem Unsinn«, schnaubte er und setzte den Hut wieder auf.
Das war das Zeichen. Nach einer winzigen Pause hämmerte die erste Breitseite der Artemis mit Donnergebrüll in das feindliche Schiff und füllte den Raum zwischen den beiden Fregatten sofort mit beißenden Schwaden von Pulverqualm.
Das ohrenbetäubende, nervenzerfetzende Krachen der ersten englischen Breitseite war kaum verklungen, der Qualm waberte durch das Kanonendeck, als die Citoyenne antwortete. Die Kugeln schlugen in die Bordwand und trugen Tod und Zerstörung in die Decks der Artemis.
»Ladet, ihr Scheißkerle!« schrie Stirk.
Die Stückmannschaft schuftete wie besessen.
Kydd hatte keine Zeit, sich umzuschauen, woher das schreckliche Kreischen nicht fern von ihm kam, keine Zeit zu überlegen, was die Ursache für das schwere Rattern über ihren Köpfen war oder warum die Kanone neben ihm nicht feuerte. Durch die Stückpforte war vom Feind nichts zu erkennen, er blieb unter der doppelten Decke der Pulverqualmschwaden verborgen.
Er führte seinen tropfnassen Auswischer mit einer Mischung aus Angst und Wut, stieß ihn tief hinab in das noch rauchende Maul des Zwölfpfünders – ein paar Drehungen nach links, dann wieder heraus, ein paar Drehungen nach rechts. Doggo stand schon bereit, die tödliche graue Kartusche samt Pfropf in das Rohr einzuführen, Kydd drehte den Stock um und rammte die Ladung mit dem Ansetzerende fest. Am anderen Ende der Kanone beugte sich Stirk über den Verschlußblock, den Daumen auf dem Zündloch, um zu spüren, wann die Kartusche richtig saß – ihre Blicke trafen sich, doch Stirk sah durch ihn hindurch.
Dann folgte die Kugel: Doggo legte sie ein und sicherte sie mit einem letzten Pfropf. Kydd führte den Ansetzer kraftvoll und entschlossen. Wenn sie noch eine Breitseite abfeuern konnten, bevor der Feind antwortete, verdoppelten sie damit die Feuerkraft ihrer Fregatte.
»Ausrennen!« rief Stirk heiser.
Das Stück brüllte auf, schoß innenbords.
Kydd sprang wieder hinzu, und alles begann von vorn. Bei dieser Arbeit mußte er jeden Handgriff mit den Bewegungen der anderen abstimmen, da blieb keine Zeit für Angst.
Die zweite donnernde Breitseite der Citoyenne:eine lange Reihe schrecklicher Hammerschläge statt der gehäuften, gleichzeitigen Einschläge der ersten Salve. Kydd erstarrte, seine Sinne waren wie betäubt. Zu seiner Linken sah er Gully mit einem erstickten Schrei in die Knie gehen. Im rauchverhangenen Halbdunkel war die Ursache kaum zu erkennen, doch der dunkle Fleck, der sich unter ihm ausbreitete, war eindeutig. Gully fiel auf die Seite, griff an die Innenseite seines Oberschenkels. Kydd bemerkte den gut einen Fuß langen Holzsplitter, der von einer umherirrenden Kugel aus den Decksplanken gepflügt worden war und sein Bein durchbohrt hatte. Gully weinte vor Schmerzen und kroch davon, eine blutige Spur hinter sich herziehend. Stirks Blick irrte umher auf der Suche nach einem Ersatzmann.
Kydd warf einen Blick über die Kanone auf Renzis ernstes Gesicht und dachte, wie leicht es statt dessen seinen Freund hätte treffen können. Er schob den Gedanken weg und drückte dem ihm unbekannten Seemann, der Gullys Platz einnahm, das Tauende des Seittakels in die Hand.
Der Feind feuerte im gleichen Tempo; es war also nichts mit der doppelten Feuerkraft. Zwei gleiche Gegner würden auf Leben und Tod miteinander ringen müssen.
Ein grimmiger Powlett marschierte gemessenen Schrittes auf dem Achterdeck hin und her, trotz der Trümmer und Splitter, die aus dem Rigg herabregneten. Vom Feind waren durch den Qualm nur die Segel und die Plattformen über den Marssalings zu sehen, wo Scharfschützen mit Musketen auf das Achterdeck der Artemis zielten.
Neville ging bedächtig auf der anderen Seite des Decks auf und ab, die Hände fest hinter dem Rücken verschränkt.
Parry hatte seinen Degen gezogen, hielt sich an einem Besanwanttau fest und blickte finster zum Feind hinüber; Merrydew war mit seinen Bootsmannsmaaten in der Hölle des Vorschiffs verschwunden. Der Adjutant des Kommandanten, ein junger Fähnrich, zitterte wie Espenlaub.
Noch eine Breitseite der Citoyenne hämmerte durch die halb verwehten Rauchschwaden zwischen den Schiffen. Als die Kugeln die Fregatte mit furchtbarer Wucht trafen, verschwand Powlett für einen Moment im Pulverqualm. Kurz darauf spürten die Männer die Einschläge durch die Decksplanken. Aus dem Nichts ertönte ein dünner Schrei, ein Mann fiel aus dem Rigg, wild mit Armen und Beinen rudernd, stürzte auf Neville und riß ihn mit zu Boden. Neville stand wieder auf; der Mann dagegen blieb liegen, ein unordentlicher Haufen verlöschten Lebens.
Eine Kugel hatte die Gaffel des Besantreibers zwischen Klau- und Piekfall fast vollständig durchschlagen. Die lange Spiere senkte sich und brach langsam entzwei. Ohne Halt fiel das große Segel erst in sich zusammen, dann riß es von oben nach unten. Der schwere Gaffelbaum mitsamt seiner Takelage begrub die Mannschaften der Backbord-Sechspfünder unter sich.
»Ich kann sie nicht halten!« schrie der Rudergänger. Verzweifelt drehte er das Steuerrad, damit das Schiff nicht leewärts zum Feind hin durchsackte.
Powlett befahl, an den Fähnrich gewandt: »Vorsegel anschlagen!«
Artemis verlor an Fahrt. Nun nützten ihr all ihre ausgezeichneten Segeleigenschaften nichts mehr: Ohne einen Treiber achtern müßte sie sich hilflos im Kreise drehen, wenn vorne Tuch gesetzt würde. Artemis konnte weder manövrieren noch fliehen. Die Qualmwolken trieben über die funkelnde See davon; die Citoyenne stand triumphierend voraus. In der Sonne blitzten die Ferngläser auf ihrem Achterdeck auf, als die französischen Offiziere gespannt das feindliche Schiff nach Schäden absuchten.
Allen an Bord der Artemis war klar, daß an eine rasche Instandsetzung des Treibers während der Schlacht nicht zu denken war, denn dieses außergewöhnliche Lateinersegel ließ sich nur mit besonderem Gerät am Mast riggen. Wenn sie aber manövrierunfähig waren, konnten sie nur tatenlos zusehen, was das Schicksal bringen würde ...
Zwei, drei Kabel voraus drehte die Citoyenne gemächlich in den Wind. Sie würde nun dwars den Bug des Briten passieren und ihren Gegner beim Wenden der Länge nach bestreichen. Der Alptraum einer vollen Breitseite gegen den Bug, die das Schiff längsseits bis zum Heck durchschlug, würde nun Wirklichkeit werden.
Vorne erkannten die erfahrenen Backsgasten die Gefahr und setzten hektisch die Vorsegel neu: Klüver, Vorstagsegel, was sie nur finden konnten. Artemis sprach an, fiel vom Wind ab, wandte aber bei dem Manöver dem Feind die Breitseite zu, indem sie zugleich mit ihm wendete. Mit all ihrer ohnmächtigen Wut donnerte Artemis erneut ihre rollende Breitseite hinaus. Die Einschläge auf der Citoyenne waren nun vom Achterdeck aus klar zu erkennen. Dünnes, vereinzeltes Feuer war die Antwort, was allerdings nur daran lag, daß die meisten erfahrenen französischen Matrosen beim Wenden des Schiffes gebraucht wurden.
Citoyenne hatte auf den anderen Bug gewendet und war nun bereit, in Gegenrichtung an Artemis vorbeizulaufen und die nächste Breitseite mit voller Besetzung abzufeuern. Das taktische Manöver hatte ihr außerdem den Vorteil verschafft, im Luv ihres Feindes zu stehen, so daß von nun an sie den Ablauf des Geschehens diktieren konnte. Die französische Fregatte begann ihren Anlauf. Ein Vorteil allerdings war der Artemis geblieben: Citoyenne wandte ihr wieder die zerschossene Seite zu, während sie selbst nun die Kanonen der unbeschädigten anderen Seite ins Spiel bringen konnte.
Als die beiden Schiffe auf Gegenkurs aneinander vorbeiliefen, feuerte jedes Stück, sobald das Ziel aufgefaßt war – beide versuchten erst gar nicht, disziplinierte Breitseiten zustande zu bringen. Wie die Zufallstreffer eines Betrunkenen hämmerten die grausamen Eisenkugeln des vorübergleitenden Franzosen in das britische Schiff.
Spershott kam von unten an Deck, wurde getroffen und wie eine Puppe, die das Kind nicht mehr will, über die Planken geschleudert. Er lag reglos da wie ein nasser Sack. Zwei Seeleute faßten ihn an Armen und Beinen und schleiften ihn nach unten.
Powlett marschierte weiter gelassen auf und ab.
Hinter dem Heck der britischen Fregatte stellte die Citoyenne das Feuer ein. So sicher war sie sich, ihr Opfer im Sack zu haben, daß sie auf die schnellere Wende verzichtete, um statt dessen zu halsen, was länger dauerte, aber Rigg und Segel schonte. Durch die Halse würde der Franzose zudem beim nächsten Anlauf viel näher am Feind liegen. So etwas tat nur ein vor Selbstbewußtsein strotzender Kommandant, der die Sache schnell zu Ende bringen wollte.
»Mr. Neville!« brüllte Powlett quer über das Deck. »Enterabwehr!« Das Gesicht schwarz verschmiert vom Pulverqualm, stand er breitbeinig da, fest wie ein Rammbock.
Die französische Fregatte wollte offenbar längsseits gehen und auf ihre überlegene Mannschaftsstärke setzen. Nach einer letzten Breitseite würden ihre Matrosen Artemis im Pulverqualm entern, und dann wäre alles vorbei.
»Aye, aye, Sir!« schrie Neville zurück.
Powlett lächelte grimmig. »Ran an den Feind!«
Das Kanonendeck bot ein Bild des Grauens. Dichte, erstickende Rauchschwaden waberten durch den engen Raum, Hilferufe und Schmerzensschreie ertönten von überall. Für Kydd gab es nur den immer gleichen Rhythmus von Laden und Feuern. Das nasse Schaffell seines Auswischers zischte jedesmal heftig, wenn es auf das glühendheiße Eisen des Rohres traf.
Jeder Anlauf des Feindes wurde vom eintönigen Krachen und Wummern der Einschläge begleitet.
Dann schwiegen die Waffen. Auf dem Kanonendeck begriffen die Männer, daß die Citoyenne sich diesmal die Zeit nahm, zu halsen statt zu wenden. Der Rauch verzog sich; wer konnte, spähte durch die Stückpforten hinaus. Der Feind kam heran, diesmal aber auf Tuchfühlung, offenbar in der Absicht, Artemis zu entern und zur Aufgabe zu zwingen.
»Enterabwehr – erste Abteilung Entergasten klarmachen!«
Kydd zögerte.
»Auf geht's, mein Junge«, sagte Stirk heiser. »Und – viel Glück, Mann!«
Das Herz schlug Kydd vor Angst bis im Halse, als er den Backsniedergang hinaufstürmte. Die Wuhling an Deck war unbeschreiblich: durchschossene Segel, zerfetztes oder ausgelaufenes Tauwerk, das aus dem Rigg herabhing und sanft in der Brise schaukelte, von Kugeln zerfräste und zersplitterte Decksplanken, über und über mit Trümmern und Scheibenblöcken bedeckt. Der letzte Akt hatte begonnen.
Er stolperte hinüber zum Fockmast, riß eine Enterpike aus ihrem Ständer. Ein Bootsmannsmaat schickte ihn nach achtern, wo er sich der kleinen Schar auf dem Achterdeck anschloß. Leutnant Neville stand mit gezogenem Degen vor seinen Leuten, hatte den Rock weggeworfen und verkündete den Männern mit großer Geste: »Wir werden den Franzosen wie Helden entgegentreten und sie ins Meer treiben!«
Kydd spürte ein brennendes Jucken an seinem rechten Bein. Unterhalb des Knies war ein langer Splitter durch die Hose ins Fleisch gedrungen, dann aber wieder ausgerissen. Das verkrustete, an den Beinhaaren ziepende Blut war es, was ihn gestört hatte. Seine erste Gefechtsverletzung nötigte ihm ein grimmiges Lächeln ab, als er seine Leinenhose über der Wunde abschnitt.
Achteraus reffte die Citoyenne vor dem letzten Anlauf die Segel. Auf ihrer Back drängten sich die zum Entern bereiten Männer zu einer bedrohlichen, laut schreienden Menge zusammen.
»Pikengasten klarmachen!« rief Neville. »An das Schanzkleid, marsch!«
»Belege.« Powlett fiel ihm in den Arm. »Das ist Wahnsinn – an Deck, los, runter mit den Pollern! Die feuern Kartätschen, Sie Dummkopf!«
Sie fielen hinter dem niedrigen Schanzkleid in Deckung. Die Bugkanonen des Franzosen waren mit Kartätschen geladen, die ihren tödlichen Hagel kleiner Kugeln über ihnen entluden. Die Kartätschenkugeln schlugen in die Bordwand, zerfetzten die Hängematten in den Finknetzen, fanden aber kein menschliches Fleisch als Kugelfang.
Die Karronaden der Artemis sprachen da schon eine andere Sprache. Diese kurzen, häßlichen, gedrungenen, auf einem Schlitten beweglich angebrachten Kanonen konnten auch nach achtern gerichtet werden, und sie antworteten ihrerseits mit Kartätschen, mit einer dichten Wolke von Musketenkugeln, die in den Körpern der Entermannschaft reichlich Ziele fanden. Sofort verwandelte sich das lautstarke Grölen in schrilles Geschrei, und Kydd blickte wie gebannt auf die Bäche von Blut, die am Bug der französischen Fregatte hinabrannen, während sie ihr Achterdeck passierte.
»Dämliche Arschlöcher«, grunzte der Stückführer der Karronade.
Die andere hielt ihr Feuer noch zurück. Ihr Stückführer war verbissen darauf konzentriert, das Rohr auf die Back zu richten, obwohl sich der Schußwinkel ständig änderte. Der Bug der Citoyenne glitt vorbei – noch immer feuerte er nicht.
»Männer, er wird versuchen, im Rauch seiner Breitseite zu entern«, rief Neville ihnen zu. Seine Stimme überschlug sich, so aufgeregt war er.
Kydd hatte verstanden. Mit den anderen sprang er auf und machte sich bereit. Er stemmte den Absatz der Pike gegen die Planken, richtete die Spitze schräg nach vorne und oben und versuchte, sich an all das zu erinnern, was man ihn gelehrt hatte. Bald würde die letzte französische Breitseite losdonnern; dann würde aus der Pulverqualmwolke eine schreiende Horde von Feinden hervorstürmen. Er mußte auf sie vorbereitet sein.
Die Bootsklampen der feindlichen Fregatte glitten vorbei – noch immer nicht ein einziger Schuß. Die Citoyenne wurde langsamer, kurz vor dem alles entscheidenden Angriff. Kydd hielt den Atem an. Plötzlich spie die zweite Karronade Feuer, für Kydd völlig überraschend. Der Schuß war gut gezielt; die Vierundzwanzigpfünderkugel schlug mitten in den Fuß des feindlichen Besanmasts, der sich langsam dem britischen Schiff zuneigte. Mit der Stenge fielen das gesamte Wirrwarr an Segeln, Spieren und Tauen und die unglücklichen Leute im Besantopp – über die Bordwand in die See.
Der Franzose hatte aber noch einen, und zwar entscheidenden Schaden erlitten, denn die Kugel hatte, nachdem sie ein so verhängnisvolles Stück aus der Besanstenge gerissen hatte, das Steuerrad der Fregatte zerschmettert. Ohne Ruder aber war die Citoyenne nicht mehr steuerbar. Zuerst zog sie für kurze Zeit davon, dann aber schwang ihr Bug auf die Artemis zu.Der Winkel wurde größer, doch nicht schnell genug – so nahe, wie die beiden Schiffe standen, war das Ergebnis unvermeidlich. Der lange Bugspriet des Franzosen stach zwischen Fock- und Großmast dwars über das Deck der Artemis;es krachte gewaltig, als die Fregatte ihren Gegner mit dem Bug mittschiffs rammte und festhing.
Kydd hatte alles entsetzt mitangesehen. Die träge Masse der Citoyenne drückte sie weiter, doch ihr fest gefangener Bug verhinderte, daß sie ausschwang. Statt dessen preßten Hunderte von Tonnen den mächtigen Bugspriet gegen den Großmast der britischen Fregatte. Dort kam er zur Ruhe, knackte und knirschte jedoch unter dem Andruck.
Einer von beiden mußte nachgeben, entweder Artemis' Großmast oder Citoyennes gesamter Bugspriet samt allem Zeug. Es war, als hielten beide Schiffe den Atem an. Dann donnerte es ein paarmal laut, und die französische Tanne gab der britischen Eiche nach: Unter ohrenbetäubendem Krachen zersprang der Bugspriet, und das gesamte Vorrigg der Citoyenne brach weg. Ihr Bug war eine einzige Wuhling aus Spieren, Leinen und Segeln; das meiste davon bedeckte mittschiffs das Deck der Artemis. Ohne das Widerlager für den gewaltigen Preßdruck schwang die französische Fregatte gegen ihren britischen Gegner und lag bald darauf längsseits.
»Fertigmachen!« brüllte Neville.
Der entscheidende Augenblick war gekommen – keine Manöver, kein Warten mehr. Das Gefecht stand auf des Messers Schneide. Die Seeleute verteilten sich längs des Schanzkleids, aber es waren erbärmlich wenige Männer, die da entschlossen ihre Piken aufstemmten.
Powlett stand still und stocksteif da. Er starrte hinüber zum feindlichen Schiff.
»Sir?« sagte Neville.
»Irgend etwas stimmt bei dem Franzmann nicht«, murmelte Powlett.
Anscheinend herrschte Verwirrung an Bord der Fregatte; die Männer liefen ziellos durcheinander. Einige enterten auf in das Rigg, irgendeinem verzweifelten Befehl folgend, doch verrieten wütende Rufe, daß der Befehl entweder widerrufen oder mißverstanden worden war. Andere irrten an Deck herum. Nirgendwo aber sammelten sich Männer zum Angriff auf das gegnerische Schiff.
»Ihr Kommandant ist gefallen«, sagte Powlett leise. Dann, lauter, wie entfesselt: »Und das ist unsere Chance, Mr. Neville.« Er zog seinen Degen. »Entermannschaft: Zum Angriff!«
Neville stand wie vom Donner gerührt. Dann brach sich ein Grinsen Bahn. »Aye, aye, Sir. Entermannschaft: Zum Angriff!«
Die Männer antworteten mit lautstarkem Jubelgebrüll. Das war allemal besser, als ängstlich auf den Feind zu warten. Sie warfen die Piken weg, stürmten zu den Kisten, griffen nach ihren Waffen – Pistolen, Säbel, Enterbeile. Kydd stopfte sich zwei Pistolen in seinen breiten Gürtel und nahm sich auch noch einen Entersäbel, den er blank gezogen in der Hand hielt. Unruhig, angespannt drehte er sich um. Neville wirkte merkwürdig heiter und gelöst. Mit feurigem Blick wandte er sich an seine Männer: »Klar zum Entern – vorwärts, Leute! Gott schütze den König!« Mit gezogenem Degen stürmte er voran. Die erste Abteilung der Entermannschaft folgte ihm.
Die Männer kletterten in Windeseile über die Reste des Bugspriets, der wie eine natürliche Brücke mittschiffs über das eingedrückte Schanzkleid der Artemis genau in das Herz des Feindes führte. Laut brüllend und wild ihre Entersäbel schwingend, standen sie bald oben auf der großen Spiere. Neville hieb links und rechts das verhedderte Tauwerk entzwei und kämpfte sich zu der Back des anderen Schiffes durch, die sich rasch mit wutentbrannten französischen Matrosen füllte. Kydd reihte sich ein, stolperte vorwärts, seine Gedanken überschlugen sich. Sie kreisten um das unbedingte Gebot zu siegen – und zu überleben.
Als sich der Pulverqualm im Kanonendeck verzog, zeigte sich, was die Schlacht an Bord angerichtet hatte. Gelegentlich feuerte noch eine feindliche Kanone, doch seit die Citoyenne ihr Vorrigg verloren hatte, war der Kampf abgeflaut. Das achterne Ende des Franzosen schwang herum; die Bordwand der französischen Fregatte, pockennarbig von Einschlägen, füllte den Rahmen der Stückpforte. Über ihnen, vom Oberdeck, ertönte englisches Jubelgeschrei.
Renzi sah in Stirks rauchgeschwärztes Gesicht. Der Mann erwiderte seinen Blick mit einem müden Lächeln.
»Sieht ganz so aus, wie wenn wir 'nen ganz scharfen Hund am Schwanz gepackt hätten«, sagte er.
Durch die geringfügige Verschiebung der Schiffe zueinander waren die Stückpforten der beiden Gegner gerade auf gleicher Höhe, doch da die meisten Männer zur Enterabwehr an Deck standen, konnten die britischen Stückführer ihre Kanonen nicht zum Einsatz bringen. Die Seeleute unter Deck mußten untätig abwarten, bis sich das Blatt gewendet hatte.
Durch die Stückpforte sah Renzi die Männer auf dem anderen Schiff hektisch umherlaufen. Dann begriff er: Das Getrampel über seinem Kopf bewegte sich zur Bordwand hin – das bedeutete, sie enterten, nicht der Feind! Eine Woge triumphaler Freude überspülte ihn, und er schrie: »Wir entern, nicht die! Bei Gott, wir entern!
Stirk blickte ihn finster an – aber dann dämmerte auch ihm, was vor sich ging, er eilte zur Waffenkiste, zog einen Säbel hervor und rief: »Mir nach, ihr Hurensöhne!«
Renzi stürzte sich auf die Kiste und griff sich ebenfalls einen Entersäbel, von den anderen ungeduldig bedrängt.