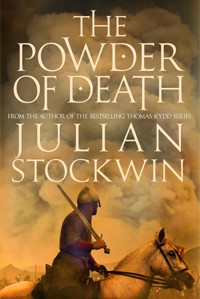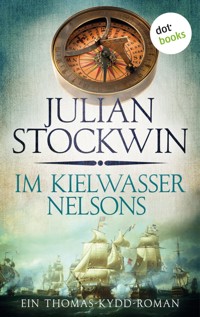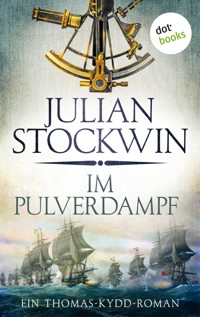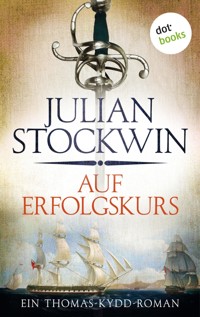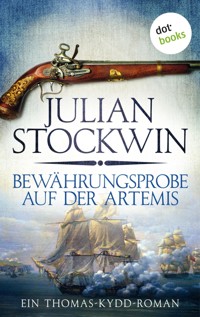Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Thomas-Kydd-Roman
- Sprache: Deutsch
Wird der Aufstieg zum Unteroffizier gelingen? Der abenteuerliche Seefahrerroman »Verfolgung auf See« von Julian Stockwin jetzt als eBook bei dotbooks. England, 1794: Nach dem Untergang der »Artemis« lässt die Royal Navy nichts unversucht, um den Skandal zu vertuschen. Thomas Kydd und die anderen Überlebenden werden auf die »Trajan« versetzt – ein beeindruckendes Kriegsschiff, das in die Karibik segelt, um die dortigen französischen Kolonien zu erobern. In der Neuen Welt erwarten Kydd ungeahnte Herausforderungen: Riskante Schlachten mit den Franzosen, Sklavenaufstände und skrupellose Piraten, die die Gewässer unsicher machen. Ein Auftrag, der eine entscheidende Wendung im Konflikt mit Frankreich bringen könnte, stellt Kydd Ruhm und Ehre in Aussicht – doch das Schiff gerät in einen todbringenden Hurrikan … Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin beschwört ein lebendiges Bild des Seemannslebens herauf, der Panik und Verwirrung einer Schlacht und der Angst im Angesicht eines Sturms auf hoher See, und weiß, wie man packende Actionszenen schreibt.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der marinehistorische Roman »Verfolgung auf See« von Julian Stockwin – Band 3 der Erfolgsreihe um Thomas Kydd und seinen Aufstieg vom einfachen Matrosen zum Helden der See. Ein Lesevergnügen für alle Fans von Patrick O'Brian und C. S. Forester. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Nachwort
Lesetipps
Über dieses Buch:
England, 1794: Nach dem Untergang der »Artemis« lässt die Royal Navy nichts unversucht, um den Skandal zu vertuschen. Thomas Kydd und die anderen Überlebenden werden auf die »Trajan« versetzt – ein beeindruckendes Kriegsschiff, das in die Karibik segelt, um die dortigen französischen Kolonien zu erobern. In der Neuen Welt erwarten Kydd ungeahnte Herausforderungen: Riskante Schlachten mit den Franzosen, Sklavenaufstände und skrupellose Piraten, die die Gewässer unsicher machen. Ein Auftrag, der eine entscheidende Wendung im Konflikt mit Frankreich bringen könnte, stellt Kydd Ruhm und Ehre in Aussicht – doch das Schiff gerät in einen todbringenden Hurrikan …
Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin beschwört ein lebendiges Bild des Seemannslebens herauf, der Panik und Verwirrung einer Schlacht und der Angst im Angesicht eines Sturms auf hoher See, und weiß, wie man packende Actionszenen schreibt.« Publishers Weekly
Über den Autor:
Julian Stockwin wurde 1944 in England geboren und trat bereits mit 15 Jahren der Royal Navy bei. Nach achtjähriger Dienstzeit verließ er die Marine und machte einen Abschluss in Psychologie und Fernöstliche Studien. Anschließend lebte er in Hong Kong, wo er als Offizier in die Reserve der Royal Navy eintrat. Für seine Verdienste wurde ihm der Orden des MBE (Member of the Order of the British Empire) verliehen, bevor er im Rang eines Kapitänleutnants aus dem Dienst ausschied. Heute lebt er als Autor in Devon und arbeitet an den Fortsetzungen der erfolgreichen Thomas-Kydd-Reihe.
Julian Stockwin im Internet: https://julianstockwin.com/
Bei dotbooks erscheint in der Thomas-Kydd-Reihe von Julian Stockwin außerdem:
»Zur Flotte gepresst«
»Bewährungsprobe auf der Artemis«
»Auf Erfolgskurs«
»Offizier des Königs«
»Im Kielwasser Nelsons«
»Stürmisches Gefecht«
»Im Pulverdampf«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2019
Copyright © der englischen Originalausgabe 2003 by Julian Stockwin
Die englische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Seaflower« bei Hodder & Stoughton, London.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/solar lady, Abstractor, Dmytro Amanzholov und eines Gemäldes von Louis Philippe Crépin
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (as)
ISBN 978-3-96148-845-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Verfolgung auf See« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julian Stockwin
Verfolgung auf See
Ein Thomas-Kydd-Roman
Aus dem Englischen von Jutta Wannenmacher
dotbooks.
Auf den Wind, der weht,auf'n Schiff, das in See geht,und auf die Liebste des Seemanns im Hafen. (Maritimer Trinkspruch)
Kapitel 1
Der einzelne Kanonenschuss, der den Beginn der Gerichtsverhandlung anzeigte, hallte in der Stille des frühen Sommermorgens laut über Portsmouth hin, aller Welt grimmig verkündend, daß ein maritimes Drama bevorstand. Wie ein böses Omen brachte er jedes Gespräch im Mannschaftslogis des Wohnschiffs zum Verstummen, wo Thomas Kydd sich gerade den Nackenzopf von seinem besten Freund und Bordkameraden Nicholas Renzi neu aufbinden ließ.
»Jetzt würd' ich liebend gern mit dir tauschen«, murmelte Kydd. Er trug schlecht passende, aber saubere Seemannskleidung, geliehenes Zeug, weil er wie Renzi bei ihrem Schiffbruch alles verloren hatte. Vor dem Kriegsgericht stand der einzige überlebende Offizier, und Kydd, der zur fraglichen Zeit Ruderwache gehabt hatte, war ein wichtiger Zeuge.
Vom vorderen Niedergang drang ein gedämpfter Ruf zu ihnen herunter. Kydd verabschiedete sich hastig, erklomm die breite Leiter und nahm an der Reling Aufstellung. Längsseits wartete schon der Backbordkutter, der die nervösen Zeugen an Land bringen sollte. Nach den seltsamen Gebräuchen der Marine schloß sich Kydd scheu den Unteroffizieren an, obwohl mit dem Ende seines Schiffes auch sein Rang erloschen war und er in der Musterrolle des Wohnschiffs nur als Vollmatrose geführt wurde. Doch sein Zeugnis würde er als Unteroffizier ablegen, weil er damals diesen Rang bekleidet hatte.
Den netten kleinen Bootstrip zum Hafen konnte Kydd nicht genießen, denn ihm schnürte sich der Hals zu, wenn er an die verknöcherten, golddekorierten Admiräle und Kapitäne dachte, unter deren durchbohrenden Blicken er im Zeugenstand seine Aussage machen mußte, die von anderen, feindlich gesinnten Offizieren leicht angefochten werden konnte.
Kydd und Renzi hatten fraglos eine schwere Zeit hinter sich. Schiffbrüchig ins Land ihrer Geburt heimgekehrt, waren sie auf dem Wohnschiff praktisch gefangen gehalten worden. Zunehmend schlechte Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz machten es für die Obrigkeit zum Problem, jetzt auch noch den Verlust der berühmten Fregatte Artemis bekanntzugeben. Also hatten sie die Überlebenden aus dem Verkehr gezogen, bis nach der Kriegsgerichtsverhandlung das weitere Prozedere festgelegt werden konnte. Und deshalb durften Kydd und Renzi nach ihrer langen Reise nicht heimkehren, obwohl ihre Angehörigen seit einem Jahr auf Nachricht von ihnen warteten; zuletzt hatten sie sich aus Macao gemeldet, ihrem letzten Kontakt mit der Zivilisation.
Der Kutter strebte den schmucken neuen Gebäuden am Kai zu. In der letzten Hälfte des Jahrhunderts war Englands wichtigster Marinehafen beträchtlich ausgebaut worden und jetzt an sich schon ein großartiger Anblick, das ehrgeizigste Industrieprojekt des Landes. Während sie sich dem Ufer näherten, musterte Kydd nervös den einsamen Union Jack, der am Signalturm auswehte. Die Flagge war der sichtbare Beweis für alle, daß der Hafenadmiral hier eine Gerichtsverhandlung abhielt. Normalerweise hätten die Militärrichter in der großen Achterkajüte des Flaggschiffs getagt, doch die Reede von Spithead war praktisch leer, weil Admiral Howes Flotte irgendwo draußen im Atlantik kreuzte, auf der Suche nach den Franzosen.
Die Wachsoldaten am Landeplatz dachten nicht daran, Haltung anzunehmen, denn das Boot brachte keine Offiziere, sondern nur einen gemischten Haufen Matrosen in schlecht sitzenden Klamotten. Wortkarg, aber gehorsam folgten die Männer einem Leutnant in den Vorraum, wo sie warten sollten, bis sie aufgerufen wurden. Vielsagend bezogen zwei Seesoldaten Posten neben der Tür.
Kydd schien die Zeit stillzustehen, als er so auf seinem hölzernen Stuhl hockte und verlegen den Hut in Händen drehte. Die Überquerung des endlos weiten Pazifiks und die Verantwortung, die ihm durch seine frühe Beförderung zugefallen war, hatten ihn beträchtlich reifen lassen. Schon nach dem ersten Blick in sein offenes, sonnengebräuntes Gesicht, auf seinen dichten dunklen Haarschopf und den kräftig gebauten Körper mußte jeder in ihm das erkennen, was er war – ein vollwertiger Seemann. Nichts erinnerte mehr an seine lange zurückliegende Vergangenheit als Perückenmacher in Guildford.
Ein Kanzlist in schwarzem Rock erschien und rief: »Abraham Smith!«
Der Gehilfe des Zimmermanns erhob sich und hinkte mit gefaßter Miene zur Tür. Kydd erinnerte sich, wie der Mann in der Dunkelheit auf dem Vordeck gearbeitet hatte: Einige der Anwesenden verdankten ihr Leben dem Floß, das er aus Wrackteilen gezimmert und in der kalten Morgendämmerung zu Wasser gelassen hatte.
Wieder erschien der Kanzlist. »Tobias Stirk!« Der große Kanonier sprang sofort auf, hielt dann aber inne und sah sich nach Kydd um. Seine Miene blieb unvermindert ernst, doch sein langsames Augenzwinkern brachte Kydd zum Lächeln. Dann fiel ihm wieder ein, was ihm bevorstand, und er bekam Herzklopfen.
»Thomas Paine Kydd?«
Kydd nickte nur, er konnte vor Aufregung nicht sprechen.
»Mein Name ist Gardiner. Unsere Aufgabe ist es, die Fakten zu ermitteln, die zum Verlust Seiner Majestät Fregatte Artemis führten«, sagte der Jurist mit der Geläufigkeit langer Übung. »Ihre Aussage wird von uns protokolliert und darauf überprüft, ob sie für den Fall, der hier verhandelt wird, von Bedeutung ist.«
Also mußte er vielleicht gar nicht vor den Richtern erscheinen? Vielleicht kam er frei und wurde nach Hause entlassen! Doch dann sagte ihm der Verstand, daß er mit seiner Aussage ein wichtiges Indiz beizutragen hatte. Er und Renzi hatten ihre jeweiligen Positionen durchgesprochen. Renzi stammte aus begütertem Hause, war wegen einer Familienschuld freiwillig ins Exil gegangen und kannte sich in der Welt aus. Kydd dagegen glaubte stur an den Sieg der Wahrheit und wich keinen Fingerbreit von seiner Überzeugung ab. Das Resultat war unvermeidlich.
»Waren Sie, Kydd, in der Nacht des 13. April 1794 auf Wache?« Gardiner ging die Sache scheinbar beiläufig an und kramte in seinen Unterlagen, während der Federkiel seines Schreibers hörbar übers Papier kratzte.
»Aye, Sir – ich war Steuermannsmaat der Steuerbordwache und stand am Ruder.« Der Mann würde ihn wahrscheinlich für impertinent halten, wenn er noch hinzufügte, daß er sich als Steuermannsmaat niemals dazu herabgelassen hätte, das Rad auch nur anzufassen. Das war Aufgabe des Rudergängers. Ihm selbst oblag die Aufsicht über die Ruderstation als Ganzes, natürlich unter dem Befehl des Wachoffiziers. Deshalb war er wahrscheinlich der wertvollste Einzelzeuge für die wahren Geschehnisse in jener Nacht.
Eine Pause und ein vielsagender Blickwechsel zwischen Gardiner und dem Kanzlisten bewiesen, daß ihnen die Bedeutung dieser Antwort nicht entgangen war.
»Also Steuermannsmaat?« fragte Gardiner, jetzt scharf und hellwach.
»Kommissarischer Steuermannsmaat, Sir.«
»Na schön.« Gardiner starrte ihn eine Weile an, seine grauen Augen wirkten irgendwie grausam. Seine einfache schwarze Perücke roch nach dem Mief von Gesetzbüchern, Urteilssprüchen und Freiheitsstrafen. »Wäre es richtig oder falsch zu behaupten, daß Ihre Position es Ihnen ermöglichte, die auf dem Achterdeck stattfindenden Ereignisse jener Nacht zur Gänze zu überblicken?«
Kydd zögerte, weil er die Bedeutung dieser Worte erst entschlüsseln mußte. Die Feder des Kanzlisten blieb reglos in der staubigen Luft hängen. Kydd wußte, daß jeder gemeine Matrose, der auf die falsche Seite des Justizsystems geriet, in den unentwirrbaren Fallstricken hoffnungslos scheitern mußte. Renzi mit seiner Logik hätte die richtige Antwort gekannt, aber Renzi hatte damals unter Deck geschlafen und war nicht als Zeuge aufgerufen.
Kydd hob den Blick und antwortete vorsichtig: »Sir, der Steuermannsmaat hat sich in der Nähe des Ruders aufzuhalten, ebenso in der Nähe des Offiziers der Wache, um seine Befehle entgegenzunehmen und auszuführen. Wachoffizier war Leutnant Rowley, Sir.«
Die Falten auf Gardiners Stirn vertieften sich. »Sie scheinen meine Frage nicht verstanden zu haben, Kydd. Ich will mich einfacher ausdrücken: Können Sie behaupten, daß Sie in Ihrer Position alles mitbekamen, was geschah – ja oder nein?«
Das war eine unfaire Frage, und Kydd argwöhnte, daß man ihm damit das Angebot machte, sich unter Wahrung seines Gesichts vor der Zwangslage des Hauptbelastungszeugen zu drücken, der dem feindseligen Verhör aller Parteien ausgesetzt sein würde. Den Grund dafür ahnte er nicht.
»Ich habe den mir dienstlich zugewiesenen Platz niemals verlassen, Sir«, sagte er leise.
»Dann behaupten Sie also, mit Sicherheit und in aller Verläßlichkeit beurteilen zu können, warum Ihr Schiff verlorenging?« Gardiners ungläubiger Ton grenzte an Sarkasmus.
»Sir, wir hatten zwar Sturm in jener Nacht, trotzdem konnte ich Leutnant Rowleys Worte gut verstehen – jedes einzelne davon«, sagte Kydd mit wachsendem Ärger.
Gardiner runzelte die Stirn und blickte kurz zum Schreiber hinüber, der mit dem Protokollieren noch wartete. »Ich frage, mich, ob Ihnen die volle Bedeutung Ihrer Worte klar ist«, sagte er mit einem Anflug von Schärfe im Ton.
Kydd schwieg und starrte nur verstockt zurück. Er würde die Wahrheit sagen – nicht mehr und nicht weniger.
»Wollen Sie behaupten, daß Sie schon deshalb, weil Sie Leutnant Rowley klar verstanden, beurteilen können, warum Ihr Schiff verlorenging?« Gardiners beißende Stimme verhärtete sich.
»Sir«, begann Kydd endlich entschlossen, »wir sichteten Brecher genau in Luv.« Er erinnerte sich, wie ihn beim Warnruf des Ausguckpostens auf dem offenen Atlantik ein wilder Schreck durchzuckt hatte. »Leutnant Rowley befahl, das Ruder hart nach Luv zu legen und ...«
Gardiner unterbrach ihn. »Daraus schließe ich, daß er sofort den korrekten Befehl gab, das Schiff von der Gefahrenstelle wegzudrehen?«
Kydd ließ sich nicht in die Falle locken. »Das Schiff fiel schnell ab, aber Leutnant Parry kam an Deck und befahl hart Leeruder ...«
Aggressiv wie bei einer zustoßenden Schlange ruckte Gardiners Kopf nach vorn. »Aber Parry war nicht Offizier der Wache, die Schiffsführung oblag ihm nicht!«
»Sir, Leutnant Party war der Vorgesetzte von Leutnant Rowley, und er konnte ...«
»Aber er war nicht Wachoffizier!« Gardiner hielt die Luft an, und Kydd fühlte sich von so viel Feindseligkeit seltsam bedroht. Ein Anwalt hatte doch die Aufgabe, die Fakten zu ermitteln, und nicht, die Zeugen einzuschüchtern, schon gar nicht einen Zeugen, der alles erklären konnte.
»Aber er hatte recht, Sir!«
Gardiner zuckte zusammen, schwieg jedoch aus unerfindlichen Gründen.
Also sprach Kydd weiter. Wenn er nur die Wahrheit sagte, dann würde am Ende alles gut werden. Außerdem hegte er eine heimliche Sympathie für den plebejischen Party, der von dem Dandy Rowley so viel hatte ertragen müssen. Zwar war er nun tot, aber Kydd wollte dafür sorgen, daß sein Andenken nicht besudelt wurde. »Er hatte recht, weil man vor einer Gefahrenstelle anluven soll, damit sich die Segel back stellen.« Gardiners Miene drückte heimliches Unverständnis aus, deshalb erklärte Kydd die Sache genauer, damit in diesem entscheidenden Punkt kein Mißverständnis entstand. »Auf diese Weise wird die Fahrt aus dem Schiff genommen, es gerät nicht in noch größere Gefahr, und man kann sich über die weiteren Schritte klarwerden.«
»Damit unterstellen Sie, daß Leutnant Rowleys Anweisung, von der Gefahrenstelle wegzudrehen, der falsche Befehl war?« knurrte Gardiner.
»Jawohl, Sir!« Kydd war seiner Sache so gewiß, daß Gardiner verunsichert wurde; undeutlich murmelte er vor sich hin und wartete.
»Denn gleich darauf sichteten wir Brecher auch in Lee, und weil Leutnant Rowley den Befehl zum Abfallen gegeben hatte, trieben wir schnell darauf zu, ohne Platz für ein rettendes Manöver zu haben.«
Gespannte Stille. Gardiners Miene verhärtete sich. »Sie behaupten also, daß der Verlust der Artemis direkt auf das Verhalten dieses Offiziers zurückgeht?«
Jetzt gab es kein Halten mehr, Kydd mußte zu seinem Wort stehen, auch später vor den Richtern. »Jawohl, Sir!« sagte er fest.
Langsam ließ sich Gardiner zurücksinken und wandte den strengen Blick nicht von Kydd. Überraschenderweise seufzte er. »Also gut – wir halten Ihre Zeugenaussage jetzt fest.«
Der Schreiber hüstelte vielsagend. Gardiner wandte sich ihm kurz zu, worauf zwischen beiden ein stummer Austausch stattfand, den Kydd nicht deuten konnte. Kydd wieder ins Auge fassend, setzte Gardiner hinzu: »Also, in Ihren eigenen Worten, wenn's recht ist.«
Völlig konzentriert erzählte Kydd die einfache, aber herzzerreißende Geschichte des Untergangs der schmucken Fregatte, vom eisigen Schreck beim ersten Sichten der Brecher mitten im Atlantik bis hin zu ihrer unausweichlichen Strandung auf dem Außenriff einer der Azoreninseln.
Allerdings verschwieg er seine ganz private Verzweiflung über den Tod des ersten Schiffes, das er wirklich geliebt hatte, das ihn rund um die Welt zu so vielen Abenteuern getragen und ihn gründlich verwandelt hatte, vom gepreßten Seemann zum erstklassigen Vollmatrosen und schließlich zum Unteroffizier. Auch ersparte er sich die Schilderung, wie das Wrack in der Nacht auseinandergebrochen und er zwischen den erbarmungslosen Brechern um sein Leben geschwommen war. Auch sprach er nicht von der Freude über seine schließliche Rettung, denn derlei Details hätten diese Paragraphenreiter nicht interessiert.
»Vielen Dank«, sagte Gardiner und warf dem Schreiber einen Blick zu, dessen Feder immer noch übers Papier flog, auf dem er Kydds Worte festhielt. »Damit scheint die Sache ja komplett zu sein.« Seine Gleichgültigkeit gab Kydd neue Rätsel auf, sie paßte nicht zu dem verbissenen Verhör von vorhin.
Der Kanzlist streute Sand über das Geschriebene und ordnete das Blatt zwischen die anderen Papiere ein. »Du mußt auf jede Seite dein Kreuzchen machen«, sagte er von oben herab, was Kydd in Rage brachte. Er hatte im Großen Südmeer mit Renzi über Diderot und Rousseau debattiert und hatte sich noch nie als Analphabet gefühlt. Deshalb setzte er schwungvoll seine Unterschrift auf jedes Blatt, die dann von dem überheblichen Schreiber gegengezeichnet wurde.
Gardiner erhob sich. »Sie dürfen auf Ihr Schiff zurückkehren«, sagte er unbeteiligt. Auch Kydd stand auf, erleichtert darüber, daß er seine Version des Geschehens endlich dargelegt hatte. »Wir werden Sie als Zeugen aufrufen, falls das Gericht dies für notwendig erachtet«, setzte Gardiner hinzu.
Kydd nickte respektvoll und empfahl sich.
Kydd saß auf der Seekiste, die er sich mit Renzi teilte. Beim Schiffbruch hatten sie ihre ganze Habe verloren und besaßen jetzt nichts mehr, das von ihrer langen Weltreise Zeugnis abgelegt hätte. Kydd schnitzte an einer Holzschatulle mit Knochenintarsien herum; damit hatte er wenigstens ein Geschenk für seine ihm herzlich zugetane Schwester, wenn er sich auf der Londoner Landstraße in den bäuerlichen Frieden von Guildford aufmachte.
Bei dem Gedanken wurde ihm warm ums Herz. »Nicholas, du bist bei uns zu Hause herzlich willkommen, das weißt du. Aber hast du auch an deine Familie gedacht, mein Freund?«
Renzi blickte von seinem Buch auf, und seine Augen verschleierten sich. »Ich fürchte, meine Heimkehr wird nicht ganz so viel Freude auslösen wie deine, mein Lieber.« Er gab keine näheren Erläuterungen, und Kydd stellte keine Fragen. Die Empfindlichkeiten, die zu Renzis freiwilligem Exil von daheim geführt hatten, wurden zwischen ihnen nicht erörtert, doch Kydd war sich klar darüber, daß Renzis begüterte Familie sein Leben als einfacher Matrose für eine haarsträubende Schande halten mußte.
Wie beiläufig fuhr Renzi fort: »Falls ich euch nicht belästige, wäre es mir eine besondere Freude, eine Weile chez Kydd zu logieren.« Daß er dabei seine Bekanntschaft mit Cecilia, Kydds hübscher Schwester, erneuern konnte, schien ihm nicht erwähnenswert.
Zufrieden seufzte Kydd auf. »Ich hab' ihnen alles erzählt, Nicholas – jetzt sag' ich mein Verslein noch vor Gericht auf, dann können wir uns auf den Heimweg machen.« Sein Messer schabte einen dünnen Span aus dem Deckel, als er die Kante abrundete.
Renzi musterte seinen Freund. Kydds Bericht über das Verhör hatte ihn beunruhigt und lag ihm seither schwer im Magen.
»Ganz recht, und dann können wir ...« Er unterbrach sich, denn die vertrauten Schiffsgeräusche waren von einem dumpfen Knall übertönt worden, wie von einer kleinkalibrigen Kanone in der Ferne. Das geschäftige Treiben im Wohndeck verstummte, weil die Leute lauschend erstarrten. Noch ein Knall, und sie tauschten verblüffte Blicke. Zielloses Kanonenfeuer war auf einer Reede so ungewöhnlich, daß man seinen Ohren nicht traute. So manches Gesicht verhärtete sich, und einige sprangen auf. Aus der zögerlichen Hinwendung zum Niedergangsluk wurde eine allgemeine Stampede, als ein dritter Schuß fiel.
An Deck galt alle Aufmerksamkeit der Hafeneinfahrt. Die Offiziere auf dem Achterdeck hielten ihre Teleskope darauf gerichtet, während die Leute erregt debattierten. Manche sprangen in die Wanten, um besser sehen zu können.
Es war ein Marinekutter, der unter Vollzeug durch die enge Hafeneinfahrt geprescht kam, achtern eine riesige Nationale führend und in beiden Wanten Flaggensignale. Von seinem Vordeck stieg ein weißes Wölkchen in die Höhe, dem Sekunden später der vierte Knall folgte.
»Depeschen. Das'n Depeschenboot«, knurrte Stirk. »Und's pressiert ihnen gewaltig. Da komm' Neuigkeiten auf uns zu, Kameraden«, ergänzte er unnötigerweise.
Der Kutter raste vorbei und begann am Signalturm flott anzuluven. Das Toppsegel back stellend, kam er zum Stehen und setzte fast sofort ein Beiboot aus, das dicht am Wohnschiff vorbeipullte. Der einzige Offizier darin mißachtete stur die neugierigen Rufe, die ihm übers Wasser entgegenschallten. Hastig erklomm er die Steinstufen der Landungstreppe und verschwand zwischen den Gebäuden, während das Boot hinter ihm wieder ablegte und in einiger Entfernung wartete.
Zu wissen, daß in Steinwurfnähe etwas äußerst Wichtiges vorging, war entnervend, und die Spekulationen überschlugen sich. Die wilden Gerüchte reichten von einer bevorstehenden Invasion der Franzosen bis zum plötzlichen Ableben des Monarchen.
Doch lange mußten sie nicht warten. Wesentlich lauter und dumpfer krachte ein viel größeres Kaliber, wahrscheinlich eine der mächtigen Kanonen im Fort. Eine Reihe Soldaten erschien und trottete im Gänsemarsch an der Wasserfront entlang. Die aufgeregte Unterhaltung an Deck versiegte. Abermals ein Kanonenschuß, und dann reckte Renzi den Hals. »Da läuten Kirchenglocken«, sagte er. »Anscheinend haben wir einen Sieg zu feiern.«
Immer mehr Glocken stimmten ein. An den Flaggleinen des Signalturms entfaltete sich ein Wald bunter Wimpel, das Hafenwasser wurde aufgewühlt von vielen kreuz und quer hastenden Booten. Ungeduldig hingen die Männer in den Wanten und beobachteten frustriert die wachsende Erregung an Land. Das Wohnschiff diente hauptsächlich als schwimmende Kaserne für die Opfer der Preßgangs, bevor sie auf ihre Schiffe verteilt wurden, und besaß probate Mittel, seine Insassen an Bord zu sistieren. Einstweilen würden sie ihren Frust herunterschlucken müssen.
Zum Glück stellte sich bald heraus, daß die Boote von Land abstießen, um die Neuigkeit überall, zu verbreiten. Eine Pinasse hielt auch auf das Wohnschiff zu, kommandiert von einem Fähnrich, der gefährlich auf der Heckducht balancierte und ihnen wie wild zuwinkte. Sein wirres Geschrei spannte sie noch ein letztes Mal auf die Folter, dann wurden die schrillen Worte des aufgeregten Jünglings verständlicher: Admiral Howe hatte auf dem stürmischen Atlantik vor knapp drei Tagen einen großen Sieg errungen. Flott kam das Boot längsseits, der Fähnrich flog förmlich an der Bordwand empor und stürzte aufs Achterdeck, um seinen Bericht zu erstatten.
Im Nu hingen die Matrosen über der Reling und fragten die Bootscrew aus; sie bekamen eine unzusammenhängende, vielstimmige Antwort zu hören, doch ihr Kern war einfach und klar: In dem Wissen, daß im ausgehungerten revolutionären Frankreich ein Getreidekonvoi voller Verzweiflung erwartet wurde, hatte Admiral Howe schon seit Wochen auf dem Atlantik gekreuzt. Natürlich wurde dieser Transport von Geleitschiffen schwer bewacht. Die beiden Flotten stießen aufeinander, und es entwickelte sich ein laufendes Gefecht von drei Tagen, bis die Schlacht schließlich am 1. Juni in einem Treffen der Giganten kulminierte und mit einer verheerenden Niederlage der Franzosen endete.
Eifrige Hände bedienten die Leinen, als das Wohnschiff über die Toppen flaggte, während seine kleinen Vierpfünder krachend in die allgemeine Kakophonie einstimmten. Wie im Delirium feierte die Nation ihren triumphalen Sieg in einem großen Flottentreffen auf See.
Das Hafenviertel und die ganze Stadt füllten sich mit Menschen, deren Jubel schwach zu den frustrierten Männern drang. Sie konnten sich nur zu gut vorstellen, was sich jetzt in den Tavernen und Wirtshäusern abspielte.
Sprachlos vor Entsetzen hörten sie, daß den Überlebenden der Artemis nichterlaubt war, an den Siegesfeiern teilzunehmen. Schmerzlich erinnerten sie sich an ihren eigenen ungestümen Empfang nach dem Sieg im Duell mit einer französischen Fregatte, dem ersten von vielen im kommenden Krieg. Sie wollten ihre Begeisterung ausleben, konnten aber nur sehnsüchtig zum Land starren, was eine bittere Enttäuschung war für Männer wie sie, die so viel gelitten hatten.
Im Masttopp wehte nach wie vor die Gerichtsflagge, doch Kydd wurde nicht herbeizitiert, auch nicht tags darauf. Als die Flagge am dritten Tag niedergeholt wurde, zuckte er nur die Schultern und machte sich zur Heimreise bereit.
Es war derselbe Tag, an dem Earl Howe mit seiner siegreichen Flotte auf der Reede von Spithead eintraf. Zum zweitenmal explodierte die Stadt im Freudentaumel, und die Matrosen von der Artemis sahen neidisch zu, wie die vielen Boote mit Landurlaubern auf den Portsmouth Point zuhielten. Sie konnten es nicht fassen, daß sie immer noch an Bord festgehalten wurden.
Aus Renzis Unruhe wurde brennende Sorge. Daß man mit Schiffbrüchigen so umsprang, war ebenso inhuman wie unvernünftig und ergab keinen Sinn. Im Freudentaumel über den Sieg am Glorreichen Ersten Juni mußte der Verlust der Artemis untergehen, deshalb sah er keinen Grund mehr, die Leute von ihren Familien fernzuhalten.
Ein Bootsmannsgehilfe erschien im Niedergangsluk und rief hinunter: »Die Leute von der Aaaartemis: zur Muuusterung an Deck! Aaantreten in der Kuuuhl mit aaallem Gepäck!«
»Das haut einen doch glatt um!« sagte Stirk. »Diese Bastarde haben sich an uns erinnert!«
Schnell suchten sie das jämmerliche Bißchen zusammen, das sie noch besaßen; Kydds Habe paßte in ein einziges kleines Bündel. Aufatmend drückte er sich den Hut fester in die Stirn und trat in den Abendsonnenschein an Deck hinaus. Unten hatte eine große Barkasse festgemacht, bemannt von einer Crew Duckmäuser, die Kydd nicht kannte. Ein ältlicher Leutnant stand neben der Pinne, die Lippen zum Strich zusammengepreßt.
»Heho, Kumpels – auf in den Kampf und selber schuld, wer in 'ner Stunde noch nüchtern is'!« rief einer von der Artemis mit glänzenden Augen.
»Hab' schon Fransen am Arsch, so lang sitz' ich auf diesem Eimer«, sagte ein anderer und schulterte seinen Seesack. »Da hilft nur 'ne schmucke Deern, die 'nem Seemann zeigt, wo's langgeht!«
Kydd grinste. Nachdem ihre Namen in der Musterrolle abgehakt waren, stieg er mit den anderen, Renzi dicht hinter sich, in die Barkasse hinab. Dort verteilten sie sich auf die Ruderbänke in der Mitte zwischen den Bootsgasten, die auf ihre Späße jedoch nicht eingingen. Stumm und niedergedrückt hielten sie ihre Blicke eisern achteraus gerichtet. Allmählich versiegte das fröhliche Geschnatter der Artemis-Veteranen, eine schlimme Vorahnung machte sich breit. Das Boot stieß ab, und die Riemen wurden so effizient und bedächtig bedient, als stünde ein langer Törn bevor.
Kydd warf Renzi einen fragenden Blick zu, erntete jedoch nur ein Kopfschütteln. Plötzlich schoß hinter dem Wohnschiff ein Kutter hervor. Entsetzt erkannte Kydd darin einen Trupp kampfbereiter Seesoldaten mit Musketen und anderen Waffen. In scharfem Bogen schor das Boot heran und hielt sich dicht hinter ihnen, von ihrem Leutnant nicht weiter beachtet, der jetzt einen Parallelkurs zur Küste steuerte.
»Diese Sackratten!« brüllte Stirk ungläubig. »Wir werden umgesetzt!« Er sprang auf und packte das Dollbord.
»Ein Versuch, und du hast 'ne Kugel im Gekröse«, knurrte der Leutnant.
Stirk erstarrte, während rundum ein Proteststurm losbrach. Es war nicht ungewöhnlich, daß die Besatzung eines Schiffes, das nach langem Einsatz zur Überholung in den Hafen zurückkehrte, auf ein anderes Schiff versetzt wurde. Aber die Überlebenden eines Schiffbruchs?
»Ruhe!« bellte der Offizier. »Ihr seid im Dienst, ihr verdammten Hunde! Wem das nicht paßt, dem nagt die Katze das Rückgrat blank!«
Kapitel 2
Schnell wurde die Barkasse vom Ebbstrom durch die Hafeneinfahrt getragen, begleitet von den Szenen und den Lauten unbändiger Freude, als die Besatzungen der siegreichen Flotte ihrem Jubel freien Lauf ließen. An Bord jedoch herrschte grimmiges Schweigen, nur das Knarren der Riemen in den Dollen und ihr hypnotisierend regelmäßiges Eintauchen waren zu hören.
Kydd spürte, wie eine schreckliche Leere von ihm Besitz ergriff. Immer dicker wurde der Kloß in seiner Kehle, während er den Blick nicht vom Land wenden konnte. So weit! Und so viel war auf dieser Reise geschehen! Sein Kummer war so groß, daß für Wut kein Platz blieb.
Als das Boot von Land freigekommen war, hielt es nach Steuerbord auf die im Abendlicht verschwimmenden Umrisse der Kriegsschiffe zu, die auf Spithead-Reede vor Anker lagen. Noch einmal drangen Hochrufe und Flüche bis zu ihnen heraus, als sie an den schiefen alten Gebäuden am Portsmouth Point mit den außer Rand und Band geratenen Urlaubern vorbeikamen.
Kydd starrte hin, bis Renzi ihm auf die Schulter tippte. Da wandte er sich um und sah ein mächtiges Linienschiff von vierundsiebzig Kanonen in ganzer Länge vor sich liegen. Ihr Boot bog um sein Heck mit der altmodisch offenen Freiluftgalerie, und Kydd spähte nach oben. In verwaschenem Gold entrollte sich da ein großes Wappenband, auf dem in elegant geschnitzten Buchstaben der Schiffsname stand: Trajan.
Würgend stieg Verbitterung in Kydd auf, als er auf dem Vordeck stand, ein Stag umklammernd, und zu seinem entschwindenden Heimatland zurückstarrte, das sich schnell in Nichts auflöste. Die Schiffsbewegungen verstärkten sich, als die Trajan in die ersten Atlantikroller stieß, die den Ärmelkanal heraufkamen; einige Männer gerieten darüber ins Stolpern. Bald kämpfte sich der Zweidecker so hoch am Wind voran, wie es nur ging, mit zwei anderen Fahrzeugen achteraus und einem voraus. Im Dunst verlor das Land jede Kontur und verschwand schließlich ganz. Kydds Kehle war wie zugeschnürt.
»Ich muß gestehen, ich fühle mich wirklich übertölpelt.« Renzi war zu Kydd getreten, die Kinken aus einer Leine schüttelnd. Kydd hätte eigentlich auf dem Vordeck arbeiten müssen, doch niemand hatte das Herz, ihn daran zu erinnern. Alle wußten, daß den Leuten von der Artemis übel mitgespielt worden war, und man überließ sie ungestört ihrem Elend.
Kydd sah auf. »Übertölpelt? So würd' ich's nicht nennen«, murmelte er.
Renzi überlegte. »Wäre der Verlust der schneidigen Artemis ein solcher Schock für die Öffentlichkeit, daß man uns unter Verschluß halten muß? Oder braucht die Flotte so dringend Seeleute, daß sogar Schiffbrüchige gepreßt werden?« fragte er. »Nein!« fuhr er fort. »Was wir hier haben, ist ein politischer Trick, um den Ruf eines Mannes zu retten, der eigentlich verurteilt gehört. Aber dank seiner Protektion durch höchste Stellen wurde Rowley freigesprochen und deine Zeugenaussage unterschlagen. Und wir – wir sind bloß ein Ärgernis ...« Er verstummte, als er sah, daß Kydd vor Wut erbleichte.
»Wir werden abgeschoben, um Rowleys Haut zu retten!« knirschte Kydd. »Und zwar in die Karibik mit ihren Fieberepidemien ...«
»Ich fürchte, das stimmt. Aber, mein Lieber, da sind auch die spanischen Pfründe, unermeßliche Schätze, die reichsten Inseln der Welt – und nicht zu vergessen der Ruhm, wenn wir den Franzosen unbarmherzig die Zuckerinseln entwinden!«
Die Vorstellung ließ Renzi insgeheim schaudern, aber bei diesem Schicksalsschlag brauchte Kydd eine Sinngebung.
»Mit diesem alten Kahn?« Kydds zornige Worte kamen aus tiefstem Herzen. Nach der schnittigen Schönheit der Fregatte Artemis verkörperte für ihn die betagte Trajan alles, was er verachtete. Sie war vergleichsweise plump und schwer, in ihren alten Hölzern saß der Rott – und an Bord herrschte die eiserne Disziplin der großen Linienschiffe, mit Profos, Korporal, Trommler und Bootsmannsgehilfen.
Außerdem war sein früherer Rang als kommissarischer Unteroffizier auf der Trajan nicht anerkannt worden, ihr Korps war komplett, und sie brauchte ihn nicht. Hier war er nicht mehr als ein Vollmatrose, zwar ein Toppgast, aber trotzdem mußte er seine Hängematte im Mannschaftslogis bei den anderen aufriggen, statt in der abgeschirmten Gemütlichkeit einer bequemen Unteroffizierskoje zu schlafen.
Renzi antwortete nicht. Kydds Zorn war berechtigt, da gab es nichts zu beschönigen. Er hatte guten Grund, empört zu sein. Howes großer Sieg hatte Kräfte freigesetzt für die bereits begonnene Invasion der karibischen Inseln, und Trajan sollte nun als Verstärkung zu ihnen stoßen. Außerdem: Welch bessere Methode gab es, sich einer Peinlichkeit zu entledigen? Sein Blick verlor sich in der Weite der wogenden Seen, die sich voraus bis in die Unendlichkeit erstreckten. Er versuchte, seine Verbitterung hinunterzuschlucken, und begab sich unter Deck.
Die Mittagsmahlzeit verlief trübsinnig. Außerdem gab es so nahe der Heimat noch Dünnbier und keinen Grog. Mit Löwenzahn und anderen Kräutern aufgekocht, schmeckte es weniger schal als bitter, war aber immer noch besser als Wasser aus dem Faß, das so schnell faulte. Nach den ersten Wochen auf See würde das Dünnbier ausgehen und durch Rum ersetzt werden, den alle bevorzugten, doch einstweilen enthielt Kydds Becher noch das dünne Gebräu, das ihn nicht gerade fröhlicher stimmte.
Er zog seine Ration zu sich heran – den viereckigen Holzteller, an den er sich von seinem ersten Einsatz als Gepreßter noch so gut erinnerte. Zinngeschirr und Besteck gab es hier nicht. Stirnrunzelnd betrachtete er den Eintopf aus Trockenerbsen und ranzigem Schweinefleisch. In Spithead hatten sie Weißbrot an Bord genommen, das war jetzt erst wenige Tage alt und taugte noch dazu, den Teller auszuwischen. Doch in den kommenden Wochen würde es nur noch Schiffszwieback geben.
»Haste schon deine Wache un' Station?« fragte Doggo mit vom Rum heiserer, aber ungewohnt leiser Stimme. Trübsal zog sein häßliches Affengesicht in die Länge.
Für die absehbare Zukunft würde Kydd in dem Teil des Schiffes Dienst tun müssen, der ihm vormittags zugewiesen worden war, zusammen mit seiner Wachmannschaft. Das konnte eine Qual werden oder auch Befriedigung bringen, je nach dem Charakter seiner Vorgesetzten. Seine Gefechtsstation konnte das Ruder sein, wo er wehrlos dem unbarmherzigen Musketenfeuer des Gegners ausgesetzt war, oder das untere Batteriedeck mit seinen Zweiunddreißiger-Kanonen, die jede Bordwand durchschlugen.
»Zweite Backbord, Großtoppgast«, antwortete Kydd düster und knetete sein Brot. »Und's vordere Magazin im Gefecht.«
Zu seiner großen Enttäuschung hatte er gehört, daß Renzi der Steuerbordwache zugeteilt worden war. Also würden sie einander nur bei den Mahlzeiten sehen und in ihrer spärlichen Freizeit, wenn sie auf dem Vordeck saßen und ihr Zeug flickten. Auf der Artemis waren sie in derselben Wache gewesen und hatten viele glückliche Stunden damit verbracht, über das Leben, die Welt und andere Themen zu philosophieren. Damit war es nun vorbei.
Isaac Larcombs offenes, sympathisches Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. »Könnt' schlimmer sein, Mann«, sagte er. »Toppgast is'n guter Anfang.« Das war nett gemeint, so wie die Artemis-Veteranen überhaupt freundlich von ihren neuen Messekameraden aufgenommen wurden.
Renzi nickte, sagte aber nichts.
»He, das heißt ja, ich bin in deiner Wache, Tom!« Kydd blickte zu dem flachshaarigen Luke hinüber, einem Schiffsjungen von der Artemis,und lächelte flüchtig. Luke war fleißig und ein eifriger Bewunderer von Kydd, aber kein Ersatz für Renzi.
Kydd war für die erste Hundewache als Rudergänger eingeteilt und fühlte sich sofort wohler, als er das mannshohe Rad gepackt und unter Kontrolle gebracht hatte. Das vertraute Ziehen und Vibrieren der Rudertaljen, mit dem sich die Stimmung der See übertrug, wirkte auf ihn wie Medizin. Die Trajan fühlte sich schwerfällig an, gehorchte jedoch willig dem Ruder; sie war nur ganz wenig luvgierig und strahlte Ruhe und Sicherheit aus.
Er erwärmte sich für das Schiff. Indem er immer wieder zum Luvliek des gemütlichen alten Großsegels hinaufspähte, probierte er aus, wie stark er bei jeder ungestüm gegen den plumpen Bug anrennenden See gegensteuern mußte und wie weit er das Gieren korrigieren konnte, wenn die See schräg unter ihrem Rumpf durchlief. Anscheinend benahm sich die alte Dame recht guterzogen, doch das mußte sich in Extremsituationen erst noch bestätigen.
Unterhalb der Segel konnte er die ganze Länge des Decks überblicken, ein Anblick, dessen er nie müde wurde: das träge Heben und Senken des Decks, der blaue Horizont, der erst abtauchte und dann in leicht verändertem Winkel wieder erschien, die regelmäßige, tröstliche Bewegung des ganzen Schiffs. Lächelnd nickte er vor sich hin. Niemand hätte die Trajan für ein Rennpferd halten können, aber als gutmütige alte Mähre war sie auf ihre Art perfekt.
»Paß auf, daß du nicht kneifst!« knurrte der wachhabende Steuermannsmaat.
Die Warnung war überflüssig, denn Kydd hatte die Lage völlig unter Kontrolle und lief keineswegs Gefahr, dadurch an Fahrt zu verlieren, daß er zu hoch an den Wind ging. Er warf einen Seitenblick auf den Mann: vierschrötig, kräftig und muskulös, zerknitterte Kleidung und eine übelgelaunte Miene, was sich Kydd zur Warnung dienen ließ.
»Aye«, sagte er, um den Mann nicht zu reizen.
Bei ihrem Wortwechsel blickte sich der auf und ab schlendernde Wachoffizier nach ihnen um. Kydd hielt den Blick weiter nach vorn gerichtet, war sich jedoch der Beobachtung bewußt. Doch er hatte nichts zu befürchten und tat gelassen weiter seinen Dienst. Nach ein oder zwei Minuten kam der Offizier heran.
»Du bist einer von der Artemis,stimmt's?« fragte er.
Es ziemte sich zwar nicht, den Rudergänger ins Gespräch zu ziehen, aber dies war ein Vorgesetzter.
»Jawohl, Sir«, antwortete er, den Blick weiterhin aufs Luvliek des Großsegels gerichtet, wofür der Offizier Verständnis haben mußte.
Schnurgerade segelte die Trajan weiter. Kydd spürte das Interesse des Offiziers.
»Du hast ein Fregattenhändchen am Ruder, wie ich merke.«
Das verlangte keine Antwort, es war allein schon ersichtlich aus Kydds häufigen leichten Korrekturbewegungen am Ruder anstelle des langsameren, bedächtigeren Steuerns auf einem Linienschiff.
»Wie heißt du?«
»Kydd, Sir!« mischte sich der Steuermannsmaat energisch ein. Da er im Augenblick die unmittelbare Aufsicht über die Schiffsführung besaß, hatte er auch das Recht, jede Ablenkung seines Rudergängers zu unterbinden.
Doch: »Danke, Coltard«, sagte der Offizier glatt und redete weiterhin Kydd an. »Also bist du mit der Artemis ums Horn gesegelt?
»Sir«, bestätigte Kydd kurzangebunden. Wenn der Offizier doch nur verschwinden wollte!
»Als Rudergänger?«
»Als Steuermannsmaat, Sir.«
»Hmmm.«
Kydd bemerkte seinen schnellen Seitenblick zu Coltard und fragte sich, was der wohl zu bedeuten hatte. Der vierschrötige Deckoffizier errötete und sah verstockt drein.
Kydds halbstündiger Törn am Ruder ging nur zu schnell vorbei. Widerwillig überließ er das Rad dem Vollmatrosen, der ihn ablöste. Der Wachoffizier sah ihm mit der Andeutung eines Lächelns nach, als Kydd das Achterdeck verließ, plötzlich frohen Sinnes.
Auf dem Seitendeck ging Kydd für den Rest seiner Wache nach vorn, jederzeit bereit, als Toppgast im Großmast aufzuentern. Der Einfluß des Atlantiks wurde immer spürbarer, die längere Dünung, die den Kanal heraufkam, machte die Bewegungen der Trajan pompöser und weiter ausholend. Kydd blickte auf zu den ausgebleichten, längst nicht mehr weißen Segeln, bemerkte ihre aufgesetzten Flicken und die ausgefransten Scheuerstellen an den Leinen. Wie früher schon auf der Duke William wurden auch hier jede Menge Abstriche gemacht, um die wertvollsten Einheiten der Flotte auf See zu halten.
Achteraus versank Portland unter der Kimm. Bald mußte auf diesem Schlag Torbay in Sicht kommen, und dort, so wollten es die Gerüchte wissen, würden sie zum Konvoi nach Madeira und in die Karibik stoßen. Wieder stieg Wut in Kydd auf, diesmal allerdings gedämpft durch Resignation.
»Auf viele Goldstücke und 'ne tolle Nacht in Port Royal!« Schmunzelnd hob Larcomb den Becher. Sein Trinkspruch erntete allgemeine Zustimmung, und die Mienen am Tisch hellten sich auf.
»'n Freund von der Daemon war '82 drüben, mit Rodney – un' wie er in Plymouth abgemustert is', hat er zwölf Guineen Prisengeld mit heimgenomm'«, sagte Larcombs Nebenmann mit sichtlicher Genugtuung.
»Jawoll, von mir sin' auch drei alte Kumpels rübergemacht – un' keiner davon is' je zurückgekomm'«, konterte Doggo.
Kydd setzte seinen Bierkrug ab. »Aber das Fieber kannste überall kriegen«, sagte er. »Ich weiß noch, wie's uns auf der Artemis erwischt hat, als wir schon ums Horn waren, schon auf'm Heimweg – sogar der Käptn is' abgekratzt.«
»Aye, aber ...«
»Hört mal«, mischte sich Larcomb ernsthaften Tones ein, »wenn aus uns Fischfutter werden soll, dann steht unsre Nummer längst im Buch, und das ganze Jammern nützt nix. Also regt euch ab und nehmt's, wie's kommt, klar?« Die Gesichter rundum blieben besorgt, doch Larcomb ignorierte sie. »War einer von euch schon mal in Westindien?« fragte er.
Offenbar traf dies auf keinen zu, also hob er nur schweigend den Becher.
Da regte sich Renzi. »Mir scheint, es läuft gut für uns in der Karibik – wir haben schon Martinique eingenommen«, sagte er, erntete aber nur blankes Unverständnis. »Eine große Insel und sehr reich«, erläuterte er. »Ich glaube, wir haben vor, den Franzosen dort eine Insel nach der anderen zu entwinden.«
»Aber wenn unsre Schiffe alle drüben beim Erobern sind«, wandte Kydd leidenschaftlich ein, »dann haben die Franzosen hier freie Hand und fallen über England her!«
»Trotzdem. Falls wir die Inseln sich selbst überlassen, wird sie der Feind annektieren. Nein, diese Inseln sind der Quell von Englands Reichtum, und wir müssen sie uns sichern.«
Doch Renzis kühle Lagebeurteilung traf nicht den Geschmack seiner neuen Kameraden, und die Unterhaltung versiegte.
Am nächsten Vormittag, als Kydd wieder Ruderwache hatte, erschien der Erste Offizier Auberon an Deck. Kydd übernahm das Rad von dem ergrauten Vollmatrosen und fühlte sich ein. Der Steuermannsmaat der vorhergehenden Wache stand noch herum, hantierte mit der Koppeltabelle und der Schiefertafel, während sich die Minuten dehnten und seine Ablösung auf sich warten ließ.
»Herrgott, Mann, was ist denn los?« fragte Auberon gereizt.
»Äh – bin noch nicht abgelöst worden«, antwortete er widerstrebend.
Auberon richtete sich auf. »Sie meinen, er ist wieder versackt!« knurrte er.
Nach einigem Zögern nickte der Deckoffizier verlegen, doch Auberon hatte kein Mitleid mit ihm. »Sie gehen erst unter Deck, wenn Sie vorschriftsmäßig abgelöst sind«, befahl er und begann, auf und ab zu tigern.
Kydd spürte die wachsende Spannung und blieb auf der Hut. Als immer mehr Zeit verstrich, fielen die neuen Wachgänger auf dem Achterdeck in Schweigen, hielten die Augen abgewandt, trimmten sorgsam die Segel und schossen ordentlich die Leinen auf.
Diese Wache sollte eigentlich die Bedienung der Segel üben, sie abwechselnd setzen und reffen. Kydd fiel auf, wie stabil das Schiff am Ruder lag, als die große Fock aufgegeit und dann wieder gesetzt wurde, um dichtgeholt den frischen Ostwind zu nutzen. Die Trajan war wirklich ein seetüchtiges Schiff, dachte er, und erwärmte sich immer mehr für sie.
Weiter vorn ertönte ein einzelner Glockenschlag, klar und drängend. Sofort fuhr Auberon zum Bootsmannsgehilfen der Wache herum. »Ruft mir den Profos herbei!« befahl er.
Im Nu erschien der Wachtmeister, baute sich vor dem Ersten auf und salutierte. »Sir?«
»Bitte warten Sie hier, Mr. Quinn«, sagte Auberon kalt.
Kydd übergab das Rad an seine Ablösung und ging, um sich für den Rest seiner Wache beim Vormann des Großmasts zu melden. Dieser wollte sich offenbar nichts entgehen lassen und wies Kydd nur an, die Fockbrassen auf ihrer Nagelbank neu zu ordnen. Der abwesende Steuermannsmaat hatte Pech, daß sich der Erste Offizier an Deck aufhielt, denn dieser kam in der Hierarchie gleich nach dem Kommandanten und hatte außerdem die Verantwortung für die Wacheinteilung und den korrekten Dienstablauf.
In der Öffnung des Hauptniedergangs tauchte ein Gesicht auf, zögernd und furchtsam: Coltard. Er kam so vorsichtig an Deck, als träte er auf rohe Eier, und warf mißtrauische Blicke um sich. Die anderen Wachgänger machten sich eifrig irgendwo zu schaffen, achteten aber darauf, in Hörweite zu bleiben.
»Sie, Sir!« bellte Auberon. »Zu mir!« Seinen Dreispitz hatte er aggressiv schräg in die Stirn gedrückt, seine Arme hingen steif auf dem Rücken. Über das, was nun bevorstand, konnte es nicht die geringsten Zweifel geben.
Coltard salutierte. »Aye, Sir?« Sein Gesicht war bleich und verkniffen, nervös wechselte sein Hut von einer Hand in die andere.
»Sie haben sich verspätet, Sir!« Wie um Auberons Worte zu unterstreichen, erklang vorn ein scharfer Doppelschlag der Glocke. »Um eine ganze Stunde verspätet!«
Scheinbar spielerisch hob sich die Trajan,als ihr Bug eine Welle nahm. Das brachte Coltard aus dem Gleichgewicht, er stolperte ein paar Schritte. »Mit Verlaub, Sir, ich hab' arge Bauchschmerzen. Mir is' furchtbar übel.« Seine Stimme klang schwach und belegt.
Auberon verzog keine Miene. »Dann haben Sie bestimmt den Doktor aufgesucht«, knurrte er böse. »Was sagt er?«
Darauf konnte Coltard nicht antworten, denn wenn dem so gewesen wäre, hätte Auberon einen entsprechenden Vermerk im Morgenrapport gefunden. Andernfalls galt Coltard als diensttauglich. »Das ist schon die dritte Beschwerde über Sie, Sir! Was haben Sie dazu zu sagen, Sie Schuft?«
»Mein Bauch, er ...«
»Ich glaube, Sie haben getrunken. Und das zu dieser frühen Stunde! Sie machen mir jetzt den Pedro-Pee-Tanz, sofort!«
Coltard straffte sich, aber in seinen Augen stand Furcht. »Sir! Ich bin Deckoffizier, kein ...«
»Wachtmeister!«
Für einen Unteroffizier war das eine arg harte Behandlung. Normalerweise genoß er Privilegien, die ihn über den gemeinen Matrosen stellten. Doch darauf konnte Coltard nicht länger zählen, die Disziplin ging vor. Wachtmeister Quinn entfernte sich um acht Schritte, dann drehte er sich nach Coltard um und sah ihn auffordernd an. Mit dem Fuß tippte er auf die schwarze Naht zwischen zwei Plankenstößen.
Mittlerweile schützte niemand mehr Arbeit vor, jeder wandte sich binnenbords und sah zu. Coltard starrte auf die schwarze Teerlinie nieder.
»Wird's bald?« fuhr Auberon ihn an.
So vorsichtig, als stünde er auf einem Hochseil, begann Coltard zu gehen. Nach drei Schritten verlor er die Balance.
»Noch einmal!« befahl Auberon.
Nach wenigen Sekunden scheiterte auch der zweite Versuch. Coltard stand da, benommen, aber trotzig.
»Mr. Quinn, dieser Mann hat einen Grograusch. Er soll an die Luvwanten gefesselt werden, bis er nüchtern ist, und sich danach vor dem Kommandanten verantworten.«
»Aaalle Mann an Deck! Aaalle Mann nach achtern, als Zeugen des Straaafvollzugs!«
Zögernd ließen die Deckshände ihre Arbeit ruhen und machten sich auf den Weg nach achtern. Andere kamen aus dem Batteriedeck herauf oder ließen sich aus den Wanten fallen, um auf dem Achterdeck anzutreten. Über ihnen auf dem Hüttendeck standen die Offiziere und blickten mit ernsten Mienen auf den kleinen Trupp zu ihren Füßen herab.
Coltard stand zwischen dem Schiffsprofos und seinem Korporal. Gehetzt huschten seine Blicke über die versammelten Kameraden. Ob er ihr Mitgefühl suchte, ließ sich schwer sagen. Kydd fing seinen Blick auf, erntete aber nur eine Grimasse. Die gehässige Reaktion ließ ihn überrascht zusammenfahren.
Die gefürchteten Worte der Kriegsartikel schallten laut und klar über die Versammlung und verkündeten das Urteil. Coltard ließ den Kopf hängen, als sein Kommandant ihn degradierte. Nun war er ein gemeiner Matrose und ins Logis vor dem Mast verbannt. Und das war zwangsläufig noch nicht alles. Coltard wehrte sich nicht, als er bis zur Taille entkleidet und seine Daumen mit Schiemannsgarn an die Gräting gebunden wurden. Als der Trommelbube der Seesoldaten mit seinem Wirbel begann, wandte Kydd den Blick ab. Dann plötzlich Stille, bis auf ein leises Zischen, als der Bootsmannsgehilfe die neunschwänzige Katze hervorzog. Erbarmungslos biß sie in Coltards bleichen Rücken, aber nur ein Grunzen unterbrach das verstörte Schweigen. Auch der zweite Peitschenhieb und die folgenden preßten Coltard keinen Laut ab, offenbar war er fest entschlossen, alles zu ertragen, ohne mit seinen Schreien den anderen Genugtuung zu bereiten. Kydd starrte auf die Planken nieder und spürte, wie eine Gänsehaut über seinen Rücken kroch.
Unter Deck konnte Kydd später erleichtert in die Heiterkeit einstimmen, mit der die Demütigung eines Deckoffiziers kommentiert wurde. Es war doch sonnenklar: Der Mann war so sehr dem Rum verfallen, daß er für seine Sucht sogar die Peitsche riskierte. Und seine Kameraden hatten es offenbar satt bekommen, ihn immer wieder zu decken, und ihn an diesem Morgen seinem Schicksal überlassen.
Noch bevor er seine Messe erreicht hatte, zupfte ein kleiner Kadett an seinem Ärmel. »Vollmatrose Kydd?« piepste er außer Atem.
»Aye?«
»Marsch nach achtern zum Kommandanten«, befahl der Junge wichtigtuerisch. Kydd starrte ihn nur an. »Sofort, du Trottel!« krähte der Kleine.
Kydd schlurfte nach achtern und meldete sich beim Wachtposten. Durfte er hoffen?
In der großen Achterkajüte saß der Kommandant an seinem Schreibtisch, und neben ihm stand der Erste Offizier mit einigen Papieren in der Hand. »Ah, Kydd?« Zum erstenmal sprach ihn Kapitän Bomford direkt an.
»Sir.«
»Wie ich höre, sind Sie einer der Freiwilligen von der Artemis.« Bomfords Umgangston war angenehm weltläufig. Kydds Herz begann zu hüpfen.
»Aye, Sir.«
»Sie sind ums Horn gesegelt, glaube ich?«
»Jawohl, Sir.«
»Und Sie waren damals Steuermannsmaat?«
»Kommissarischer Steuermannsmaat, Sir.« Niemals würde er diese Zeit im Großen Südmeer vergessen, die ebenso begeisternd wie erschreckend gewesen war mit ihren gewaltigen Seen und den plötzlichen Stürmen, die von überall her über das Schiff hereinbrachen ...
»Und davor waren Sie auf der Duke William?«Der Erste wechselte einen Blick mit Bomford.
»Jawohl, Sir.« Das große Linienschiff mit seinen achtundneunzig Kanonen gehörte für ihn längst der Vergangenheit an. Daß er dort als gepreßter Landlubber und später als Leichtmatrose in der Musterrolle gestanden hatte, mußte er hier nicht erwähnen.
»Dann bin ich sicher, daß Sie sich auf der Trajan bewähren werden«, meinte Bomford leutselig. »Ich habe nämlich vor, Sie zum Deckoffizier zu befördern – was halten Sie davon?«
Also hatte er sich mit Recht Hoffnungen gemacht! Doch er behielt kühlen Kopf und sagte sich, daß Auberon dem Kommandanten längst vor den Ereignissen dieses Morgens gemeldet haben mußte, daß sich ein geeigneter Ersatz für Coltard an Bord befand. Trotzdem ... »Mit Verlaub, Sir, das würde mir sehr gefallen.« Er konnte das Lächeln einfach nicht unterdrücken. »Mit welchem Rang, Sir?«
Mit hochgezogenen Brauen studierte Bomford ein Blatt Papier. »Als Steuermannsmaat.« Wieder suchte er Kydds Blick. »Wenn Sie Ihren Dienst korrekt und fleißig erfüllen, dann wüßte ich nicht, was gegen eine weitere Beförderung spräche, sobald sich die Gelegenheit ergibt.«
»Besten Dank, Sir.« Das war ein entscheidend wichtiger Karriereschritt.
»Dann sind Sie hiermit befördert. Der Erste Offizier wird Ihnen Ihre Wache und Station zuteilen. Bitte machen Sie weiter.«
Voll der guten Neuigkeiten lief Kydd zurück ins Vorschiff, hielt aber plötzlich inne: Jetzt war er Unteroffizier und gehörte nicht mehr zu den anderen. Seine freudige Erregung verflog, als er sich klarmachte, daß all seine Messekameraden nun im Rang unter ihm standen, alle – sogar Renzi, sein bester Freund.
Er ging weiter ins Batteriedeck, behielt seine Beförderung aber bis nach dem Mittagessen für sich. Dann begann er, sich leise und unauffällig zu verabschieden, von Renzi als letztem. Sein Freund hatte die Neuigkeit mit irritierendem Gleichmut aufgenommen. Leise lächelnd hielt er sich im Hintergrund, während die anderen Kydd auf die Schulter schlugen und keinen Hehl aus ihrem Neid machten. Nun wurde es Zeit – verlegen streckte er die Hand aus. Renzi ergriff sie mit festem Druck, sagte aber kein Wort. Kydd murmelte etwas und ging.
Das Logis der Unteroffiziere lag ganz achtern an Backbord und bestand aus einzelnen Kammern, die mit Paravents aus Segeltuch abgeteilt waren: lauter kleine Welten innerhalb der großen. Beim Eintritt in sein neues Heim kratzte Kydd leise an der Persenning und wurde von Toby Stirk begrüßt.
»Hab' ja gewußt, daß du dir schleunigst 'ne eigene Koje beschaffen wirst!«
Der Seemann grinste übers ganze wie aus Teak geschnitzte Gesicht – bei seiner Erfahrung war er bald als Stückmeister eingeteilt worden – und zog ihn in die Messe. Sie war gemütlich eingerichtet, mit Schwalbennestern für die Zinnkrüge und vielen maritimen Farbdrucken innen an den Wänden.
»Leute, das is' Thomas Kydd – war früher mit mir auf der Artemis. Is'n guter Kumpel und'n harter Knochen auf Wache, der Tom«, meinte Stirk vielsagend, während seine schwarzen Augen glitzerten.
Von niemandem hätte sich Kydd lieber einführen lassen, denn Stirks Kampfesmut in der Schlacht und seine Geschicklichkeit an den großen Kanonen waren legendär. Er knallte sein Bündel auf den Tisch und musterte die Runde seiner neuen Messekameraden, innerlich glühend vor Glück.
Kapitel 3
»Laaand in Sicht!« Laut schallte der Ruf aus dem Masttopp und brachte alle Arbeit an Deck zum Erliegen. »Laaand – ein Strich zu Luv!«
In der Vorhut des Konvois boten die hohen Masten der Trajan die beste Fernsicht, deshalb sichtete man dort Barbados früher als alle anderen. Eine Reihe Flaggen stieg an ihren Signalleinen empor, und die Neuigkeit verbreitete sich auf den achtzig anderen Schiffen des Konvois. Vor fünf Wochen hatten sie England verlassen und seither nur einen kurzen Zwischenstopp auf Madeira eingelegt. Die Männer in den Großwanten, beschäftigt mit dem Teeren des stehenden Guts, brachen in einen erregten Disput aus, dem Kydd von seinem Platz an der Querreling aus lauschte.
»Was issen das für'n Land?« fragte Larcomb gespannt.
»Na, Barbados natürlich«, antwortete Carby, ein älterer Matrose. »Is' der erste Landfall in der Karibik – alle andern Inseln liegen zu Luv, auch die französischen.«
Kydd sah den grauen Schemen an der Kimm Kontur annehmen und in die Breite wachsen, während die weißmähnigen Brecher zügig darauf zu eilten. »Wie sieht'n da die Küste aus?« fragte er Carby, denn er hatte keine Ahnung, was ihn erwartete. Renzi hatte zwar die strategische Bedeutung der Zuckerinseln betont, doch die schien ihm nicht zu den wirren Geschichten zu passen, die er gehört hatte – Geschichten über Piraten, das spanische Festland und den berüchtigten Hafen Port Royal. Vor allem die Piraten – trieben sie noch ihr Unwesen?
»Tscha, viel gibt's da nich' – nur Zuckerrohr un' Schwarze«, grunzte Carby. »Innen Kneipen kannste ordentlich auf'n Putz hau'n, un' die Weiber sin' so was von willig, sag' ich dir ...« Er grinste so breit, daß seine tiefliegenden Augen fast zwischen den Falten verschwanden. »Aber glaub' ja nich', daß du so'n Landgang erlebst wie in Portsmouth, Junge.«
Binnen einer Stunde hatte sich Barbados aus einem undefinierbaren, graublauen Streifen Land in eine stattliche, seltsam zerklüftete Insel verwandelt, mit kleinen Bergrücken und braunen Tälern. Als sie die Südwestspitze rundeten, gewahrte Kydd auf den Hängen viele Windmühlen und winzige Hütten, umgeben vom hellgrünen Meer der Zuckerrohrfelder.
Eines nach dem anderen kreuzten die Schiffe des Konvois um die Huk, ein gewaltiger Schwarm weißer Segel, der die ganze See zu bedecken schien. Während Kydd im Großtopp wartete, bis das Schiff vermurt war, richtete er es so ein, daß er Carby mit seinen Erläuterungen in Hörweite hatte.
»Seht ihr dort, Kameraden, das issen Rotröcken ihre Kaserne. Und weiter oben, der große Klotz anner Lichtung, das isses Hospital. Mit'm Gelben Jack kommste dort rein, und's steht hunnert zu eins, daß du nur mit den Füßen voran wieder rauskommst.«
Kydd studierte die Details des Landes, das an ihm vorbeiglitt. Hinter dem großen Fort auf der Landspitze öffnete sich eine weite Bucht, in deren Arm sich eine kleine Stadt schmiegte.
»Die Carlisle Bay mit Bridgetown«, erklärte Carby.
Wie auch die anderen Schiffe liefen sie nicht in den Hafen ein, sondern ankerten auf Reede. Laut klatschend fiel ihr Eisen ins unberührte, blaugrüne Wasser der weiten Bucht. Während mehr Trosse gesteckt wurde, faltete Kydd mit den anderen das mächtige Großsegel an seiner Rah zusammen. Die letzte Lage mußte in einer besonders exakten Hafenrolle aufgebunden werden, und Kydd arbeitete auf dem Ehrenplatz in der Mitte der Rah, nicht an der Nock. Es machte ihn stolz, daß er als guter Seemann anerkannt wurde. Beim Reffen auf hoher See arbeiteten die besten Leute immer am gefährlichen Ende der Rah und beim Aufbinden im Hafen an der bauchigen Mitte des Segels.
Kydd auf der einen Seite und Carby auf der anderen zogen die Bauchtalje fest, legten die beiden Schothörner in sauberen »Schweineohren« um die Rah und fixierten zuletzt die faltenfreie, gleichmäßige Hafenrolle mit ihren Zeisingen. Der Vormann des Großtopps ließ sie ohne besondere Anweisungen arbeiten, denn Kydds gute Seemannschaft war ihm inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen.
Endlich zur Ruhe gekommen, törnte die Trajan gemächlich vor Anker ein, den Bug von der warmen, sanften Brise umfächelt, der einzigen Erinnerung an den rastlosen Passat, der sie draußen auf See fast über die gesamte Breite des Atlantiks geweht hatte. Die Oberflächenwellen waren hier winzig, gerade nur glitzernde Katzenpfötchen, doch darunter stand ein mächtiger Schwell in die Bucht und legte drohend Zeugnis ab von einem starken Sturm in der Ferne.
Wie eine erstickende Decke sank die Hitze auf das reglose Schiff herab. Eines nach dem anderen wurden die Boote von ihren Lagern in der Kuhl über die Seite geschwungen und ins Wasser gesetzt. Der ablandige Wind brachte einen warmen, undefinierbaren Duft mit, nach staubiger Erde, exotischer Vegetation und tropischer Süße.
Als erste wurden Kapitän Bomford und der Erste Offizier, in ihren Paradeuniformen sichtlich beengt, an Land gepullt. Ihnen folgte die große Barkasse, die mit wertvollen Vorräten beladen zurückkehren würde, zu wertvoll, um sie den ortsansässigen Leichtern zu überlassen, die bereits aus dem Innenhafen zu ihnen herausschwärmten.
Trübsinnig beobachtete Kydd, wie sich Trajans Boote im Gedränge der anderen Wasserfahrzeuge verloren, die zwischen den vielen Ankerliegern und der Küste hin und her wuselten. Von den Einzelheiten an Land konnte er genug erkennen, um sich frustriert zu fühlen; er brannte darauf, mehr über die karibischen Inseln zu erfahren.
Die Trajan knarrte rhythmisch, als der Schwell auf ganzer Länge unter ihrem Rumpf durchlief; die Bewegung brachte die Blöcke im Rigg zum Klappern und ließ die Leinen müßig gegen die Masten schlagen.
»Alle Mann zum Stauen!«
Als Steuermannsgehilfe mußte Kydd sich jetzt zur Arbeit melden, warf aber noch einen letzten sehnsüchtigen Blick zur Küste. Vom fernen Kai stießen bereits die schweren Wasserleichter ab, beladen mit sauber gestapelten Trinkwasserfässern. Erstaunt sah er, daß sie nur von zwei Mann manövriert wurden, und zwar mit gewaltigen, an die achtzehn Meter langen Riemen.
Um in den Laderaum zu gelangen, mußten auf jedem Deck die Hauptluken geöffnet werden, jeweils eine genau unter der nächsten. Im Orlop wurden die Bodenbretter angehoben, um Zugang zum dunklen, stinkenden Bauch des Schiffs zu schaffen. Immer stärker wurde das Sonnenlicht, das durch die offenen Luken fiel und wenigstens für etwas Helligkeit sorgte.
Kydd ließ sich auf die eingelagerten Vorräte fallen. Die leeren Wasserfässer mußten weggeräumt werden, damit die erste Lage der vollen so fest in ihrem Bett verstaut werden konnte, daß sie nicht rutschte. Der Gestank war überwältigend, denn der Ballastschotter hatte das Bilgenwasser aufgesaugt und strömte jetzt, da er umgewühlt wurde, Übelkeit erregende Dämpfe aus. Bei der Hitze war das schwer zu ertragen, und Kydd kletterte mit einem Anflug von Schuldbewußtsein wieder nach oben. Am Rand der Hauptluke stehend, hielt er auf seiner Schiefertafel fest, was im Laderaum verstaut wurde.
»Alle Mann – räumt die unteren Decks! Alle Mann nach achtern!«
Die Rufe der Bootsmannsgehilfen kamen überraschend. Kydd fluchte, denn dies war nicht der rechte Zeitpunkt, die Arbeit zu unterbrechen. »Alles sichern!« knurrte er die fragend zu ihm aufblickenden Gesichter seines Arbeitstrupps an.
Eingerahmt von seinen Offizieren, wartete der Kommandant geduldig vor der Hütte.
»Ruhe!« brüllte der Profos, worauf jede Unterhaltung und das Scharren der vielen Füße fast verstummten.
Kapitän Bomford trat nach vorn an die Querreling. »Trajaner – ich habe euch zusammengerufen, um euch die Neuigkeiten mitzuteilen.« Bei diesen Worten trat endgültig Stille ein. »Unser Dienst am Konvoi ist erfüllt.« Dies wurde mit steinernen Mienen quittiert, denn es war aufreibende Arbeit gewesen, den langsamen Konvoi über den Atlantik zu geleiten. »Jetzt wurden wir freigestellt für unsere eigentliche Aufgabe.« Er ließ die Worte einsinken. »Unser nächstes Ziel ist die französische Insel Guadeloupe. Es wird euch freuen zu hören, daß den Waffen Seiner Majestät in Westindien großer Erfolg beschieden war – wir nehmen den Franzosen eine Insel nach der anderen ab: Martinique, St. Lucia – und jetzt Guadeloupe! Dorthin laufen wir noch heute aus. Macht euch darauf gefaßt, bei der Ankunft in Landkämpfe verwickelt zu werden. Allerdings rechne ich nicht mit stärkerer Gegenwehr.«
Ohne auf Widerstand zu stoßen, segelten Trajan und die Zweiunddreißiger-Fregatte Wessex in die schützenden Arme der Grande Baie von Guadeloupe. Die verschlafene Insel hatte eine seltsame Form – an Backbord dräute wie ein geducktes Tier ein runder Landrücken, und an Steuerbord erstreckte sich die niedrige, runzlige Küste in einem weiten Bogen. Am Kopf der Bucht stießen beide in einer flachen Senke zusammen. Mit seinem satten, von Sonnenschein gesprenkeltem Grün schien das Land für Kydd all das zu verkörpern, was er von einer karibischen Insel erwartete. Er konnte weder Kais noch Hütten erkennen, nur Gebüsch und dazwischen ab und zu die goldenen Bögen von Sandstränden. Der frische Wind trug ihm den berauschenden Duft des saftigen Laubes zu.
Der Anker fiel, polternd lief die Trosse aus. Die Trajan kam zur Ruhe, doch die Wessex segelte weiter. An Land sah Kydd von einem kleinen viereckigen Fort aus Korallengestein weiße Wölkchen aufsteigen. Die mickrigen Kanonen schienen die Fregatte nicht zu stören, unbeeindruckt glitt sie auf das Fort zu. Kydd fragte sich, wie er sich jetzt fühlen würde, wenn ihre Rollen vertauscht wären. Hier rückte das Äquivalent einer ganzen Batterie schwerster Kaliber gegen das winzige Fort vor.
Von den Mauern stieg kein Pulverrauch mehr auf, die Besatzung floh wohl vor der drohend näherkommenden Übermacht. Doch Kydd blieb keine Zeit zum Beobachten. Unter Leutnant Calleys Befehl war er verantwortlich für einen Trupp von fünfzehn Matrosen mit einem ihm unbekannten Mastersgehilfen und mußte sie schleunigst in eins der Landungsboote bugsieren.
Plötzlich hallte der Donner einer Breitseite durch die Bucht: Die Wessex hatte das Feuer eröffnet. Schnell trieb der Pulverqualm mit der frischen Brise heran und verbarg die Fregatte vor den Blicken der Männer, doch die Auswirkung des Kugelhagels auf das verstummte Fort war nicht zu übersehen. Die schweren Kaliber rissen an Land große Trichter auf und jagten Erdklumpen oder Steine himmelwärts. Tropenbäume fielen wie umgemäht, und ein Staubvorhang senkte sich über die Ruinen.
Unter stürmischem Jubel ließen sich die Männer eifrig in die Boote fallen. Kydd und seinem Trupp wurde der vordere Teil der Barkasse zugewiesen, also drängte er sich zwischen den Bootsgasten zum Bug vor, behindert durch die lange Scheide seines Entermessers. Er sah, daß Renzi erst in letzter Minute in sein Boot sprang, konnte aber auf die Entfernung seinen Blick nicht auffangen. Vergeblich fragte er sich, was seinen Freund so lange aufgehalten hatte. Außerdem gehörte er nicht zu seinem Trupp.
Gespannt beobachtete er, wie der Rest seiner Leute an Bord kletterte. Sein Puls raste, ob in Erwartung des Kräftemessens mit dem Feind oder aus Angst, daß er als Anführer in dieser fremden Umgebung versagen könnte, das wußte er nicht. Die Männer allerdings schienen frohen Muts und rissen lockere Witze. Ihre grobschlächtige Seemannsart wirkte tröstlich auf ihn.
Das Boot stieß ab, mit Kydd an der Pinne. Gehorsam wandte es den Bug dem Land zu, während die hohen Wellen ungestüm gegen die Bordwand klatschten und alle durchnäßten. Bei dieser Brandung mußte das Anlanden schwierig werden – und falls der Feind in einem Hinterhalt auf sie wartete ...
Das Krachen der zweiten Breitseite ließ Kydd hochschrecken. Die Wessex konzentrierte ihr Feuer jetzt auf die Stelle, der die Boote zustrebten, und es hätte schon übermenschliche Tapferkeit gebraucht, um diesem schrecklichen, alles vernichtenden Beschuß zu widerstehen.