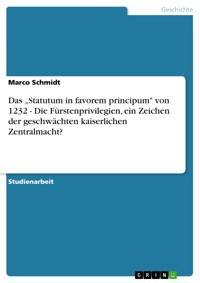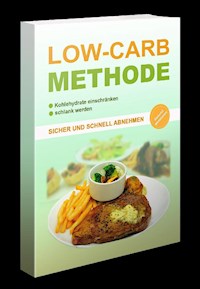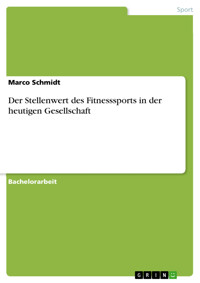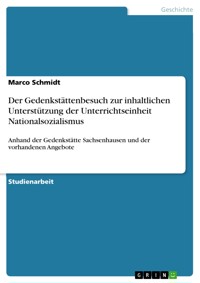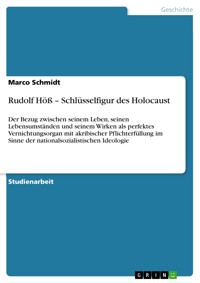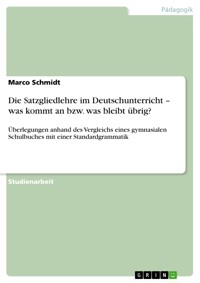Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule. Wie bringen wir mehr Bewegung in den Alltag von Kindern und Jugendlichen? E-Book
Marco Schmidt
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer rastet, der rostet. Dieses Sprichwort trifft auch auf den heutigen Lebensstil vieler Kinder und Jugendlicher in Deutschland zu. Wie aber bringt man mehr Bewegung in ihren Alltag? Marco Schmidt erklärt, welche Chancen und Möglichkeiten die Ganztagsschule bietet. Gerade hier können Spiel- und Sportangebote wortwörtlich etwas in Bewegung setzen. Diese Publikation zeigt, wie man ein größeres Bewegungsangebot in den schulischen Alltag integriert. Dazu zählen Kooperationen zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen, bewegungsorientierte Konzepte und der herkömmliche Sportunterricht. Ein wertvoller Beitrag zu einem gesellschaftlich relevanten Thema! Aus dem Inhalt: - Ganztagsschule; - Spiel und Sport; - Kinder und Jugendliche; - Gesundheit; - Bewegungsvermittlung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2019
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Ganztagsschule- Definition, historische Entwicklung und Begründungen
2.1 Definition
2.1.1 Die offene Form der Ganztagsschule
2.1.2 Die voll gebundene Ganztagsschule
2.1.3 Die teilweise gebundene Form
2.2 Historische Betrachtung der Ganztagsschule in Deutschland
2.3 Begründungen der Ganztagsschule
2.3.1 Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit
2.3.2 Individuelle Förderung von Schüler/innen
2.3.3 Mehr Chancengleichheit im Bildungssystem
2.4 Kritische Betrachtung
3 Der Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule
3.1 Die veränderte Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf Bewegung
3.2 Begründungen für Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule
3.2.1 Förderung des Selbstkonzepts
3.2.2 Medizinisch- gesundheitswissenschaftliche Begründung
3.2.3 Soziale Entwicklung
3.2.4 Kognitive Entwicklung
4 Bewegung, Spiel und Sport in der ganztägigen Bildung
4.1 Bewegungsorientierte Ganztagskonzeptionen
4.1.1 Additiv-Duales Kooperationsmodell
4.1.2 Kooperation durch komplementäre Ganztagsbildung
4.1.3 Kooperation durch Inklusion von Bewegung, Spiel und Sport in den Ganztag
4.2 Kooperation zwischen Ganztagsschule und Sportverein
4.2.1 Chancen für die Schule
4.2.2 Chancen für den Sportverein
5 Bewegte Schule
5.1 Rahmenmerkmale
5.1.1 Pädagogisch-personalstruktureller Rahmen
5.1.2 Infrastruktureller Rahmen
5.2 Inhaltliche Merkmale
5.2.1 Unterrichtsinterne Merkmale
5.2.2 Unterrichtsexterne Merkmale
6 Empirische Untersuchungen über Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote im Ganztag
6.1 Umfang und Häufigkeit von Bewegungsangeboten an Ganztagsschulen
6.2 Kooperationen zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen
6.2.1 Umfang der Kooperationen
6.2.2 Personaleinsatz in den Kooperationen
6.2.3 Auswirkungen der Kooperationen
7 Zusammenfassung
8 Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Anteil der Schulen mit Ganztagsschulbetrieb an allen Schulen sowie die Veränderung zum Vorjahr in Prozent 2011 bis 2015
Abbildung 2: Additive und integrative Formen der Kooperation von Ganztagsschule und Sportverein in Bezug zu den Organisationsmodellen von Ganztagsschulen
Abbildung 3: Kategorisierung der Strukturmerkmale einer Bewegten Schule
Abbildung 4: Anschlussmöglichkeiten von Bewegungshausaufgaben
1 Einleitung
Unsere Gesellschaft ist so sportlich wie nie zuvor. Nicht zuletzt verantwortlich dafür sind die Medien, die heutzutage eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Überall wird man mit durchtrainierten, dynamischen und top-gestylten Werbefiguren konfrontiert, die einem suggerieren, dass ein fittes und gesundes Aussehen der Schlüssel zum Erfolg ist. Mit einem fitten Körper werden positive Eigenschaften assoziiert. Komplementär ist das konstant wachsende Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft, unterstützt durch zahlreiche Studien, die die Wichtigkeit des Sporttreibens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden belegen. Den sogenannten Zivilisationskrankheiten, wie Adipositas, Herz- Kreislaufbeschwerden oder Diabetes Typ 2, die in unserer Gesellschaft inflationär anzutreffen sind, kann mit Sport vorgebeugt werden.
Doch an den Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft scheinen die Feststellungen und Empfehlungen vorüberzugehen. Ihnen fehlt noch das nötige Gesundheitsbewusstsein, das im Erwachsenenalter ausgeprägter wird. Sie verbringen ihre Freizeit lieber zu Hause vor dem Computer, dem Fernseher oder der
Playstation. Diese bewegungsarme Freizeitgestaltung hat nicht nur dramatische Folgen auf die körperliche, sondern ebenfalls auf die geistige sowie die emotionale und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen (Zimmer, 2004).
Dass dieser Entwicklung entgegengewirkt werden muss, kann kaum mehr geleugnet werden. Dabei ist es von großer Relevanz, dass dies bereits in jungen Jahren vollzogen wird. Gerade die Ganztagsschule, die sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut und eine Instanz darstellt, in der die Kinder und Jugendlichen die meiste außerfamiliäre Zeit verbringen, muss in diesem Zusammenhang Verantwortung dafür übernehmen, dass die Schülerinnen und Schüler[1] in Deutschland wiederkehrend mehr Bewegungsmöglichkeiten erhalten. Durch die Verlängerung des Schultages, die mit der Umstellung von einer Halbtagsschule auf eine Ganztagsschule einhergeht, bietet die Ganztagsschule eine hervorragende Möglichkeit, über den regulären Sportunterricht hinaus mehr Bewegung in den Alltag der Kinder zu implementieren.
Aus diesem Grund soll in dieser wissenschaftlichen Arbeit der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit die Ganztagsschulen in Deutschland dieser Verantwortung nachkommen und den Bereich Bewegung, Spiel und Sport in ihr Schulleben integrieren. Zu diesem Zweck soll eruiert werden, welche Ansätze existieren und wie diese charakterisiert sind.
Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit widmet sich der Definition einer Ganztagschule sowie ihrer historischen Betrachtung. Darüber hinaus werden im ersten Kapitel die Begründungen für die Ganztagsschule dargestellt und nachfolgend kritisch betrachtet.
Im Fokus des zweiten Kapitels steht der Stellenwert des Bereiches Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule. Dabei wird zusätzlich auf die veränderte Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen Bezug genommen und die Begründungen für den Bereich Bewegung, Spiel und Sport aufgeführt.
In der Folge werden im dritten Kapitel die aktuellen Entwicklungslinien im Bereich Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule demonstriert. Die Betrachtung der Kooperation zwischen der Ganztagsschule und dem Sportverein runden dieses Kapitel ab. Im Anschluss daran wird im vierten Kapitel das Konzept der Bewegten Schule exemplarisch vorgestellt.
Auf der Grundlage von verschiedenen empirischen Untersuchungen wird im fünften und letzten Kapitel der aktuelle Forschungsstand zu dem Bereich Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule dargestellt.
2 Ganztagsschule- Definition, historische Entwicklung und Begründungen
Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Terminus „Ganztagsschule“ und dient der Einführung in die Thematik. Dabei soll zunächst mit Hilfe der Kultusministerkonferenz (2014) und dem Ganztagsschulverband e.V. der Frage nachgegangen werden, was eine Ganztagsschule definiert. Im Anschluss daran wird im zweiten Teil des Kapitels die historische Entwicklung der modernen Ganztagsschule in Deutschland betrachtet. Die Darstellung der Begründungen für die Ganztagsschule und die kritische Betrachtung dieser runden dieses Kapitel ab.
2.1 Definition
Um der Frage nachgehen zu können, was eine Ganztagsschule definiert, muss eine Abgrenzung zur herkömmlichen Halbtagsschule durchgeführt werden. Ein grundsätzliches Merkmal der Ganztagsschule ist, dass der Unterricht an dieser über den Vormittag hinausgeht (Rahm, Rabenstein & Nerowski, 2015). Jedoch ist die Reduktion auf dieses grundsätzliche Merkmal zu unpräzise, da infolgedessen jedes Gymnasium, auf Grund der Tatsache, dass an den meisten Gymnasien der Unterricht auch am Nachmittag stattfindet und somit über den Vormittag hinausgeht, eine Ganztagsschule wäre (Rahm et al., 2015).
Folglich ist dieses Merkmal zur Definition einer Ganztagsschule nicht ausreichend. Deswegen sollen im Folgenden zwei unterschiedliche Definitionen des Begriffs „Ganztagsschule“ vorgestellt werden, um das Verständnis dessen näher bestimmen zu können.
Die Kultusministerkonferenz (KMK), die ein „Gremium zur Koordinierung der bildungspolitischen Vorhaben der einzelnen Bundesländer“ (Rahm et al., 2015, S.15) ist, definiert den Begriff „Ganztagsschule“ wie folgt:
„Unter Ganztagsschulen werden Schulen verstanden, bei denen im Primar- oder Sekundarbereich I:
an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst;
an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein Mittagessen bereitgestellt wird;
die Ganztagesangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung durchgeführt werden sowie in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.“ (Rahm et al., 2015, S.15 zit. n. KMK 2014, S.9)
Somit postuliert die Kultusministerkonferenz, dass an einer Ganztagsschule mindestens an drei Tagen in der Woche ein Angebot für die SuS bereitgestellt werden muss, das mindestens sieben Zeitstunden umfasst. Dabei ist es irrelevant, wie viele SuS an diesem Angebot teilnehmen und in welchem Umfang sie dies tun (Rahm et al., 2015). Des Weiteren geht aus der Definition hervor, dass den SuS an den Tagen, an denen das Ganztagsprogramm stattfindet, von Seiten der Schule ein Mittagessen bereitgestellt werden muss. Zusätzlich fordert die Kultusministerkonferenz, dass die Schulleitungen die Verantwortung für die Angebote der Ganztagsschule tragen und diese Angebote in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem schulischen Unterricht stehen sollen. Demnach kann eine Schule, „die am Nachmittag nur Spiele zum Zeitvertreib anbietet“ (Rahm et al., 2015, S.16) nicht als Ganztagsschule angesehen werden.
Die zweite Definition zu dem Begriff „Ganztagsschule“, die in dieser wissenschaftlichen Arbeit aufgezeigt werden soll, ist auf den Ganztagsschulverband GGT e.V. zurückzuführen. Dieser ist eine „Initiative zur Förderung des Ausbaus qualitativ hochwertiger Ganztagsschulen“ (Rahm et al., 2015, S.19).
„Eine Ganztagsschule gewährleistet nach der Definition des Ganztagsschulverbandes GGT e.V., dass
allen Schülerinnen und Schülern ein durchgehend strukturiertes Angebot in der Schule an mindestens vier Wochentagen und mindestens sieben Zeitstunden angeboten wird,
Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler am Vormittag und am Nachmittag in einem konzeptionellen Zusammenhang stehen,
erweiterte Lernangebote, individuelle Fördermaßnahmen und Hausaufgaben/Schulaufgaben in die Konzeption eingebunden sind,
die gemeinsame und individuelle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler als pädagogische Aufgabe im Konzept erhalten ist,
ihre Angebote altersgerechte Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen fördernd aufgreifen
alternative Unterrichtsformen wie z.B. Projektarbeit ermöglicht werden,
das soziale Lernen begünstigt wird,
die Schule den Schülerinnen und Schülern an allen Schultagen ein warmes Mittagessen anbietet,
eine ausreichende Ausstattung mit zusätzlichem pädagogischen Personal, mit einem erweiterten Raumangebot und mit zusätzlichen Lehr- und Lernmitteln vorhanden ist,
die Organisation aller Angebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schule steht.“ (Rother, 2003, S.4)
Vergleicht man die Definition des Ganztagsschulverbandes mit der Definition der Kultusministerkonferenz, so lässt sich konstatieren, dass sie durchaus einige Gemeinsamkeiten, jedoch ebenfalls einige Unterschiede aufweisen.