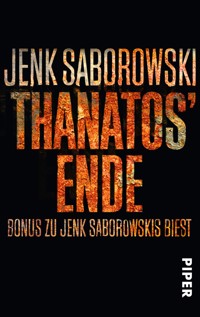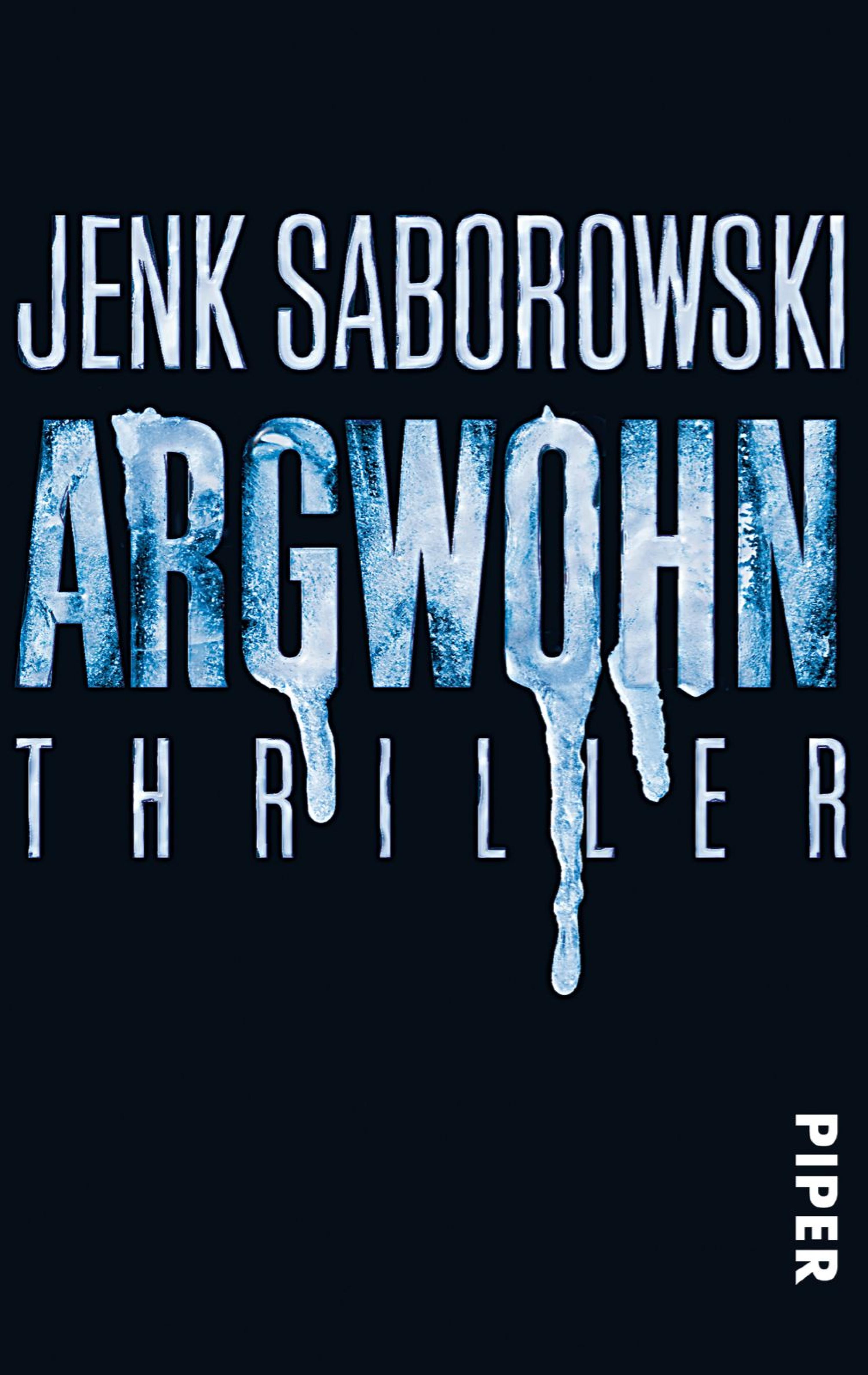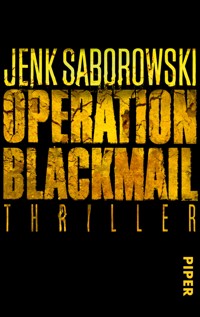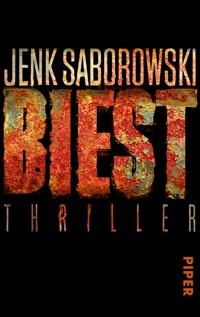
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der gefährlichste Computervirus der Welt gelangt in die Hände von Terroristen. Ein Anschlag, der bis gestern noch undenkbar schien, steht unmittelbar bevor. Mitten im Herzen Europas. Welche Rolle spielt der ehemalige Stasi-Funktionär, den der Journalist Marcel Lesoille in Tel Aviv fotografiert? Gemeinsam mit Agent Solveigh Lang von der europäischen Geheimpolizei ECSB verfolgt er eine Spur bis nach St. Petersburg und Berlin. Können sie gemeinsam die Katastrophe verhindern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Das »Biest« ist eine fiktive Geschichte. Ereignisse, Personen und Institutionen sind frei erfunden, jede Übereinstimmung mit der Realität wäre reiner Zufall.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95901-8
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur
Umschlagfoto: cg Textures
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
PROLOG
Moskau, Russland Juni 2011
Die ausladenden Kronleuchter des großen Saals im Kreml funkelten heute nur für Freunde des ewigen Präsidenten. Der normalerweise für den Empfang von Staatschefs reservierte, riesige Raum mit auf Hochglanz poliertem, reich mit Intarsien verziertem Parkett und den höchsten Decken, die Russland zu bieten hatte, stammte aus einer Zeit alter Größe. Aber Zeit und Größe verloren von jeher an den riesigen Pforten des russischsten aller Gebäudekomplexe Moskaus ihre Bedeutung. Was letztere Einschätzung anging, hätte der Präsident im Scherz behaupten können, selbst die Lubjanka, jenes berühmt-berüchtigte KGB-Gefängnis, sei russischer als ausgerechnet der Kreml. Ein lautes Lachen wäre dieser Bemerkung zwangsläufig gefolgt, natürlich nur ein Scherz. Der heutige Abend unter handverlesenen Freunden des russischen Staatsoberhaupts, begleitet von sanften Streicherklängen und im funkelnden Licht der Kandelaber, war ein perfekter Anlass für solche intimen Scherze, deren Wahrheitsgehalt und ihre Undenkbarkeit zugleich die eigentliche Pointe bildeten.
Das Biest, von dem niemand, der noch lebte, wusste, warum er so genannt wurde, betrat den Saal in Begleitung seiner Gattin um genau 19.55 Uhr, wie ihm ein zufriedener Blick auf seine reich verzierte goldene Armbanduhr verriet. Er kannte das Protokoll immer noch gut genug, um pünktlich zu sein, ohne wie ein alberner Speichellecker zu wirken. Er lächelte seiner Frau zu und hoffte, dass sie die Verlogenheit dahinter nicht bemerkte, denn natürlich wäre er viel lieber mit Mascha zum Präsidenten gegangen. Seine Augen schweiften unauffällig durch den Saal, und er entdeckte jede Menge bekannter Gesichter. Kein Wunder, schließlich drängte sich die halbe neue Elite Russlands um die gigantische Tafel, die sich wie in guten alten Zeiten unter opulenten Platten mit erlesenen Köstlichkeiten bog und die in etwa achtmal so viel Essen aufbot, wie die versammelte Runde in einer Woche hätte vertilgen können. Heute Abend galten die neuen Gesetze nicht, die vorschrieben, dass sich die russische Seele an die westliche Kultur annähern sollte, um nicht gestrig zu wirken. Das Biest lächelte ob des kleinen, aber für den Präsidenten bedeutenden Signals. Diese Nacht galt als Signal für die tiefe Verbundenheit der alten Machtzirkel mit der neuen dünnen Elite, die wie smarte Investmentbanker aussah, sich gewählt ausdrückte und weniger Wodka trank. Sie erfüllten auch heute Abend ihre perfekte Zweckehe, die Ex-KGB-Funktionäre und die neuen Eigentümer ehemaliger Staatsunternehmen wie Gazprom und Vneshtorgbank. Eine neue Runde mit den gleichen Spielern und ihren Ziehsöhnen. Während das Biest darüber sinnierte, betrachtete er das lilafarbene Abendkleid seiner Gattin und stellte sich seine zweiundzwanzigjährige Geliebte darin vor, was seine Frau mit resignierter Miene zur Kenntnis nahm. Sie standen etwas abseits, am Rand des riesigen Saals, und er starrte mit leeren Augen in die Menge. Wieder einmal wurde ihm nur allzu deutlich, dass er zwar dabei sein durfte, aber dennoch weit davon entfernt war, zu ihnen zu gehören. Er stand in der zweiten Reihe zwischen den Stühlen. Auch er hatte im Westen studiert, aber eben nicht in Harvard oder Cambridge, sondern nur an der Columbia. Von Jelzin hatte er einst die größte Tankstellenkette des Landes und einen Futtermittelhersteller erschlichen, abgesichert über einen Kredit bei einer Bank, die dann in die Pleite gerutscht war. Nicht nur seiner, sondern die Kredite der meisten hier Anwesenden waren als nicht pfändbar eingestuft worden, worüber jeder unabhängige Wirtschaftsprüfer nur den Kopf geschüttelt hätte. Doch nicht so der Insolvenzverwalter jener Bank, der in diesem Moment auf der anderen Seite des Raumes stand und gelangweilt die Perlen in seinem Champagnerglas zählte. Die Unternehmen besaß das Biest längst nicht mehr, er hatte sie gegen lukrativere Beteiligungen eingetauscht. Er war schon immer das Deut cleverer gewesen, das ihn heute zum Außenseiter stempelte. Wortlos nahm er seine Frau am Arm und schob sie in Richtung der für sie vorgesehenen Plätze, etwa zwanzig Stühle vom Gastgeber entfernt. Wenigstens als er sich setzte, erntete er das eine oder andere Schulterklopfen, mehr gönnerhaft als freundschaftlich. Dabei besaß auch er selbst unermesslich viel Geld, er war nahe daran, ein Milliardär zu sein, zumindest auf dem Papier. Aber was zählte heute Abend schon eine Milliarde? In der Nähe des Präsidenten saßen Männer, deren Spesenkonto ähnlich viele Nullen aufwies wie sein gesamtes Investment-Portfolio. Als ihr Gastgeber endlich an sein Glas klopfte und ihn damit aus seinen selbstzerstörerischen Gedanken riss, tätschelte er als eine Geste des guten Willens den Saum des Kleids seiner Frau, sie lächelte ein wenig versonnen und ein wenig verächtlich. Ihr Tisch hatte kaum die erste Schicht des Kaviarbergs auf dem großen Tablett abgetragen, als ein alter Bekannter, der deutlich näher beim Präsidenten saß, unvermittelt aufstand und das Glas erhob: »Auf ein starkes Russland!«, prostete er in die Runde. Gelangweilt schloss er sich dem Prosit an. Offenbar führten sie einige Tische weiter eine deutlich interessantere Unterhaltung. Es war offensichtlich, dass der Trinkspruch für alle anderen aus dem Zusammenhang gerissen war.
»Meine lieben Freunde«, hallte plötzlich die kräftige Stimme des Präsidenten durch den Saal. »Wo er recht hat, hat er recht. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten.« Wie immer klang seine Stimme nüchterner als die der anderen. Er hatte diese Symbiose eigens geschaffen, der Reichtum der smarten jungen Männer war sein Teil ihrer stillen Abmachung, die im Gegenzug unbedingte politische Loyalität verlangte. Diejenigen von ihnen, die sich gegen ihn gewandt hatten saßen im Gefängnis, wegen Steuerhinterziehung oder Hochverrats.
»Die Stärke Russlands ist heute mehr denn je in Gefahr. Der russische Bär ist müde geworden über die Jahre, der Hunger macht ihm zu schaffen, und die Einnahmen aus der Schaustellerei, die sich Weltzirkus nennt, sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.« Er lachte laut, während sich der Rest des Tisches betreten abwendete. Dabei hatte er natürlich recht. Er sprach nur aus, was die dekadenten Milliardäre am Tisch angesichts ihres eigenen Luxuslebens nicht mehr interessierte. Politisch und volkswirtschaftlich steuerte Russland auf die Bedeutungslosigkeit zu. In dem Maße, in dem die Rohstoffe an Wichtigkeit verloren, schwand die Zukunftsfähigkeit ihres Landes. »Das Einzige«, fuhr ihr Gastgeber fort, »das Einzige, was Russland wirklich helfen würde, wären explodierende Rohstoffpreise. Unsere einzige Rettung ist noch immer dieses wunderbare Land.«
Was meint er damit?, fragte sich das Biest. Er sollte es in der nächsten Sekunde erfahren, und diese Sekunde würde sein Leben verändern, obwohl er das zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte. Denn der alte und nach einem beispiellosen Coup auch der nächste Präsident des Landes fuhr fort: »Ich bitte euch, darüber nachzudenken bei euren Geschäften und Transaktionen«, skandierte er wie bei einer launigen Rede zu einem dieser lächerlichen amerikanischen Charity-Dinner, »wie können wir sie dazu bringen, uns mehr für unsere wertvollen Güter zu bezahlen? Egal, mit welchen Mitteln.« Er lachte laut. »Auf unser wunderbares Land, meine Freunde.« Dazu streckte er das halb volle Wodkaglas vors Gesicht. Erst waren es nur vereinzelte Lacher, aber je mehr der Anwesenden die gelungene Mischung aus Scherz und aberwitziger Wahrheit bewusst wurde, desto mehr stimmten ein. Alle leerten ihre Gläser in einem Zug, und der Präsident lachte selbstzufrieden in die Runde. Das Biest hatte das Gefühl, dass sein Blick eine halbe Sekunde länger an seinen Augen kleben blieb als an allen anderen. Egal, mit welchen Mitteln? Er hatte doch nur einen Scherz gemacht, oder nicht? Er zog mit dem Messer eine Linie in den Berg aus Kaviar auf seinem Teller und zerschnitt abwesend einen der köstlichen Blini, den nächsten Trinkspruch hörte er kaum. Der brillante Verstand des Biests hatte angefangen zu arbeiten.
TEIL 1
Man muss wissen, dass es zwei Arten zu kämpfen gibt, die eine nach Gesetzen, die andere durch Gewalt; die erste ist die Sitte der Menschen, die andere die der Tiere. Da jedoch die erste oft nicht ausreicht, so muss man seine Zuflucht zur zweiten nehmen. Ein Fürst muss daher sowohl den Menschen wie die Bestie zu spielen wissen.
Niccolò Machiavelli
Der Fürst
1513
KAPITEL 1
Amsterdam, Niederlande 03. September 2012, 21.23 Uhr (drei Monate später)
Solveigh Lang lag rücklings auf der sehr unbequemen Chaiselongue in ihrem Wohnzimmer und versuchte, ein Buch zu lesen. Genauer gesagt versuchte sie, einen Western zu lesen, was sie zum einen noch niemals in ihrem Leben getan hatte und was ihr zum anderen auch niemals eingefallen wäre, hätte die Buchhändlerin in der Willemstraat es ihr nicht wärmstens ans Herz gelegt. Natürlich wusste ihre Buchhändlerin nichts von ihrem teils bis ins Abnorme gesteigerten Geruchsinn, sonst hätte sie ihr gerade diesen Roman wohl kaum empfohlen, denn er stellte das 19.Jahrhundert keineswegs verklärt dar, sondern so, wie es wohl war. Mit stinkenden Badehäusern, mannigfaltigen Geschlechtskrankheiten, die allerhand Beschwerden verursachten und die sich Solveigh nicht einmal vorstellen wollte, und eben mit Dreck, fauligen Tümpeln und ungewaschenen Huren. Ein gutes Buch, aber was ihre Nase anging, eine echte Herausforderung. Solveigh legte den Band beiseite und goss sich einen zweiten Schluck Rotwein ein, um ihren schärfsten Sinn zu versöhnen. Eine Strähne ihrer dunkelbraunen, gewellten Haare fiel ihr ins Gesicht. Sie setzte das große Glas an und sog die Aromen auf, der Wein duftete nach roten Beeren, reifer Pflaume und einem Hauch Grafit. Ein schwerer Wein, von dem sie hoffte, dass er sie ein wenig müde machen würde. Sie wusste, dass sie dringend Schlaf brauchte, sie war erst heute Morgen nach einem kräftezehrenden Einsatz in Krakau gelandet, und die stundenlange Abschlussbesprechung hatte auch nicht gerade dazu gedient, ihre Batterien wieder aufzuladen. Dafür konnte sie im eigenen Bett schlafen, was für Solveigh schon fast ein kleiner Luxus war. Ihr Job als Special Agent der Europäischen Sondereinheit ECSB, die sich mit paneuropäischen Verbrechen beschäftigte, brachte jede Menge Flugmeilen und Zugkilometer mit sich. Ihr Job waren die Täter, die sich um keine Staatsgrenzen scherten und die Tatsache auszunutzen wussten, dass Europol immer noch keine operativen Befugnisse erhalten hatte. Und es wurden immer mehr: Die Mafia, Schleuserbanden, Drogen, Terroristen, das war die Klientel der ECSB. Willkommen im vereinten Europa, murmelte sie in ihr Weinglas und warf einen Blick auf die Prinsengracht, an der sie eine kleine, aber durchaus schicke Wohnung in einem der typischen Amsterdamer Häuser bewohnte: schmal und mit einem spitzen Giebel, dessen Kran noch Anfang des letzten Jahrhunderts Waren und Güter in das jetzt ausgebaute Dachgeschoss gehievt hatte. Solveigh hatte die obersten beiden Stockwerke des Hauses angemietet, was deutlich luxuriöser klang, als es tatsächlich war: Zweiundsiebzig Quadratmeter heller Holzboden mit schwarz gestrichenen Deckenbalken und weißen Wänden. Aber immerhin ein selbst erarbeitetes Zuhause, so sah es Solveigh, die in einem Hamburger Problembezirk aufgewachsen war.
Die Prinsengracht lag in dichtem Nebel, den die Straßenlaternen kaum durchdrangen, und die vorbeieilenden Studentengruppen lachten dumpf zu ihrem spitzen Fenster herauf. Sie mochte dieses kleine Disneyland von einer Stadt inmitten der Kanäle mit den unentwegt klingelnden Fahrradfahrern und den windschiefen Gebäuden, die aussahen wie Puppenhäuser. Sie setzte gerade das Glas an, um einen weiteren Schluck Wein zu trinken, als ihr Handy klingelte. Sie griff nach links und fummelte in der Sofaritze nach der glatten Oberfläche. Eine SMS. Die Nachricht war von Marcel, er musste am Flughafen in Frankfurt umsteigen und wartete auf seine Maschine nach Tel Aviv, eine heillose Verspätung inklusive. Seine SMS waren seltener geworden, stellte Solveigh fest. Und weniger aufregend, mehr alltäglich. Am Anfang ihrer Beziehung, die nun schon fast ein Jahr dauerte, hatten sie sich fast täglich geschrieben. Solveigh während eines Einsatzes irgendwo in Europa und er in seinem alten Leben bei seiner Exfreundin Linda in seiner Pariser Studentenbude. Seitdem hatte er sich sehr verändert, größtenteils zum Positiven, vielleicht sogar durch sie. Sie schickte eine schnelle Antwort und wünschte ihm alles Gute für seinen ersten Auftrag. Als sie die Nachricht abgeschickt hatte, fragte sie sich, ob sie zu geschäftsmäßig geklungen hatte. Nachdenklich nahm sie noch einen Schluck Rotwein. Sie hoffte nicht, aber sie wusste es nicht mehr so genau, zumindest heute nicht. Solveigh merkte, wie der Wein sie schläfrig machte. Sie legte sich auf die Seite und starrte noch eine Weile hinüber zur Küchenzeile, wo die Uhr der Mikrowelle 23.04 anzeigte, als sie plötzlich ein vertrautes Geräusch wahrnahm. Sie bekam einen Anruf auf ihrem Laptop. Das leise Zirpen wurde langsam lauter. Das konnte nur Eddy sein, ihr engster Kollege und bester Freund, der vermutlich wie so oft bis spätabends im Büro saß. Der, dem sie diese Wohnung zu verdanken hatte und ihren Job bei der ECSB. Seufzend stand Solveigh auf und ging hinüber zu ihrem Schreibtisch, der genau vor der großen Fensterfront stand. Tatsächlich war es Eddy, dessen Konterfei sie bereits vom Monitor anlächelte. Allerdings nicht aus dem Büro, sondern offenbar aus einer Kneipe, im Hintergrund erkannte sie die langen Flaschenreihen seiner Lieblings-Tapasbar. Eddy Rames war Spanier und verzichtete als solcher ungern auf ein gutes, spätes Abendessen, auch wenn es hieß, dass er seinen Rollstuhl über die nicht behindertengerechte Treppe im Saragossa wuchten musste. Sie griff nach ihrer Brille, einem dickrandigen Designermodell, in dessen Gestell eine hochauflösende Kamera verbaut war. Es war ein wichtiger Teil ihrer Ausrüstung und diente normalerweise dazu, dass Eddy auf seinem Bildschirm in der Zentrale stets das sehen konnte, was sie bei einem Feldeinsatz vor Augen hatte. Heute würde es ihm etwas anderes zeigen. Solveigh setzte die Brille auf die Nase und lief die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Sie schaltete das Licht ein und zerwühlte das Laken. Der Laptop würde die Kamera als Signalquelle von alleine erkennen. Wunder der Technik, oder besser: der Militärtechnik, korrigierte sich Solveigh. Es hat schon seine Vorzüge, die gesamten Ressourcen der Europäischen Union anzapfen zu können, dachte Solveigh, als sie die Taste drückte, um das Gespräch anzunehmen.
»Eddy«, sagte sie mit gespielt vorwurfsvollem Ton. »Siehst du das da? Das ist ein Bett, mein Bett. Und weißt du, was hier nicht stimmt?« Ohne seine Antwort abzuwarten, sagte sie: »Richtig. Ich liege nicht drin. Eddy, was willst du?«
»Slang, hör zu, es gibt Neuigkeiten …«
Er nannte sie bei ihrem Spitznamen, so weit alles wie immer. Aber sein Tonfall ließ sie stutzen. Irgendetwas musste passiert sein, hier ging es nicht um eine ihrer durchaus üblichen längeren Abendunterhaltungen über das Chatprogramm der ECSB, das sich nicht nur für die Polizeiarbeit, sondern auch perfekt zum Schachspielen eignete.
»Was ist los, Eddy?«
»Sitzt du?«, fragte ihr Kollege, der sonst jedes Wort auf die Goldwaage legte und jedes Gramm davon zu viel als Verschwendung erachtete.
Solveigh hatte gelernt, ihm blind zu vertrauen, auch wenn sie keine Ahnung hatte, weswegen, in Gottes Namen, sie sich hätte hinsetzen sollen. Trotzdem ließ sie sich auf der niedrigen Kante ihres Betts nieder. Natürlich sah Eddy jede ihrer Bewegungen, sodass er nicht auf ihre Bestätigung warten musste.
»Er hat anbegissen, Slang.«
Solveigh wurde schlagartig hellwach und nüchtern. »Er, heißt, ER, oder?«, fragte sie flüsternd.
»Ja, Solveigh. Und diesmal kriegen wir ihn, das verspreche ich dir. Wenn ich mein Bier ausgetrunken habe, treffen wir uns im Büro, in Ordnung?«
Solveigh seufzte und griff nach ihrer Hose: »Manchmal wünschte ich, an dem Klischee der entspannten Südländer ohne jede Arbeitsmoral wäre doch etwas dran.«
Aber natürlich hatte er recht. Wenn es um IHN ging, konnten sie sich keine Verzögerung leisten. Und keinen Fehler. ER war der Einzige, der die ECSB jemals geschlagen hatte. Und keiner von ihnen würde das jemals vergessen.
KAPITEL 2
Moskau, Russland 04. September 2012 (einen Tag später)
Dimitrij Sergejewitsch Bodonin legte den Ball auf den Elfmeterpunkt, und obwohl er nach siebenundachtzig Minuten bereits schwitzte wie ein Wasserbüffel auf der Flucht, lief es ihm jetzt eiskalt den Rücken hinunter. Er war der Kapitän, bei ihm lag die Verantwortung, gerade bei einem 0:1-Rückstand gegen ein erdrückend überlegenes Team. Und obwohl es bei der Klasse, in der ihr zusammengewürfelter Haufen antrat, um nichts weiter ging als Ruhm und Ehre an der Technischen Universität, spürte er dennoch die Last der Erwartungen auf seinen Schultern. Tonnenschwer. Und elf Augenpaare plus die auf der Bank, die sich in seinen Rücken bohrten. Noch einmal bückte sich Dimitrij zum Leder hinunter – nur um Zeit zu gewinnen – und drehte den Ball einmal in der Luft, um ihn auf dem gleichen Punkt wieder abzulegen. Er atmete tief ein, beugte den Oberkörper leicht nach links, um dem Torwart anzudeuten, dass er das rechte Eck wählen würde. Die Sonne trat hinter einer Wolke hervor. Zu spät. Er lief an, riss im vollen Lauf das rechte Bein nach hinten und drosch das Leder Richtung Kasten …
Zwanzig Minuten später standen die Mitglieder des Uni-Freizeitclubs FC Sehr Roberto unter der Dusche, und Viktor klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter.
»Mach dir nichts draus, Dimitrij Sergejewitsch, das kann jedem passieren. Außerdem stand die Sonne wirklich beschissen.« Dimitrij glaubte dem üblicherweise Poloshirts tragenden Juppie kein Wort. Natürlich nahm er den misslungenen Elfer persönlich, Sonne hin oder her, aber er ließ es sich nicht anmerken. Schließlich gab es noch ein nächstes Spiel, und der Trupp sollte nicht von einem frustrierten Kapitän weiter demoralisiert werden. So lächelte er Viktor zu und drückte gedankenlos eine extragroße Portion Haarwaschmittel aus der Plastikflasche.
Auf dem Parkplatz lief ihm Viktor zum zweiten Mal über den Weg, die Haare frisch gegeelt, Sonnenbrille im Haar. Sie kannten sich noch nicht sonderlich gut, Viktor spielte erst seit zwei Monaten in ihrem Verein und studierte Wirtschaft und nicht Computerwissenschaften, wie die meisten anderen.
»Hey, Dimi«, nannte Viktor ihn bei seinem Kosenamen, der ihm verhasst war, aber auch das ließ er sich gegenüber seinen Freunden nicht anmerken, »sehen wir uns heute Abend im Prospekt?« Dimitrij seufzte innerlich. Während Viktor seine Sporttasche in einem scheinbar nagelneuen Golf verstaute, nutzte er die Zeit, um nachzudenken. Das Prospekt war ein unter Studenten sehr angesagter Klub, aber leider auch entsprechend kostspielig. Sein Budget als Sohn eines mittleren Angestellten und einer Russischlehrerin reichte für maximal zwei Besuche eines solchen Klubs im Monat. Und obwohl er schon an seiner Kandidatur-Dissertation schrieb, war er auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen.
»Hey, was ist das Problem?«, fragte Viktor und legte einen Arm um ihn. »Wenn es um die Kohle geht, mach dir keine Gedanken, mein Alter zahlt.«
Dimitrij blickte ihn skeptisch an, aber Viktor grinste nur verschwörerisch: »Er hat mir gesagt, ich könne mitnehmen, wen ich wolle. Sein schlechtes Gewissen, dass er sich so wenig um mich kümmert, weißt du?«
Dimitrij nickte. Was hätte er auch sonst tun sollen? Und wenn er ehrlich war, wollte er natürlich ins Prospekt. Die schärfsten Bräute an der Uni gingen ins Prospekt.
»Weißt du was?«, raunte Viktor ihm konspirativ zu. »Manchmal glaube ich, ich liebe sein schlechtes Gewissen mehr als ihn selbst.«
Vielleicht war er ja doch kein so schlechter Kerl, dachte Dimitrij auf dem Rückweg in seine Wohnung. Immerhin schien er mit der Kohle seines Vaters ganz okay umzugehen. Klar, er ließ es ein bisschen raushängen, aber bei Weitem nicht so schlimm wie viele andere. Ich muss dringend rauskriegen, wer eigentlich sein Vater ist, nahm sich Dimitrij vor und stellte in seinem Kopf schon einmal die Suchbefehle zusammen. Während er durch die grauen Betonklötze des Studentenwohnheims lief, schrieb er im Kopf dazu ein kleines Computerprogramm, das ihm vielleicht noch etwas mehr über Viktors Vater verraten würde. Das waren die Privilegien eines armen Studenten, aber immerhin eines Studenten der besten Hightech-Uni, die Russland zu bieten hatte.
Die Schlange vor dem Prospekt an diesem Abend war lang, die überwiegend jungen, gut angezogenen und vor allem gut aussehenden Menschen scharten sich fast den gesamten roten Klinkerbau entlang bis zur nächsten Straßenecke. Geduldig reihte sich Dimitrij am Ende der Schlange ein und flirtete mit dem Mädchen vor ihm, einer rothaarigen, zierlichen Kommilitonin, die er aus der Mensa kannte. Sie trug ein weißes Tanktop, einen sehr kurzen Rock und Schuhe mit den höchsten Absätzen, die Dimitrij je gesehen hatte. Sie amüsierten sich prächtig, und Dimitrij gelangte zu der Überzeugung, dass er sich bei ihr vielleicht sogar eine Chance ausrechnen durfte. Wenn nicht wieder einer dieser neureichen Schnösel mit den großen Autos und Brieftaschen so dick wie seine Doktorarbeit auftauchte und sie ihr im letzten Moment wegschnappte. Junge Russinnen, wie wahrscheinlich junge Frauen überall auf der ganzen Welt, konnten unglaublichem Reichtum einfach nicht widerstehen. Geld schon, kein Mädchen heiratete einen Mann seines Geldes willen, wenn er nur doppelt so viel verdiente wie sie. Aber die Sorte Reichtum, bei dem Geld keine Rolle mehr spielte, die Jachten, die Villen in Cannes, die Ferraris, das war etwas anderes. Die Schlange bewegte sich kaum, es konnte Stunden dauern, bis sie auch nur einen Fuß in den Klub setzen würden, aber Dimitrij genoss die Zeit mit Maja. Sie lachte gerade über einen seiner Scherze, als ihm jemand den Arm um die Schulter legte.
»Da bist du ja endlich«, begrüßte ihn Viktor. »Was ist los, wollen wir nicht reingehen? Komm mit!« Er zog ihn weg von Maja, aber Dimitrij wollte Maja auf keinen Fall alleine lassen.
»Maja kommt mit«, sagte Dimitrij bestimmt. Viktor zuckte mit den Schultern und lief vorneweg, an der gesamten Schlange vorbei bis zum Eingang. Als Viktor das schwarze Schirmchen am VIP-Eingang sah, unter dem dunkel gekleidete Türsteher die Arme verschränkten, wurde Dimitrij klar, warum sich Viktor aufführen konnte, als gehörte ihm der Club höchstpersönlich. Sie zierte das Logo der Wodkafabrik, bei der sein Vater als CEO arbeitete. Die neue obere Mittelschicht. Bei Weitem unterhalb der Oligarchen, aber für russische Verhältnisse astronomische Gehälter auf Westniveau, wie Dimitrij seit heute Nachmittag aufgrund eines Geschäftsberichts auf der Firmenwebsite wusste. Als die Security-Leute ihnen die Tür aufhielten, warf er einen Blick auf Maja. Sie sah sehr glücklich und stolz aus. In diesem Moment beschloss Dimitrij, dass es gut war, Viktor als Freund zu haben, auch wenn er ihn anfangs für einen aufgeblasenen Schnösel gehalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt machte er sich keine Gedanken darüber, welchen Preis diese Freundschaft mit ihren Privilegien haben könnte. Das kam später.
KAPITEL 3
Tel Aviv, Israel 04. September 2012 (zur selben Zeit)
Der bis auf den letzten Platz gefüllte Airbus A 340 setzte mit über zwei Stunden Verspätung zur Landung an. Marcel Lesoille seufzte, als der Fensterplatz die Sandalen über seine blauen Socken zog, kaum dass der Pilot die Anschnallzeichen ausgeschaltet hatte. Pflichtschuldig schälte er seine 1,85 Meter aus dem engen Sitz und stand gebeugt im Gang, während neben ihm seine Mitreisenden eifrig die Fächer leerten, nur um eine Minute länger am Gepäckband warten zu dürfen. Um die Zeit zu überbrücken, nahm er seine Kamera aus der gewachsten Messenger-Tasche und prüfte zum dritten Mal auf diesem Flug, ob die Batterien der 5000-Euro-Leica voll und der Speicherchip leer waren. Jungfräulich wie seine erste Freundin, grinste Marcel und starrte wieder dem aufgeregten Ehepaar vor ihm auf die gestreiften Hemdrücken. Zwei Reihen weiter vorne weckte eine junge Frau seine Aufmerksamkeit, die dem Bild, wie er sich Israelinnen vorgestellt hatte, schon ziemlich nahe kam. Schwarze dicht gelockte Haare, ein olivfarbener Teint und sehr geheimnisvolle, rabenschwarze Augen. Und sie schien ihn auch bemerkt zu haben. Er lächelte ihr zu, und sie wich seinem Blick nicht aus. Da sich Marcel mit Frauenblicken auskannte oder sich das zumindest einbildete, nahm er an, dass sie an ihm interessiert sein könnte. Grüne Augen, Lockenkopf, einigermaßen in Form, normalerweise funktionierte es. Auch frühe erste graue Haare mit Ende zwanzig hatten daran bis jetzt nichts geändert. Aber ihrem flüchtigen Interesse folgte kurz darauf eine unvermittelte Kühle, eine Distanz, die bei ihrem nicht einmal existenten Flirt überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Sie wirkte viel zu persönlich betroffen, vollkommen unsinnig. Über die Schultern des Ehepaares versuchte er ihren Blick zu erhaschen, diese schwarzen Augen zu fixieren, ihnen zuzulächeln, nur den Bruchteil einer Sekunde lang. Aber sie war abgetaucht in eine andere Welt, die sich in weiter Ferne abspielte und in die ihr Marcel nicht folgen sollte. Als er sich Zentimeter für Zentimeter durch den engen Gang des überlangen A 340 schob und mit einem freundlichen Lächeln einem allein reisenden Asiaten den Vortritt ließ, dachte er für einen Moment an Solveigh. Sie hatte einen Auftrag in Osteuropa, irgendetwas Wichtiges, Unaufschiebbares. Wie immer. Er hatte sie seit zwei Monaten nicht mehr gesehen, nur einmal, für zwei Stunden auf ein sonniges Picknick im Jardin des Tuileries. Keine Frage, sie war eine tolle Frau, dachte er, während er weiter vorne nach dem dunklen Haarschopf Ausschau hielt. Sie hatten so vielversprechend angefangen: er, der verirrte Medizinstudent auf Sinnsuche, und sie, die aufregende Polizistin irgendeiner geheimen Sondereinheit der EU-Kommission. Und sie hatte ihn mit ihrer schieren Willenskraft und ihrem unerschütterlichen Glauben daran, dass man alles erreichen kann, was man will, auf den richtigen Weg geführt. Auf die richtige Schiene gehievt, würde Solveigh sagen. Und es stimmte. Vom ambitionierten Hobbyfotografen hatte er es bis zu einem Praktikum bei der angesehenen Zeitung L’Echo Diplomatique gebracht. Immerhin. Er war fast schon ein richtiger Fotojournalist. Und seine letzte Reportage hatte sogar einen Preis gewonnen. Keinen wichtigen, aber immerhin einen Preis. Aber sollte er deshalb leben wie ein verdammter Mönch? Schließlich wusste er ja auch nicht, wen sie im Rahmen ihrer ach so geheimen Aufträge alles mit ins Bett nahm, oder? Egal, sie ist sowieso verschwunden, dachte er, als er den dunklen Lockenkopf am Gate immer noch nicht wieder zu Gesicht bekommen hatte. Er zuckte mit den Achseln. Wir werden sehen, was das Leben uns bringt. Tel Aviv und seine Frauen schienen ihm jedenfalls eine aufregende Alternative zu sein, auch wenn er immer noch nicht wusste, was er von diesem Land und seiner Politik halten sollte. Zu widersprüchlich waren all die Positionen, die er dazu in den letzten Jahren gehört hatte, und er war froh, dass ihm seine Story die Gelegenheit geben würde, sich selbst eine Meinung zu bilden.
Nachdem er die Passkontrolle hinter sich gelassen und bei dem Grund für seine Reise zumindest nicht die volle Wahrheit angegeben hatte, sammelte er sein Gepäck ein und betrat die große Ankunftshalle, in der Taxifahrer und einige Nonnen auf ihre jeweils sehr unterschiedliche Klientel warteten. Ein weitverzweigtes Brunnensystem aus Edelstahl, über dessen Kanten ständig Wasser von einem halb offenen Rohr zum nächsten Becken plätscherte, verbreitete den Geruch von Chlor. Was für eine Symbolik: Das 1948 gegründete Israel begrüßte Einreisende mit einem Brunnen, der nach Chlor stank. Ob dies von den Entscheidungsträgern beabsichtigt gewesen war, als sie der Installation zugestimmt hatten, wagte Marcel zu bezweifeln. Er schoss ein paar Fotos aus der Hüfte, um nicht aufzufallen. Die Präsenz der Sicherheitskräfte wirkte auf eine passive Art bedrohlich. Und man konnte sich nicht sicher sein, ob es geduldet wurde, den Flughafen Ben Gurion zu fotografieren, der als eines der terrorgefährdetsten Gebäude der Welt galt.
Als er durch die vergilbten Automatiktüren in die Sonne trat, sah er sie wieder, die geheimnisvolle Schönheit von Sitz 45H. Sie lehnte an einem Pfeiler aus Beton gegenüber dem Eingang des Flughafenbahnhofs und rauchte eine Zigarette. Er hätte schwören können, dass sie ihm hinter der dunklen Sonnenbrille direkt in die Augen sah, aber sie ließ sich nicht anmerken, ob sie ihn wiedererkannt hatte. Marcel blieb nichts anderes übrig, als die Treppe hinunter zu den Gleisen zu nehmen, ihm fiel auf die Schnelle einfach kein guter Grund an, sie anzusprechen. Auf der fünften Stufe klingelte sein Handy: Solveigh. Vielleicht ist es besser so, dachte Marcel, kurz bevor er die Taste zum Annehmen des Gesprächs drückte, und nahm sich vor, die dunkelhaarige Schöne diesmal wirklich zu vergessen.
Als Marcel am nächsten Tag in seinem einfachen Hotelzimmer aufwachte, schien ihm die Sonne durch die hauchdünnen Vorhänge direkt ins Gesicht. Er öffnete das Fenster und sah hinaus auf die viel befahrene Ben Yehuda, eine der Hauptverkehrsadern der Innenstadt, die parallel zur Strandpromenade Richtung Süden verlief und an der die meisten der günstigeren Hotels lagen. Da er weder Budget noch einen genauen Plan hatte, wie er seine Reportage über die israelische Sabotageaktion des iranischen Atomprogramms angehen sollte, beschloss er, einen Morgenlauf am Strand einzuschieben, um ein erstes Gefühl für die Stadt zu bekommen. Marcel liebte es, sich Städte joggend zu »erlaufen«, man schafft einige Strecke und kann sie trotzdem mit allen Sinnen genießen, anstatt in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder einem stickigen Taxi festzusitzen, wobei sein Budget Letzteres ohnehin nicht hergegeben hätte. Eine Dreiviertelstunde oder 8,5 Kilometer später stand er erfrischt unter der Dusche und wusste, dass auch Tel Aviv das klägliche Ergebnis stadtplanerischer Ideen der Siebzigerjahre war, die überall auf der Welt die Strände von Großstädten am Meer verschandelt hatten. Dicht verbaut und mit einer überaus schnell befahrenen Straße zwischen Innenstadt und Promenade, die mutige Fußgänger nur mit einem gewissen Gottvertrauen in die Bremswilligkeit der Tel Aviver überqueren konnten. Den Rest des Tages verbrachten Marcel und seine geliebte Leica in den Straßen der Stadt. Seinen Kontakt beim Mossad, dem israelischen Auslandsgeheimdienst, würde er erst morgen anrufen, er hatte die Maschine einen Tag früher als geplant erwischt, und so wusste niemand, dass er bereits im Land war. Zumindest dachte Marcel, dass niemand seine Ankunft wahrgenommen hatte.
Am Abend ließ sich Marcel am Tresen des Hotels ein Restaurant empfehlen und bekam ein Fischlokal auf der Dizengoff genannt, das sehr beliebt sei. Vor allem bei den Frauen, wie der einigermaßen schmierige Portier mit einem wissenden Grinsen ungefragt ergänzte. Achselzuckend fügte sich Marcel in sein Schicksal, wenigstens konnte er die Strecke vom Hotel locker laufen, und in die größte Shoppingmeile der Stadt hatte es ihn heute auch noch nicht verschlagen. Als er das kleine Lokal betrat, fiel sie ihm sofort auf: Dort saß an der Bar, hinter der sich die schlauchförmige offene Küche befand, sein Flirt aus dem Flugzeug, die langhaarige, sonderbare Schönheit, die ihn danach nicht mehr erkannt haben wollte. Sie war mit einer Freundin unterwegs, die beiden lachten ausgelassen. Marcel beschloss, diesen unglaublichen Zufall als Wink des Schicksals aufzufassen, und wählte einen Platz in der Ecke, sodass er ihr fast direkt gegenübersaß. Er bestellte einen Weißwein und grinste zu ihr herüber. Zwischenzeitlich schien sie ihre Erinnerung wiedergefunden zu haben, denn sie prostete ihm fröhlich zu, und als sich ihre Freundin eine halbe Stunde später verabschiedete, ergriff er die Gelegenheit beim Schopfe und lud sie auf ein Glas Wein ein, als Wiedergutmachung für die Verspätung ›seiner Airline‹. Auf ihren Hinweis, er sei doch nicht einmal Deutscher und wie er sich da für die Lufthansa-Verspätung verantwortlich fühlen könne, entgegnete er, dass Franzosen bei dem Versuch, eine schöne Frau kennenzulernen, noch keine Lüge je zu abwegig gewesen sei. Er fand es einen dummen Spruch, aber sie schenkte ihm ein fröhliches Lachen. Nach einem Hinweis auf die Überlegenheit der französischen Küche und dem beabsichtigten Protest ihrerseits schaffte er es wenig später, sie zu einem gemeinsamen Abendessen zu überreden.
Als der Hauptgang aufgetragen wurde, Pasta mit Meeresfrüchten, eine Empfehlung von Yael, wuchs in Marcel das eigentümliche Gefühl, dass er von ihr ausgefragt wurde. Das zweifellos charmanteste und attraktivste Verhör, das Marcel je erlebt hatte, aber nichtsdestotrotz ein Verhör. Sie wusste mittlerweile, dass er für den Echo arbeitete und hinter welcher Story er her war, sie wusste, dass er mehrere Jahre Medizin studiert hatte, bevor er sich seiner Leidenschaft, der Fotografie und dem Journalismus, gewidmet hatte, nur seine Beziehung zu Solveigh hatte er ihr verschwiegen. Er fragte sich, ob er für seinen neuen Beruf überhaupt geeignet war, denn er wusste bisher so gut wie nichts über sie, außer dass sie Yael hieß. Deshalb brachte er zwischen zwei Gabeln vorzüglicher Nudeln die Sprache auf sie. Er war wirklich gespannt darauf, wie sie reagieren würde.
»Was bedeutet eigentlich der Name Yael? Klingt irgendwie biblisch.« Was für ein dämlicher Versuch, schalt sich Marcel innerlich, aber Yael lachte ihn an.
»Nicht ganz falsch, mein liebenswerter Franzose. Yael taucht im Buch der Richter auf, sie vernichtete angeblich einen Feind Israels. Aber er bedeutet auch Bergziege.« Dazu legte sie den Kopf schief.
»Wie passend«, befand Marcel und pulte eine orangefarbene Muschel aus der Schale.
»Und was machst du, Yael? Also, ich meine, was arbeitest du? Oder studierst du?«, wollte Marcel wissen. Yael zögerte einen Moment zu lange, sodass Marcel klar war, dass sie irgendetwas vor ihm verbergen wollte. Vermutlich hatte sie einen Freund, der zu Hause auf sie wartete. Ihre Antwort verblüffte ihn trotzdem: »Wieso ist das wichtig, Marcel? Ja, ich studiere. Aber wieso möchtest du das wissen? Du musst noch viel über uns israelische Frauen lernen.«
»Ich denke, das könnte mir gefallen«, sagte Marcel und grinste.
»Und über unser Land«, fügte sie hinzu.
Marcel nickte: »Natürlich. Das ist der Grund, weshalb ich gekommen bin. Die Konflikte, eure Nachbarn, der Gazastreifen, der drohende Krieg, ich möchte so viel wie möglich über alles erfahren.«
Yael starrte auf ihren Teller und bemerkte nach einem nachdenklichen Bissen: »Um unser Land zu verstehen, ist es wichtig, unsere Geschichte zu kennen. Die frühe wie auch die jüngere. Wusstest du zum Beispiel, dass dieses Lokal hier«, sie deutete mit dem Finger auf die Bar, »einer der wichtigsten Kontaktplätze beim Zorn Gottes war?«
Operation Zorn Gottes. Marcel hatte seine Hausaufgaben gemacht. Unter diesem Decknamen hatte der Mossad in den Siebzigerjahren die Liquidierung der Olympia-Attentäter durchgeführt. Er schluckte und schüttelte den Kopf.
»Nein, natürlich nicht«, sagte er.
»Lass uns aufessen und über die schönen Dinge reden, und dann gehen wir spazieren. Glaubst du, es könnte dir gefallen, mit mir zu Ende zu essen, Marcel?« Sie sprach das ›c‹ kehlig aus, sein Name klang auf einmal sehr exotisch. Marcel hatte keine Einwände.
Zwei Gläser Wein und ein Dessert später, auf dem Yael bestanden hatte, schlenderten sie über den Rothschild Boulevard, sie hatte sich bei ihm untergehakt. Für jeden Außenstehenden mussten sie aussehen wie ein Liebespaar, das wie so viele andere in der lauen Septembernacht über die baumgesäumte Prachtstraße der Stadt schlenderte, die in der Mitte für Fußgänger reserviert war. Marcel versuchte immer noch die spezielle Stimmung dieser Stadt zu ergründen, aber er konnte nicht fassen, was ihn so faszinierte. Sie hatte ein hässliches Gesicht und strahlte trotzdem, sie lachte einem ins Gesicht – direkt und ohne an dir vorbeizuschauen. Selbst jetzt, in der Nacht, schaute sie dir direkt in die Augen, als wolle sie dich prüfen, und dir, wenn sie dich für gut befand, das Paradies bieten. Tel Aviv hatte etwas sehr Sexuelles, nicht im konkreten, mehr in einem eigentümlich indirekten Sinn. Wenn er jemals etwas Sinnvolles über diese Stadt schreiben wollte, würde er das besser formulieren müssen, dachte Marcel, als er ihr davon erzählte.
»Und du willst etwas über unser Land und den Iran schreiben?« Sie lachte und lehnte ihren Kopf an seine Brust, ihre Locken schmiegten sich an sein Hemd. Er legte eine Hand um ihre schlanke Taille und blieb stehen. Das Licht einer Laterne schien ihr auf die blauschwarzen Haare. Sie sah ihn an, ihre Lippen öffneten sich ein wenig, die Andeutung einer Einladung. Eine Einladung, die Marcel nicht ablehnen konnte, diese Affäre war unausweichlich, das hatte er in der Sekunde beschlossen, als er sie zufällig wiedergetroffen hatte. Als sich ihre Lippen wieder trennten, keuchte sie ein wenig.
»Hast du deshalb in dem Lokal auf mich gewartet?« fragte Marcel mit einem verschmitzten Lächeln.
Yael schien kurz irritiert zu sein. »Unter anderem«, sagte sie geheimnisvoll, und Marcel sah sie verwundert an. Irgendetwas an dieser anziehenden Frau stimmte nicht, aber ihm wollte partout nicht einfallen, was das sein könnte. Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, legte sie ihm einen Finger auf die Lippen und zog sein Gesicht zu sich heran.
KAPITEL 4
Prag, Tschechische Republik 07. September 2012, 22.05 Uhr (vier Tage später)
Um exakt 22.05 Uhr betrat die brunette Mittdreißigerin die Lobby des Hotels Maria in der Prager Altstadt durch eine schwere Drehtür in der Mitte der Fensterfront. Die breitrandige Brille verlieh ihrem ansonsten sehr geschäftsmäßigen dunkelblauen Kostüm eine modische Note. Der Rock war eng, endete aber erst knapp unter dem Knie, ihre Bluse blütenweiß und der Ausschnitt nicht zu provokant. Sie hätte eine hochrangige Vertreterin einer Fluggesellschaft oder eines internationalen Lebensmittelkonzerns sein können. Allein der Inhalt ihrer braunen Ledertasche hätte alle diese ersten Eindrücke Lügen gestraft. Ihre braunen High Heels klackerten auf dem Steinboden, und einige der Geschäftsleute, die in den modernen Ledersesseln auf was auch immer warteten, blickten ihr hinterher, als sie an den Tresen des Concierges trat. Der Rest des ECSB-Teams arbeitete im Hintergrund fieberhaft an der Falle, die sie ihrem größten Widersacher stellen wollten, seit Monaten warteten sie darauf, dass Thanatos, Europas erfolgreichster Auftragskiller der letzten zwanzig Jahre, einen ihrer fingierten Aufträge annahm. Und es sah so aus, als hätten sie in Prag Glück gehabt. Es war eine heikle Mission, zumal sie ohne offizielles Mandat durchgeführt wurde, nur die tschechische Regierung war informiert. William Thater, der Chef der ECSB, hatte ihnen sämtliche Ressourcen der Organisation versprochen, als Thanatos im letzten Jahr einen Kollegen zum Krüppel geschlagen hatte, und er hatte Wort gehalten. Allerdings nicht, ohne sie immer wieder daran zu erinnern, wie vorsichtig sie vorgehen mussten.
Agent Solveigh Lang entschied sich für den Fahrstuhl, gemeinsam mit einem offenbar frisch verliebten Pärchen, das der Kleidung und ihrer Stimmung nach einen Opernabend oder Ähnliches hinter sich haben musste. Die Tür schloss sich überaus sanft, und noch bevor sich die Kabine in Bewegung setzte, knackste der Sprechfunk in ihrem linken Ohr: »Slang, nach wie vor keine Signatur«, meldete eine ihr wohlvertraute Stimme. Sie nickte kaum merklich, um den Kollegen über die Kamera in ihrer Brille mitzuteilen, dass sie verstanden hatte. Der Fahrstuhl bremste sanft und vermeldete mit einem dumpfen Dreiklang die Ankunft im vierten Stock. Unglücklicherweise stieg das Pärchen mit ihr aus, sodass ihr nichts anderes übrig blieb, als die Schlüsselkarte ihres Zimmers aus der Rocktasche zu ziehen, um den Eindruck zu erwecken, sie habe die Nummer vergessen. Erleichtert stellte sie fest, dass die angeschickerten Turteltäubchen den Westflügel bewohnten, während ihr Ziel gen Osten lag. Ohne ein erkennbares Zeichen von Eile steckte sie die Karte zurück in ihre Rocktasche, ihr eigenes Zimmer lag nicht einmal auf diesem Stockwerk. Während sie den langen Flur hinunterlief, war sie froh, dass der dicke Teppichboden alle Geräusche ihrer Schritte schluckte. Erneut knackte der Sprechfunk in ihrem Ohr: »Noch immer nichts«, vermeldete Eddy in gewohnt knappen Worten, und kurz darauf stand sie vor der Tür mit der Nummer 416. Solveigh atmete tief ein. Dann los, ermunterte sie sich und schob die Universal-Schlüsselkarte in den Chipleser. Ein kaum hörbares Klicken im Schloss und eine winzige grüne Leuchtdiode zeigten ihr, dass sie die Tür öffnen konnte. Ein letztes Mal warf sie einen Blick in den menschenleeren Korridor und zog die Jericho. Mit einem gleichmäßigen Schwung drückte sie mit der Hüfte die Tür auf und betrat das Zimmer des Killers, die Waffe im Anschlag.
Keine halbe Minute später wusste Solveigh, dass sich Eddys Sensoren nicht getäuscht hatten: Thanatos war nicht da, und obwohl diese Tatsache exakt ihrem Plan entsprach, war Solveigh beinah ein wenig enttäuscht darüber. Aber sie wusste, dass Rache kein besonders guter Ratgeber in ihrem Geschäft war, und sie zählte zu den besten Field Agents der ECSB. Eiserne Disziplin gehörte zu ihren wichtigsten Grundsätzen, und daher schluckte sie ihre Emotionen herunter, um sich ihrer eigentlichen Aufgabe zuzuwenden. Ihr Besuch in dem Hotelzimmer mit den blickdicht zugezogenen Gardinen hatte einen viel schlichteren Grund, als man es hätte erwarten sollen. Ihr Ziel war nicht der Attentäter selbst, sondern sein Gepäck. Und so durchsuchte sie nacheinander den Kleiderschrank und den kleinen schwarzen Rollkoffer, um seine Kleidungsstücke eins nach dem anderen zu katalogisieren. Die hochauflösende Kamera in ihrer Designerbrille verzeichnete ein Hemd nach dem anderen: das blaue, das weiße, das karierte, eine Baseballmütze, einen grauen Hut, vier Hosen und ein paar Schuhe. Das Wechseln von Schuhen gehörte auf der Flucht nicht zu den probaten Mitteln, etwaige Verfolger abzuschütteln, das Wechseln der Kopfbedeckung oder das Ausziehen eines Hemds, um zu einer zweiten Kleidungsschicht zu gelangen, hingegen schon, und sie mussten auf alles vorbereitet sein. Indem Eddy, ihr zweites Gehirn, in einem leer stehenden Apartment auf der anderen Straßenseite das Verschlagworten übernahm, hatte Solveigh binnen weniger Minuten, was sie brauchte. Beim Schließen des Koffers achtete sie peinlich genau darauf, alles exakt so zu hinterlassen, wie sie es vorgefunden hatte, ebenso beim Zurückhängen der Bügel an die offene Kleiderstange. Eddy, der sich die Aufnahmen ihrer Kamera vom Betreten des Raums jederzeit wieder anschauen konnte, korrigierte hier und da eine Kleinigkeit: »Der Bügel ganz links hing leicht schräg, sodass der Mantel die Schubladen berührt«, ermahnte er sie beispielsweise. Als Letztes widmete sich Solveigh einem einfachen, aber effektiven Klassiker im Spionagegeschäft: dem unsichtbaren Schloss. Da die Tür des Zimmers nach innen aufging, kam nur der Boden direkt davor infrage. Solveigh bückte sich und scannte den Teppich. Sie fand das sogenannte unsichtbare Schloss in Form eines abgebrannten Streichhölzchens, das vom Türblatt gefallen sein musste, als sie das Zimmer betreten hatte. Da ihr Eddy in diesem Fall nicht von Nutzen sein würde, testete sie mehrfach mit demselben Schwung, mit dem sie die Tür geöffnet hatte, und legte das Hölzchen schließlich etwa zwanzig Zentimeter vom linken Rand entfernt auf die Tür. »Thermo?«, fragte sie Eddy, von dem sie wissen wollte, ob der Gang auf ihrem Stockwerk leer war. »Negativ«, antwortete ihr Kollege, und so zog sie mit einem letzten Blick zurück ins Zimmer vorsichtig die Tür ins Schloss. Nicht einmal einer der meistgesuchten Auftragsmörder der Welt würde ahnen, dass jemand in diesem Zimmer gewesen war. Jemand, der nun wusste, auf welche Kleidungsstücke sie bei einer Verfolgung achten mussten, und jemand, der fest entschlossen war, Thanatos diesmal nicht entkommen zu lassen.
Am nächsten Mittag saß Solveigh im Restaurant Francouská an einem Fensterplatz direkt hinter einem Aufkleber, der für ein günstiges Mittags-all-inclusive-Menü warb. Das Francouská bot Touristen einen riesigen, prunkvollen Jugendstilsaal, gehobene tschechische Küche und lächerlich überzogene Weinpreise mit Blick auf den Platz der Republik. Sie trug nicht mehr das dunkelblaue Kostüm, mit dem sie in dem Hotel kaum aufgefallen war, sondern eine Jeans, eine billige weiße Jacke und Turnschuhe. Während um sie herum die spärlich besetzten Tische auf einen sehr langsamen Kellner und ihr Essen warteten, wartete sie bei einem Glas Rotwein, das sie nicht anrührte, auf Thanatos. Ihre Geduld wurde nicht allzu sehr strapaziert, denn keine zwanzig Minuten später kündigte Eddy über den Sprechfunk an, dass er das Maria verlassen hatte. Thater, der in der Lobby des Hotels mit einem Blackberry scheinbar seine E-Mails beantwortete, hatte ihn identifiziert. Solveigh, die ihn draußen übernehmen sollte, knallte einen Fünfzigeuroschein auf den Tisch und schnappte sich ihre Handtasche, die wichtig war. Nicht nur, weil Frauen ohne Handtaschen zwangsläufig auffielen, sie enthielt auch ihre Jericho, da ihr selbst ein Schulterholster durch die auffällige Beule, die es zwangsläufig erzeugte, zu riskant erschien. Sie stellte sich vor das Schaufenster eines großen Einkaufszentrums, in dem eine neue, von einer Formel-1-Firma lizensierte Schuhkollektion beworben wurde, und beobachtete in der Spiegelung die Straßenseite gegenüber. Eddy leitete ihr die Information weiter, dass Thanatos das blaue Jackett und ein weißes Hemd trug. Er benötigte etwa zwei Minuten vom Hotel bis hierher, und es war der einzig logische Weg, denn am Platz der Republik trafen sich sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel: der Taxistand sowie die Straßen- und die U-Bahn. Sie würde ihn nicht verpassen. Der Grund, warum sie ihn überhaupt aufwendig verfolgen mussten und ihn nicht einfach festnahmen, lag darin, dass sie ihm nach wie vor nichts beweisen konnten. Selbst das umfangreiche Archiv, das ein Kommissar in Stockholm über ihn angelegt hatte, reichte nicht für eine Verurteilung vor Gericht. Sie mussten ihn auf frischer Tat ertappen, und sie hatten die Falle, die heute zuschnappen würde, über Monate vorbereitet. Es war einer von fünf fingierten Aufträgen, die sie an Thanatos über Boten herangetragen hatten. Ihn direkt zu kontaktieren war schon einmal gründlich schiefgegangen, und so hatten sie ihre Fallen über aufwendig verschleierte Mittelsmänner ausgelegt. Und bei dieser einen hatte er angebissen. Bei der in Aussicht gestellten Summe hatte er wohl nicht widerstehen können, obwohl er immer weniger zu arbeiten schien. Die Frequenz der Attentate, die sie ihm zuschrieben, stagnierte seit Jahren. Auch Auftragsmörder gehen offenbar in Rente, vermerkte Solveigh, als sie plötzlich einen Mann bemerkte, der scheinbar ohne Eile auf der anderen Straßenseite an der Fassade des Francouská vorbeischlenderte, genau vor dem Fenster, hinter dem sie noch vor wenigen Minuten gesessen hatte. Am Eingang zur U-Bahn blinzelte er kurz in die Sonne, bevor er die Stufen hinuntereilte. Solveigh sprintete quer über den Platz, ständig auf der Hut vor losen Pflastersteinen, die hier an der Tagesordnung waren. Auf der endlos langen, mit Holzimitat vertäfelten zweiten Rolltreppe, die hinunter zum Bahnsteig der U-Bahn führte, holte Solveigh ihn ein. Sie hielt sich etwa fünfzehn Personen hinter ihm, während die Stufen sie mit unfassbar hoher Geschwindigkeit tief unter die Stadt trugen. Das Schöne an Verfolgungsjagden in Großstädten war die Tatsache, dass das gängige Klischee aus Agentenfilmen in keiner Weise der Realität entsprach. Es war für einen Verfolgten in urbaner Umgebung beinah unmöglich, einen gut geschulten Schatten zu bemerken. Allenfalls simple Ganoven verhielten sich derart fahrlässig, dass sie in die Luft starrten oder im Stehen eine Zeitung vors Gesicht hielten. Solveigh wusste das aus eigener Erfahrung, und sie gedachte heute ihre Trümpfe bis zur letzten Karte auszuspielen.
»Sieht so aus, als wollte er Richtung Süden«, sagte Solveigh auf dem Bahnsteig, geschützt von einer beleuchteten Reklametafel. »Wo ist die Zielperson?«
»Auf dem Weg zum Gericht, wie abgesprochen. Glaubst du, er will dort zuschlagen?«
»Keine Ahnung, ich halte es nach wie vor für die unwahrscheinlichste Variante.«
»Bleib an ihm dran«, mischte sich Thater für seine Verhältnisse recht harsch ein. Er war der größte Verfechter der Gerichtstheorie. Es gehörte zum Wesen der ECSB, dass unterschiedliche Meinungen nicht wegdiskutiert, sondern akzeptiert wurden. Sie waren auf alle Möglichkeiten vorbereitet, die ihnen ein Team von über zwanzig Attentatsexperten anhand des Terminkalenders des Staatsanwalts ausgearbeitet hatte. Eines Terminkalenders, der dank der absichtlichen Unachtsamkeit seiner Sekretärin für fünf Tage nicht wie sonst üblich im Safe seines Büros eingeschlossen worden war. Am zweiten Tag hatten Solveigh und Eddy vom Büro darüber aus beobachtet, wie jemand eingebrochen war. Sie hatten nicht eingegriffen, denn sie hatten Thanatos erst dadurch genau dort, wo sie ihn haben wollten. Eine Stunde und eine der langweiligsten Verfolgungsjagden, die Solveigh jemals erlebt hatte, später war klar, dass er gar nicht daran dachte, den Staatsanwalt vor Gericht zu ermorden. Er irrte scheinbar ziellos durch die Straßen, fuhr im Kreis, nahm die Straßenbahn erst in die eine Richtung und dann wieder zurück, kaufte einmal Sandwich mit Hühnchen und Blauschimmelkäse und rauchte unablässig. Manchmal glaubte sie sogar den scharfen Tabak riechen zu können, wie kalter, verbrannter Dung. Solveigh hatte gerade die letzte Schicht Kleidung gewechselt und ein Baseballcap tief in die Stirn gezogen, als sie das Gefühl beschlich, an dieser Straßenecke schon einmal gewesen zu sein. In dieser Gegend gab es hauptsächlich unbedeutende, vom Smog stark verrußte Verwaltungsgebäude, Touristen verirrten sich kaum in diese Ecke, obwohl sie kaum zehn Minuten von den lebendigen Kopfsteinpflasterstraßen der Altstadt entfernt lag.
»Such nach Überschneidungen mit dem Terminkalender, hier in der Nähe waren wir heute schon«, bat sie ihren Kollegen, der vor einem leistungsstarken Rechner saß.
»Schon passiert, Slang«, vermeldete Eddy, dem der seltsame Zufall offenbar auch nicht entgangen war. »Gleich um die Ecke liegt das Restaurant, in dem er … warte kurz…nächsten Freitag mit dem Wirtschaftsattaché der deutschen Botschaft zu Abend essen wird.
»Der Attaché, das war eine Frau, oder nicht?«
»Ja, Dr. Andrea Falk, um genau zu sein.«
»Besorg uns Bilder, Eddy.«
Solveigh grinste, während sie zum vierzigsten Mal an diesem Tag die Straßenseite wechselte. Sie würden den Attaché einer europäischen Botschaft niemals wissentlich einer derartigen Gefahr aussetzen, sie war nicht eingeweiht, im Gegensatz zum Staatsanwalt, der freiwillig kooperierte. Und deshalb würde er an jenem Abend nicht mit einer deutschen Diplomatin speisen, sondern mit einem Agenten der europäischen Geheimpolizei ECSB. Solveigh freute sich beinahe ein wenig auf den Abend.
KAPITEL 5
Dubrovnik, Kroatien 12. September 2012, 13.28 Uhr (fünf Tage später)
Die Septembersonne stand hoch am Himmel, als der alte Mann in einem weißen Sommeranzug durch das ehemalige Tor der mittelalterlichen Steinmauer in den Hafen trat. Blinzelnd setzte er die Sonnenbrille auf – seine Augen vertrugen die Sonne nicht mehr so gut wie früher – und suchte ein vertrautes Gesicht. Als er seinen Mann gefunden hatte, der wie verabredet in einem der beiden Restaurants an einem Tisch saß, nickte er kaum merklich. Der kleine alte Hafen der Stadt, in dem hauptsächlich die winzigen Nussschalen der Einheimischen und Wassertaxis anlegten, die jene Horden von Touristen zwischen Dubrovnik und den Inseln hin- und herschipperten, war zum Bersten voll, was Thomas Eisler nur recht sein konnte. So würde er trotz seiner wie immer makellosen Garderobe nicht auffallen. Nicht, dass es etwas bedeutet hätte, vermerkte er für sich. Der gefährliche Teil der Reise war vorüber. Das einzig Gefährliche an Dubrovnik waren die Taschendiebe und der Mann, mit dem er verabredet war. An einem kleinen Stand aus eilig zusammengezimmerten Spanplatten mit einer sehr aufwendig frisierten Frau dahinter kaufte er ein Ticket nach Cavtat, einem Ort etwa zehn Kilometer die Küste hinunter, dessen Exklusiviät sich an der kleineren Touristenschar und der Nähe zum Flughafen bemaß. Eisler wusste, dass nicht nur sein Auftraggeber, sondern viele neureiche Russen hier ihre Boote ankern ließen. Als das Wassertaxi ablegte, warf er einen Blick auf seine Mitreisenden, bei denen es sich ausnahmslos um harmlose Touristen handelte. Eine etwa dreißigjährige Frau mit mintfarbenem Top schoss Fotos von ihrer Mutter und war wohl drauf und dran, ihn um einen Schnappschuss zu bitten. Thomas Eisler tat so, als läse er den informationsarmen Prospekt, den ihm die Frau mitsamt seiner Fahrkarte in die Hand gedrückt hatte. Nachdem ihr Schiff den engen Hafenbereich verlassen hatte, hob sich der Bug aus dem Wasser, das mintfarbene Top widmete sich ihren Fotos, und Thomas Eisler starrte in die schäumende Heckwelle. Ihre Fahrt führte sie an der Küste entlang. In den Bergen dahinter häufte sich der Anblick von verlassenen Hotelanlagen, die man leicht für intakt hätte halten können, würde nicht allen Fenstern das Glas fehlen, das zwangsläufig die Sonnenstrahlen reflektiert hätte. Er machte eine mentale Notiz, sich einige der Grundbucheinträge anzuschauen. Verlassene Gebäude dieser Größenordnung, für die sich seit Jahrzehnten niemand mehr interessiert hatte, konnte man in seinem Gewerbe immer brauchen.
Als sie eine halbe Stunde später Cavtat erreichten und Thomas Eisler von dem schwankenden kleinen Kahn auf die Kaimauer des Jachthafens sprang, wobei zu seinem Missfallen seine Knie schmerzten, war es fast Mittag. Zu seiner Linken lagen am Heck vertäute Luxusjachten, an deren Masten große Fahnen traurig im lauen Wind hingen, zu seiner Rechten erstreckten sich die Liegeplätze für die einheimischen Boote, kleine Segeljachten und einige Motorboote. Er warf einen Blick auf seine Uhr: zu früh für seine Verabredung, also beschloss er, die Promenade abzulaufen und einen Kaffee zu trinken. Um exakt zehn Minuten vor eins stand er wieder an demselben Platz, nur dass diesmal kein öffentliches Wassertaxi auf ihn wartete. Mit der rechten Hand die Sonne abschirmend, warf er einen Blick über das Wasser und entdeckte kurz darauf ein kleines weißes Motorboot, das auf ihn zuhielt. Keine zwei Minuten später tuckerte der PS-starke Außenborder im Leerlauf am Pier, und zwei muskulöse, sonnengebräunte Arme halfen ihm beim Einstieg. Eisler bedankte sich artig und ließ sich auf der ledergepolsterten Rückbank nieder, als sein Skipper das Beiboot auf Kurs brachte. Sie hielten Kurs auf das offene Meer, aber ihr Ziel lag viel näher. Anatoli Kharkovs Jacht, oder besser gesagt, die Firmenjacht der Wodkafabrik, war zu groß für den Hafen, und so ankerte sie in der Bucht davor, fernab von neugierigen Blicken der Touristen oder, was noch viel schlimmer wäre, der Boulevardpresse. Eisler wusste, dass vor Kurzem noch das Schiff eines echten Oligarchen hier gelegen hatte, was Anatoli sicher verärgert hätte, denn es war noch einmal um ein Vielfaches größer als sein eigenes. Thomas Eisler grinste innerlich bei dem Gedanken, als der braun gebrannte Steward das Schlauchboot am Heck der 40-Meter-Jacht vertäute, vor allem da er bei seinen intensiven Recherchen über seinen neuen Arbeitgeber herausgefunden hatte, dass die Firma sie oft über eine sehr diskrete Agentur aus Monaco zum Chartern anbot. Oder wohl eher anbieten musste. Er wartete nicht darauf, dass ihm wieder jemand an Bord half, sondern hievte sich eigenhändig auf das Teakholz der Badeplattform und kletterte über die kurze Leiter an Deck. Ein weiterer Steward in weißer Uniform erwartete ihn bereits:
»Herzlich willkommen an Bord der Annabelle, Mr Eisler. Mr Kharkov erwartet Sie bereits, wenn Sie mir folgen möchten?«
Der Engländer stakste vorweg, wahrscheinlich fanden sie die Blasiertheit schick, ein Stück altes Geld auf einem Kahn, finanziert von neuem und dafür umso mehr davon. Oder seine Frau stand auf den Engländer, sie kümmerte sich um das Personal. Dies zu wissen gehörte ebenso zu Thomas Eislers Arbeitsverständnis wie die Tatsache, dass der Mann in dem Café in Dubrovnik darauf wartete, dass er wohlbehalten von der Jacht zurückkehrte. Bei Kharkov konnte man nie wissen. Zum wiederholten Mal fragte sich Eisler, wie es möglich war, dass er trotz bester Kontakte niemals hatte herausfinden können, wer seine wahren Auftraggeber waren. Eindeutig war nur, dass es nicht der Vorstandsvorsitzende der Wodkafabrik sein konnte, dafür reichte sein Einfluss bei Weitem nicht aus. Der Steward blieb vor einer verspiegelten Glastür auf dem Oberdeck stehen. Er musste nicht klopfen, denn sie glitt zur Seite, kaum dass sie sie erreicht hatten. Anatoli betrat die Sonnenterasse, weiße Hosen und ein rosafarbenes Poloshirt, das stark spannte und sein sonnengerötetes Gesicht noch betonte. Offenbar hatte er seinen hellen slawischen Teint etwas zu lange der Mittelmeersonne ausgesetzt. Der Russe begrüßte ihn mit einem festen Händedruck und einem abschätzenden Blick. Sie hätten ein wundersames Paar abgegeben, wenn jemand sie beobachtet hätte, die fünfzigjährige Leuchtboje und der alte sehnige Mann im feinen Sommeranzug. Eisler lächelte dünnlippig, Anatoli hatte keinen Grund, nervös zu sein. Im Gegenteil. Sie setzten sich auf eine bequeme Eckbank unter einen Sonnenschirm, sein Jackett legte er ordentlich gefaltet über die Lehne. Nachdem er einen Drink dankend abgelehnt hatte, waren sie alleine, und Anatoli kam ohne Umschweife zur Sache. Hinter seinem roten Gesicht glitzerte das Mittelmeer von der Sonne, und die seichten Wellen kräuselten sich in der Bucht.
»Wie lief es in Israel?«, fragte der Russe und nippte an einem Pimm’s mit viel Eis. Für einen kurzen Moment ruhten seine Augen auf Eisler, der in diesem Moment begriff, dass dieser Mann nicht nur über einen messerscharfen Verstand verfügte, sondern auch überhaupt keine Skrupel kannte. Der Kontrast zwischen diesen ausdruckslosen Augen und dem bunt-fröhlichen Jetset-Drumherum hätte krasser kaum ausfallen können.
»Zufriedenstellend, Mr Kharkov. Absolut zufriedenstellend.«
»Also haben Sie das Virus?«
»Es ist kein Virus, Mr Kharkov. Es ist Schadsoftware. Wenn Sie einen griffigeren Ausdruck bevorzugen: ›Wurm‹ trifft es etwas besser.«
»Das weiß ich selbst«, bellte der Russe verärgert. »Und Sie sind sich sicher, dass es der echte ist?«
»Wenn der Mossad-Agent echt war, ist der Wurm es auch … Und glauben Sie mir, Mr Kharkov, ich erkenne einen Agenten, der ein doppeltes Spiel spielt«, stellte er fest und legte sein Telefon in die Mitte des Tisches. Er wusste, dass wiederum der Russe wusste, dass er bis zum Ende der DDR der erfolgreichste Spionageabwehroffizier der Stasi gewesen war, jener Organisation, die noch heute von allen Geheimdiensten der Welt für ihre Effizienz bewundert wurde, auch wenn sie den Staat, den sie hatte schützen sollen, letztlich durch die unglaublichen Kosten in den Ruin getrieben hatte. Der Anteil am Staatshaushalt hatte – alle bei anderen Ministerien versteckten Budgets eingerechnet – am Schluss bei über fünfzehn Prozent gelegen. Ein unglaublicher Kostenfaktor, den der Arbeiter- und Bauernstaat unmöglich hatte weiterführen können, er war unrettbar verloren gewesen, noch bevor die Menschen mit ihren Demonstrationen in Leipzig und Dresden den friedlichen Umsturz eingeläutet hatten. Glücklicherweise galt das nicht für die Offiziere jener Organisation, noch heute gab es Konten, welche die Bundesrepublik nie gefunden hatte. Und es gab neue Arbeit, so auch für Thomas Eisler.
»Daran zweifele ich ja gar nicht, Eisler«, riss ihn Anatoli aus seinen Gedanken. »Ich wusste, dass Sie das schaffen. Ist es da drauf?« Er blickte auf das Telefon in der Mitte des Tisches. Eisler nickte. Anatoli Kharkov nahm das Telefon in die Hand und wog es, wie um seinen Wert zu bestimmen. Dann nickte er anerkennend: »Gut gemacht, Eisler. Sie haben Ihren Bonus verdient. Und Sie fahren weiter nach Berlin, um sich um den Rest zu kümmern?«
»Selbstverständlich, Mr Kharkov. Wie besprochen. In drei Monaten sind wir einsatzbereit. Gesetzt den Fall, dass Ihre Leute das mit dem Wurm hinbekommen.« Thomas Eisler warf einen skeptischen Blick auf das Telefon, das in der riesigen Hand des Russen beinahe verschwand.
»Darüber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe genau den richtigen Mann dafür, und er wird bald so weit sein.«
In dem Moment betraten zwei junge Männer das Sonnendeck in tropfnassen Badehosen. Anatoli winkte sie zu sich und raunte Eisler zu: »Na, was für ein Zufall. Wenn man vom Teuf… Jungs, darf ich euch Thomas Eisler vorstellen? Ein Geschäftspartner aus Deutschland.«
Die beiden Jungs wirkten höflich, wobei der eine deutlich selbstbewusster auftrat als der andere. Er vermutete, dass es sich bei ihm um Anatolis Sohn handelte.
»Das sind mein Sohn Viktor und sein bester Freund Dimitrij. Sie studieren zusammen und sind für das Wochenende rübergeflogen«, bestätigte Anatoli seine Vermutung. Der Sohn und der Freund. So, so. Er gab ihnen höflich die Hand.
»Und was studieren Sie, Dimitrij?«
»Fortgeschrittene Computertechnologie an der MSTU«, antwortete der Junge und blickte zu Boden. Er konnte kaum fünfundzwanzig sein.
»Und in welchem Semester?«
Anatoli mischte sich ein, wahrscheinlich ärgerte er sich, dass er nicht nach den akademischen Leistungen seines Sohnes fragte: »Er macht gerade seinen Doktor. Mit vierundzwanzig, das muss man sich mal vorstellen. Der Junge ist fast so etwas wie ein Genie!« Dabei legte er den Arm um die Schultern der beiden und drückte sie so fest an sich, als wollte er sie zerquetschen. Anatoli lachte, und Thomas Eisler ahnte, warum. Er selbst hielt nicht viel von jungen Leuten, noch hätte er so einem Jungspund jemals einen derart heiklen Teil ihrer Mission anvertraut. Aber er musste zugeben, dass sie wahrscheinlich mehr von Computern verstanden als seine gesamte Söldnertruppe.
Ihr geschäftliches Gespräch war ebenso effizient beendet worden, wie es begonnen hatte. Vielleicht hatte Anatoli seinen Posten doch nicht ganz zu Unrecht zugeschanzt bekommen, wenn auch möglicherweise von noch unangenehmeren Zeitgenossen, als er selber einer war. Erst als Eisler wieder in dem Boot saß, das ihn nach Cavtat brachte, dachte er an den Mann, der schon auf ihn wartete. Sein Back-up, im wahrsten Sinne des Wortes, denn auf dessen Telefon befand sich eine weitere Kopie von Stuxnet, falls sein Handy durch einen unglücklichen Zufall zerstört worden oder ihm etwas zugestoßen wäre. Eigentlich hätte Eisler es zerstören sollen, aber sein Bauchgefühl sagte ihm, dass es nicht schaden könnte, das Back-up noch ein wenig zu behalten. Man konnte nicht genügend Back-ups haben in seinem Geschäft, dachte er und hielt die Nase in den Fahrtwind.
Das Biest nahm den regulären Wasserbus, er hielt nichts von Auffälligkeiten und Statussymbolen zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hatte Kharkovs Jacht gestern Abend vom Ufer in Cavtat aus betrachten können, protzig und mit am Heck vertäuten aufgeblasenen Bananen und Jetskis für seinen verwöhnten Jungen. Er verachtete ihn dafür. Aber er brauchte ihn, diesen neureichen, zweitklassigen Manager, dessen Loyalität außer Frage stand. Nachdem das schwerfällige Boot, das im Halbstundentakt von Dubrovnik auf die Insel vor der Küste fuhr, sanft gegen die Bojen am Pier geschaukelt war und der Ticketabreißer kaugummikauend die Leinen vertäut hatte, betrat er mit etwa vierzig weiteren Passagieren das Naturreservat, das Eintritt kostete und deshalb gut besucht, aber nicht von Touristen überschwemmt war. Die meisten der Neuankömmlinge trugen Flipflops, Strandlaken unter dem Arm und schnatterten dummes Zeug. Das Biest konnte sie schon jetzt gut leiden, sie würden den Mann mit dem etwas zu teuren weißen Hemd und den Khakis schnell vergessen. Er wartete bei einer Cola auf der Terrasse des hiesigen Restaurants, das eher als Kiosk bezeichnet werden musste. Es störte ihn nicht, einen Tag lang den Touristen zu mimen, wenn es seinen Zwecken diente. Und die Verbindung zwischen ihm und Kharkov durfte niemals ans Licht kommen, das war einer der wichtigsten Teile seines Plans. Nur deshalb betrieb er diesen Aufwand. Als sich der dicke Russe schwitzend und schnaufend den Weg hinaufschleppte, ging er ihm ein Stück entgegen und lächelte. Auch das war wichtig.
»Gehen wir ein Stück«, schlug er vor, nach einer Begrüßung, die Kharkov als herzlich empfunden haben dürfte.
Der Wodka-CEO wischte sich den Schweiß von der Stirn, beeilte sich aber, mit ihm Schritt zu halten. Sie nahmen den Weg hinauf zu den verfallenen Mauern eines Klosters, zu jenem Teil, den die Touristen mieden, weil die Klippen steil und der Weg zu weit war. Nach einigen Biegungen verschluckte ein Dickicht aus grünen Bäumen und Sträuchern sie und der Weg wurde steinig.
»Läuft alles nach Plan?«, fragte das Biest.