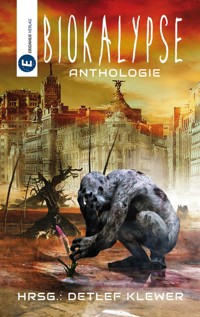
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eridanus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Welt in nicht allzu ferner Zukunft – Wir wollten unsere Erde zu einem Paradies machen. Doch obwohl uns alles Wissen der Welt zur Verfügung stand, wir kreativ und frei unsere Ressourcen zum Wohlstand der Menschheit hätten einsetzen können, taten wir genau dies nicht. Stattdessen brachten wir uns dank Bio-Modifikationen, zerstörerischer Selbstoptimierung und Ausbeutung des Planeten aus egoistischen Motiven an den Rand einer Biokalypse. 17 Autorinnen und Autoren zeigen uns in 15 Geschichten, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir unseren Weg weiter beschreiten wie bisher. Erschreckend, berührend, aber doch hin und wieder auch mit einem Funken der Hoffnung. Nach „Alien Eroticon“ die zweite im Eridanus Verlag herausgegebene Anthologie von Detlef Klewer, mit 15 Illustrationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Biokalypse
– Anthologie –
Herausgegeben von Detlef Klewer
Vollständige E-Book-Ausgabe der Druckausgabe
ISBN 978-3-946348-42-9
ISBN 978-3-946348-41-2 (Print Ausgabe)
© Eridanus Verlag | Jana Hoffhenke
Hastedter Heerstraße 103 | 28207 Bremen
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Iwo – www.kritzelkunst.de
Umschlaggestaltung: Detlef Klewer
Ebook-Realisierung: Jana Hoffhenke
Vorwort
~ ~ ~
Das passende Thema für eine dystopische Anthologie zu entwickeln, scheint derzeit leichter als je zuvor. Die Nachrichten, die sozialen Medien und oft auch die tagtäglichen persönlichen Gespräche vieler Menschen sind gefüllt von negativen Zukunftsaussichten. Während die einen die Erde als sinkendes Schiff sehen, das wir einfach nicht verlassen können (zumindest in nächster Zeit noch nicht), wollen andere nicht aufgeben und tun ihr Möglichstes, um Umweltzerstörung, Klimawandel, Verschmutzung & Co. entgegenzuwirken.
Wir fragen uns ängstlicher als je zuvor, wie die Welt in einigen Jahren und Jahrzehnten aussehen wird. Wie erfolgreich werden die Bemühungen zur Rettung unseres Planeten wohl sein? Und was bedeuten die unweigerlich auf uns zukommenden Veränderungen für unseren Alltag. In diesem Buch haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt, auf eine Welt, in der die biologische Krise tiefgreifende Veränderungen hervorgerufen hat. Die Geschichten erzählen von einer Zeit, in der wir nicht mehr zurück können, in der die Menschen sagen »Ach, hätten wir doch nur …« und sicher vor allem vorwurfsvoll auf vorherige Generationen schauen.
Gut achtzig Storys wurden für diesen Wettbewerb eingereicht, von denen uns viele sehr nachhaltig beeindruckt haben. Manchen davon mussten wir dennoch eine Absage erteilen, mal weil sich Themen zu sehr ähnelten, mal weil sie sich doch inhaltlich zu weit von unseren Vorstellungen entfernt hatten. Letztendlich ist die finale Auswahl der Geschichten für eine Anthologie der schwierigste Teil bei der Entstehung des Buches, weil Absagen schreiben eben niemals angenehm ist – für beide Seiten.
Insgesamt 15 Geschichten haben es letztendlich ins Buch geschafft und wir sind mit der Vielfalt und der Qualität der Erzählungen mehr als zufrieden. Wir hoffen, es wird unseren Leserinnen und Lesern ebenso gehen und freuen uns über jegliche Form von Feedback. Schreibt uns einfach, kontaktiert uns über die sozialen Medien, erzählt von unserem Buch. Und nun wünschen wir euch ein spannendes Abtauchen in die »Biokalypse«. In der unerschütterlichen Hoffnung, dass die Zukunft doch ein Happyend für die Menschheit bereithält. Viel Vergnügen!
Jana Hoffhenke & Detlef Klewer
Die Membran (Ivan Ertlov)
~ ~ ~
Ein durchdringendes Piepen riss mich aus meinen Träumen, und das war gut so. Wie in den Nächten zuvor hatten sich diese alles andere als angenehm gestaltet – ein Taumeln durch dunkle Wälder, deren mit Nanotech verseuchten und von pulsierenden Geschwülsten überzogenen Bäume nichts mit den Eichen, Buchen, Fichten und Tannen unserer Vorfahren gemein hatten. Ein Waten durch giftige Sümpfe, deren Chemikalien zuerst meine Stiefel, dann mein Fleisch verzehrten, vorbei an schwarzglänzenden Teichen, in deren blubbernden Abgründen titanische Schatten mit Tentakeln so lang wie ein Fußballfeld auf ihre Beute lauerten.
Auf mich.
Über den sich gegenseitig um Licht und Nährstoffe bekriegenden Baumkronen schwebten riesige, dunkle Kreaturen mit ledrigen Flügeln, ihre dünnen, verzerrten Körper durchzogen von der entflohenen, sich unkontrolliert anpassenden Technologie, dem falschen Fleisch. Keine die Erde überwuchernde graue Masse, keine Nanoapokalypse wie am Anfang des Wandels befürchtet, sondern Trillionen winziger synthetischer Organismen, die beschlossen hatten, Teil des Ökosystems, Teil aller anderen Lebensformen zu werden, sie langsam in das zu verwandeln, was ihnen am nützlichsten schien. Hundertfach mutierte, bizarre Pflanzen, Tiere und Mischformen, die dem verseuchten Planeten so etwas ähnliches wie Leben abringen konnten. Eindringlinge in diesen neuen Kosmos mit seinen eigenen Regeln und Gesetzen waren vor allem eines – Futter. Biomaterial. Leicht verwertbare Proteine, vielleicht sogar die genetische Blaupause für ein neues Geschöpf.
Darauf verspürte ich aus verständlichen Gründen wenig Lust, weder in meinen Träumen noch in der Realität, und so blickte ich dankbar auf meinen linken Handrücken und deaktivierte mit einer simplen mathematischen Gleichung – als Beweis, dass ich wirklich wach war – die Alarmfunktion. Der Grirash-2-Chip, eine von knapp zwanzig technologischen Modifikationen an meinem Körper, gehorchte. Ja, ich weiß schon, was ihr jetzt denkt – zumindest die meisten von eEuch. Jene, die in der Barriere leben. Ihr beneidet mich, oder, noch schlimmer, haltet mich für eine Verräterin, für eine stiefelleckende Dienerin der Elohim im Ring.
Und wisst ihr was?
Damit habt ihr recht. Es bietet einige Vorzüge, in den Diensten jener zu stehen, die über uns herrschen, daran hat sich in Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte nichts geändert. Es waren stets die nützlichen Idioten in der zweiten und dritten Ebene der Machtstruktur, die den besten Kompromiss aus Privilegien und Exposition fanden. Wichtig genug, um in bescheidenen Maßen geschützt und verhätschelt zu werden, aber nicht so offensichtlich auf der gesellschaftlichen Bühne präsent, dass sie den Kopf verloren, wenn sich die Machtverhältnisse änderten. Erfahrene Feldherren ohne politische Ambitionen im römischen Reich. Raketenwissenschaftler der Nazis, die von den USA mit offenen Armen empfangen worden waren. Die Hacker und Cryptokiddies, die 2038 die erste Singularität verhinderten – sie alle hatten die Privilegien dieses Equilibriums genossen.
So wie ich meinen Kaffee, aus echten Bohnen, unter verschwenderischem Aufwand angebaut von den Wiener Gärten auf dem Gelände, das einst der Zentralfriedhof gewesen war. Mit einem großzügig dimensionierten Becher in der Hand trat ich ans Fenster, um die Aussicht zu genießen. Wie die meisten meiner Zunft residierte ich in einem altertümlichen, aber aufwändig modernisierten Pavillon auf der Baumgartner Höhe, in einem ehemaligen Sanatoriumsgebäude mit vortrefflicher Weitsicht. Die ersten Sonnenstrahlen beleuchteten das schwarze, pulsierende Gebilde jenseits der Barriere, den aus Biogenetik, Spontanmutationen und Nanotech geformten Dschungel des Todes, der einst der Wienerwald gewesen war. Ein dreißig Meter hoher Zaun schützte die Stadt vor ihm – Wien, oh Wien, nur du allein! Nur ein sentimentales Lied aus längst vergangen Zeiten. Wien hatte überlebt, ebenso Prag, Budapest und ein paar hundert andere Städte weltweit. Die gesamte Barriere, kreisförmig um die Donaumetropole errichtet, war nichts weniger als ein titanischer EM-Pulser, der jegliche Nanotechnologie zerstörte, die sich an oder über sie wagte. Automatische Geschütze kümmerten sich um die rein organischen Bedrohungen – oder, besser gesagt, versuchten sich darum zu kümmern. Der Wald schien zu lernen, ebenso seine Geschöpfe. Seit Jahren hatte es keinen wirklichen Angriff mehr gegeben – aber das bedeutete keinesfalls uneingeschränkte Sicherheit innerhalb der Barriere. Dieses Privileg blieb den Ringbewohnern vorbehalten.
Hier, in der Überlebenszone, regierten chemische Verseuchung, sich rasant anpassende Viren und Bakterien, Mutagene in Luft und Wasser – und natürlich das gnadenlose UV-Licht der Sonne, das spätestens in einer halben Stunde beginnen würde, DNA-Stränge in ungeschützten biologischen Oberflächen zu zerstückeln.
Ungeschützt – das war das Stichwort.
Ich schloss kurz die Augen, spannte jene Muskeln an, die Komiker benutzen, um mit den Ohren zu wackeln – und genoss meine Metamorphose. Kein Implantat, keine Nanotech, nein, Baby, nur eine meiner Biomodifikationen. Das Beste vom Besten, wie man es sonst nur im Ring findet! Achthundert Millionen meiner Hautzellen veränderten sich in weniger als zwei Minuten, reicherten sich mit Aluminiumoxid an, verliehen mir einen silbrigen Glanz und schenkten mir ein anregendes Prickeln.
Ein weiterer Alarm riss mich aus dem sensorischen Erlebnis der Wandlung, und diesmal kam er nicht aus dem Handgelenk, sondern von meiner Smartwand. Acht Quadratmeter Info- und Entertainment, mit semiholographischer Frontalprojektion, ein Geschenk unserer ehrenwerten Elohim. Ein Geschenk? Nein, eher ein Weg, um mich rund um die Uhr abrufbereit zu halten. Hastig schlüpfte ich in meine Uniform, deren Schwarz einen spannenden Kontrast zu meiner metallischen Haut bildete, und akzeptierte den eingehenden Stream.
Interessant. Nicht einer meiner üblichen Handler – ich verweigerte das Wort Vorgesetzte aus Prinzip – erschien auf dem Schirm, sondern die Hofrätin persönlich. Alexandra Kandler, ihres Zeichens Sicherheitssprecherin des Rates und damit so etwas wie informelle Verteidigungs- und Innenministerin der Stadt Wien in Personalunion. Es war das erst das zweite Mal, dass sie mich direkt kontaktierte, und an das erste hatte ich alles andere als angenehme Erinnerungen. Ich ließ mir meine Skepsis nicht anmerken, ebenso wenig wie die zwiespältigen Gefühle, die ihre offen zur Schau gestellte Dekadenz in mir auslöste.
Kandler residierte direkt in der Hofburg, nur dem Kaiser unterstellt, in einem obszön großen Büro mit Blick über den Ring – den ich im Moment nicht sehen konnte, klar. Aber sehr wohl die Schalen mit exotischen Früchten, die vor ihr auf dem Tisch standen. Feigen, Datteln, Bananen – ein Normalsterblicher innerhalb der Barriere würde für ein einziges Stück Dinge tun, die man vor fünfzig Jahren nicht einmal von einer Hafenprostituierten oder einem semiversklavten Toyboy verlangt hätte. Nicht, dass Kandler solcherlei Tauschhandel nötig hatte. Hinter ihr waren zwei Lustdrohnen angekettet, knieten nackt und mit schicksalergebenem Gesichtsausdruck neben Futter- und Wasserschüsseln. Ihre genetisch grotesk vergrößerten Penisse hingen selbst im schlaffen Zustand bis zum blaumetallisch glänzenden Fußboden, die überlangen hyperagilen Zungen aus ihren Mäulern. Zwei Sekretärinnen in ebenso knapper wie durchsichtiger Dienstkleidung standen hinter der Sicherheitssprecherin, bereit, ihr nicht nur jeden dienstlichen Wunsch von den Augen abzulesen.
Nein, das war nicht meine Welt.
Auch wenn sie es hätte sein können.
»Majorin Weber, was für eine Freude, ist schon viel zu lange her, nicht wahr? Ich sehe, Sie haben bereits ihre Ausgehuniform an, wie praktisch!«
Ihre honigsüße Stimme schmeichelte mit dem ebenso breiten, wie falschen Lächeln um die Wette. Dass sie mich mit dem formalen Titel ansprach – geschenkt. Klar, offiziell war ich in der Tat Majorin Lena Weber, irgendwo in das alte Rangsystem von Bundesheer oder Polizei eingegliedert – aber in der Praxis keines von Beidem. Was nichts daran änderte, dass sie – vom Kaiser abgesehen – meine oberste Befehlshaberin war und ich ihr Spiel wohl oder übel mitspielen musste, um meine Privilegien zu behalten.
»Sprecherin, es ist mir eine Ehre. Wie kann ich dem Rat dienen?«
»Das gefällt mir, Majorin – fragen Sie nicht, was der Rat für Sie tun kann, sondern fragen Sie, was Sie für den Rat tun können! Nun, die Antwort ist simpel – so schnell wie möglich hierherkommen.«
Ich zog meine Augenbraue hoch, mehr erstaunt als geschmeichelt.
»Sie meinen in den Ring? In die Hofburg?«
Sie nickte, sichtlich amüsiert von meiner Reaktion.
»Genau in dieser Reihenfolge. Die Ringwächter sind angewiesen, Sie beschleunigt einzulassen. Solange Sie keine Nukleargranaten oder ähnlich schwere Waffen bei sich tragen.«
Ich stutzte. Einerseits, weil es ein Hinweis darauf war, dass ich meine reguläre Bewaffnung tragen durfte. Andererseits, weil es das dritte Mal sein würde, dass ich wieder in den Ring durfte, seit …
… der Sache mit meinem Großvater vor mehr als zwei Jahrzehnten. Zuletzt hatte ich die Hofburg vor knapp drei Jahren betreten, um die silberne Ehrennadel der Stadt Wien entgegenzunehmen. Für meinen Einsatz in Schwechat, oder, wie es der Rat formulierte, für einen »beispiellosen Einsatz außerhalb der Barriere, um die Ressourcensicherheit der Stadt zu gewährleisten«. Am Arsch, liebe Freunde, in Wirklichkeit hat ihnen meine Eskapade geholfen, Bratislava zu unterwerfen. Aber das wusste ich damals nicht. Hätte ich den Einsatz sonst verweigert? Ich will es glauben, aber sicher bin ich mir nicht.
»Ich kann es in dreißig Minuten schaffen.«
»Ausgezeichnet. Wir warten.«
Wir warten – diese beiden Worte gingen mir durch den Kopf, als ich eine sorgfältig verschraubte Röhre aus meinem Nachtkästchen fischte und in meine Hosentasche schob. Und natürlich legte ich meine Waffen an, ehe ich das Gebäude verließ und in meinen Gleiter stieg. Lautlos schwebte ich über das hinweg, was einst Wien gewesen war. Dächer voller Löcher, von Hagel und saurem Regen zerfressen, die Fassaden blätterten ab und viele Gebäude verfielen einfach. Was die Überlebenden des Wandels und ihre Nachfahren nicht daran hinderte, weiterhin in ihnen zu wohnen. Hatten Sie eine Wahl? Nein, ihnen blieb nichts anderes übrig, genauso wenig, wie sie es sich leisten konnten, NICHT aus der braunen Brühe zu trinken, die sich Wienfluss schimpfte. Das penibel kontrollierte, gefilterte und UV-bestrahlte Hochquellenwasser war den Elohim vorbehalten – und privilegierten Leuten wie mir, die eine Privatleitung besaßen.
Lediglich der Karlsplatz, auf dem ich landete, hatte sich in den letzten hundert Jahren kaum verändert, war immer noch ein Sammelbecken für Ausgestoßene und Verbrecher, Sandler und Drogensüchtige. Dazwischen die von noch nicht vollständig erloschener Hoffnung beseelten armen Schweine, die in der Schlange vor dem Portal standen. Man musste entweder verzweifelt oder wahnsinnig sein, um zu glauben, dass man auch nur den Hauch einer Chance hatte, ins Innere der Membran zu gelangen. Gut, die knapp achttausend Elohim brauchten das fünf- bis zehnfache an Dienern und Handlangern, um ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, aber jede und jeder einzelne davon war handverlesen, über Jahre hinweg ausgesucht, vorbereitet und trainiert – oder gar speziell für den Einsatz gezüchtet worden. Nicht einmal ich konnte einfach in den Ring spazieren – nicht ohne eine spezielle Einladung.
Eine solche besaß ich, und so ignorierte ich die Schlange, schritt vorbei an den schluchzenden, raunzenden, sudernden und weinenden Gestalten, die schon seit Stunden oder gar Tagen hier ausharrten und dabei langsam von den omnipräsenten Umweltgiften aufgefressen wurden. Das Portal am Opernring war vielleicht nicht der größte, aber aufgrund der Nähe zur Hofburg praktischste Zugang für mich. Breite Treppen führten in die Tiefe der ehemaligen U-Bahn-Station, unter der Membran hindurch.
Membran?
Das war ein vielleicht technisch korrekter, aber viel zu schnöder Begriff für das grünlich schimmernde, transparente Gebilde, die Kuppel des Lebens – des lebenswerten Lebens! – über dem Ring. Sie ließ den Sauerstoff hinein, hielt die Schadstoffe draußen, verfügte über einen UV-Filter und sorgte dafür, dass die Atemluft im Inneren blieb. Die spezielle Atemluft, angereichert mit DNA-Reparaturenzymen, hochwirksamen Entgiftern und Metabolismus-Regulatoren und all dem anderen guten Zeug, dass den Elohim eine Lebenserwartung von knapp zweihundert Jahren bescherte. Außerhalb des Rings, aber innerhalb der Barriere galt man mit 50 schon als Methusalem. Wenn man nicht schon früher starb – viel früher. Ich ignorierte die hasserfüllten Blicke jener, an denen ich vorbeischritt, aber konnte nicht darüber hinwegsehen, dass eine Frau an der Spitze der Schlange gerade erbittert mit den Ringwächtern stritt.
Stritt?
Nein, sie flehte.
»Ich bitte euch! Sie wird sterben!«
Diese Worte nagten an mir, ließen mich meinen Schritt verlangsamen, einen genauen Blick auf die Szene werfen. Ein junger Wächter, vermutlich ein Kadett, sowie ein Mann um die Vierzig, mit Bierbauch und dem Abzeichen eines Revierinspektors auf der Brust, die ihr den Weg versperrten. Dem Jungen schien die Situation unangenehm, er trat nervös von einem Bein auf das andere. Der Ältere hingegen hielt demonstrativ das antike, aber immer noch überaus tödliche Sturmgewehr 77 auf die Frau gerichtet.
»Du kommst trotzdem nicht rein!«
Sie war um die dreißig, die Haare bereits im Ergrauen begriffen und schütter, der Körper sichtlich ausgezehrt. Aber es war noch Leben in ihr, und Kraft – genug, um das sie begleitende Kind in die Höhe zu heben. Ein Mädchen, gerade mal im Kindergartenalter – wenn es noch Kindergärten gäbe. Ihre dunkelbraunen Haare lockig und halblang, weder dicht noch lang genug, um die verräterischen purpurnen Striche am Hals zu verbergen. Zusammen mit dem röchelnden Husten ein Indiz dafür, dass die Frau – die Mutter? – nicht übertrieb.
»Seht sie euch an! Sie wird sterben!!«
Der Revierinspektor grunzte verächtlich.
»Dann tu uns beide den Gefallen und geh vorher zum Biorecycling. Das spart dem Abdecker den Weg zu euch.«
Ich zuckte ein wenig zusammen, nicht so sehr wie die Frau, die wie von einem Fausthieb getroffen zurück taumelte, beinahe das Kind fallen ließ. Streng genommen hatte der Widerling nicht unrecht. Die Magistratsabteilung 48 freute sich immer, wenn sie nicht ausfahren musste und die Leichen – oder Sterbenden – direkt an einen ihrer Recyclinghöfe geliefert wurden. Den Begriff Abdecker mochten sie jedoch ebenso wenig wie ich die Art und Weise, mit der die Mutter – ich hatte beschlossen, das sie genau dies war – behandelt wurde.
Und ich hatte keine Zeit für diesen Scheiß.
»Ich nehme die Kleine mit rein.«
Ein Hauch von Hoffnung lag im Blick der Frau, als sie herumwirbelte, und ein verächtlicher, abschätziger Gesichtsausdruck auf der Visage des Revierinspektors.
»Was? Warum? Geht nicht, Vorschrift ist Vorschrift. Wir können ned einfach jeden reinlassen.«
Noch hatte ich einen Rest Geduld, versuchte es mit Diplomatie.
»Es ist ja nicht für immer. Ich bringe sie durch das Portal, sie bleibt eine halbe Stunde drüben. Das reicht, um sie zu heilen – und dann kehrt sie wieder hierher zurück. Niemand verlangt, sie zu einer Dienerin zu machen. Das passt uns dann allen, oder?«
Die Mutter nickte heftig, auch der jüngere der beiden Wächter bewegte zögerlich seinen Kopf auf und ab. Nur dumm, dass sein Partner aus einem anderen Holz geschnitzt war.
»Na, des past ned. Was geht dich des scheiß Gschratz überhaupt an?«
Betont gelassen legte ich meine Hand an die Seite, dort, wo die Glock 38A ruhte. Er war trotz seiner Berufswahl nicht dumm genug, den Lauf seiner Waffe auf mich zu richten – nicht auf eine Sondereinsatzkraft des Rates.
»Du weißt, wer ich bin, oder?«
Natürlich wusste er es, und zwei Seelen rangen in seiner Brust. Zum einen war er ein Ringwächter – ein Diener der Elohim, dessen Wohnung innerhalb der Kuppel lag. Ich hingegen lebte da draußen, daher per Definition und Weltbild eindeutig minderwertiger. Andererseits …
»Schauts, Burschen, es gibt genau zwei Optionen hier. Entweder marschiere ich mit der Kleinen hier durchs Portal, lasse sie auf der anderen Seite bei einem eurer Kollegen und der bringt sie dann gesund und munter wieder zurück zu ihrer Mutter.«
Die so erwähnte lächelte dankbar – und verneinte nicht ihre Rolle. Hatte ich also doch richtig gelegen.
»Oder aber ihr erklärt in spätestens …«
Demonstrativ hob ich mein linkes Handgelenk und ließ den darin verbauten Chip die Uhrzeit als schickes Hologramm in die Luft projizieren.
»… zwanzig Minuten der Sicherheitssprecherin, warum ich nicht in der Hofburg bin. Also, was ist euch lieber? Ich nehme an, Variante Eins?«
Beide waren beim Begriff Sicherheitssprecherin zusammengezuckt, aber ihre Reaktion fiel dennoch höchst unterschiedlich aus. Der Ältere ließ die Waffe sinken, trat demonstrativ zur Seite und murmelte ein halbherziges »Von mir aus«.
Der Jüngere hingegen, offensichtlich mit einem gesunden Überlebensinstinkt gesegnet und wohl wissend, was gut für seine Karriere war, zeigte weitaus mehr Enthusiasmus.
»Natürlich, Frau Majorin, küss die Hand, gnä’ Frau Majorin. Ich werde Sie beide persönlich auf die andere Seite bringen – und das Kind zurück hierher. Natürlich nur, wenn sie das will.«
Die Mutter, an die er sich mit dem letzten Satz gewandt hatte, nickte und stammelte mehrfache Bejahungen, ehe sie an mich herantrat und meine Hand ergriff.
»Danke, danke, vielen Dank! Die Julia ist ein braves Kind, sie wird Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten! Und nochmal danke, Gott segne sie!«
Ich verzog unwillkürlich das Gesicht. Gott war tot, viel wahrscheinlicher hatte er niemals existiert – und wenn doch und falls noch am Leben, war er ein ausgemachtes Arschloch.
Der junge Ringwächter, der sich als Simon Plehn vorstellte und es sich nicht nehmen ließ, mir dreimal seine Dienstnummer mitzuteilen, brachte uns hindurch auf die andere Seite. Julia, ihre kleine schwächliche Hand in die meine gelegt, stolperte fast über ihre eigenen Beine, als sie zum ersten – und allen Gesetzen nach letzten Mal – den Ring betrat, die Pracht und Herrlichkeit mit eigenen Augen sah.
Bunte Schmetterlinge flatterten über Blumenwiesen hinweg, in denen vortrefflich gedeihende Obstbäume den flanierenden Elohim in ihren weißen, wallenden Gewändern Schatten und Früchte spendeten. Golden spiegelte sich das gefilterte Sonnenlicht auf verzierten Dächern wider, traf zwischen aufwendig restaurierten Barock-, Renaissance- und Jugendstilgebäuden auf dutzende Gewächshäuser, in denen fleißige Diener der Wiener Gärten jenes Getreide und Gemüse zogen, das auf den Tellern der Elohim landete. Beziehungsweise in den Trögen ihres Viehs.
Ein Fiaker näherte sich von der Hofburg, eine Kutsche aus echtem Holz, von ebenso echten Pferden gezogen und einem weiteren Diener gelenkt.
»Warum liegt die Membran nur über dem Ring?«
Ihre Worte klangen keineswegs vorwurfsvoll, und das machte die Sache nur schlimmer. Sie hatte verdammt nochmal jedes Recht dazu, vorwurfsvoll oder gar anklagend zu klingen, stattdessen fragte sie wie … nun, wie ein kleines Kind eben, dass die Welt nicht verstand, aber verstehen wollte.
»Warum leben wir nicht alle so?«
Weil die Ressourcen dafür nicht reichen. Weil der Rat beschlossen hat, dass es wichtiger ist, der Elite den gewohnten Luxus zu garantieren, als allen von uns ein halbwegs menschenwürdiges Leben. Es gab nicht genug für alle – zumindest nicht auf diesem Niveau. Nicht genug Enzyme aus den Zuchttanks, nicht genug High-Tech-Medizin, nicht genug Energie und vor allem nicht genug Lebensmittel. Du und deine Freunde, ihr sollt alle sterben, bevor ihr Großeltern werdet, damit die Elohim zweihundert Jahre oder älter werden. Dabei könnten wir alle akzeptabel, vielleicht sogar gut leben, wenn wir nur gerecht verteilen würden. Wollen wir aber nicht.
All das sagte ich natürlich nicht laut, schon gar nicht zu dem kleinen Mädchen, dessen Husten bereits verschwunden war. Auch die purpurnen Striche am Hals begannen zu verblassen, ein deutliches Zeichen, dass die Scharlachseuche bereits bekämpft wurde. Sie würde leben – nur eben nicht besonders gut. Was sollte ich ihr schon groß antworten? Eine gnädige Lüge, was sonst.
»Eines Tages werden wir alle so leben. Du musst nur Geduld haben.«
Sie blickte mich zuerst skeptisch an, beschloss aber offenbar, mir zu glauben, was vor allem daran lag, dass ich sie immerhin hierher gebracht hatte. Ich löste mich von ihr, nickte dem Junior-Inspektor noch einmal zu – eine stumme Aufforderung, sich Zeit zu lassen, bevor er die Kleine zurückbrachte. Ich habe es nicht so mit Abschieden, und deswegen marschierte ich so rasch wie möglich zur Hofburg selbst.
Dem Epizentrum der Wiener Politik.
Dem Hort der Macht.
Nur zwei Burgwächter standen draußen, mit den neuesten 2050er Gewehren bewaffnet.
»Majorin, der Kaiser erwartet Sie im Maria-Theresien-Zimmer.«
Das war ungewöhnlich. Zum einen eine Audienz beim Kaiser selbst, und dann noch dazu in einem Bereich, der eigentlich Repräsentationsaufgaben vorbehalten war. Ich ging durch prunkvolle Gänge und Räume, umgeben von Gold und Kristallleuchtern, schweren, roten Samtvorhängen und dem allgegenwärtigen Duft besten Wiener Kaffees. Eine Totenstille lag über dem Gebäude. Nur wenige Wächter säumten den Weg, keine Sprecher begegneten mir in den Hallen und selbst die Hofschranzen schienen verschwunden. Die Hofburg wirkte wie ausgestorben – bis auf den Kaiser und die Sicherheitssprecherin, die tatsächlich bereits auf mich warteten, auf der roten Sitzbank nebeneinander positioniert, den goldverzierten Tisch vor sich und ein Portrait von Maria Theresia im Rücken. Ich verbeugte mich tief.
»Sprecherin, melde mich wie befohlen. Eure Hoheit, es ist eine Ehre, empfangen zu werden.«
Seine Majestät Kaiser Michael III. schien angespannt, ja beinahe erregt zu sein, rang sich aber ein gütiges Lächeln ab. Er konnte es sich leisten, als absoluter Herrscher über ganz Wien, Nachfolger von Bürgermeister und Landeshauptmann in Personalunion. Schon vor dem Wandel hatten diese hier beinahe gottgleiche Macht besessen, nun war sie durch Membran und Barriere noch mehr gefestigt. Man sah ihm seine hundertfünfzig Jahre kaum an, er würde noch mindestens ein halbes Jahrhundert weiter regieren und im dekadentesten Luxus schwelgen. Kein Wunder, dass er mir gegenüber großzügig auftrat.
»Genug der Förmlichkeiten, Lena. Du weißt, dass wir dich wie eine der unseren sehen. Dein Großvater war mir ein lieber Freund.«
Wie eine der unseren – eine spannende Formulierung dafür, dass ich eben doch nicht zur Elite gehörte. Und was meinen Opa betraf – dem hatte ich ganz andere Dinge vorzuwerfen.
»Eure Hoheit meint den Großvater, der beschloss, nicht im Ring zu wohnen und damit auch mich zu einem Leben außerhalb verdammte? Jenen Großvater, der zuerst die Membran entwarf und sich dann in die Wildnis verzog, mich als Jugendliche einfach mir selbst überließ?«
Die Sprecherin räusperte sich, wollte schon zu einer Antwort ansetzen, aber der Kaiser hob seine Hand – und sie schwieg, gehorsam und unterwürfig wie immer, wenn er redete.
»Lena, nimm es ihm nicht übel, er war ein – nun ja, eine Idealist, wenn auch ein fehlgeleiteter. Aber wir haben uns um dich gekümmert, nicht wahr? Die beste Ausbildung, das beste Training, ein eigener Pavillon auf der Baumgartner Höhe. Eine Investition, die sich für uns gelohnt hat. Schwechat war – nun, das, was unsere Vorfahren einen Gamechanger nannten. Aber jetzt brauchen wir dich noch einmal. Für einen allerletzten Einsatz, und nach diesem ernennen wir dich zur Elohim. Wenn du willst, kannst du sogar in die Hofburg selbst ziehen – wenn du erfolgreich bist.«
Ich schluckte. Seit Jahrzehnten war niemand mehr zum oder zur Elohim ernannt worden. Ja, es gab privilegierte Diener, die sich hier zur Ruhe setzen durften, ohne weiter Arbeiten nachgehen zu müssen – aber eine formale Erhebung, vererbbar für alle Ewigkeit? Ich konnte am Gesichtsausdruck der Sprecherin sehen, wie sehr ihr das zuwider war, und ebenso, wie sehr sie es zu verbergen versuchte. Aber mir ging Wichtigeres durch den Kopf als das Klassenbewusstsein meiner Vorgesetzten.
»Eure Hoheit, gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um einen Einsatz außerhalb der Barriere handelt? Eine Mission, die so geheim ist, dass Eure Majestät alle anderen Sprecher und Minister, Hofschranzen und sogar die meisten Burgwächter nach Hause geschickt hat, damit niemand davon Wind bekommt?«
Der Kaiser nickte und lachte auf, ehe er entwaffnend die Hände hob.
»Siehst du, Lena, warum wir dich so schätzen? Du bist die intelligenteste Agentin des Rates, dir kann man nichts vormachen. Ja, du hast in allem recht. Sprecherin, die Aufnahme.«
Kandler nickte knapp und aktivierte ihren Chip. Die Geräusche der Wildnis, des falschen Fleisches in all seinen Formen, ertönten im Raum, dazu das Plätschern von Wasser – und schließlich eine Stimme, männlich, gehetzt und verzerrt.
»Wien, Wien, bitte kommen. Hier spricht Professor Trutzer von der Festung Zürich. Wir bitten um Extraktion und Asyl. Es – es gab einen Aufstand, wir mussten fliehen. Über die Alpen … Gleiter – abgestürzt, Zuflucht … Ötscher. Ötscher Tropfsteinhöhlen.«
Die Verzerrung wurde stärker, offenbar hatten sie den Funkspruch mit den allerletzten Energiereserven abgesetzt.
»Dringend. Wir haben Verletzte. Die Kreaturen … kommen näher … haben … achtzig Kilogramm … Enzyme … Forschungsergebnisse … Baupläne für Waffen … alles für Sie … holen Sie uns raus!«
Hier endete die Übertragung, und der Kaiser lehnte sich zurück.
»Zürich, Lena, Zürich! Du weißt, was das bedeutet, und warum vorerst noch niemand davon erfahren darf?! Die Festung hat dem Wandel am längsten und besten getrotzt, sie hatten die besten Wissenschaftler, haben sie wahrscheinlich immer noch. Trutzer ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Biogenetik, und was immer sie auch an Waffen entwickelt haben, es bedeutet …«
Ich lächelte wissend.
»… totale Dominanz für Wien. Nicht nur hier und in Bratislava.«
Die Sicherheitssprecherin nickte begeistert, vergaß für einen Augenblick meine versprochene Erhebung.
»Genau! Wir holen uns zuerst Budapest, dann Prag und München unter unsere Schirmherrschaft. Langfristig ist das unsere Chance, über ganz Europa zu herrschen!«
Da hatte sie nicht unrecht, aber wie so oft trübte Machtgier die Sinne, ließ die Herrschenden leichtsinnig werden. Ich entspannte meine Schultern, lockerte meinen Nacken.
»Vielleicht. Vielleicht aber ist es auch eine raffinierte Falle. Ein Plan, Wien zu übernehmen. Oder auch nur gravierend zu verändern.«
Der Kaiser war skeptisch.
»Was meinst du damit?«
»Stellen Sie sich vor, der Funkspruch kommt gar nicht von diesem Trutzer, sondern in Wirklichkeit von … jemand anderem außerhalb der Barriere. Jemandem, der einen Weg gefunden hat, die Nanotech für seine Zwecke einzusetzen. Rebellische, vielleicht sogar revolutionäre Zwecke. Er oder sie hätte eine Waffe, aber keinen Weg, sie einzusetzen.«
Kandler lachte kurz auf, freudlos und höhnisch.
»Warum dann dieser Funkspruch? Dieser ominöse Jemand kann wohl kaum erwarten, dass wir angeflogen kommen und ihn dann in die Stadt bringen, ohne seine Identität, seine Geschichte und vor allem sein Gepäck gründlich zu kontrollieren.«
Ich blickte in Richtung Flur, wo seit meiner Ankunft niemand zu sehen gewesen war – und es wirkte nicht so, als ob sich das bald ändern würde.
»Nein, natürlich nicht. Er würde seine Waffe bereits zuvor durch die Barriere gebracht haben, zum Beispiel auf dem Rücken einer trainierten Ratte, durch den Wienkanal, geschützt vor den Pulsern. Aber dann bräuchte er immer noch einen Weg in den Ring, vor allem, falls seine Waffe nur dann funktioniert, wenn sie innerhalb der Kuppel gezündet wird.«
Die Sprecherin begann zu zittern, aber ich sprach ungerührt weiter.
»Er bräuchte jemanden, der durch das Portal spazieren kann, ohne gefilzt zu werden. Jemanden wie mich.«
Der Kaiser schluckte und hob langsam die Hände.
»Lena, ich verstehe nicht, was du meinst.«
Mit einer geschmeidigen Bewegung, so schnell, dass ihre Augen meiner Hand nicht folgen können, bringe ich meine Glock in Anschlag, richte sie auf den Kaiser.
»Mein Großvater hat mich nicht verlassen. Er hatte einen Plan. Wir hatten einen Plan. Und jetzt sendet er seine Grüße.«
Ich warte eine halbe Sekunde, genieße den Schock der Erkenntnis, zuerst im Gesicht der Sprecherin, dann in der enzymgepflegten Fratze des Kaisers selbst.
Die Glock bellt auf, der Knall hallt durch die Hofburg, und das Gehirn des Herrschers verteilt sich über das Portrait der einstigen Kaiser.
Das Rot passt hervorragend zu den Tapeten.
Zwei weitere Schüsse, in Brust und Hals der Sprecherin, dann warte ich, zähle im Geiste die Sekunden.
Zehn, zwölf, dreizehn – und dann stürmen die Wachen in den Flur.
Natürlich tun sie das, instinktiv, enthusiastisch – und dumm.
Meine Projektile fegen sie von den Beinen, lassen sie in grotesken Zuckungen zu Boden gehen.
Ich halte den Atem an und lausche.
Stille, keine weiteren Schritte, keine Schreie.
Noch nicht.
Zielstrebig steige ich über die Leichen, holstere meine Waffe und ziehe das Röhrchen heraus.
Opa, du warst schon immer ein Genie, aber damit hast du dich selbst übertroffen.
Ich öffne zuerst das Fenster, dann den Behälter.
Drei Millionen winziger Helfer strömen ins Freie, fliegen als dunkelgrauer Schwarm nach oben, in Richtung der Membran.
Nicht, um sie zu zerstören, oh nein!
Sie werden sie erweitern, sich vermehren und die schützende Kuppel dabei wachsen lassen, über den Ring hinaus, über die Bezirke Wiens, bis hin zur Barriere, wo die EM Pulser ihnen Grenzen setzen.
Und das ist gut so.
Wir werden alle geschützt sein, bis zu einem gewissen Grad.
Und alle werden wir dieselbe Luft atmen, über kurz oder lang auch dasselbe Wasser trinken, die gleiche Nahrung essen.
Ressourcengerechtigkeit, so wie mein Großvater sie einst predigte.
Der Untergang aller Elohim hat begonnen, und ich feiere es mit einem Lächeln, während ich ein frisches Magazin in meine Waffe führe.
~ ~ ~
Über den Autor
Ertlov, Ivan: Geboren 1978 in Prag, eingebürgert und aufgewachsen in Österreich.
Seit 2003 in der Computerspieleindustrie tätig, meist als Producer oder Creative Writer, bekannt unter anderem durch »Gothic«, »Hitman« und »Medieval Dynasty«. Nach einer fünfzehnjährigen, auch politischen Karriere immigrierte Ertlov 2017 nach Australien, um die Spielemarke RISIKO als Senior Producer weiterzuentwickeln. In seiner neuen Heimat begann Ertlov, politisch subversive und humorvolle Science-Fiction Romane zu veröffentlichen – sowohl als Selfpublisher, als auch in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Verlagen.
Mit mehr als 40 Veröffentlichungen, davon 15 ins Englische übersetzt und international vermarktet, sowie mehr als einer Million verkauften Exemplaren über alle Plattformen und Dienste hinweg, zählt Ertlov zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Phantastik-Autoren der Gegenwart. Zwei Siege und zahlreiche Platzierungen beim deutschen Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Phantastik sowie zwei Siege beim Global Book Award unterstreichen die Bedeutung des Autors innerhalb seiner Nische.
Sweeper (Julia Freyer)
~ ~ ~
Sie sagen, Krieg sei ein schmutziges Geschäft, bei dem man sich die Hände schmutzig mache. Aber in Wahrheit haben sie keine Ahnung. Noch viel schmutziger als der Krieg selbst präsentiert sich nämlich das, was danach übrig bleibt: Stinkende, verkohlte Überreste, um die sich niemand mehr kümmern will. Das ist der wahre Dreck. Und ich muss es wissen, wühle schließlich jeden Tag darin herum.
Denn ich bin ein Sweeper.
Tote Erde zieht unter uns vorbei. Wo früher grün und blau dominierten, sieht man nun weit und breit nichts anderes als rot und schwarz. Verbrannter Boden und zerstörte Natur. Die einstige Schönheit kann ich mir nur ausmalen, denn sie verging bereits vor meiner Zeit. Als ich noch ein kleiner Junge war, brachte mir mein Vater einmal von seinen Touren ein Buch mit. Es befand sich zwar in üblem Zustand, aber die Farben der Fotos waren das Schönste, das ich je gesehen habe. Die Bilder zeigten Dinge, die ich zwar nicht benennen konnte, jedoch zu vermissen begann, obwohl ich sie nie besessen hatte. Das Buch war Zeuge einer längst verlorenen Welt.
»Hast du die Ausrüstung überprüft?«
Der aus dem Cockpit ertönende Ruf meines Vaters holt mich aus meinen Gedanken zurück in die Wirklichkeit. Meine Wirklichkeit. Ich wende den Blick vom Fenster ab und widme mich wieder der Ausrüstung. Wenn auch nur ein Schlauch nicht richtig angeschlossen ist, sind unsere Tage noch gezählter als ohnehin schon.
»Ich gehe jetzt runter«, warnt mich mein Vater vor. Als im nächsten Augenblick die Landungsdüsen zünden, erschüttert ein gewaltiger Ruck das Shuttle. Ich kann mich gerade noch festhalten und blicke erneut hinaus. Staub wirbelt empor, als mein Vater die Maschine vorsichtig dem Boden annähert. Die senkrecht ausgerichteten Start- und Landungsdüsen verringern allmählich ihren Schub, bis wir sicher auf – hoffentlich – festem Boden angekommen sind.
»Ich starte den Umgebungsscan«, kündigt mein Vater an. Obwohl diese Einsätze Routine für uns sind, geht er jeden einzelnen Schritt nach Lehrbuch durch. Er vertritt die Auffassung, nur deswegen überhaupt noch am Leben zu sein. Ich glaube, seine penible Vorgehensweise liegt darin begründet, dass er noch zu den wenigen nicht technisch verbesserten Menschen gehört. Nicht ein einziges mechanisches Hilfsmodul befindet sich in seinem Körper, daher muss er sich zu hundert Prozent auf sich selbst verlassen können. Hier draußen könnte jeder kleine Fehler den Tod bedeuten.
Ich seufze und reibe instinktiv an meinem rechten Bein. Ab der Oberschenkelmitte abwärts besteht es aus Carbon. Mit den Fingerspitzen fahre ich die vielen Furchen und Schrammen nach. In meinem Empfinden gehörten Körperupgrades schon immer dazu, und einige sind sogar überlebenswichtig für mich. Denn ich gehöre zu einem ganz besonderen Teil der Cyborg-Bevölkerung, zur Generation CyborgBaby. Unsere Körper erwiesen sich bereits bei der Geburt durch negative Umwelteinflüsse und Drogenabhängigkeiten unserer Mütter derart beeinträchtigt, dass wir ohne Cyborg-Implantate nicht lebensfähig waren.
Das rechte Bein verlor ich mit ungefähr vier Jahren, Teile meiner Lunge wurden bereits kurz nach meiner Geburt mechanisch ersetzt, und die Gehörimplantate erhielt ich, als sich meine Sprachentwicklung auffällig verzögerte. Ich erinnere mich genau daran, dass mein Vater regelmäßig mit mir zu den Check-ups ins Krankenhaus ging. Nach jedem Wachstumsschub mussten meine Implantate ausgetauscht werden. Das ging natürlich ins Geld, und als ich ungefähr neun Jahre alt war, belauschte ich einen Streit meiner Eltern darüber. Meine Mutter insistierte mit schriller Stimme, dass ich keine neuen Ohrimplantate brauche. Die alten würden es auch noch ein paar Jahre machen. Sie brauche das Geld für ihre synthetischen Drogen. Weil ich wegen des hysterischen Gekreisches meiner Mutter nicht schlafen konnte, saß ich im Dunkeln auf der Treppe und horchte. Was Vater dann sagte, werde ich wohl nie vergessen:
»Du willst also, dass ich unseren Sohn für deine Drogen opfere?«
Mit angehaltenem Atem wartete ich auf ihre Antwort. Ganz sicher würde sie sofort verneinen und erklären, Drogen wären nun für sie endgültig Geschichte. Wie naiv ich doch war! Ein kleines, hoffnungslos optimistisches Kind.
»Verdammt, es sind doch nur seine Ohren!«, kreischte sie schließlich. Die aus dem Wohnraum dringende nachfolgende Stille, brannte in meiner Seele. Die Sucht hatte das Herz meiner Mutter endgültig versteinern lassen. Dann ertönte in vernichtend verächtlichem Tonfall Vaters Stimme.
»Du verdienst den Tod.«
Der darauf folgende Schrei meiner Mutter ließ die Wände erbeben. Eine halbe Stunde später hatte Vater unsere Sachen zusammengepackt und wir verließen meine Mutter. Für immer.
Ich weiß, dass er während der nächsten zwei Jahre immer wieder nach ihr sah. Ziemlich sicher gab er ihr auch Geld, wann immer wir genug davon hatten. Tja, Liebe kann grausam sein. Eines Tages kehrte er tränenüberströmt von einem dieser Besuche zurück.
»Deine Mutter ist nun an einem besseren Ort«, flüstert mir seine Stimme noch heute manchmal ins Ohr. Die einzige Aufnahme, die ich auf jedes neue Implantat gerettet habe. In besonders düsteren Momenten höre ich mir diesen Satz an. Ich hoffe, dass er stimmt.
»Scan ohne Auffälligkeiten abgeschlossen.«
Vaters Stimme reißt mich aus den Tragträumen. Energisch schüttle ich den Kopf. Für unseren Einsatz brauche ich einen klaren Verstand und äußerste Konzentration. Fehler können das Leben kosten. Wir steigen in unsere Schutzanzüge und setzen die mit Luftfilter ausgestatteten Helme auf. Natürlich wären Sauerstoffflaschen besser, aber an die gelangt man praktisch nicht. Bevor der Helm meines Vaters luftdicht an den Anzug anschließt, hustet er kräftig. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Über kurz oder lang, voraussichtlich aber eher kurz, würde seine Lunge schlapp machen. Dann benötigt er entweder ein Implantat – oder würde an Atemnot leiden und schließlich sterben. Die harte Realität.
Auch mein Helm verschließt sich am Kragen meines Anzugs. Ich zeige Vater Daumen hoch, er nickt und meldet sich über meine im Helm integrierten Kopfhörer.
»Test Sprechgerät. Kannst du mich hören, Caleb?«
Ich schalte mein Mikro ein.
»Höre dich klar und deutlich, Paps.«
»Verstanden. Ich öffne die Landungsklappe.«
Er drückt auf den gelben Knopf neben dem Ausstieg, und langsam fährt die Rampe herunter. Als sie den Boden berührt, erzittert das Shuttle kurz. Mein Vater tritt als Erster in die unwirtliche Umgebung hinaus. Ich aktiviere die Schubdüsen an unserem Anhänger, so dass dieser einige Zentimeter über dem Boden schwebt. Auf diese Weise lässt er sich problemlos voranschieben, während ich Vater langsam folge.
Der Boden unter meinen Stiefeln fühlt sich hart und brüchig an. Jegliches Wasser ist verschwunden. Das Messgerät auf dem kleinen Wagen schlägt aus. Aber um welche Art Strahlung es sich hier genau handelt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, welches Land das früher war, oder was hier passiert ist. Ist auch egal. Weil es nichts mehr gibt, um das sie sich streiten können, gibt es auch keine Länder mehr, die sich bekriegen. Was noch existiert, sind Orte, an denen man leben kann – und Orte, an denen das eben nicht mehr möglich ist.





























