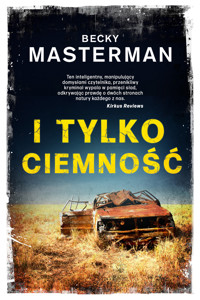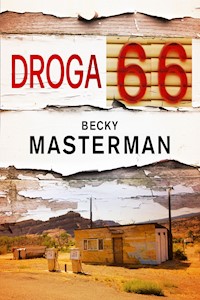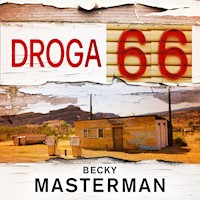9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Lange kann sich Brigid Quinn, FBI-Agentin a.D., nicht von der Jagd nach dem berüchtigten Route-66-Killer erholen. Unter der gnadenlosen Sonne Arizonas erhitzt der rätselhafte Tod eines fünfzehnjährigen Jungen die Gemüter. War es tatsächlich ein Unfall? Die Mutter des Jungen glaubt nicht an diese Theorie. Während Brigid immer tiefer in die Geschichte hineingezogen wird, leidet sie selbst zunehmend unter mysteriösen Symptomen, die ihre Arbeit beeinträchtigen. Dazu kommt die Sorge um ihre Nichte Gemma, die erst kürzlich bei ihr eingezogen ist. Als die Leiche eines weiteren Teenagers gefunden wird, keimt in Brigid ein schrecklicher Verdacht: Es gibt einen Zusammenhang zwischen all diesen merkwürdigen Vorkommnissen - und sie sind nur die Vorboten einer viel größeren Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Ähnliche
Inhalt
Über die AutorinTitelImpressumProlog1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.Über die Autorin
Becky Masterman arbeitet seit vielen Jahren in einem amerikanischen Verlag, der auf forensische Fachliteratur spezialisiert ist. Für ihre Romane hat sie den Rat diverser Experten auf diesem Gebiet eingeholt. Ihr Debüt, DER STILLE SAMMLER, ist ebenfalls bei Bastei Lübbe erschienen und hielt sich wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mit BIS DU TOT BIST legt sie nun die Fortsetzung um ihre charismatische Ermittlerin Brigid Quinn vor. Becky Masterman lebt mit ihrem Mann in Tucson, Arizona.
Becky Masterman
Bis du tot bist
Thriller
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Werner-Richter
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Fear the Darkness«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Becky Masterman LLC
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Britta Schiller, Eitorf
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
Einband-/Umschlagmotiv: Sandra Taufer, München unter
Verwendung von Motiven von © paulrommer / shutterstock;
pashabo / shutterstock; Kuznetsov Alexey / shutterstock;
Thirteen / shutterstock; DeSerg / shutterstock;
Kess / shutterstock; JungleOutThere / shutterstock
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-8387-5311-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Prolog
Ich fürchte mich vor der Dunkelheit, aber das ist mein geringstes Problem. Ich kenne den Raum mit seinen geradezu klaustrophobischen Dimensionen, der mich auch dann in meiner Bewegungsfreiheit einschränken würde, wenn ich keine Schussverletzung im Bein hätte. Bis auf das Werkzeug unter der Matte ist der Raum leer. Carlo ist ein ordentlicher Mensch und achtet auf solche Dinge. Noch bin ich klar genug, um an das Werkzeug zu denken, aber es fällt mir schwer, mich auf seinen möglichen Nutzen zu konzentrieren. Benutze das, was du zur Hand hast, pflegte Black Ops Baxter mir früher einzuschärfen. Bilder schwirren durch meinen Kopf, aber ich schaffe es höchstens noch, ihnen einen Namen zuzuordnen. Wenn überhaupt. Wagenheber. Schraubenschlüssel. Radmutterschlüssel. Dieses elastische Seil. Muttern.
Ein leichter Luftzug dringt durch den Spalt in der unterteilten Rückenlehne. Ersticken werde ich also nicht.
Nein, am dringendsten benötige ich Wasser, um mich herunterzukühlen, meine Atmung zu verlangsamen und um dieses synkopische Hämmern zu stoppen, mit dem mein Herz mich vor dem endgültigen Stillstand warnt. Wenn ich hier drinnen den Löffel abgebe, werde ich vermutlich an irgendeiner abgelegenen Stelle entsorgt. Vor meinen Augen entsteht das Bild meiner eigenen, von Kojoten angeknabberten Leiche. Die Tiere werden dort zu fressen anfangen, wo ich verletzt bin. Die verbleibenden Reste mumifizieren dann später im Wüstengestrüpp. Ich weise den Gedanken von mir.
In den Obduktionsbericht wird George unter Todesart »Unfall« schreiben.
Todesursache: Hyperthermie. Das Opfer erlitt eine Überwärmung des Körpers. Sie entsteht, wenn der Körper mehr Wärme produziert oder von außen zugeführt bekommt, als er verbraucht. Ein extrem erwärmter Körper ist ein medizinischer Notfall und bedarf sofortiger Behandlung, damit nicht Invalidität oder der Tod eintritt.
Schmachvoll. Schmachvoll. Ein typisches Carlo-Wort, von dem ich eigentlich nicht so ganz genau weiß, was es bedeuten soll, aber ich glaube, hier passt es. Ein schmachvoller Tod. Mag sein. Aber niemand soll ihn für einen Unfall halten. Zumindest bin ich in der Lage, für die nötigen Beweise zu sorgen, dass es sich hier um einen Mord handelt.
Ich liege auf der linken Seite. Die Ärmel der Bluse sind um mein Bein gewickelt, wo die Kugel mich gestreift hat. Mir ist jetzt klar, warum Vorkehrungen getroffen wurden, die Blutung zum Stillstand zu bringen. Niemand soll etwas finden können. Mein Blut wäre der einzige Beweis für die Gewalttat.
Obwohl ich mich so lethargisch fühle wie eine ausgekühlte Schlange, strecke ich die Hand aus und fummele so lange an dem Knoten herum, bis er sich öffnet. Ich befühle die Wunde. Aufgrund der Zeit, die vergangen ist, der großen Hitze und meines fast unbeweglichen Liegens ist das Blut hübsch geronnen. Als hätte man es in einem Herd gebacken. Ich zerre die Bluse unter meinem Bein hervor und presse schon im Voraus die Zähne zusammen, damit ich weder schreie noch mir die Zunge abbeiße. Und dann bohre ich meinen Finger tief in die Wunde. Nicht so nah an der Arterie, dass es eine zu große Schweinerei wird (dabei muss ich an eine andere Leiche denken – es gab deren so viele), aber tief genug. Wenn ich noch ein bisschen weiterpule … Trotz der zusammengebissenen Zähne muss ich schreien, wenn auch nicht sehr laut. Verdammt, tut das weh! Aber zumindest sorgt der Schmerz dafür, dass ich nicht vor lauter Hitze das Bewusstsein verliere.
Meine Finger werden schmierig. Ich hoffe, dass ich ordentlich auf den Teppich blute, aber auch Teppiche kann man ersetzen oder säubern. Zwar ist das Blut dann immer noch unter UV-Licht nachweisbar, doch wer würde schon auf diese Idee kommen? Nein, ich muss meine Spur an einer Stelle hinterlassen, wo sie nur jemand findet, der danach sucht. Derjenige wird es der Polizei zeigen und den Verdacht auf das Falschspiel lenken.
Ich fahre mit den Fingern an dem Deckel über meinem Kopf entlang und hoffe dabei nur, dass nichts auf mein Gesicht tropft, denn dort würde es schnell bemerkt. Noch einmal wühle ich in der Wunde und streife meine Finger an dem warmen Metall über mir ab.
Ich raffe meinen letzten Rest Grips zusammen, greife nach der Bluse und wische mir die Finger daran ab. Dann verlagere ich meine Hüften, um die Bluse zurück unter mein Bein zu bekommen, und binde sie unter einigen Schwierigkeiten – mein rechter Arm ist inzwischen taub geworden – wieder zusammen.
Schließlich stecke ich meine Finger in den Mund und versuche, den letzten Rest Blut abzulutschen, doch meine Zunge verweigert den Dienst. Sie ist zu trocken und zu geschwollen. Ich weiß daher nicht, ob unter meinen Fingernägeln und rings um die eingerissene Nagelhaut noch Beweismaterial klebt. Vielleicht werden sie es übersehen. Selbst in meinem geschwächten Zustand fällt mir auf, wie ironisch es ist, mich selbst als Beweisstück zu betrachten, so wie es im Lauf der Jahre so viele Leichen für mich gewesen sind.
Doch selbst wenn da noch etwas sein sollte – was ich hier versuche, ergibt nur dann einen Sinn, wenn ich sterbe. Im Fall des Todes von Brigid Quinn.
1.
Als ich die Neuigkeiten über meine Schwägerin erfuhr, war ich gerade auf dem Rückweg vom Frauenhaus. Es liegt am Rand von Marana, ungefähr eine halbe Autostunde von meinem Wohnort nördlich von Tucson, Arizona entfernt. Das Frauenhaus trägt einen Namen wie »Wüstentauben« oder etwas ähnlich Hirnrissiges. Wenn ich nicht gerade mit Ermittlungen beschäftigt war, bot ich den misshandelten Frauen dort Kurse an, damit sie sich nicht mehr als Tauben fühlen mussten.
An diesem Tag waren es vier gewesen. Eine hatte noch überall tiefblaue Flecken, die am Rand langsam grünlich wurden, und auf allen Gesichtern lag dieser Opfer-Ausdruck. Für mich waren sie in diesem Stadium verwechselbar. Noch konnte ich mir ihre Namen nicht merken, aber in ein paar Tagen würde es vielleicht schon klappen. Ein junger Mann Mitte zwanzig mit höchstens zwei Prozent Körperfettanteil stand in einer Ecke und schaute zu. Ich hatte ihn noch nie gesehen und vermutete, dass es sich um jemanden vom Sicherheitsdienst handelte.
Ich betrat die Matte in der Mitte des kleinen Raums, in dem ein Stepper, ein Crosstrainer und ein paar Gewichte untergebracht waren, die alle nach Spenden aussahen. Zuvor hatte ich mit den Frauen ein wenig Stretching und ein Cardio-Warm-up gemacht, aber nur, um ihr Körperbewusstsein zu stärken. Und jetzt bereiteten wir uns auf die Grundübungen der Selbstverteidigung vor.
Mit einem Haargummi raffte ich meinen weißen Pferdeschwanz zu einem Knoten zusammen und setzte mein mütterlichstes Lächeln auf. »Freiwillige vor!«
Ihre Augen wichen mir aus, und ich hatte den Eindruck, dass diese Augen so etwas öfter taten.
»Schaut mich an! Nun schaut mich doch an! Sehe ich etwa aus, als wollte ich euch wehtun?«, fragte ich.
Die jüngste der Frauen betrat die Matte. Sie war größer als ich, hatte aber die Muskelmasse eines Vögelchens.
»Wie heißt du, Schätzchen?«, erkundigte ich mich.
»Anna.« Es klang wie eine Entschuldigung.
»Anna, du gehst jetzt auf mich zu, als wolltest du mich angreifen. Versuche es in Zeitlupe. Gut. Genau so. Schon okay, du darfst ruhig dabei kichern. Ich bewege mich auch ganz langsam, und wenn wir es einmal so gemacht haben, zeige ich euch, wie es in Wirklichkeit aussieht. Seht ihr, wie Anna mit erhobener rechter Hand auf mich zukommt, als wolle sie mich ins Jenseits befördern? Schön und gut, aber es spielt keine Rolle, ob sie die Hand ausstreckt, mich mit der Faust unter dem Kinn treffen will oder sogar ein Messer hat. Sie ist nämlich ganz auf ihren Angriff konzentriert und bemerkt nicht, dass ich nicht einfach stehenbleibe und es über mich ergehen lasse.
Wie ihr seht, weiche ich nicht etwa zurück, sondern gehe auf sie zu. Ich verkleinere die Angriffsfläche, indem ich meinen Kopf senke, meine Schulter unter ihren Arm schiebe und … nicht erschrecken, Anna, ich verspreche dir, dass es nicht weh tut … sie an der Taille packe und über meine Hüfte rolle. Bei Frauen klappt es am besten mit der Hüfte. Wir haben dort und in unseren Oberschenkeln mehr Kraft als jeder Mann, ganz gleich, wie groß er ist. Und seht ihr, ich habe Annas Vorwärtsschwung gegen sie benutzt.«
Das Ganze in Zeitlupe vorzuführen machte es ein wenig schwieriger. Ich atmete kurz durch und fuhr fort. »Jetzt hängt Anna kopfüber, ehe sie weiß, wie ihr geschieht, und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie es ist, wenn es richtig schnell passiert. Nein, ich lasse euch bestimmt nicht auf den Kopf fallen. Wenn ich meinen Fuß so hinstelle, landet Anna auf ihrer Schulter. Gleichzeitig schiebe ich mein Bein unter sie. Es mag aussehen, als täte ich das, um sie nicht zu verletzen, und tatsächlich schlägt sie dadurch nicht so hart auf dem Boden auf, aber der wichtigste Grund ist, dass ich mich fallen lassen und mein anderes Bein über ihre Kehle legen und sie würgen kann. Seht ihr, wie mein Körper rechtwinklig zu ihrem liegt?
Auf diese Weise kann sich euer Angreifer nicht mehr bewegen. Eure Möglichkeiten bestehen anschließend entweder darin, aufzuspringen und so schnell wie möglich abzuhauen, während der Kerl sich noch wundert, wie er auf dem Boden gelandet ist, oder ihn zu würgen, bis er das Bewusstsein verliert. Keine Sorge, er trägt keinen bleibenden Schaden davon. Ich empfehle die zweite Möglichkeit, damit er weiß, woran er ist. Danke, Anna. Um das zu erreichen, müsst ihr nicht besonders groß und vor allem keine Männer sein.«
Als Anna wieder stand und unwillkürlich lächelte, fragte das Mädchen mit den deutlichsten blauen Flecken: »Wenn ich das mit meinem Mann machen würde – was glaubst du, was anschließend passieren würde? Was würde er tun?«
Ich hätte natürlich Süßholz raspeln können, ihnen sagen, dass der Angetraute Respekt zeigen und ihnen Blumen schenken würde, selbst wenn er sie zuvor vergewaltigt hatte, und dass danach alles eitel Freude und Sonnenschein wäre. Aber die Filmindustrie hatte diesen Frauen schon genügend Lügen über die Liebe aufgetischt. Jetzt war es an der Zeit für Statistik.
Je härter die Worte, desto freundlicher der Ton. »Er würde sich vermutlich nicht gerade bedanken, Schätzchen.«
»Er würde mich umbringen«, erwiderte sie.
Ich versuchte, das Gefühl zu ignorieren, dass sie die Worte mit einem gewissen Wonneschauder aussprach, beinahe mit Lust. So als wolle sie sagen: »Er würde mich dafür lieben.«
»Das ist das Komische an Tyrannen«, sagte ich. »Du denkst, er geht wieder auf dich los, aber das tut er nicht. In neunundneunzig Prozent der Fälle verschwindet er. Er verlässt dich und sucht sich eine andere. Eine, die er unter Kontrolle hat. Eine, die er verprügeln kann, ohne dass sie sich wehrt.«
Das Mädchen verschränkte die Arme vor der Brust. Diese Antwort gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie zog die Lüge vor und würde ihr eines Tages zum Opfer fallen. Ich erkannte, dass sie längst verloren und vielleicht sogar schon tot war. Sie alle taten mir leid. Aber dann wandte ich mich ab, denn es ist unmöglich, jeden zu retten. Manchmal muss man grausam sein, um weiterkämpfen zu können.
Ich blickte zu dem Kerl in der Ecke hinüber. Er war gut anderthalb Köpfe größer als ich und hatte völlig ausdruckslose Augen. Er tat, als hinge er einfach nur so herum, aber die prallen Muskeln unter den Ärmeln seines T-Shirts verrieten ihn. Sein traumatisierter Blick ließ darauf schließen, dass er seinen Körper nicht im Fitnessstudio geformt hatte.
»Irak oder Afghanistan?«, fragte ich.
Er nickte. »Afghanistan.«
»Wie heißt du?«
»Dennis.« Obwohl der Film mindestens zwei Generationen alt war, warnten seine Augen mich davor, seinen Namen keinesfalls mit »die Nervensäge« zu vervollständigen.
»Hast du Lust, ihnen zu zeigen, wie es richtig gemacht wird?«
Er trat auf die Matte.
»Komm.«
Mit erhobenen Fäusten kam er auf mich zu. Kein Problem. Ich brachte ihn zu Fall, wie ich es mit Anna getan hatte, nur schneller. Die Frauen applaudierten. Allmählich machte es ihnen Spaß. Als ich Dennis aber auf die Beine helfen wollte, umfing er meine Taille und warf mich gegen die Wand, wo der Stepper stand. Darauf war ich nicht vorbereitet, und er erwischte mich so, dass ich unter den Stepper rutschte. Die Frauen staunten zwar, taten aber nichts. Schließlich kannten sie so etwas zur Genüge.
Ich riss mich zusammen, stand auf und wappnete mich für seinen nächsten Angriff. Wieder kam er mit geballten Fäusten auf mich zu. Wahrscheinlich war es der Mattenwurf mit meinen um seinen Hals geschlungenen Beinen, der den Killerinstinkt in ihm geweckt hatte. Ich erkannte, dass seine Erlebnisse in Afghanistan ihn eingeholt hatten, und auch mein leises »Dennis, Dennis« bremste ihn nicht.
Es widerstrebte mir, ihn vor den Frauen zu blamieren, aber dieser Junge war in der Lage, mich schwer zu verletzen. Ich versetzte ihm zwei hoch angesetzte Fausthiebe, um seine Arme nach oben zu bekommen. So konnte ich verletzlichere Stellen angreifen. Aber er fiel nicht darauf herein. Anstatt sein Gesicht zu decken, riss er seinen rechten Arm zurück und wollte einen Schwinger landen.
Wollte. Ich schlüpfte unter seinem Arm hindurch und versetzte ihm einen Leberhaken. Ohnmächtig sackte er zusammen.
Die Frauen waren zunächst verblüfft. Schnell aber überwog die Begeisterung darüber, einen so hochgewachsenen Mann vor sich auf dem Boden liegen zu sehen. Ich hingegen nahm mir vor, keinen Kriegsveteranen mehr für Demonstrationszwecke zu benutzen.
Ich versicherte den Frauen, dass Dennis okay sei und dass wir ihnen nur ein paar Griffe für Fortgeschrittene gezeigt hätten. Sie verließen den Raum, und ich brachte ihn wieder zu sich. Wir sprachen kurz miteinander und sahen uns eigentlich erst jetzt zum ersten Mal richtig an. Ich erklärte ihm, dass ich einen Sparringspartner für meine Übungen brauchen könnte, weil ich ein wenig eingerostet sei. Das bezweifelte er zwar, sagte aber zu.
Auf dem Weg nach draußen, wo niemand mich sehen konnte, dehnte ich meinen Nacken und rieb die Stelle an meiner Schulter, die eine recht unsanfte Begegnung mit der Wand hinter sich hatte. Insgesamt aber fühlte ich mich gut. Ach, was rede ich? Ich fühlte mich geradezu fantastisch! Außerdem war ich erleichtert, auch nach vielen Jahren Undercover-Arbeit beim FBI, einem anschließenden Bürojob und meiner Hochzeit mit einem im reifen Alter von achtundfünfzig Jahren zum Philosophieprofessor ernannten ehemaligen katholischen Priester noch immer in Form zu sein. Das Leben mit Carlo DiForenza bot mir die heitere Ruhe, nach der ich mich gesehnt hatte, doch erst kürzlich hatte ich die Erfahrung gemacht, dass man nie wissen konnte, wann man einen trainierten Körper brauchte, um sich verteidigen zu können. Ich musste dafür sorgen, dass ich fit blieb. Wenn ich demnächst mein Kampfsport-Training auch noch damit kombinieren könnte, Dennis über sein Trauma hinwegzuhelfen, wäre es doppelt schön.
Um mich für den einigermaßen gut erledigten Job zu belohnen, genehmigte ich mir an einem Verkaufswagen in Thornydale einen Kaffee, fuhr nördlich nach Tangerine und wandte mich nach Osten. Die gerade Straße durch das Tal wellte sich so sanft wie eine Achterbahn für Kleinkinder. Wenn man diesen Teil von Arizona zum ersten Mal sieht, denkt man: Um Himmels willen, hier gibt es ja nur Beige in gefühlten fünfzig Schattierungen. Aber das stimmt nicht. An diesem späten Frühlingsnachmittag erinnerte mich der rosige Widerschein der untergehenden Sonne auf den fernen Catalinas an den weisen Spruch meiner Freundin Mallory: »Sind die Berge pink, ist es Zeit für ’nen Drink.«
Ich freute mich auf ein Glas Rotwein und nach der Rauferei mit Dennis auch auf ein heißes Bad mit viel Badesalz. Während ich meinen Kaffee schlürfte und dabei das Lenkrad mit den Knien gerade hielt, rief ich meinen Ehemann Carlo an, um ihm mitzuteilen, dass ich in etwa zwanzig Minuten da sei.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dass meine Schwägerin Marylin Quinn gestorben war.
Gleichzeitig mit der Straße sackte auch mein Herz ab. Es fühlte sich an, wie wenn ein Flugzeug in ein Luftloch gerät.
Im Film meldet sich dann der Pilot über Lautsprecher und verkündet, es gäbe einige Turbulenzen und man solle sich bitte anschnallen, aber es bestünde keine Gefahr. Der Scherzkeks eine Sitzreihe weiter macht einen Witz über Bette Davis.
Dann explodiert das Flugzeug, und der Feuerball presst die Luft aus den Lungen der Passagiere, ehe sie wissen, was passiert ist. Alle sterben.
Eine solche Zeit sollte jetzt auf mich zukommen. Auf mich warteten Verrat, eine schleichende Krankheit und die Begegnung mit dem Inbegriff des Bösen. Denn nun würde ich das Versprechen halten müssen, das ich Marylin gegeben hatte.
Genieße deinen Kaffee, Schätzchen.
2.
Es ist schwierig, den Teufel zu erkennen, wenn seine Hand auf deiner Schulter liegt.
Weil ein Psychopath nämlich auch nur ein Mensch ist, ehe er zur Schlagzeile wird. Ehe er in einer Kirche das Feuer eröffnet oder auf dezentere Weise foltert und tötet. Auch Psychopathen trinken ihren Kaffee gerne bei Starbucks oder Dunkin’ Donuts, mögen Jeansstoff oder Leinen und lesen Dickens oder … Sie verstehen, was ich meine. Sofern sie ihren zerstörerischen Drang einigermaßen unter Kontrolle haben, werden sie gerne Chirurgen, in deren Innerem es prickelt, wenn sie das Skalpell über ein schlagendes Herz halten. Oder sie arbeiten als Investmentbanker und lassen sich von dem Spiel mit den Lebensersparnissen kleiner Leute erregen. Vielleicht aber werden sie auch Priester und vergnügen sich insgeheim bei der Beichte eines Ehebruchs. Meist leben diese Kreaturen ihre Gelüste nur bei ihren nächsten Angehörigen aus und werden verdächtigt, für niemanden außer sich selbst etwas zu empfinden und nur zu ihrem eigenen Vorteil zu handeln.
Ich muss zugeben, dass es zumindest peinlich ist, den Teufel nicht zu erkennen, aber ich kann es verstehen, weil es mir selbst so ergangen ist. Das liegt zum Teil daran, dass es den meisten Leuten nicht möglich ist, ganz und gar schlecht zu sein. Während meiner Zeit als verdeckte Ermittlerin beim FBI habe ich Mörder kennengelernt, die aus freien Stücken die Ballettvorführung ihrer Tochter besuchten, und Männer, die mit menschlichen Organen handelten, während sie sich in Babysprache mit ihrem Papagei unterhielten. Der Typ, der in der Tierhandlung Leckerchen besorgt, lächelt einen verlegen an, als sei es ihm peinlich, dass er seinen Vogel liebt; es fällt schwer, sich vorzustellen, dass er Frauen aus Guatemala an Casinos in Las Vegas verkauft. Selbst der schlechteste Mensch zeigt manchmal Mitgefühl. Vielleicht schwärmt der Teufel ja für Malteserhündchen.
Andererseits erwartet niemand, zum Beispiel ausgerechnet bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, im Wohnzimmer eines Freundes oder in einer Arztpraxis auf das Böse zu treffen.
Wer in meinem Job über »Amerikas ein Prozent« redet, meint nicht die Stinkreichen. Es geht um das gut versteckte und daher schwer auszumachende Böse. Genau das aber sorgte während meines Berufslebens für den besonderen Kick, zumindest dann, wenn ich vergessen konnte, dass unschuldige Menschenleben auf dem Spiel standen.
Nicht immer habe ich so gedacht. Das Leben war sehr viel einfacher, als es nichts Wichtigeres für mich gab, als unbedingt zu vermeiden, entdeckt, gefoltert oder getötet zu werden oder selbst zu töten. Seit ich aber mit einem Philosophieprofessor verheiratet bin, denke ich über bestimmte Dinge vielleicht etwas intensiver nach als früher. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass ich jetzt im Ruhestand mehr Zeit habe, die Sterne zu beobachten.
Der Anblick des Sternenhimmels erinnert mich immer an den Tod, und ich denke darüber nach, ob es ein Leben danach gibt. Wenn irgendwer stirbt, muss ich jedes Mal daran denken, wie oft ich selbst dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Marylin starb im Alter von einundfünfzig Jahren an multipler Sklerose. Sie lebte zusammen mit meinem kleinen Bruder Todd, der jetzt zweiundfünfzig war, der gemeinsamen siebzehnjährigen Tochter und meinen Eltern in Florida. Am liebsten wäre ich allein zur Beisetzung gefahren, um Carlo nicht meiner Familie auszuliefern, aber er bestand darauf, mich zu begleiten. Wir waren inzwischen seit zwei Jahren verheiratet. Höchste Zeit, deine Familie einmal kennenzulernen, erklärte er in seiner sanften, aber direkten Art – eine Art, die ihn umso tröstlicher wirken ließ, je besser wir einander kennenlernten.
Ich hätte alles für Marylin getan, denn ich liebte sie. Obwohl sie wusste, wie verdreht wir alle waren – außer Mom arbeiteten wir alle in der Verbrechensbekämpfung –, heiratete sie in unsere Polizistenfamilie ein und zeigte uns, dass man auch nett zueinander sein konnte. Aber lange durften wir uns ihrer Lektionen nicht erfreuen. Vier Jahre nach ihrer Hochzeit mit meinem Bruder Todd wurde bei ihr multiple Sklerose diagnostiziert. Sie bestand darauf, ihr Leben bis zu ihrem Tod zu genießen und sogar ein Kind zu bekommen, obwohl die Ärzte sie davor gewarnt hatten, dass eine Schwangerschaft ihrer Gesundheit großen Schaden zufügen könne. Nach Gemma-Kates Geburt ging es ihr zunehmend schlechter. Auf den Rollstuhl folgte das Pflegebett, doch sie hielt noch siebzehn Jahre durch, ehe sie starb.
Das Versprechen, das ich Marylin gegeben hatte, bezog sich auf Gemma-Kate. Marylin hatte mich Anfang des Jahres angerufen und gefragt, ob ihre Tochter bis zu ihrer Immatrikulation an der University of Arizona bei Carlo und mir bleiben könne, falls ihr etwas zustieße.
»Wie hat sie sich denn gemacht?«, hatte ich gefragt, ohne die Dinge zu erwähnen, die ich von Mom gehört hatte. Nichts wirklich Dramatisches – ein kleiner Ladendiebstahl und als gerade Vierzehnjährige ein wenig Herumgeflirte mit jungen Männern am Strand.
»Ganz gut. Die kleinen Verfehlungen damals waren einfach nur jugendliche Aufmüpfigkeit«, hatte Marylin beschwichtigt. Sie kannte den Familienklatsch.
»Aber dir ist klar, dass ich keinerlei Erfahrung mit Kindern habe.«
»Du wirst sehen, dass sie recht erwachsen geworden ist. Sie wird dir gefallen.«
Ich hatte zugestimmt. Nur drei Monate später starb Marylin. Jetzt musste ich mein Versprechen einlösen.
Bei der Bestattung weinte Todd nicht, schwitzte aber stark. Als ob die Tränen, die er sich verbot, gezwungen wären, sich einen anderen Weg zu suchen. Während der gesamten Zeremonie benutzte er die zu kurzen Ärmel seines Jacketts, um sich auf beiden Seiten das Gesicht abzuwischen. Aber vielleicht waren auch die feuchte Hitze Floridas und sein Gewicht schuld an den Schweißbächen. Todd behauptete immer, er müsse acht Kilo abnehmen, aber in Wirklichkeit waren es eher fünfzehn. Und trinken hätte er auch nicht mehr dürfen. Ebenso wenig wie rauchen.
Die Trauergemeinde setzte sich in der Hauptsache aus Marylins Angehörigen sowie einer beachtlichen Menge Cops aus Todds Dezernat zusammen, die alle unbehaglich dreinblickten – nicht etwa wegen der Toten, sondern weil sie Uniformen tragen mussten. Die Kerle hatten ihre Zähne so fest zusammengebissen, dass sie sie beim kleinsten Schreck vermutlich angeknackst hätten.
Todd betupfte sich noch immer mit seinem Taschentuch, als wir längst in dem Wohnzimmer saßen, das Marylin dreißig Jahre zuvor eingerichtet hatte und in dem sich Bilder und allerlei Schnickschnack angesammelt hatten, ohne dass jemals etwas weggeworfen worden war. Alle anderen, die dem Gottesdienst beigewohnt und am anschließenden Imbiss teilgenommen hatten, waren längst nach Hause gegangen.
Das Aroma von abkühlender Lasagne und Hühnerleberragout hing in der Luft. Marylins Familie war bereits geflüchtet und hatte Carlo und mich den Fängen der Quinns überlassen. Carlo und ich sollten bei Todd übernachten. Wir hatten angefangen, Wodka auf Eis zu trinken, weil es so am einfachsten war. Die anfänglich stimulierende Wirkung, die zu netten Geschichten über Marylin anspornte und uns zum Lachen brachte, wie es bei einer anständigen irischen Totenwache sein soll, wich allmählich einer depressiven Stimmung.
Eigentlich waren wir keine schlechten Leute, zumindest soweit mir damals bekannt war. Vielleicht lag es daran, dass wir alle in irgendeiner Weise als Gesetzeshüter tätig waren und leeren Gläsern mit haarfeinen Ermüdungsrissen ähnelten. Und in diesem Moment hingen wir alle ein bisschen zu nah aufeinander. Es war reine Spekulation, was geschehen würde, aber an diesem Tag versuchten wir, wenn nicht für uns, dann um Marylins willen, vernünftig zu sein und uns nicht gegenseitig zu zerbrechen.
»Heute waren erstaunlich viele Leute da«, sagte ich, weil ich dachte, dass Todd so etwas gerne hören würde. Ich wünschte mir, es gäbe ausgedruckte Vorlagen, damit der Einstieg in eine Konversation weniger Mühe bereitete. Die männlichen Mitglieder meiner Familie hatten mit Gesprächen, bei denen man sich nicht anbrüllte, wenig am Hut. Stellen Sie sich Leute vor, die sich anschnauzen, um sich Gute Nacht zu wünschen, und Sie haben zumindest einen Eindruck.
»Alles Typen vom Dezernat«, sagte Todd, sichtlich bemüht, seine Stimme im Zaum zu halten, die tatsächlich auch nur leicht genervt klang. »Von Marylins Freunden war kaum jemand da. Die Leute lassen einen fallen, wenn man so lange krank ist.« Todd vergaß die vielen Leute, die dabei gewesen waren, und fixierte sich nur auf die Abwesenden. Er war schon immer jemand gewesen, der über die Dunkelheit schimpfte, während ein anders gestrickter Zeitgenosse eher nach einem Streichholz gesucht hätte.
Am liebsten hätte ich ihn darauf hingewiesen, doch es gelang mir, stattdessen zu fragen: »Weiß Ariel Bescheid?« Ariel ist unsere mittlere Schwester, mit der ich mich immer gut verstanden habe, bis sie sich entschied, zur CIA zu gehen. Seitdem haben wir kaum noch Kontakt. Inzwischen könnte ich nicht einmal mehr sagen, wie sie aussieht, geschweige denn, wo sie sich aufhält.
»Ich habe auf ihren Anrufbeantworter zu Hause gesprochen«, sagte Todd. »Aber vielleicht hält sie sich ja gerade im Ausland auf.« Mit einer heftigen Bewegung drückte er seine Zigarette in einem Aschenbecher auf dem Tisch gleich neben seinem Sessel aus. Die meiste Asche blieb sogar drin.
Niemand sprach. Dann und wann ließen wir die schmelzenden Eiswürfel in unseren Gläsern klirren und nippten an unserem Wodka, um die Stille zu übertönen. Auf der Suche nach einem neuen Gesprächsthema neigte ich den Kopf und warf einen Blick auf die Bücher, die sich in dem Fach unter der Tischplatte befanden. Ich sehe mir immer die Bücher anderer Leute an, denn ihre Auswahl sagt weit mehr über die Besitzer aus, als diese eigentlich preisgeben möchten.
In dem Fach standen ein altes Messbuch, zwei Kochbücher sowie ein Handbuch über Kindererziehung mit einem kranken Elternteil. Leider nichts, um ein Gespräch in Gang zu bringen.
Ich stemmte mich aus einem dieser Armsessel, die so niedrig sind, dass sie den Schwerpunkt durcheinanderbringen und man zum Aufstehen seine Arme benutzen muss, und folgte dem Leberragout- und Hühnchengeruch ins Esszimmer. Der Tisch bog sich unter Plastikbehältern, in denen die Polizistengattinnen Selbstgekochtes mitgebracht hatten. Ich strich etwas von dem mit Nüssen umhüllten, schon etwas angetrockneten Cheddarkäse auf ein winziges Stück Pumpernickel und aß es. Jeder hat eben seine eigene Art zu trauern.
Gemma-Kate hatte sich mit einem Glas Tonic beschäftigt, von dem ich nicht wusste, ob es außerdem auch Wodka enthielt. Ich hatte nicht gesehen, wie sie sich einschenkte, aber sie schien nicht angeheitert zu sein. Sie kam zu mir ins Esszimmer und begann, im Fleisch herumzustochern. Sie entrollte eine Scheibe Roastbeef, legte ein Stück gelben Käse und drei Oliven darauf und rollte es wieder zusammen. Sehr methodisch. Sie aß es jedoch nicht. Stattdessen bediente sie sich mit den Fingern an der Garnitur des Fleischtellers. Mit der Präzision einer Anästhesistin trank ich einen weiteren Schluck aus meinem Glas – gerade genug, um den Schmerz nicht zu spüren, ohne es später bereuen zu müssen.
»Hier sind nur alte Leute«, sagte ich zu Gemma-Kate und sah ihr zu, wie sie schließlich doch langsam die von ihr fabrizierte Fleischrolle kaute. »Was ist mit deinen Freunden?«
Mein Vater Fergus hörte mich quer durch den Raum. Für einen so alten Mann hat er ein geradezu frappierendes Gehör. »Wir gehören nicht zu den Leuten, die Freunde haben, nicht wahr, Cupkate?« Und das meinte er durchaus nicht als Kritik. Weder an der Familie noch an Gemma-Kate. Der alte Mistkerl klang geradezu stolz. Und es stimmte, dass Dad keine Freunde hatte. Sein häufigster Gesprächsstoff bestand darin, zu berichten, wie er jemanden zurechtgewiesen hatte. Als Kinder hatten wir ihn ernst genommen und seinen Blick gefürchtet, wenn wir nicht brav gewesen waren. Wenn ich ihn jetzt so zusammengesackt und mit gerunzelten Augenbrauen dasitzen sah, fragte ich mich, ob es außer uns irgendjemandem noch so ergangen war. Inzwischen wirkte er auf mich ungefähr so furchterregend wie eine Hexe aus Pappmaché. Aber um des lieben Friedens willen tat ich weiterhin so, als ob es anders wäre.
Gemma-Kate ignorierte ihn. Erneut biss sie von ihrem Röllchen ab und schluckte. »Ich dachte, du wärst größer«, sagte sie zu mir.
»War ich auch mal«, gab ich zurück. Als sie den Scherz nicht zu verstehen schien, legte ich nach: »Als ich dich das letzte Mal sah, warst du kleiner.« Ich betrachtete sie, und mir fiel auf, wie gut ihr Spitzname Cupkate zu ihr passte. Wie alle Quinns war sie recht klein geraten – eben wie ein Cupcake im Gegensatz zu einem richtigen Kuchen.
Sie verputzte das Olivenröllchen ganz und wischte sich die Finger an einem Stapel fast schwarzer Servietten ab. Ich bestrich ein weiteres Stück Pumpernickel mit etwas, das Mom wahrscheinlich Lebermischmasch genannt hätte, und wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Wohnzimmer zu. Ich glaube nicht, dass Todd nervös war, aber seine Schwitzerei ließ ihn so wirken. Er begann, die letzten Tage seiner Frau zu beschreiben.
»Vor einiger Zeit hat sich Marylins Zustand verschlechtert. Wann war das ungefähr, Mom? Irgendwann letztes Jahr?«
»Gemma-Kate war so lieb zu ihr«, sagte Mom. »Sie kann wunderbar mit Kranken umgehen. Marylin hat sich nicht ein einziges Mal wundgelegen.«
Todd nickte. »Wenn ich von der Arbeit kam, saß GK oft bei ihr und las ihr vor. Aber Marylin ging es immer schneller immer schlechter. Wir dachten bereits daran, sie in ein Hospiz zu bringen.«
Während er redete, blickte Gemma-Kate an der Gruppe vorbei durch die Jalousienfenster des Wohnzimmers, als ob sie draußen etwas entdeckt hätte, das niemand außer ihr sehen konnte. Für mich sah es so aus, als hätte sie das Drama um den Tod ihrer Mutter schon so oft gehört, dass es sie nicht mehr berührte. Das Wort, das mir dazu einfiel, lautete kontrolliert.
»Und dann starb sie«, fuhr Todd fort. »Zunächst erschien es uns unendlich lange zu dauern – viele Jahre lang –, aber an den letzten Tagen ging alles ganz schnell.« Er schluckte. Plötzlich wurde es ganz still. Carlo füllte die Leere mit ein paar Kirchensprüchen. »Es ist tragisch für diejenigen, die weiterleben müssen, aber der Sterbende hat plötzlich erstaunliche Einsichten. Er versteht, was mit ihm geschieht. Wir müssen ihn gehen lassen.«
Gemma-Kate holte ihren ruhigen Blick ins Wohnzimmer zurück und heftete ihn auf Carlo. »Tante Brigid hat gesagt, dass du einmal katholischer Priester warst.«
»Das stimmt, zumindest teilweise«, entgegnete Carlo. »Zwar habe ich bereits vor fast dreißig Jahren auf mein Priesteramt verzichtet, aber rein technisch gesehen bleibt man nach der Ordination lebenslang Pfarrer.«
»Aber du darfst heiraten.«
»Eigentlich nicht.«
»Aber du hast es getan.«
»Ja.«
Todd hatte vielleicht befürchtet, dass Gemma-Kate Carlo als Nächstes fragen würde, ob er und ich in Sünde lebten. Denn das entsprach vermutlich Todds Ansicht. Gott allein weiß, was er von uns halten würde, wenn er wüsste, dass wir vor einem Friedensrichter geheiratet haben. Er schwitzte noch etwas mehr und unterband dann alles, was Gemma-Kate noch hätte sagen können, indem er das Thema wechselte. »Gemma-Kate wollte nicht auswärts studieren, solange ihre Mutter so krank war. Aber Marylin hoffte, dass sie bei dir und Carlo wohnen könnte, bis ihr Studium beginnt. Sie hat eine Zulassung für Biochemie an der University of Arizona.«
An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich mit dieser Regelung nicht ganz glücklich war. Als ältestes Kind einer recht alkoholisierten Polizistenfamilie und nach einem kompletten Berufsleben beim FBI hätte ich zwar immer noch mein Leben für ein Kind gegeben, mir war jedoch aufgefallen, dass ich mit Kindern nicht viel gemeinsam hatte. Vielleicht lag es daran, dass ich selbst nie eine richtige Kindheit hatte. Nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung fühlte ich mich außerdem inzwischen in meiner Ehe wirklich wohl, und ich zauderte, etwas zu tun, was das friedliche Gleichgewicht stören könnte. Als ich Marylin mein Versprechen gegeben hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich es so bald würde halten müssen.
Carlo aber zögerte keine Sekunde. »Selbstverständlich«, sagte er und lächelte mich an. Vermutlich erwartete er, dass ich mich über seine Unterstützung meiner Familie freute. »Kein Problem. Wir haben ein Gästezimmer.« Todd sprach weiter, als hätte er nicht erwartet, dass es so einfach werden würde. Er musste alles loswerden, was er sich bereitgelegt hatte. »Für GK war es viele Jahre lang wirklich hart«, sagte er und gestikulierte zu dem jungen Mädchen hinüber, das unbeteiligt aus dem Fenster starrte, während über sein Leben entschieden wurde. »Eine Mutter, die nicht viel ausrichten konnte, und ein Vater, der nie da war. Ihr wisst ja, wie es in unserem Beruf zugeht.« Er senkte den Kopf, als säße er im Beichtstuhl.
»Auf diese Weise kann sie in Arizona ihren Erstwohnsitz anmelden und muss nicht für den Zweitwohnsitz bezahlen«, fuhr er fort.
»Todd, ich habe schon …«, begann ich.
»Es war Gemma-Kates Idee. Ihre und die ihrer Mutter«, sagte er. »Sie besprachen es, ehe sie … sie fanden, dass es gut wäre, die Uni in einem anderen Bundesstaat zu besuchen und einmal etwas ganz anderes zu sehen.«
Zu diesem Zeitpunkt hörte ich ihm schon längst nicht mehr zu, sondern begann zu staunen, dass er es schon so lange geschafft hatte, nicht laut zu werden. Endlich erlöste Mom ihn aus seiner Not. »Sie haben Ja gesagt«, erklärte sie mit einer ungeduldigen Handbewegung und stand problemlos auf. Mom war trinkfester als wir alle. »Komm, Brigid, hilf mir, das Essen wegzuräumen.« Ich gehorchte. Auch wenn ich Preise und Auszeichnungen von Präsidenten bekommen hatte, auch wenn ich mich so oft in lebensbedrohlichen Situationen wiedergefunden hatte, dass ich nicht mehr um mein Leben fürchtete, auch wenn ich ein paar der ruchlosesten Bösewichte in der Geschichte des FBI zur Strecke gebracht hatte und egal, wie alt ich war – hier war ich einfach nur die älteste Tochter. Und so sammelte ich brav die Tupperware-Deckel ein und drückte sie auf die zugehörigen Schalen.
Mom und ich unterhielten uns bei der Arbeit. Offenbar erinnerte sie sich nicht, dass wir Probleme miteinander hatten. Entweder das, oder sie konnte Missstimmung nicht so lange aushalten.
»Nun, wie läuft es so in Arizona?«, erkundigte sie sich.
»Gut, Mom. Wirklich gut.«
»Carlo hat gesagt, dass du aus der Kirche ausgetreten bist.«
Anstatt ihr zu erklären, wie sehr die Episkopalkirche, die wir besuchten, der römisch-katholischen ähnelte, patzte ich: »Ich war nie in der Kirche, Mom.«
Das saß. Sie presste die Lippen zusammen, was sämtliche Raucherfältchen zum Vorschein brachte, obwohl sie schon seit Jahren nicht mehr rauchte. »Aber du bist zur Erstkommunion gegangen«, entgegnete sie. »Du hattest einen kleinen, weißen Schleier und weiße Mary Janes an.«
Ich legte meine Arme um sie und drückte sie an mich. Das hatte ich nicht in meiner Familie gelernt, sondern von Carlo. »Tut mir leid, Mom. Tut mir leid.«
Ich spürte, wie sich die nachgiebige, alte Haut über ihren Knochen straffte. Wahrscheinlich lehnte sie nicht mich ab, sondern den ungewohnten Kontakt mit einem anderen Körper. Aus Mitleid ließ ich sie los.
An der Veränderung ihrer Haltung spürte ich, dass sie mir verzieh. »Wer passt auf deine Hunde auf?«
»Eine Freundin.«
»Du hast eine Freundin?«
Ich antwortete nicht und brauchte auch nur einen Augenblick, um wieder in den friedliebenden Brigid-Modus zurückzufinden, während ich die Wachstuchtischdecke schrubbte und mich in Grübeleien und Familiensmalltalk vertiefte. Alles ging glatt, bis Todd uns zwei Tage später am Flughafen von Fort Lauderdale absetzte.
Gemma-Kate flog zum ersten Mal in ihrem Leben. Zwischen Dallas und Tucson wurde ihr schlecht. Mit theatralischem Gehabe kletterte sie vom Fensterplatz über Carlo und mich hinweg und rannte den Gang entlang nach vorn. Als sie jedoch blass und kleinlaut zurückkehrte, besorgte ich ihr Ginger Ale und eine Decke, was in der Economyklasse eine wahre Meisterleistung darstellt, und ließ sie an meiner Schulter einschlafen, während sich die Berge New Mexicos unter uns auftürmten.
Schade, denn auf diese Weise versäumte sie ihren ersten Blick auf eine Berglandschaft.
Ich spürte, wie ich weicher wurde. Immer schon fiel ich auf alles herein, was sich klein oder schwach zeigte. Und dann ging es schließlich auch noch um Marylin. Sich auf die Welt einzulassen bedeutete unter anderem auch, der Familie zu helfen und Versprechen zu halten. Außerdem konnte Gemma-Kate vermutlich eine Veränderung gebrauchen. Sie hatte ihre Mutter praktisch die ganze Zeit gepflegt, was bestimmt nicht gerade eine ideale Jugend bedeutete. »Völlig verheert«, hatte Mom bei der Trauerfeier über sie gesagt. Wahrscheinlich hatte sie diesen Begriff bei einer Reportage über Naturkatastrophen aufgeschnappt. Mein Bruder Todd hatte sie allerdings als robust bezeichnet. »Eine robuste Kleine.« Offenbar ist dies das höchste Lob, das ein Quinn dem anderen geben kann. Robust.
Ich würde das schon schaffen. Auch ich war robust. Auch wenn ich klein bin und vorzeitig weißes Haar bekommen habe, bin ich psychisch und physisch so fit, wie es in meinem Alter überhaupt nur möglich ist. Und wie ich bereits berichtet habe, bin ich in der Lage, einen erwachsenen Mann zu entwaffnen, ehe der auch nur ein Wort sagen kann.
Wie soll ich es ausdrücken?
Verglichen mit mir ist Chuck Norris ein Weichei. Wie schwer konnte es sein, sich als gute Tante zu erweisen?
3.
Jeder Polizist wird Ihnen erklären, dass das schlimmste Geräusch überhaupt ein klick ist. Es ist nämlich das Geräusch einer blockierenden Waffe. In Beziehungen aber, so habe ich gelernt, ist es gut, wenn es macht. Es geschieht, wenn man im Verlauf von zwei oder drei gewechselten Sätzen feststellt, dass man zu Freunden oder gar Liebenden wird.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!