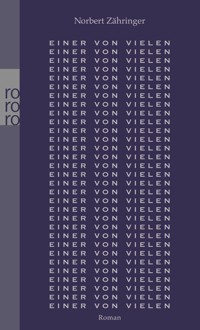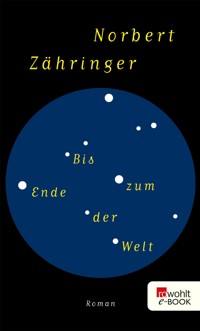
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Studentin Anna aus Kiew, nach dem Tod ihrer Großmutter ohne familiären Halt, wendet sich an eine internationale Partnerschaftsagentur und lässt sich an einen älteren Deutschen vermitteln, Gerhard Laska. Auswahlkriterium für ihn: Anna hatte angegeben, dass sie sich für Sterne interessiert, und er ist Amateurastronom. Er nimmt sie mit nach Berlin in sein Reihenhaus am Stadtrand. Bald erfährt sie, dass Laska nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Seine Frau ist tot, zu seinem Sohn hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr. Er bietet Anna 20000 Euro für den Fall, dass sie mit ihm nach Portugal in sein Ferienhaus reist und ihm dort bis zu seinem Tod Gesellschaft leistet. Einfach so, damit er nicht allein ist. Kann sie ihm vertrauen? Oder täuscht er seine Krankheit nur vor? Anna braucht Geld, und sie muss verschwinden, denn ihr Vater und seine Saufkumpane suchen nach ihr. Eine junge Ukrainerin, ein alternder deutscher Amateurastronom und der Sohn des «millionsten Gastarbeiters» sind die Hauptfiguren dieses Romans über Menschen, die – aus der Bahn geworfen – auf vorsichtige Weise zueinanderfinden. Halbseidene Gestalten, skurrile Entführungen, filmreife Fluchten kommen darin ebenso vor wie das Anrührende, Leise einer Geschichte über Vertrauen, gesuchte Nähe, Liebe. Norbert Zähringer, gefeierter Erzählmagier und Romanmaschinist, erweist sich in diesem fesselnden und zugleich virtuos erzählten Roman auch als ein Meister der nachhallenden Zwischentöne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Norbert Zähringer
Bis zum Ende der Welt
Roman
Über dieses Buch
Die Studentin Anna aus Kiew, nach dem Tod ihrer Großmutter ohne familiären Halt, wendet sich an eine internationale Partnerschaftsagentur und lässt sich an einen älteren Deutschen vermitteln, Gerhard Laska. Auswahlkriterium für ihn: Anna hatte angegeben, dass sie sich für Sterne interessiert, und er ist Amateurastronom. Er nimmt sie mit nach Berlin in sein Reihenhaus am Stadtrand.
Bald erfährt sie, dass Laska nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Seine Frau ist tot, zu seinem Sohn hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr. Er bietet Anna 20000 Euro für den Fall, dass sie mit ihm nach Portugal in sein Ferienhaus reist und ihm dort bis zu seinem Tod Gesellschaft leistet. Einfach so, damit er nicht allein ist. Kann sie ihm vertrauen? Oder täuscht er seine Krankheit nur vor? Anna braucht Geld, und sie muss verschwinden, denn ihr Vater und seine Saufkumpane suchen nach ihr.
Eine junge Ukrainerin, ein alternder deutscher Amateurastronom und der Sohn des «millionsten Gastarbeiters» sind die Hauptfiguren dieses Romans über Menschen, die – aus der Bahn geworfen – auf vorsichtige Weise zueinanderfinden. Halbseidene Gestalten, skurrile Entführungen, filmreife Fluchten kommen darin ebenso vor wie das Anrührende, Leise einer Geschichte über Vertrauen, gesuchte Nähe, Liebe. Norbert Zähringer, gefeierter Erzählmagier und Romanmaschinist, erweist sich in diesem fesselnden und zugleich virtuos erzählten Roman auch als ein Meister der nachhallenden Zwischentöne.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Das Zitat auf S. 176 der Printausgabe stammt aus: Meyers Handbuch über das Weltall, bearbeitet von Karl Schaifers und Gerhard Traving, Mannheim 1973.
Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther, nach einem Entwurf von Anzinger|Wüschner|Rasp, München
ISBN 978-3-644-02061-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
Die Geschichte vom Mann im Mond
3. Kapitel
Die Geschichte eines Autos
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Die Geschichte vom schrecklichen Colonel Spikes oder Wie die Gespenster von Spandau zu Gespenstern wurden
11. Kapitel
Die kurze Geschichte vom kleinen Hund
1
Nach dem Tod ihrer Großmutter hatte Anna Tschertschenko keinen Menschen mehr auf der Welt, sah man einmal von ihrem Vater ab, einem einbeinigen Säufer, den sie das letzte Mal bei ihrer Abiturfeier einige Jahre zuvor gesehen hatte, zu welcher er nur erschienen beziehungsweise herangehumpelt war, um sich kostenlos volllaufen zu lassen.
Sie beerdigte die Großmutter zwischen ihrer Mutter und dem Großvater, einem Oberst der glorreichen Sowjetarmee, der als junger Mann an der Eroberung Berlins teilgenommen hatte und dann – bevor man ihn nach Kasachstan versetzte – eine Weile lang Aufseher im Kriegsverbrechergefängnis Spandau gewesen war. Während er niemals etwas von der Schlacht um Berlin berichtet hatte, war die Zeit in Spandau zu einem unerschöpflichen Quell von Schauergeschichten geworden, die er seiner Enkeltochter, als sie noch klein war, in den dunklen Nächten des Winters zu erzählen pflegte.
Noch ganze zwei Wochen ging Anna nach der Beerdigung in die Pädagogische Hochschule, besuchte die Seminare «Grundlagen der Astrometrie» und «Deutsch für Fortgeschrittene», aber dann begannen die Semesterferien, und sie zog sich nicht wie sonst unter den strengen Blicken ihrer Großmutter in das eigens für sie geschaffene Studierzimmerchen zurück, um für ihre Abschlussprüfung zu lernen. Vielmehr war es so, dass ihr die kleine Wohnung, in der es immer noch, obwohl die alte Frau nun schon bald einen Monat tot war, nach Kohlsuppe mit Fleisch roch, auf einmal unendlich weitläufig und leer vorkam und sie sich kaum Schlimmeres denken konnte, als allein in dieser winzigen, fensterlosen Kammer neben der Waschmaschine über den Büchern zu sitzen. Natürlich hätte sie sich in das Wohnzimmer mit den schweren, an die Wände gehängten Teppichen aus der Zeit in Kasachstan setzen können, auf das Sofa, auf dem sie die letzten zehn Jahre geschlafen hatte. Aber auch davor graute es ihr aus irgendeinem Grund fast ebenso sehr wie vor der Vorstellung, das Schlafzimmer wieder zu betreten, jenen Ort, an dem die Großmutter einst den Großvater und sie schließlich die Großmutter gefunden hatte. Es war, als ob die Zeit selbst zu Ende gegangen wäre. Als ob es nichts mehr zu tun gäbe.
Anfangs flüchtete sie in die Universitätsbibliothek und saß bis spätabends vor den aufgeschlagenen Lehrbüchern im Lesesaal, ohne dass es ihr gelang, mehr als auch nur eine Seite am Stück zu lesen. Kaum war sie am Ende einer Seite angelangt, hatte sie den Anfang schon wieder vergessen, der Text schien sich vor ihr aufzulösen. Wenn jemand, den sie zufällig kannte, an ihrem Platz vorbeikam und vorschlug, das Lernen für heute seinzulassen und stattdessen etwas trinken zu gehen, ging sie mit. Irgendwann geschah das, was man wohl den Halt verlieren oder, wie es in einer Nacht ein Matrose formulierte, keinen Fuß mehr an Land haben nennt, und sie verbrachte immer mehr Zeit in Kneipen oder auf Partys, wurde hineingezogen in die nächtlichen Schattenspiele der Clubs, wachte auf in Betten, in die gestiegen zu sein sie sich nicht erinnern konnte.
Der Tag und die Nacht verschwammen in unheilvollem Zwielicht. Sie begann, das Gefühl für die Zeit zu verlieren, während das kleine Erbe, das ihr die Großmutter hinterlassen hatte, zusammenschmolz wie ein Haufen dreckigen Schnees in der Frühlingssonne am Straßenrand.
Eines Morgens (oder war es bereits Mittag?) kam sie nach einer sehr, sehr langen Party nach Hause, öffnete die Wohnungstür und hörte ein seltsames Geräusch. Ta-tok-ta-tok machte es. Ta-tok. Sie musste etwas nachdenken, bevor ihr klar wurde, was es war: Ihr Vater wanderte mit seinem Holzbein in der Wohnung umher, auf der Suche nach Trinkbarem. Endlich habe er sie gefunden, erklärte er leutselig, und nun würde er gerne ein wenig teilhaben – an den Ersparnissen seiner toten Schwiegermutter.
So endete die Zeit der Partys und Clubs, und es begannen jene Wochen, in denen sie die Wohnung nur zum Einkaufen und Wodka-Beschaffen verlassen durfte. Sie musste für ihren Vater kochen und mit ihm und seinen Freunden, die nun, da sich in mehrfacher Hinsicht eine neue Quelle aufgetan hatte, häufiger kamen, auf dem Sofa sitzen, auf dem sie nicht mehr schlafen konnte, da dort schon die Männer schliefen, die manchmal nach ihr langten, denen sie aber meistens durch das Abräumen der Gläser oder das Holen der nächsten Flasche in die Küche entkam, wo für sie fortan eine Matratze auf dem Boden unter dem Fenster bereitlag. Manchmal, bevor sie das Licht löschte, konnte sie von dort aus beobachten, wie eine Kakerlake ihre Fühler zunächst abwägend in den Luftstrom über dem Dielenboden hielt, bevor sie sich auf ihre allabendliche Strecke von der Heizungsverkleidung bis unter den röhrenden, alten Kühlschrank machte, das Licht meidend und mit Bewegungen, die gleichzeitig schnell und unscheinbar waren, als wollte das Tierchen unter allen Umständen verhindern, dass von seiner Existenz irgendjemand etwas mitbekam.
Und auf einmal gab es Ratten. Es hatte vorher nie Ratten gegeben in der Wohnung ihrer Großmutter, aber auf einmal waren sie da, zwei Ratten, die sie ab und an des Nachts in dem zerbeulten Kehrichteimer unter der Spüle im Müll wühlen hörte, wo sie ein freudiges Quieken ausstießen, als hätte eine der beiden etwas Besonderes gefunden und hielte es der anderen zur staunenden Betrachtung hin. Über solchen Gedanken schlief Anna spät ein, denn sie achtete darauf, nie auch nur ein Auge zu schließen, bevor der letzte der saufenden Kumpane laut schnarchend im Wohnzimmer zusammengesunken war.
Einmal freilich passierte es doch. An jenem Abend hatten sich ihr Vater und seine Freunde kurz und heftig der Rattenjagd hingegeben, hatten mit Stock und Klappspaten eines der Tiere verfolgt, das leichtsinnigerweise vor dem Löschen des Lichtes durch den Flur gehuscht war. Die Jagd blieb erfolglos, die Ratte kauerte hinter dem Küchenschrank, was Anna zwar wusste, aber nicht verriet. Schließlich gaben es die Männer auf und widmeten sich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Trinken. Zu müde, um wach zu bleiben, hatte Anna auf einem Stuhl in der Küche zu dösen begonnen, hatte ihre Arme auf dem Tisch verschränkt und ihren Kopf daraufgelegt, war immer tiefer in das Dickicht uralter Träume gezogen worden und eingeschlafen.
Sie wachte erst auf, als der Mann sie bereits von hinten umschlungen hatte und mit einer Hand unter ihrem T-Shirt nach ihren Brüsten grapschte. Schlaftrunken versuchte sie sich zu befreien, doch der Mann hob sie, etwas Unverständliches brabbelnd, hoch. Sie wollte schreien, doch gelang ihr nur ein Keuchen, so fest hatte sie der Kerl gepackt. Er bugsierte sie in Richtung der Matratze und stieß sie dorthin. Durch das Fenster darüber tauchte der Schein einer alten Straßenlaterne die Küche in bleiches Licht. Der Mann baute sich vor ihr auf: Er trug ein Unterhemd, eine alte Armeehose, keine Schuhe oder Socken. Er öffnete seinen Hosenlatz und holte ein schlaffes, seltsam käsig glänzendes Glied heraus, das er dann eine Sekunde lang, leicht wankend, betrachtete, bevor er es mit seinen Händen bearbeitete, wobei er weiterbrabbelte und Anna anstarrte. Anna griff hinter sich, konnte aber nichts anderes finden als eine verbogene Aluminiumgabel. Als sie die Gabel fest umfasst hatte, bereit, sie ihrem Gegenüber sonst wohin zu stoßen, sah sie etwas Graues über den Boden auf die Füße des Mannes zurennen, kurz auf dem Spann seines rechten Fußes verharren, bevor er aufschrie, fluchte und schließlich wild danach zu treten begann, ohne es zu erwischen. Durch den Lärm wachten die übrigen Trunkenbolde auf, standen mit blödem Grinsen im Türrahmen und fragten ihren Freund, was er da mache. «Ratten jagen natürlich», sagte er. «Mit offener Hose?», fragte Annas Vater, und der Mann, der eben noch seinen Schwanz massiert hatte, verzog sich, seinen Gürtel schließend, wortlos nach nebenan.
Anna wusste, dass das nur ein Aufschub war. Und dass ihr Vater seinen Freund nur deswegen so feindselig angestarrt hatte, weil er der Anführer war und es bleiben wollte.
Abzuhauen habe gar keinen Sinn, sagte ihr Vater am nächsten Morgen, denn er werde sie sowieso überall finden, früher oder später, und sie könne sich wohl denken, was er tun müsste, wenn er sie fände, nachdem sie ihn im Stich gelassen hätte.
Als der Schneehaufen immer weiter zusammengeschmolzen war, erinnerte sich ihr Vater an ein paar andere Freunde, die Geld und Verbindungen hatten, vornehme, saubere Freunde, wie er sich ausdrückte, die man ja auch mal einladen oder gemeinsam besuchen könne, die würden einem vielleicht bei einem Engpass aushelfen, aber dann dürfe sie sich nicht mehr so anstellen, sondern solle ruhig netter sein, wirklich nett und nicht so zickig.
Tags darauf öffnete er einem Mann die Tür, den Anna noch nie gesehen hatte. Ihr Vater führte ihn in die Küche, rief ihren Namen. Sie machte gerade den Abwasch, griff nach dem Geschirrtuch, trocknete sich die Hände ab und drehte sich um.
Er war jünger als Anna, gerade kein Kind mehr. Er hatte kurzgeschorenes dunkles Haar, war mittelgroß und breitschultrig. In seinem T-Shirt und den Trainingshosen sah er nicht sonderlich vornehm aus, aber wesentlich sauberer als die Saufkumpane ihres Vaters, die zwar auch Trainingshosen trugen, dies aber nur aus Bequemlichkeit taten oder weil sie gar keine anderen mehr hatten und es sich in diesen Hosen, gefälschten Markenhosen – die irgendwo in China von Menschen, die das falsche Bild gemalt, das falsche Lied gesungen oder einfach die falsche Geschichte erzählt hatten, zusammengenäht worden waren –, so sonderbar gut saufen und vor dem Fernseher einschlafen ließ. Der Junge hingegen wirkte, als würde er tatsächlich in seinen Hosen etwas trainieren, als käme er geradewegs aus einer Trainingshalle, einem Fitnessstudio, einem Sportstadion, einem Boxring oder wäre auf dem Weg dorthin. Er trug eine Hüfttasche, und in dieser Hüfttasche musste etwas Schweres verstaut sein, denn sie wurde vor seinem Bauch vom Gewicht des Inhalts nach unten gezogen.
Er sagte nicht hallo. Er sagte gar nichts. Aus den Tiefen seiner Trainingshose zog er ein Handy, klappte es auf und fotografierte sie. Er kontrollierte das Bild, und bevor sie etwas sagen konnte, steckte er das Telefon wieder ein, nickte ihrem Vater zu und ging.
An jenem Abend wunderte sich Anna. Sie wunderte sich auf eine Weise, wie es Forscher oder Wissenschaftler tun, wenn sie etwas entdeckt haben, das sie gar nicht suchten, dessen Existenz sie sich gleichwohl nicht so recht erklären können. In einer Schublade im Küchenschrank hatte sie ganz hinten ein altes, gerahmtes Foto gefunden: Es war in den verschneiten Bergen aufgenommen worden, vor einer Ewigkeit. Ihr Vater stand auf Skiern und hielt sie im Arm, und er lächelte sie an, und sie lächelte zurück. Sie war vielleicht zwei Jahre alt. Und sie wunderte sich genauso wie ein Gelehrter, wenn der einen Lichtjahre entfernten Stern beobachtet, fragte sich, was passiert war, zwischen dem Damals – dem Moment, in dem das Licht sich auf den Weg gemacht hatte, Teilchen und Welle zugleich – und dem Jetzt.
Die Stunde vor der Dämmerung war immer die stillste gewesen, schon als sie noch gar nicht auf der Welt gewesen war und ihre Mutter, während Annas Großmutter noch schlief, am Ende einer ruhelosen Sommernacht hinter dem geöffneten Fenster dem einzigen Geräusch lauschte, das zwischen den Wohnblocks zu hören war – dem Klang des Sozialismus. Denn was sei der Sozialismus anderes als ein Dach über dem Kopf, war Annas Großvater nicht müde geworden zu sagen – und Elektrizität? Sechs dicke Hochspannungsleitungen, getragen von zwei nicht besonders hohen Strommasten, zerteilten die Wohnanlage, und war es still genug – das Lärmen der Kinder, die blechernen Stimmen der amerikanischen Fernsehserien, das Grölen der Trinker und das Schimpfen ihrer Weiber verstummt –, dann konnte man auch jetzt noch das sonore, tiefe Summen hören, das Summen des Sozialismus, das nur ein einziges Mal ausgesetzt hatte, im Jahr vor Annas Geburt, als es ein großes Unglück gegeben hatte, von dem ein Freund ihrer Mutter, ein Feuerwehrmajor, mit versengten Fußsohlen, ausgefallenen Haaren und so schlimmem Durchfall zurückgekehrt war, dass er drei Wochen später starb, was ihre Mutter damals sehr traurig gemacht haben musste, andererseits, sagte sie Anna einmal, wenn der Feuerwehrmajor nicht so krank aus Prybjat zurückgekommen wäre, dann wäre sie vielleicht niemals mit ihrem Papa zusammengekommen, und das wäre doch ungleich trauriger, so werde halt das Glück der einen mit dem Pech der anderen bezahlt, man könne es sich nicht aussuchen.
Unter dem Strommast, dessen Leitungen die Milchstraße kreuzten, blieb Anna einen Augenblick stehen und lauschte dem Summen der Hochspannung, die Hunderte von Kilometern entfernt erzeugt wurde. Nichts weiter war zu hören, nur dieses Geräusch. Ihr kam es vor wie das Summen der Vergangenheit, der Nachhall der Kindheit, wie man ihn manchmal in besonderen Momenten hören, spüren und riechen kann. Und die Vergangenheit, so hatte ihr Großvater, der Bewacher von Spandau, ihr einmal gesagt, tue nichts lieber, als einen einzuholen.
Es war Zeit, sich einen kleinen Vorsprung zu verschaffen. Behutsam, um ja keinen Lärm zu machen, ließ sie das Holzbein in den Müllcontainer gleiten, bevor sie ging.
Natürlich hatte sie die Geschichte von «Miss Popo» gehört, einer Frau, die mal Tamara, mal Elena oder Olga hieß. In allen Fällen handelte es sich um eine junge Frau, die entweder eine große Nase oder abstehende Ohren hatte, immer aber ein betörendes Hinterteil. Deswegen hatte man sie auf einer der unzähligen und allen möglichen Motti folgenden Wahlen zur «Miss Popo Ukraina» – zur Frau mit dem schönsten Hintern der Ukraine – gekürt, allerdings war sie dann bei der Welt-Popo-Wahl im Finale einer Mexikanerin unterlegen. Wie immer bei solchen Geschichten kannte jeder diese Tamara, Elena oder Olga über mehrere Ecken, und jeder schwor, dass das Erzählte von vorne bis hinten wahr sei, so auch Annas Kommilitonin aus dem Astrometrie-Seminar, auf deren Bett im Studentenwohnheim sie jetzt saß.
«Also damit, dass die dicke Mexikanerin sie mit ihrem breiten Arsch buchstäblich aus dem Rennen gestoßen hatte, also – damit fing das ganze Unglück so richtig an. Sie hatten ihr nämlich vorher versprochen, dass sie einen Model-Vertrag bekommen würde, aber wie das so ist, stellte sich dann heraus, dass sie nur in einer Dauerwerbesendung für irgendeinen Fetischfummel auftreten durfte, wobei man sie immer nur vom Hals abwärts zeigte, wegen ihres dicken Zinkens, verstehst du, und das Ganze sogar für fast kein Geld, denn das meiste bekam der Typ, der diese Misswahl organisiert hatte. Danach dauerte es nicht lange, und sie war wieder genauso abgebrannt wie vorher, und außer ein paar Kerlen, die mit ihr so komische Filmchen drehen wollten – kannst dir ja denken, was für Streifen das gewesen wären –, interessierte sich auch niemand mehr für ihren Hintern. Was macht ein armes Mädchen da? Es sucht sich einen reichen Mann. Miss Popo geht zu einer Partnervermittlung, die Kiewer Mädchen wie uns an reiche, nicht mehr ganz so frische Ausländer vermittelt. Das heißt: Sie geht nicht nur zu einer Agentur. Sie geht zu fünf, sechs, sieben verschiedenen. Wusstest du, dass die ihr Geld mit den Adressen verdienen? Fünfzehn Dollar kriegen sie für eine. Sie verkaufen den Kerlen aus dem Westen die Adressen, und wenn ein Mädchen nur hübsch genug aussieht, verkaufen sie die Adresse tausendmal. Sie haben gar kein Interesse daran, dass die Mädchen schnell einen abkriegen, oder es ist ihnen egal, denn sollte ein Mädchen tatsächlich heiraten, kann man die Adresse zum Foto ja trotzdem noch verkaufen, so lange jedenfalls, bis sich jemand beschwert.
Die Agenturen veranstalten dann solche Gruppentreffen, bei denen in einem Hotel zwei Dutzend Mädchen auf ein halbes Dutzend Männer treffen. Ein Drittel von den Damen sind Professionelle, und ein weiteres Drittel wären gern welche oder haben es nur auf den Champagner abgesehen, aber das letzte Drittel, na ja, die suchen vielleicht wirklich den Mann fürs Leben. Also. Alle müssen sie sich in einer Reihe aufstellen, dann gehen sie eine nach der anderen zu diesen Herren an einen Tisch und haben eine Viertelstunde Zeit zum Reden. Das heißt – eigentlich sollen sie gar nicht so viel reden. Sie sollen ihre Beine zeigen, ihre Hintern, ihre Titten. Es geht zu wie auf einem Sklavenmarkt.»
Annas Kommilitonin zog ihre Zigaretten hervor, öffnete mit dem Feuerzeug eine Flasche Bier und prostete ihr zu, bevor sie fortfuhr:
«Eine Viertelstunde, man stelle sich das vor, eine Viertelstunde nur, die über die Zukunft entscheidet, über das ganze Leben. Gut, nehmen wir mal die Kerle aus, die nur was für eine Nacht suchen, dann gibt es im Wesentlichen zwei Gruppen: zum einen die alten Knacker – meistens Deutsche. Von den ganz alten, ich meine die, bei denen das Gebiss klappert und der Sabber aus den Mundwinkeln läuft, waren ein paar schon mal hier in Kiew – kannst dir ja denken, wann. Merk dir: Wer mit einem germanischen Opa mitgeht, der muss sich seine Erbschaft sauer verdienen. Denn egal, ob der Deutsche eine Reise macht, ins Theater geht oder sich eine Frau kauft – das oberste Gebot lautet: Bezahlt ist bezahlt. Du kannst dich schon mal drauf einrichten, dass du fortan den Abwasch machen und seinen kleinen, schrumpeligen Pimmel wichsen musst, während er dir seine Kriegsgeschichten erzählt: ‹Damals in den Prybjat-Sümpfen, damals am Dnjepr, ach, all die toten Kameraden … könntest du mir erst meine Tränen und dann meinen Adolf trocknen?›
Die andere Gruppe sind die Gestörten. Typen zwischen 30 und 50, von denen einige ganz charmant sind und manchmal auch ein dickes Bankkonto haben. Natürlich kannst du jetzt fragen, warum sie bei sich zu Hause keine Frau abbekommen, sondern dafür bis in die Ukraine fahren müssen. Gute Frage! Der Haken ist nämlich, dass die was an der Waffel haben. Und wenn das bedeutet, dass sie noch in die Hosen machen oder abends ein Schlafliedchen brauchen, hast du Glück gehabt.
Bei so einer Fleischbeschau lernt Miss Popo einen Mann Anfang fünfzig kennen. Er sei Bauunternehmer, sagt er zu ihr, komme eigentlich aus England, lebe und arbeite aber im sonnigen Portugal. Er ist wirklich nett, interessiert sich auch für mehr als nur ihren Popo, beachtet die große Nase gar nicht. Vielleicht weil er selbst einen dicken Bauch hat, ja – einen Makel hat er, der Kerl ist ein Koloss, aber was soll’s, denkt sie, wenn von nun an das Leben ein einziger langer Urlaub ist? Die beiden finden Gefallen aneinander. Bevor sich das Paar dann glücklich auf den Weg nach Westen macht, geschieht etwas Seltsames: Miss Popo findet im Gepäck ihres Liebsten die Adressen und Fotos von einem halben Dutzend weiteren Agenturmädchen. Als sie ihn darauf anspricht, kriegt er einen Wutanfall, und zum ersten Mal sieht Miss Popo sein wahres Gesicht. Aber vielleicht nicht lange genug. Vielleicht hat sie ihn tatsächlich ein bisschen lieb und will nicht wahrhaben, was sie da gesehen hat. Wie dem auch sei – ebenso schnell, wie er auf hundertachtzig gewesen ist, beruhigt er sich wieder, entschuldigt sich und erklärt, dass er ja nicht habe wissen können, dass er die Frau seines Lebens gleich auf Anhieb finde. Nie habe er zu träumen gewagt, dass er noch zu solchen Gefühlen fähig sei, wie er sie jetzt für Miss Popo empfinde. Undsoweiterundsofort. Das hätte sie eigentlich misstrauisch machen sollen. Doch sie will, dass er es ehrlich meint, verstehst du? Sie will glauben, dass ihr endlich einmal jemand im Leben etwas wirklich Nettes gesagt hat, ohne Hintergedanken. Dass endlich mal was klappt. Gut ausgeht. Wollen wir das nicht alle?»
Sie zündete sich eine Zigarette an, trank einen Schluck Bier und sah dann nachdenklich aus dem Fenster des kleinen Zimmers, in dem Anna die nächsten Wochen wohnen konnte. Das Fenster ging auf einen gelbgrauen Hinterhof hinaus. Zwischen zwei zerbeulten Mülltonnen huschte, Schatten suchend, eine Katze.
«Also, sie verloben sich noch im Kiewer Hotel mit großem Tamtam, und alle anderen Mädchen weinen, und schon geht sie mit ihm nach Portugal. Dort wohnen sie in einer Ferienanlage, die der Unternehmer selbst gebaut hat. Tagsüber liegt sie am Pool, abends kommt der dicke Prinz müde, aber zufrieden nach Hause. Doch nach und nach ist das Leben für sie nicht mehr so toll. Sie würde gerne mal aus der Ferienanlage raus, aber der Prinz hat Angst vor Banditen, die Touristen ausrauben, und außerdem, sagt er, spreche sie die Sprache doch auch noch gar nicht richtig. Die anstehende Heirat verzögert sich immer wieder, angeblich wegen irgendwelcher fehlenden Papiere. Er nimmt die Schlüssel für die Garage, in der der Zweitwagen steht, immer mit. Und auch, was die romantische Liebe angeht, ändert sich was. Es stellt sich heraus, dass er mehr auf die harte Tour steht, der Fettsack. Und dann hat er eines Abends so ein Seidentuch und die Idee, dass sie es auch mal mit ein wenig Strangulieren machen könnten – aber das ist ihr dann wirklich zu viel. Sie sagt nein und auf das Nein ein richtiges Nein! Da steht ihr Traumprinz gar nicht drauf. Sie kriegen mächtig Streit, er haut ihr eine runter.
Von da an ist ihr Leben die Hölle. Er droht ihr für den Fall, dass sie abzuhauen versucht, mit dem Tod. Nun gibt es in dem riesigen Haus einen Keller. Und in dem Keller gibt es einen Raum, der immer abgeschlossen ist. Oft hat sie ihn dorthin gehen sehen, weiß, wo er den Schlüssel versteckt, hat sich aber nie etwas dabei gedacht, vielmehr geglaubt, er holt dort Wein oder so was. Aus welchem Grund auch immer, ob aus Langeweile oder Neugier oder weil sie eine Ahnung hat, auf jeden Fall stibitzt sie sich eines Tages den Schlüssel und geht in den Keller. Und sie findet tatsächlich ein großes Weinregal und nimmt sich eine Flasche und gönnt sich aus Bosheit erst mal einen guten Tropfen. Dann entdeckt sie, dass da noch was ist in dem Keller – eine große Tiefkühltruhe. Du wirst nicht glauben, was dadrin war: unter anderem eines der Mädchen, deren Fotos Miss Popo im Hotel gefunden hatte. Körperteile – Arme, Hände, Finger, Ohren, Köpfe –, feinst säuberlich zerlegt und in Gefrierbeuteln abgepackt! Doch, doch, es ist wahr! Ich hab’s von jemandem, der sie gekannt hat! Also, kurzum: Der Traumprinz war, nein – ist ein Serienkiller. Miss Popo kriegt einen hysterischen Anfall, rennt in den Garten und klettert über die zwei Meter hohe Mauer aufs nächste Grundstück. Dort ist aber niemand. Der Pool leer, das Haus verrammelt. Wie in einem Albtraum. Da rennt sie quer über dieses Grundstück und klettert wieder über eine Mauer, völlig außer sich, und steht auf einem Grundstück mit ordentlich gemähtem Rasen und Swimmingpool und zwei alten Leutchen, die Portwein schlürfen und kein Wort von dem verstehen, was Miss Popo, die kaum etwas anhat, ihnen sagt. Und so klettert sie noch über einige andere Mauern an einigen anderen verwirrten britischen und holländischen Rentnern vorbei, bis sie an einen gerät, den es stört, dass sie da in Tanga und T-Shirt vor seinen kleinen Enkelkindern über seinen frischgemähten Rasen hüpft. Er ruft die Polizei. Die Dorfgendarmen nehmen sie mit auf die Wache, eine junge, bis auf die Nase eigentlich bildhübsche, aber kreischende Fremde, und auch sie verstehen kein Wort und bringen sie dann am Abend in die Provinzhauptstadt, und dort gibt man ihr ein Bett und holt am nächsten Tag einen Dolmetscher, und der übersetzt die Geschichte mit dem Traumprinzen und der Tiefkühltruhe, und die Polizisten fahren zu dem Bauunternehmer, und der glotzt sie fassungslos an, erklärt, die kleine ukrainische Nutte habe ihm Geld geklaut, das undankbare Luder, und dann zeigt er ihnen den Keller mit der Tiefkühltruhe, in der natürlich nichts ist außer tiefgefrorenem Fisch. Und Miss Popo steht daneben und kriegt den nächsten Kreischanfall, und der Traumprinz sagt: ‹Schaffen Sie mir dieses Weib aus den Augen, ich will sie nicht mehr.›»
Annas Mitstudentin machte sich ein neues Bier auf, drückte die Zigarette aus.
«Der Rest ist schnell erzählt. Die einen sagen, die Portugiesen hätten Miss Popo abgeschoben und sie habe sich wieder bei einer Agentur gemeldet, aber diesmal bei so einer, wo die Mädchen nur für eine Nacht vermittelt werden. Die anderen sagen, sie sei den Polizisten ausgerissen, habe sich dann als Bardame, als Tänzerin, als Model durchgeschlagen, sei durch halb Europa getingelt und schließlich in einem Ort, der sich Castrop-Rauxel nennt, in einem billigen Puff gelandet. Und der Kühltruhenkerl läuft immer noch frei herum! Sitzt wahrscheinlich gerade vor seinem Computer und schaut sich Bildchen von jungen, saftigen Mädchen für seine Sammlung an. Deswegen – also, wenn du meinen Rat hören willst, lass das sein. Warum willst du weg von hier? Schon richtig, wir leben von der Hand in den Mund, aber das halbwegs anständig. Ich hänge jedenfalls an meiner Heimat. Wir Mädchen, wir müssen zusammenhalten, verstehst du? Bleib hier, ich hör mich mal um, vielleicht kannst du später woanders unterkommen. Die von diesen Agenturen versprechen dir das Blaue vom Himmel, aber am Ende liegt doch nur ein Massenmörder oder ein Zuhälter auf dir drauf.»
Die Partnervermittlunghieß «Transeuro Wedding» und befand sich in einem kleinen Büro in einer Seitenstraße des Kreschatik. Die Frau, die sie führte, hatte am Telefon auf Anna den freundlichsten Eindruck gemacht, und nun saß sie mit hochtoupierten Haaren hinter ihrem Schreibtisch und lächelte Anna einladend an.
Anna setzte sich auf einen Stuhl ihr gegenüber, und sie gingen gemeinsam den Fragebogen durch.
«Du bist also Lehrerin? Für Geographie und Deutsch?»
«Ich studiere noch. Bin fast fertig.»
«Das ist egal. Wenn du fertig wärst, bekämst du trotzdem keine Arbeit als Lehrerin. Also können wir auch gleich reinschreiben, dass du schon Lehrerin bist.» Die Vermittlerin strich etwas durch und kritzelte dann etwas daneben. «Kinder?»
«Nein.»
«Aber du magst Kinder? Du willst gerne welche?»
«Kann sein.»
«Du magst Kinder, glaube mir. Und wenn dich einer fragt, dann sagst du immer: Ich liebe Kinder, ich kann gut mit Kindern. Du musst nicht jedes Mal sagen, dass du selbst welche haben willst, das kannst du von Fall zu Fall selbst entscheiden, aber es ist immer gut zu sagen, dass man sie mag. Was machst du sonst so, hast du Hobbys?»
Anna zuckte mit den Achseln. «Ich geh gerne in Clubs, tanzen und so …»
Die Vermittlerin verzog das Gesicht. «Das ist doch kein richtiges Hobby, oder?»
«Was ist ein richtiges Hobby?»
«Das ist etwas, was man in seiner Freizeit macht, aber nicht um das Leben zu genießen, sondern um es zu vergessen. Es ist so eine Art zweites Leben, ein kleines Glück, das die Mühen des Alltags vergessen lässt. Die Männer aus dem Westen lieben und pflegen ihre Hobbys. Sie sammeln exotische Pflanzen, Fische, alte Schallplatten oder Spielzeugeisenbahnen. Sie kochen, puzzeln, züchten Hunde und seltene Fische. Es hält sie jung, verhindert, dass sie melancholisch werden und zum Wodka greifen. Deshalb sind sie so erfolgreich.»
«Musik hören und lesen vielleicht.»
«Weißt du, wie viele Mädchen es in meiner Kartei gibt, auf deren Kärtchen steht: ‹Hallo! Ich heiße Sowieso, meine Hobbys sind Musikhören und Lesen›? Hast du nicht noch was Besseres? Irgendwas? Es reicht schon, wenn es nur ein bisschen ungewöhnlich ist, damit du ins Gespräch kommen kannst.»
Anna dachte an das Astrometrieseminar. «Astronomie.»
«Astronomie? Gar nicht schlecht. Das heißt, du kannst die Zukunft vorhersagen und so was?»
«Nein, die Zukunft vorhersagen ist Astrologie. Astronomie ist –»
«Von mir aus. Aber sollen wir das so reinschreiben – Astronomie? Klingt ein wenig sperrig für den ersten Satz. Besser so: Ich heiße Anna. Ich kann gut mit Kindern umgehen und schaue mir gern die Sterne an.»
Der Deutsche hieß Gerhard Laska und kam aus Berlin. Nachdem sie in einem armenischen Restaurant zu Abend gegessen hatten, liefen sie den Kreschatik bis zum Anfang. Dann hatte er die Idee, an der Philharmonie vorbei hinauf zum «Bogen der Freundschaft» zu gehen, einem kolossalen Denkmal aus Titan, das man anlässlich des 60. Jahrestags der Gründung der Sowjetunion hatte aufstellen lassen. Mittlerweile mochte sich kaum jemand gerne an dieses Ereignis erinnern, doch war der Blick von dort oben überwältigend, man sah den alten Handelsbezirk Kiews und –
«Das da unten ist der Dnjepr», sagte Laska, doch seinem Tonfall nach begeisterte ihn das gar nicht sehr.
«Ja, ist Dnjepr», bestätigte Anna. Na toll, dachte sie, jetzt geht es gleich mit den Kriegsgeschichten los. Dabei schien ihr dieser Mann gar nicht so alt zu sein. Aber Hitler, dachte sie, soll ja bereits Fünfjährige in eine Uniform gesteckt haben.
Der Deutsche blickte längst woandershin. Er starrte in den Himmel. Anna beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Er war etwas kleiner als sie, schlank und wirkte sportlich. Dass er bereits Rentner war, erkannte man an seinen weißen, kurzgeschorenen Haaren, die sich von der Stirn aufwärts zu einer Halbglatze gelichtet hatten. Er trug eine Brille und eine billige Uhr. Überhaupt sah er ziemlich durchschnittlich aus, und im Gegensatz zu den anderen «Interessenten» ging ihm das übliche Bei-uns-zu-Hause-ist-alles-anders-(sprich: besser)-Getue völlig ab. Sie versuchte sich daran zu erinnern, wie alt er war, aber es fiel ihr nicht mehr ein. Sechzig? Fünfundsechzig? Siebzig? Die Vermittlerin hatte abgeraten.
«Er ist viel zu alt für ein so junges, attraktives Mädchen wie dich. Du kannst jüngere haben. Du willst an sein Geld? Dafür ist er wiederum zu jung. Der macht es noch zwanzig Jahre – zwanzig Jahre, die seine Verwandten darauf verwenden werden, sein Vermögen vor dir in Sicherheit zu bringen, und dann», säuselte sie mit übertriebenem Pathos, «bist du verblüht, mein Aschenbrödel, musst du die gläsernen Schuhe zum Pfandleiher bringen und einen Job als Bardame in einem billigen Puff in Castrop-Rauxel annehmen. Außer natürlich» – hier machte die Vermittlerin eine vieldeutige, auch irgendwie gezierte Bewegung mit ihrer goldberingten rechten Hand – «du gehörst zu dieser ganz besonders ausgebufften Sorte Mädchen, die, wie man so sagt, über Leichen gehn.»
«Wo ist dieser Puff noch mal?»
Da baute sich die Vermittlerin vor ihr auf, spitzte die übertrieben rot angemalten Lippen und sprach ihn nochmals aus – den Namen des Ortes, der allein schon von seinem Klang her nichts anderes als ein Synonym für Hölle sein konnte:
«Castrop-Rauxel.»
«Was sehen Sie?»
Anna schaute ihn an. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und lächelte leicht, aber irgendetwas an seiner Frage roch nach Hinterlist, nach Heimtücke.
«Was ich sehen?»
«Ja. Was sehen Sie am Himmel?»
Im Märchen von Aschenbrödel ist es nur ein gläserner Schuh, der fehlt. In der Wirklichkeit ist es manchmal mehr, manchmal weniger. Anna dachte nach. «Kapella, im Sternbild –», sie suchte nach einer passablen deutschen Übersetzung – «Wagenfahrer.»
«Wir nennen es Fuhrmann», sagte Laska. «Und daneben?»
«Persej.»
«Perseus, ja.» Jetzt endlich wandte er sich vom Himmel ab und sah sie an. «Wissen Sie, die meisten Frauen, mit denen ich hier bislang ausgegangen bin, hatten immer Dinge auf ihren Kärtchen stehen, die gar nicht stimmten.» Er nickte, wie um sich selbst beizupflichten. «Verstehen Sie mich bitte nicht falsch», fuhr er fort, «aber sie sagen zum Beispiel, sie lesen gerne, aber dann schauen sie doch nur in Modemagazine. Oder sie behaupten von sich, dass sie ‹neugierig auf alles Neue› sind, aber wenn man ihnen dann wirklich etwas –», er stockte einen Augenblick, suchte nach dem richtigen Wort, «Ungewöhnliches zeigt, fangen sie an zu gähnen.»
Etwas Ungewöhnliches – der Knilch meint wahrscheinlich ungewöhnliche Sex-Praktiken. Anna überlegte, bei welchen sie gerade noch mitmachen würde.
«Was hat zu tun mit Sternen?», fragte sie.
Er zwinkerte ihr zu. «Alles.»
«Da haben sich so ein paar Typen nach dir erkundigt», sagte das Mädchen, das im Wohnheim das Zimmer neben ihr hatte.
«Was für Typen?»
«Üble Typen. Alle besoffen. Ich hab nichts gesagt. Dass du jetzt hier wohnst oder so. Ihr Anführer – vor dem konnte man richtig Angst bekommen. Das Gruseligste an ihm war, mhm, also, vielleicht glaubst du mir das jetzt nicht, aber der hatte so ein Stück aus einem alten Treppengeländer – als Bein.»
Am übernächsten Abend fragte Laska, ob Anna ihn nach Deutschland begleiten wolle. Zunächst nur für ein paar Wochen. Eine Art Urlaub. Zum Kennenlernen.
«Kennen Sie Castrop-Rauxel?», fragte sie ihn.
Er runzelte die Stirn. «Nein, kenne ich nicht. Bin nie da gewesen.»
«Gut.»
2
Am Flughafennahmen sie ein Taxi. Es war schon Abend, und als sie die Autobahn kreuzten, ging die Sonne hinter dem Geländer einer Betonbrücke unter, groß und schwer wie ein sterbender Roter Riese im All. Ihren Kopf an das Seitenfenster gelehnt, vertrieb Anna die Gedanken an das, was sie zurückgelassen hatte. Sie schaute in die Dämmerung hinaus, die sich auf die Straßen senkte, und versuchte die Leuchtreklamen zu entziffern – wie der Abspann eines Films in fremder Sprache huschten sie an ihr vorbei. Sie fragte sich, wohin sie gehen würde. Sie hatte nicht vor, länger bei diesem Laska zu bleiben als unbedingt nötig. Mal sehen, wie viel Geld sie ihm würde abnehmen können, ohne ihm allzu nahe zu kommen. Und dann würde sie im Dickicht der Stadt verschwinden. Na gut – eine kleine Schonfrist würde sie ihm wohl gönnen müssen. Immerhin hatte er sich bisher unerwartet anständig benommen. Er hatte nicht darauf gedrängt, dass sie in sein Hotelzimmer kommt, hatte keinen Versuch gemacht, sie zu küssen oder zu umarmen, er hatte ihr nicht an den Hintern gefasst, er hatte ihr in der Hotelbar nicht Dutzende Cocktails ausgegeben, um ihr irgendwann in einem unbeobachteten Moment zwischen die Beine zu greifen. Im Taxi saß er vorne.
«Wir fahren durch die Stadt», sagte er unvermittelt.
«Ja.»
«Wir hätten auch die Autobahn nehmen können, aber ich dachte, du willst vielleicht die Stadt sehen.»
«Schön.»
Laska sagte dem Fahrer etwas, und der Fahrer fragte etwas zurück, schüttelte dann den Kopf und murmelte vor sich hin. Aus dem Funkgerät drang eine Frauenstimme, abgehackt und schrill, «Gneisenaustraße … Revaler Straße … Mierendorffplatz … Tour zum Ostbahnhof … Landsberger Allee» – fremde Orte in der Dämmerung.
Der Fahrer sprach von «viel Verkehr». Anna wunderte sich. Die Straßen waren voller Autos, aber es war kein Vergleich zu Kiew, wo man manchmal eine halbe Stunde auf der Stelle stand, bevor es dann, aus unerfindlichen Gründen, doch weiterging.
Sie bogen auf eine breite Allee ein, und einen Augenblick lang fühlte sich Anna wie zu Hause. Der Boulevard erinnerte sie an den Kreschatik. Aber es waren nur wenige Menschen auf den Bürgersteigen zu sehen.
So fuhren sie eine Weile, trieben im Feierabendverkehr an einem Gebäude vorbei, das «Kosmos» hieß, so viel konnte sie lesen. Ihr kam der Gedanke, dass diese beiden da vorne sonst wohin mit ihr fahren könnten, und sie würde es nicht einmal bemerken.
«Wie heißt die Straße?»
«Die hier? Karl-Marx-Allee.»
«Früher mal Stalin-Allee», ergänzte der Fahrer.
«Und was war Kosmos?»
«Kosmos?»
«Das Haus.»
«Ach das – ein altes Kino. Steht jetzt leer, glaube ich.»
«Events», sagte der Taxifahrer mürrisch, «die machen da jetzt Events, so heißt das heute.»
Sie bogen an einer großen Baustelle ab, dahinter erstreckte sich der Alexanderplatz. Sie konnte sich daran erinnern, dass es ein deutsches Buch gab, das so hieß, aber sie hatte vergessen, wer es geschrieben hatte. Jetzt fuhren sie offenbar Richtung Westen, kamen an einer Kirche und einem Museum vorbei, dann an der Oper, an der Universität, an Banken und Autosalons. Schließlich ging es nicht mehr weiter. Auf einem Platz, umgeben von alten und neuen Häusern, hielt der Fahrer an.
«Fahren Sie außen rum und sammeln Sie uns bitte auf der anderen Seite wieder ein», sagte Laska, stieg aus und öffnete ihr die Tür. «Gehen wir ein Stück.»