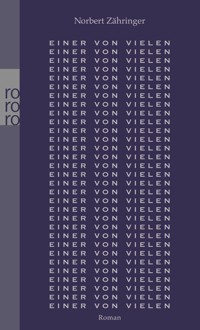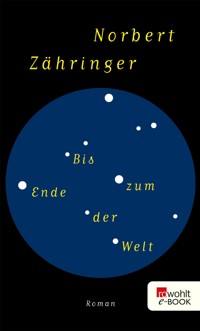9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo wir waren - Eine moderne Dickens-Geschichte über einen Waisenjungen, der zum Dotcom-Millionär wird Im Juli 1969, als Abermillionen die Mondlandung am Fernseher verfolgen, nutzt die verurteilte Mörderin Martha Rohn das Ereignis, um aus dem Frauenzuchthaus Neuwied zu fliehen. Zur gleichen Zeit entkommt ihr fünfjähriger Sohn Hardy aus dem Kinderheim, in das er als Waise Nummer 13 gesteckt wurde. Ein Ehepaar nimmt sich seiner an und bietet ihm ein liebevolles Zuhause. Von da an träumt Hardy davon, eines Tages Astronaut zu werden, inspiriert von Neil Armstrongs historischen Schritten auf dem Mond. Jahre später, nachdem er im Internetzeitalter in Amerika zum Millionär geworden ist, scheint die Verwirklichung seines Kindheitstraums zum Greifen nah. Doch die Vergangenheit holt ihn ein, als er unverhofft auf Spuren seiner Mutter stößt. Wo wir waren ist ein ungeheuer farbiger und einfallsreicher Generationenroman, der drei Generationen vom Rheingau über die Kurische Nehrung bis nach Amerika umspannt und die bewegte deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts lebendig werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Norbert Zähringer
Wo wir waren
Roman
Über dieses Buch
Wo waren wir am 21. Juli 1969?
In der Nacht, in der Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betritt, verfolgen Abermillionen auf der Erde die Fernsehübertragung. Das machen sich einige zunutze. Martha Rohn etwa, wegen Mordes verurteilt, entkommt in jener Nacht aus dem Frauenzuchthaus, und ihr fünfjähriger Sohn Hardy flieht aus dem Kinderheim. Er weiß nichts über sie, weiß nicht einmal, dass sie noch lebt. Ein Ehepaar nimmt sich seiner an, bietet ihm ein Zuhause in der Neubausiedlung am Kahlen Hang, im Rheingau. Dort träumt er davon, eines Tages Astronaut zu werden, und tatsächlich – Jahre später, in Amerika, ist die Verwirklichung des Kindheitstraums zum Greifen nah.
«So viel Welt, so viel Geschichte und so viel Leben, klug und spannend ineinander verschlungen, stecken nur selten in einem einzigen Buch.» (Deutschlandfunk)
«Norbert Zähringers neustes Buch vereint vieles, was gute Literatur ausmacht: Tiefgang, Pointiertheit, Überraschung – und Unterhaltung. Ein aufwühlender Roman.» (SRF)
«Eine Entdeckung, keine Seite zu lang, ziemlich fabelhaft.» (Stern)
«‹Wo wir waren› ist ein wunderbarer Roman über die Faszination für das Fremde, über eine grausige Vergangenheit und über das Erwachen der Jugend – ich las ihn mit Staunen und Faszination, mit Trauer und Freude. Und Science-Fiction-Leser dürfen sich über viele Anspielungen freuen.» (Klaus N. Frick, Chefredakteur Perry Rhodan)
«Jeder Satz sitzt, und ihm gelingt, was man von einem Erzähler erwartet: eine großartige Geschichte, die auch nach 500 Seiten viel zu schnell endet.» (ntv)
Vita
Norbert Zähringer, 1967 in Stuttgart geboren, wuchs in Wiesbaden auf. Er veröffentlichte die Romane «So», «Als ich schlief», «Einer von vielen» und «Bis zum Ende der Welt». Für einen Ausschnitt aus «Wo wir waren» wurde er vorab mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet, später wurde der Roman für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.
Impressum
Der Autor dankt der Kulturverwaltung des Berliner Senats und dem Hessischen Literaturrat für die Unterstützung der Arbeit an diesem Buch und der Robert-Bosch-Stiftung sowie dem Literarischen Colloquium Berlin für die Förderung seiner Recherchen im Rahmen des Grenzgänger-Programms.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Ralph Crane/Getty Images
ISBN 978-3-644-05311-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
This is a present from a small distant world,
a token of our sounds, our science, our images,
our music, our thoughts and our feelings.
We are attempting to survive our time so we may
live into yours.
Jimmy Carter, Voyager Golden Record
Erster TeilIm Meer der Ruhe
Jul 21 1969
109:24:15
Der Mond ist versunken, die schwarze Nacht ist da, es gibt kein Zurück.
Er lag in der Finsternis des Schlafsaals der Jüngeren und lauschte dem Atmen der anderen Kinder. Obwohl er müde von der Feldarbeit war, hatte er sich gezwungen, wach zu bleiben, und während er mit geschlossenen Augen dalag, war ihm, als würde er außerhalb seines Körpers über den Betten schweben.
Der Schlafsaal der Jüngeren war der größte im ganzen Heim. Hier, im Mönchs-Dormitorium des ehemaligen Klosters, schliefen die vier- bis neunjährigen Jungen. Die Mädchen durften noch, bis sie zwölf waren, bei den ganz Kleinen bleiben, die Älteren – Jungen wie Mädchen – schliefen im Hospitaltrakt nebenan.
Im Nachbarbett hörte er den kleinen Schröder im Traum mit seinen Eltern reden. Bald würde er mit dem Hund sprechen, mit der Katze, mit dem Hasen und seinen Brüdern und wer sonst noch alles in dem Auto gewesen war, und dann würde er wieder ins Bett machen. Eigentlich hatte er dem kleinen Schröder versprochen, dass er ihn wecken würde, wenn er im Schlaf redete, damit er nicht in dem verdammten Auto sitzen müsste, wenn der Unfall passierte, sondern vorher den Topf unter seinem Bett benutzte. Sonst bekam er Schläge oder musste, wenn die Sauerei besonders schlimm war, im Keller ins Fass.
Er dachte an das Fass und stellte sich vor, welch große Angst der kleine Schröder darin haben würde. Der ganze Plan kam ihm auf einmal dumm und falsch vor, wie etwas, auf das er sich nie hätte einlassen sollen. «Nein, Mama», flüsterte der kleine Schröder, «nein, Mama.»
Es würde noch dauern, aber irgendwann würde der Schleicher kommen, und dann stand er im Wort, im Blutwort, denn mit Blut hatten sie ihre Abmachung besiegelt, er und der Schleicher, hatten sich die Hände geritzt mit dem Messer, das der Schleicher immer bei sich trug. Alle Jungen wussten von dem Messer, aber die Schwestern und die Erzieher und die Hilfsaufseher und der Pförtner merkwürdigerweise nicht, und der Schleicher hatte ihm gesagt, dass, wenn einer von beiden kneifen sollte, wenn einer den anderen verriete, vorher, sodass die Sache aufflöge, oder hinterher, sodass einer von beiden geschnappt würde, der andere den Verräter finden werde, wenn der schon gar nicht mehr an ihn denke, und ihm mit einem Messer den Hals aufschlitze vom einen bis zum anderen Ohr. Er hatte nicht zu fragen gewagt, ob der Schleicher sich auch selbst den Hals aufschlitzen würde, vom einen bis zum anderen Ohr, sondern hatte nur still und ehrfürchtig seine kleine, blutige Hand in die größere, aber seltsam zarte, fast mädchenhafte Hand des Älteren gelegt, der mit beachtlicher Kraft zudrückte, während er auf die grau-fleckige, blutige Schneide des Messers starrte und Halsschmerzen bekam.
Der Schleicher, der in Wirklichkeit Andreas Krämer oder Kramer hieß, war ein großer, schlaksiger Junge mit abstehenden Ohren und hellen blauen Augen, die nicht recht zu seinem schwarzen Haar passten. Trotz seiner Schlaksigkeit bewegte er sich geschmeidig und lautlos wie eine Katze, konnte urplötzlich neben einem stehen oder schon lange in der Ecke eines Raumes warten, ohne dass man ihn bemerkt hätte. Schon mehrmals war er «entwichen», wie das in der Sprache des Heimleiters Dr. Wassermann hieß, doch immer wieder eingefangen worden. Mal hatten sie ihn völlig durchnässt und unterkühlt unter einer Brücke aufgegriffen, mal hatte ihn ein Gastwirt in Neuorth, dem nächsten Dorf, verpfiffen, und ein anderes Mal hatte er es sogar bis an den Stadtrand geschafft, war in der Dunkelheit über einen Zaun geklettert, hinter dem er eine Garage entdeckt hatte, die ihm als geeignete Schlafstätte erschienen war. Ohne es zu wissen, hatte er eine Wohnanlage der U.S. Air Force betreten. Die Amerikaner hatten ihn zwar nicht gehört, aber am Tag darauf schlafend in einem Oldsmobile gefunden.
Dr. Wassermann, der sein Büro praktisch nie verließ und dort den ganzen Tag, eine Flasche Weinbrand neben sich, am Finanzplan des Kinderheims tüftelte, hatte gelächelt, als die beiden Militärpolizisten ihm den Schleicher wieder zurückbrachten. Offenbar hatte es ihn amüsiert wie einer der Witze, die er manchmal den Größeren erzählte und über die er selbst gerne lachte.
Sein Stellvertreter, Herr Martin, hatte auch gelächelt. Und als der Jeep der Amis durch das alte Tor gefahren und hinter der Kurve der Landstraße verschwunden war, da nahm der lächelnde Herr Martin den Schleicher mit in den Keller der Brüder, wo einen niemand mehr sieht und niemand mehr hört, und verabreichte ihm die dreifache Tracht Prügel, und danach musste der Schleicher eine ganze Woche im Fass bleiben.
Dieses letzte Wieder-eingefangen-Werden schien den Schleicher Mores gelehrt zu haben. Er benahm sich, nachdem man ihn aus dem Fass geholt hatte, wie ein Musterschüler, sodass selbst Herr Martin überrascht gewesen war. Zunächst war er nur von einer vorübergehenden «Charakteraufhellung» ausgegangen, aber nach einem Jahr des vorbildlichen Benehmens war er mehr denn je davon überzeugt, dass seine Erziehungsmethoden nicht nur die härtesten, sondern auch die erfolgreichsten weit und breit waren.
Alle mussten sie ab dem fünften Geburtstag arbeiten. Da hieß es noch nicht Arbeit, sondern Naturerziehung, weil es sonst verboten gewesen wäre. Das Leben fange mit der Ackerkrume an, erklärte ihnen Schwester Ursula, aber man müsse nicht sein gesamtes Leben auf dem Felde verbringen, wenn man nur schön anständig und fleißig und folgsam sei. Wer in ihren und Herrn Martins Augen schön anständig, fleißig und folgsam war, hatte gute Aussichten, eines Tages die Jüngeren auf dem Feld oder in der Küche oder im Schweinestall herumzukommandieren, was einer fürstlichen Entlohnung der Jahre entsprach, in denen man selbst herumkommandiert worden war.
Nach seiner «Bekehrung» hatte es der Schleicher vom Vorarbeiter über den Jauchegrubenkommandeur bis zum Schlafsaalaufseher gebracht. Aber warum er dann ausgerechnet ihn, der ja noch ein Pimpf war, zu seinem Vertrauten gewählt hatte, blieb ihm lange ein Rätsel. Vielleicht, weil er wie der Schleicher ein Vergessener war. Obwohl er kein hässliches Kind, vollkommen gesund und «in Maßen» intelligent sei, so hatte Dr. Wassermann es kurz vor Weihnachten einmal den versammelten Kindern gesagt, hätten sich für Nummer 13 auch in diesem Jahr leider keine neuen Eltern gefunden.
Nummer 13 – das war er, Hardy Rohn. Wieder keine Post für Nummer 13. Keine Geburtstagsgeschenke für Nummer 13. Keine Anrufe, keine Besuche. Zwar stimmte es, er war ein blonder, fünfjähriger Junge mit einem freundlichen Lächeln und wachen Augen, doch «in Maßen intelligent» war nicht unbedingt richtig. Hardy hatte es geschafft, sich noch vor dem ersten Schultag das Lesen beizubringen.
«Aber darauf», hatte ihm der Schleicher eines Tages erklärt, «kommt es überhaupt nicht an. Die Mamas und Papas dadraußen, die keine eigenen Kinder haben können, die wollen Kinder, die noch ganz klein sind, dumm und klein, damit sie sich nicht an ihre wahren Eltern, an das Heim und den ganzen Dreck erinnern können. Deswegen wollen die dadraußen nur Babys adoptieren, denn spätestens sobald du drei bist, kannst du dich erinnern, an Wassermanns Weinbrandfahne, an den Rohrstock vom lieben Herrn Martin oder an das Geschrei von Schwester Ursula. Dann ist es vorbei, und du musst hier verrotten, bis du ein uralter Mann mit weißem Bart bist oder sie dich totgeprügelt haben. Aber darauf willst du doch nicht warten, oder?»
Wann hatte er sich zum ersten Mal gefragt, was jenseits der Hügel hinter dem Kloster lag? Wann hatte er begonnen, in der Nacht von Ländern zu träumen, die er noch nie gesehen hatte? Und wann war ihm zum ersten Mal der Gedanke an Flucht gekommen?
Wahrscheinlich, nachdem Herr Martin ihn eines Sonntags mit einem Buch in der Schulbibliothek erwischt hatte. «Kannst du denn schon lesen?», hatte er verwundert gefragt, und Hardy hatte vorsichtig genickt. «Du bist doch aber noch gar nicht in der Schule, Nummer 13?»
Er hatte die Älteren gefragt, beinahe angebettelt, sie mögen ihm erklären, wie das gehe mit dem Lesen, und die Älteren hatten nach anfänglichem Widerwillen festgestellt, dass sie selbst besser lesen konnten, wenn sie zusammen mit Nummer 13 ein paar Absätze in der Fibel geübt hatten, ja dass sie das mehr als einmal vor dem Rohrstock rettete.
Herr Martin glaubte nicht, dass jeder lesen können musste. Das Landesschulamt war da anderer Ansicht und hatte einen allgemeinen Test am Ende des ersten Grundschuljahres in allen Heimerziehungsanstalten angeordnet. Als in einem Jahr die Ergebnisse im Aubacher Kloster besonders schlecht ausgefallen waren, hatten es doch tatsächlich zwei aufgeregte Inspektoren des Amtes bis hinter die Klostermauern geschafft und Fragen gestellt und erst dann mit der Fragerei aufgehört, nachdem Direktor Wassermann einen hingebungsvollen Vortrag über die negativen Einflüsse von Radiohören, Fernsehen, Comics und Negermusik auf die Lesebegeisterung der Kleinsten gehalten und seinen teuersten Kognak für die Zukunft des Aubacher Heims und damit natürlich irgendwie auch für seine eigene geopfert hatte.
Seit dieser ärgerlichen Episode war Herr Martin unentwegt darum bemüht, die Lesebegeisterung der Kleinsten zu steigern, und das bewährte Mittel dafür war und blieb der Rohrstock. Die Älteren vermuteten, dass Hardy aus Angst vor Bestrafung noch vor der ersten Klasse hatte lesen lernen wollen, aber das war nicht der wahre Grund. Herr Martin hatte während all der Jahre eine Art sechsten Sinn für Begabungen seiner Schützlinge entwickelt, die ihm bedrohlich werden konnten. Er wusste, dass Nummer 13 nicht aus Furcht vor ihm oder dem Stock lesen gelernt hatte.
Als er ihn in der Bibliothek gesehen hatte, vertieft in den «Atlas der Entdeckungen», eine für Kinder aufbereitete Geschichte der Entdeckungsreisen der Menschen seit der Antike (reich illustriert mit grandiosen Zeichnungen von griechischen Triremen, portugiesischen Karavellen, bärtigen spanischen Konquistadoren und des noch bärtigeren Ernest Shackleton und schließlich – man stelle sich das vor! – sogar mit einem Bild des ersten Menschen im All, der ja ein «Roter» gewesen war), da spürte er instinktiv die Gefahr, die von solcher Lektüre ausging: Hier ging es um Männer, die sich durch nichts und niemanden aufhalten ließen, die ein reines Gewissen hatten und keine Angst. Wortlos nahm er Hardy das Buch aus der Hand, und ebenso wortlos verabreichte er ihm eine Tracht Prügel mit dem Rohrstock.
«Das ist nur der Anfang. Sobald der Angst hat, dass du schlauer wirst als er, geht’s dir so wie dem dummen Gustav. Den hat er im Keller ins Fass gesteckt, aber vorher hat er seinen Kopf erst noch ein paarmal gegen die Wand gedotzt, und als der Gustav dann wieder rauskam aus dem Fass, da war er so blöde, wie er jetzt eben ist. Willst du darauf warten, bis du blöde aus dem Fass rauskommst?» Der Schleicher sah ihn prüfend an. «Oder willst du abhauen?»
Hardy schwieg.
Der Schleicher nickte. «Klar willst du. Gibt’s jemanden, zu dem du gehen kannst?»
«Ich habe einen Onkel, aber den habe ich noch nie gesehen, und ich weiß auch nicht genau, wo er wohnt.»
«Das findet sich, das findet sich», sagte der Schleicher leise und fügte noch leiser hinzu: «Ich mach bald weg, aber ich brauche jemanden, der mir hilft. Einen Mitverschworenen. Du wärst genau der Richtige.»
Erst viel später hatte ihm der Schleicher seinen Plan enthüllt, nicht ohne ihm davor, mittendrin und danach mit dem qualvollen Durchschneiden der Gurgel zu drohen, sollte er nur das kleinste bisschen verraten. Und da konnte Hardy dann auch verstehen, warum ausgerechnet er der Auserwählte war.
«Dreizehn?»
«Ja?»
«Bist du wach?»
«Ja.»
Lautlos ist der Schleicher in den Schlafsaal gekommen, plötzlich steht er neben Hardys Bett.
«Es ist so weit.»
«Wie spät ist es?»
«Fast halb vier.»
«So spät schon!»
«Psst. Leise. Bist du bereit?»
«Ja.»
«Alles läuft so, wie wir’s abgemacht haben?»
«Ja.»
«Schwörst du’s?»
«Ja.»
«Schwörst du’s beim Leben deiner Mutter?»
«Meine Mutter ist tot.»
«Das ist egal. Meine auch. Also?»
«Ich schwör’s bei meiner toten Mutter.»
Er klettert aus dem Bett, wirft einen letzten Blick auf den kleinen Schröder, der im Traum durch die Nacht fährt. Ganz still ist er, atmet ruhig – vielleicht muss ja in dieser Nacht das Auto nicht aus der Kurve rutschen, die Leitplanke durchbrechen und in den Abgrund stürzen. Hardy streift sein Nachthemd ab, unter dem er schon Hemd und Hose trägt, schlüpft in die Schnürstiefel.
«Los geht’s!»
Sie schleichen die Treppe hinunter. Die Stufen sind ausgetreten von den Mönchen, den Irren, den Kriegsversehrten, Verbrechern, Flüchtlingen und Waisen, die sie zuvor hinuntergestiegen sind. Über ihnen wölbt sich die Decke, kleine Drachenköpfe beobachten ihre Flucht. Wie viele sind wohl so schon unter ihnen durchgeschlichen, und wie viele sind dann doch geblieben?
«Gibt eine schlechte Nachricht», sagt der Schleicher. «Heute hält Max Schmeling Wache.»
Seit Anbeginn der Zeit versieht Kurt als Pförtner seinen Dienst. Doch immer häufiger plagen ihn inzwischen üble Gichtanfälle, und immer häufiger muss Herr Martin sich nach einer Aushilfe umsehen, einer Aushilfe wie dem jungen, baumlangen Kerl mit der offensichtlich schon mehrfach gebrochenen Nase, den sie alle deshalb nur Max Schmeling nennen.
Wie Gespenster huschen sie an Dr. Wassermanns Büro und an Schwester Ursulas Dienstzimmer vorbei. Alle sind sie im Bett, schlafen oder hören, wie die Älteren es jetzt gerade heimlich tun, leise Radio, vertrauen darauf, dass der Schleicher den Schlaf der Jüngeren hütet, der Schleicher, der zuvor verlauten ließ, dass er auch in dieser Nacht die Aufsicht übernehme, weil er mit den Amis so seine Probleme habe (da musste selbst Herr Martin lachen) und der Mond ihn mal gernhaben könne, der interessiere ihn genauso wenig wie Cassius Clay oder die ganze Negermusik. Das zauberte Herrn Martin ein weiteres freundliches Lächeln ins Gesicht, denn er wusste ja nun, dass er sich auf seinen lieben Andreas verlassen konnte, und er legte ihm sogar die Hand auf die Schulter, ganz sanft, ohne zu ahnen, wie viele Jahre vergehen sollten, bis er ihn wiedersehen würde – an einem Abend, einem ganz normalen Freitagabend, an dem das Schlimmste der Woche überstanden schien, wird er ihn wiedersehen und sich daran erinnern müssen, dass man auch einen Freitag nicht vor dem Abend loben soll.
Etwas liegt in der Luft. Verborgen im Schatten, biegen sie in den letzten Gang ein, an dessen Ende die eisenbeschlagene Tür nach draußen führt. Zu dieser Tür geht es vier, fünf breite Stufen hinab, der Gang liegt höher. Es brennt kein Licht, doch drei Meter vor der Tür befindet sich die neue, erst im Frühjahr eingebaute, verglaste Pförtnerloge. Jetzt, im Sommer, steht ihre Tür zum Gang immer halb offen, damit wenigstens von dort ein wenig frische Luft in den kleinen Raum gelangen kann.
Dort drinnen, unter dem Pult, an dem der Pförtner für gewöhnlich sitzt, gibt es einen Schalter, einen Druckknopf, der die Tür am Ende des Flurs mit einem leisen, elektromagnetischen Klicken öffnet. Dieser Schalter ist es, um den sich in Schleichers Plan alles dreht. Zwar könnte vielleicht auch er unbemerkt durch die halb geöffnete Pförtnertür schlüpfen und unter das Pult kriechen, doch wer würde dann im rechten Moment die Ausgangstür aufziehen und aufhalten?
In der Dunkelheit hören sie die Stimmen. Gedämpft zunächst, aber dann, als sie sich weiter voranschleichen, immer deutlicher. Aus der Pförtnerloge dringt oszillierendes Licht in den Gang, flackert auf der gegenüberliegenden Wand auf, als wäre es die Projektion einer kaputten Laterna magica.
«Hab ich’s dir nicht gesagt, hab ich’s dir nicht gesagt», flüstert der Schleicher. Alle hätten sie nur die Amis und den dummen Mond im Kopf.
Sie hören die Stimme eines deutschen Kommentators und ein Gewirr von Funkgeräuschen, Fragen auf Englisch und Bestätigungen auf Englisch, das sich mit dem Fiepen und Kratzen kosmischer Störungen mischt. Als sie die Pförtnerloge fast erreicht haben, hält der Schleicher ihn fest, deutet auf die offene Tür. Kurts Vertretung hat ihnen im Drehstuhl den Rücken zugewandt (sie sehen seine breiten Schultern, den dicken Hals, den Bürstenhaarschnitt), er hat weder sie noch die Anstaltstür im Blick. Der Schleicher hebt seine rechte Hand, spreizt alle fünf Finger: Das ist das Zeichen, die Verabredung, der Blutschwur.
Jetzt gilt es. Jetzt nimm deinen Mut zusammen. Wenn du es jetzt vermasselst, bist du fällig, fast schon mausetot, vielleicht schlitzt er dich gleich hier auf, der Schleicher – denkt Hardy, während Max Schmeling auf den Zauberspiegel starrt, den sich Kurt vor einem Jahr, kurz vor den Olympischen Spielen, gebraucht gekauft hat: über zehn Jahre alt und defekt, damals einer der ersten, dreiundvierzig Zentimeter Bildröhre, Grundig Zauberspiegel Modell 237, kein Ton, aber für ’nen Appel und ’n Ei. Der Kurt hat ihn wieder hingekriegt, hat ihn zum Sprechen gebracht, hat gesagt: «Ich hab noch jeden zum Sprechen gebracht», und hat ihn allen Jungs, die an ihm vorbeimussten, stolz gezeigt, hat ihn flimmern, brummen, quietschen, hüpfen und quasseln lassen und davon erzählt, wie er ihn repariert hat, vor allem aber, wo ihm das Reparieren beigebracht worden ist, in Italien, als er in der Division Reichsführer (da hat ihm Herr Martin gegen das Schienbein getreten) … in der Nachrichtenabteilung 16 (und noch mal gab’s einen Tritt gegen das Schienbein) … also im Krieg gelernt hat, wie man so einen Empfänger eben repariert.
Fünf Finger – das heißt fünf Sekunden. Wenn du den Schalter gedrückt hast, wenn es vorne klickt, zieht der Schleicher an der Tür, zieht sie ein winziges Stück auf und zählt stumm bis fünf, und wenn du bis dahin nicht bei ihm bist, zieht er sie gerade so weit auf, dass er durchpasst, und haut lautlos ab, und dann fällt die Tür wieder langsam ins Schloss, und er ist weg, und du bist da und allein, und niemand macht dir je wieder auf.
Auf allen vieren kriecht er auf die Pförtnerloge zu, gelangt unentdeckt durch die Türöffnung unter das Pult. Ein Piepsen und Fiepen und die Stimme aus dem Kontrollzentrum erfüllen den kleinen Raum. Armstrong ist jetzt auf der Leiter. Und da, nicht weit über ihm, ist der Schalter! Und er hört sein Herz pochen und wundert sich, wie einfach das doch alles ist. Armstrong steigt die Leiter hinab. Drück den Knopf! Drück den Knopf und verschwinde!
Er will ja. Er will es wirklich. Aber gerade als er sich zum Schalter streckt, schaut er in den Zauberspiegel und sieht den Mann die Leiter seines kleinen Raumschiffes hinabhüpfen und erwartet gebannt diesen letzten, ersten Schritt, gleich ist er unten angekommen, gleich steht er auf der fremden Welt.
1901
Heute verläuft im Norden von Neuorth die Fernstraße, rumpeln schwere Laster an den Ausläufern des Dorfes vorbei, hört man auch in tiefer Nacht noch das gleichförmige Brummen ihrer Motoren, das sich mit dem Rauschen des Waldes und der Hecke auf dem Hügelgrat vermischt. Vom Kahlen Hang aus, den die Neue Siedlung sich langsam hinaufgeschoben hat, kann man jetzt, da der Tannenhain schon lange gerodet ist, sofern nicht die Dächer der Doppelhäuser den Blick verstellen, den Rhein sehen, bis zu dessen Ufer man mit dem Auto nur fünfzehn Minuten braucht, außer morgens und abends, wenn der Pendlerverkehr sich beinahe bis zur Fußgängerampel am Ortseingang staut, oder auch an den Wochenenden, wenn sie die umliegenden Altenheime und die nahe Irrenanstalt auf dem Auberg durchlüften und Greise und Verrückte in Omnibussen in das beschauliche Uferdorf verfrachten, das Auwinkel heißt, aber in der Kindheit von Hardy Rohns Großvater Adam nur das Sumpfdorf genannt wurde. Denn diejenigen, die dort wohnten, waren, so erzählte man es sich, entweder aufgrund irgendeiner Verfehlung aus Neuorth verjagt worden oder von noch weiter her gekommen, wo sie niemand hatte haben wollen, und fristeten ein armseliges Leben als Flößer oder Handwerker.
Damals war die Welt noch klein, keine asphaltierte Straße, kein Geleis, keine Hochspannungsleitung, kaum ein Feldweg gab ihr Kontur. Sie endete im Westen am trägen, grauschwarzen Strom, und im Osten führte eine von den Gendarmen kontrollierte Straße, die noch aus der Römerzeit stammte, zu den Städten im Süden, die größer sein mussten, als es sich jeder in Neuorth vorstellen konnte, was auch daran lag, dass niemand je dort gewesen war. Wollte man die Straße entlangfahren, musste man jenseits der Hohen Hecke Wegzoll zahlen, das jedenfalls hatte Adams Vater Arthur ihm, dem jüngsten Sohn, erzählt. Ab und an kamen Herrschaften diese Straße entlang, um hinunter zum Rhein zu fahren und in dem einen oder anderen Weinlokal Rast zu machen, und fuhren dann in ihren Kutschen weiter.
Adam hatte zwei ältere Brüder und zwei ältere Schwestern, war als jüngstes Kind das einzige, das nicht in dem graubraunen, niedrigen Haus der Rohns am Rande des Dorfes geboren worden war. Er war auf dem Auberg, in der Nervenheilanstalt, zur Welt gekommen – nicht weil seine Mutter verrückt gewesen wäre, sondern weil sich sein Vater, ein wortkarger, groß gewachsener Mann mit kantigem Gesicht und einer schiefen Nase, im letzten Moment entschieden hatte, nicht länger auf die Hebamme aus Auwinkel zu hören, die empfahl, nach dem Pfarrer zu schicken, damit das Kind, bevor es tot aus der Mutter gezogen werde, wenigstens noch getauft werden könne, auf dass dann Mutter und Sohn gemeinsam in das Himmelreich, das himmlische Paradies, einziehen würden. Er machte eine Geste, die seinen Söhnen Helmuth und Ullrich bedeutete, den Wagen zu holen und den Gaul vorzuspannen, und seinen Töchtern Hedwig und Gerda befahl, mit dem Jammern aufzuhören, die Wehklage aufzuschieben, Decken und frisches Wasser zu besorgen und alles vorzubereiten, um die Mutter in dieser Nacht zum nächsten Doktor zu bringen, der sich, wie jeder wusste, nun mal in der neuen Irrenanstalt auf dem Auberg befand. So war Adam, noch bevor er geboren worden war, auf eine Reise gegangen, von der alle in Neuorth annahmen, dass sie ohne Wiederkehr sein würde, eine Reise, um die sich noch lange nach seiner Rückkehr im Dorf Gerüchte rankten. So oder so war es die erste und für viele Jahre die weiteste Reise, die Adam unternahm.
Noch als Zehnjähriger wusste er nicht nur nichts von der Welt, er wusste vor allem nicht genau, wie sie aussah. Als sie die Eisenbahn gebaut hatten, als die Ortschaften am Fluss größer und wohlhabender wurden, als in Auwinkel eine Sektkellerei errichtet worden war, deren Besitzer, der Enkel eines verachteten Sumpfdörflers, eines Tages in einem weißen Anzug auf einem knatternden, feuerspuckenden Motorenwagen den Hohen Hang hinaufgefahren kam, vorbei an Weinbergen, die nun alle ihm gehörten, und dann durch Neuorth fuhr, hupend die Hühner und Schafe vor sich hertrieb und auf dem Platz vor der kleinen Kirche wendete, bevor er, lachend und Sekt trinkend und Verwünschungen gegen alle Dörfler hinausbrüllend, in einer nach Sekt, Schafscheiße und Auspuffgasen duftenden Dreckwolke wieder verschwand, da fand Adam auf dem Weg zurück von der Schule, als sich der Staub schon gelegt und sich die Schafe und Hühner beruhigt hatten, auf der Straße ein kleinformatiges, aber dickes Büchlein, das voll war mit Wörtern, deren Gestalt ihm völlig unbekannt war.
Er hatte in der Klosterschule, unweit der Irrenanstalt, in der er geboren worden war, lesen gelernt. Das heißt: Er hatte versucht, es dort zu lernen.
Eigentlich war es gar keine richtige Klosterschule. Neuorth besaß kein eigenes Schulgebäude, was lange niemanden gestört hatte, bis der preußische Oberpräsident entschied, dass das preußische Schulgesetz auch im letzten Winkel des Reiches und daher selbst in Neuorth durchzusetzen sei. Damit die Kinder fortan nicht mehr ihre Kindheit auf dem Rübenacker vertaten, sondern lesen und schreiben lernten und brave, gottesfürchtige Untertanen wurden, hatte man die Schule in einem Seitentrakt des eigentlich verlassenen Aubacher Klosters untergebracht, dessen Blütezeit Jahrhunderte zurücklag. In jenen Tagen war es nur noch von wenigen Laienmönchen bewohnt, die, wie Adam fand, nach Schafen rochen und in ihren abgetragenen Kutten auch so aussahen, Mönchen, von denen es hieß, dass sie auf die Rückkehr des zukünftigen Abts warteten, der nach Rom aufgebrochen war, um beim Papst die Neugründung des Klosters zu erbitten, das zeitweise als Gefängnis, als Kaserne und zuletzt als Irrenhaus gedient hatte, bis die neue, auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft gründende Nervenheilanstalt auf dem Berg nebenan gebaut worden war. Nur die Weinberge waren noch von Wert gewesen, doch die hatte sich der Graf von Auberg schon vor einiger Zeit unter den Nagel gerissen, bevor er sie an jenen motorisierten Sektpanscher aus Auwinkel verkaufte oder ja vielleicht sogar im Spielcasino an diesen Luftikus verlor.
Im Kloster gab es nichts mehr, was an den einstigen Glanz hätte erinnern können. Alles, was auch nur annähernd von Wert gewesen war, hatten schon lange zuvor die Mainzer Domherren, die legitimen und die illegitimen Grafen von Auberg, die Sträflinge und die Soldaten verschiedener Armeen verscherbelt oder zur baldigen Verscherbelung weggeschleppt, und was dann noch übrig gewesen war, fand seinen Weg in das Feuer, das die sich selbst überlassenen Irren an einem Nachmittag im Winter 1848 zu ihrer Erwärmung und auch zu ihrem Entzücken entfacht hatten. Nur eine Sache sollte all die Jahrhunderte auf wundersame Weise unbeschadet überstehen.
An seinem ersten Schultag hatte Adam den Saal, in dem die Dörfler unterrichtet werden sollten, nicht gleich gefunden. Er war durch die kühlen, modrig riechenden Gänge gestolpert, denn der Holzfußboden war krumm. Der Marsch der Mönche, Sträflinge, Soldaten, Irren hatte ihn über die Jahrhunderte an manchen Stellen abgesenkt, dann wieder angehoben, man konnte an einzelnen, hochstehenden Dielen hängen bleiben oder sich die Sohlen an alten, handgeschmiedeten Nägeln aufritzen – es war, als ginge er auf den Planken eines gestrandeten Schiffes. Schließlich, nach mehreren Türen, die seinem Druck mit einem Ächzen nachgegeben hatten, ohne mehr als allerlei Gerümpel und den Geruch längst vergangener Zeiten preiszugeben, stand er vor der letzten, am Ende des Flurs. Als er gerade nach der Klinke greifen wollte, fühlte er sich beobachtet, spürte, dass da noch jemand oder etwas war, und drehte sich um: Links an der Wand, gegenüber von einem hohen Fenster, dessen hölzerne Läden zum Schutz gegen die Sonne zugeklappt waren, sodass den Flur ein öliges, nachmittägliches Dämmerlicht erfüllte, hing etwas.
Im ersten Moment dachte er, es wäre nur ein weiterer gekreuzigter Heiland, aber der Schatten an der Wand hatte die Beine seltsam weit abgespreizt, und diese Beine waren dick. Nein, das konnte kein Heiland sein, denn Christus mit abgespreizten, dicken Beinen, das wäre schändlich gewesen. Vielleicht war es ein ausgestopftes Tier, ein Bärenfell?
Was es auch sein mochte, schon auf die Entfernung roch es ranzig, gleichzeitig muffig und alt und scharf. Und als er näher herantrat und sich seine Augen an das schlechte Licht gewöhnt hatten, erkannte er, dass es kein Bärenfell, sondern die aufgespannte Haut eines noch größeren Tieres war, auf die jemand Zeichen, Figuren und Fabelwesen, Flüsse, Wüsten und feuerspeiende, von stürmischen Ozeanen umspülte Berge gemalt hatte. Was den Heiland anging, hatte Adam nicht völlig falschgelegen: Hoch oben, bereits jenseits des turbulenten Geschehens und außerhalb der tosenden See, die die Länder in der Mitte umgab, saß auf einem goldenen Thron Jesus Christus, Gottes Sohn.
Das Merkwürdige an ihm war, dass er so alt wirkte. Seine Haare waren silbern, so als hätte er nach seiner Auferstehung nicht nur Tage, sondern noch Jahre auf der Erde zugebracht. Reglos sah er Adam an, und reglos betrachtete er die Welt, als ob ihm das Treiben von Mensch und Tier ziemlich wurst wäre.
Ein wenig unterhalb davon sah Adam etwas, das sich allein schon deswegen vom Rest abhob, weil es farbiger war. Alles auf der Tierhaut erschien im Zwielicht des Flurs in stumpfen Braun- und Rottönen, doch dort war ein Wald abgebildet mit weit ausladenden, fremdartigen Bäumen, in denen bunt gefiederte Vögel zwischen leuchtend grünem Laub hockten – beinahe glaubte er, das Rauschen des Windes in den Wipfeln und die Rufe der exotischen Vögel hören zu können. Gleichzeitig aber war der Wald von allem anderen auf der Karte getrennt: Eine hohe, dunkle Dornenhecke umgab ihn, in deren Ranken er kleine, rostende Schwerter, silbrige Rüstungen, Helme und die Gerippe von Rössern und ihren toten Reitern ausmachen konnte.
Lautlos, nur mit einem Luftzug, öffnete sich die Tür. Vor ihm stand ein Mann in einer Kutte. Er war hager, aber kräftig. Der fast kahle Kopf und die lange Nase ließen ihn älter wirken, doch sein Blick war klar. Er konnte kaum älter als Adams Vater sein.
«Wer bist du?», fragte der Mann leise.
«Ich bin der Adam. Aus Neuorth. Ich suche die Schule.»
«Was willst du dort?»
«Ich muss lesen lernen.»
«Niemand muss lesen lernen.»
«Der Kaiser hat gesagt, dass ich muss.»
«Willst du denn lesen und schreiben lernen?»
«Ja.»
«Und wenn du jetzt fliegen lernen wolltest?»
«Kann man das hier auch lernen?»
Die Andeutung eines Lächelns huschte über das Gesicht des Mannes, der nun schwieg.
Bleiben oder gehen? Den langen Flur zurückrennen, nicht stolpern, nicht schreien, sich nicht einmal umdrehen, einfach verschwinden, denn noch war nichts passiert, noch konnte das Leben so weitergehen, wie es immer weitergegangen war, konnte er die Woche über zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern auf Feld und Hof arbeiten und sich abends in der Stube auf die Bank vor dem Ofen fallen lassen, wo ihm eine seiner Schwestern ein Stück Brot reichen würde und, wenn es ein guter Tag war, noch ein Stück Schinken dazu, und er würde schweigend kauen und in die Gesichter seiner älteren Brüder blicken, die genauso müde waren wie er selbst, und niemand würde etwas sagen, denn wie all die Tage zuvor und all die Tage, die noch kommen würden, gäbe es nichts zu sagen, und er würde schon nach dem letzten Bissen einschlafen, den Hinterkopf an die Ofenwand gelehnt, und irgendwann würde ihn eine Schwester antippen, und er würde aufstehen, wie im Traum die Stiege nach oben gehen und in sein Bett fallen und bis zum Morgengrauen schlafen.
Immer noch sah ihn der Mann an. Immer noch schwieg er. Wenn das nun gar kein Lehrer war, sondern einer jener Verrückten, die vor noch nicht allzu langer Zeit hier gehaust hatten, bevor man die Anstalt auf dem Berg gebaut hatte, einer, den sie vergessen hatten in einer der Zellen für die Gemeingefährlichen?
«Gut», sagte der Mann schließlich, «ich bin Bruder Roland. Du kannst hier lesen lernen. Als Nächstes musst du die wichtigsten Wörter lernen.»
«Als Nächstes? Bin ich zu spät? Hab ich schon was verpasst?»
«Du hast die erste Lektion hinter dir. Die erste Lektion ist das Schweigen. ‹Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.› Zuerst müssen wir schweigen, bevor wir unsere eigenen Worte sprechen dürfen. Du denkst vielleicht, alles besteht aus Wörtern, aber schon ein einfacher Satz besteht aus Wörtern und den Räumen dazwischen – den Pausen, dem Unsagbaren, der Stille. Wer das Unsagbare nicht lesen kann, ohne es auszusprechen, wird niemals wirklich verstehen.»
Er stieß die Tür weit auf und deutete mit einer Geste an, dass er hindurchgehen solle. Adam drehte sich noch einmal um und sah nach der bemalten Tierhaut.
«Eine Karte», erklärte Bruder Roland, «eine Karte der Welt, wie sie früher einmal war. Schau, da – der Berg Ararat mit Noahs Arche, der Turm zu Babel, Moses auf dem Berg Sinai und, in der Mitte, das heilige Jerusalem.»
«Und wo sind wir?»
«Wir?»
«Auf der Karte.»
Der Mönch runzelte die Stirn, dann deutete er auf den grünen Wald. «Vor langer Zeit waren wir einmal hier.»
«Und jetzt?»
«Jetzt?» Er lachte. «Jetzt sind wir nirgendwo!»
Bruder Roland hatte nicht sonderlich viele Schüler. Am Anfang war es gerade mal ein Dutzend, von denen drei Jungen wie Adam aus Neuorth kamen: der ständig verschnupfte Sohn des Tischlers, ein weiterer Bauernsohn, der das Schweigen perfektioniert zu haben schien, und ein stämmiger, dicker Junge, Georg, genannt Schorsch, dessen Vater das Gasthaus «Zum Weißen Ochsen» betrieb und der sich um das Schweigen wenig scherte, häufig dazwischenredete und dabei Dinge sagte, die in keinem Zusammenhang mit dem zu stehen schienen, was an der Tafel stand, doch von Bruder Roland nur maßvoll dafür gerügt wurde. Schorsch irritierte seine Klassenkameraden durch die eigenartige Unruhe, die er ausstrahlte. Einmal hatte ihm der Sohn des Tischlers in der Mathematikstunde den Schnürsenkel seines rechten Schuhs aufgezogen. Schorsch beschwerte sich nicht, sondern verbrachte die Schulstunde damit, unter der Bank den Schuh zu binden. Immer, wenn er schon fertig war, gefiel ihm etwas nicht, und er zog die Schleife wieder auf und begann von vorne.
Bruder Roland ignorierte das zuerst, aber irgendwann fragte er: «Vier und vier? Georg? Vier und vier – sind?»
Schorsch hob noch nicht einmal den Kopf, sondern band weiter seinen Schnürsenkel, während er sagte: «Vier und vier sind acht und vier sind zwölf und vier sind sechzehn und vier sind zwanzig und vier sind vierundzwanzig und vier sind achtundzwanzig und vier sind zweiunddreißig und vier sind …»
Wie ein klappernder Webstuhl sagte er die Zahlen auf, und wenn die anderen am Anfang noch leise gekichert hatten, dann kicherten sie spätestens ab «hundertundacht» nicht mehr. Der Tischlersohn war kreidebleich geworden. Später sollte er herumerzählen, dass der Teufel in den armen Schorsch beim Schuhebinden gefahren sei. Verlassen habe der Teufel ihn dann bei einer unglaublich hohen Teufelszahl, an die er sich nicht mehr erinnern könne. Tatsächlich war Schorsch gerade bis zur Neunhundertvierundsechzig gekommen, als die Glocke der kleinen Kapelle läutete und die Stunde zu Ende war.
Von da an ließen die meisten ihn in Ruhe, auch Bruder Roland sah über ihn hinweg, was vielleicht vor allem daran lag, dass Schorsch als Sohn des Ochsenwirts das meiste Essen mitbrachte. Denn ein Teil des Schulgeldes bestand aus Naturalien: Fleisch, Würsten, Milch. In dem verwilderten Garten des Klosters bauten die etwa zwanzig Mönche zwar Gemüse an, und es gab auch ein paar Obstbäume, doch Adam sah, dass sie sich nicht sonderlich geschickt dabei anstellten, auf jeden Fall reichte es nie für alle.
Im ersten Jahr tat er sich schwer in der Schule. Das Rechnen ging leidlich, aber Lesen blieb ihm ein Rätsel. Er verstand die Buchstaben nicht, und deswegen verstand er auch keines der Wörter. Die Wörter waren für ihn nichts weiter als unergründliche Symbole, Brandzeichen ihres Eigentümers auf dem Pergament, deren Gestalt er sich einprägen musste, wollte er sich beim täglichen Vorlesen nicht blamieren.
Er lernte das Geschriebene auswendig. Zunächst war das noch einfach. «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde» – da die einzige Lektüre die Heilige Schrift war, half es weiter, wenn man Formulierungen wie «Und Gott sprach» oder auch «Und Gott schuf» sofort erkennen konnte, sollte man einmal den Text vergessen haben. Doch dann wurde die Geschichte, die Geschichte von Gott und den Menschen, komplizierter und länger und unübersichtlicher, und Adam hatte immer mehr Mühe, ihr zu folgen.
«Du musst die Buchstaben zusammenzählen», sagte Schorsch, «die großen und die kleinen, und das richtige Ergebnis ist dann das Wort!»
«Buchstaben sind doch keine Zahlen», widersprach Adam. Er saß im Unterricht die meiste Zeit neben Schorsch, was ihm unangenehm war, allerdings half sein Banknachbar ihm manchmal, indem er ihm die Wörter leise vorsagte.
«Doch! Buchstaben sind Zahlen! Wörter sind Zahlen!», sagte Schorsch.
«Bücher sind also auch Zahlen?»
«Ja! Ja! Ja!» Der Gedanke schien Schorsch aufzuregen.
«Und das Buch Gottes besteht auch aus Zahlen?»
«Natürlich!»
«Und der liebe Gott selbst – ist der auch eine Zahl?»
Da verstummte Schorsch und versank in sein typisches, in sich gekehrtes Gebrabbel, bei dem er leise und schnell Worte sprach, die niemand verstehen konnte, ein kaum hörbares Flüstern, das manchmal Stunden andauerte. Es war, als hätte diese letzte Frage in seinem Kopf etwas in Gang gesetzt, ganz so, wie einst das Schnürsenkelaufziehen etwas in Gang gesetzt hatte.
Adam fragte seinen älteren Bruder Ullrich, der zwei Jahre lang in die Schule in Auwinkel gegangen war, bevor sie zu seiner Erleichterung nach einem Hochwasser geschlossen wurde, wie er bloß lesen lernen könne.
«Musst halt die Silben klopfen», antwortete der Bruder und stampfte mit einem Bein auf. «Wa-gen-rad! Rü-ben-ak-ker!»
Wie auch immer die Buchstaben zusammenzuzählen, zu klopfen oder zu stampfen waren, es half nichts. Auch am Ende seines zweiten Jahres an der Schule konnte Adam nicht richtig lesen und behalf sich damit, sich die Gestalt der Wörter einzuprägen.
In dem Jahr, in dem Amundsen und Scott zum Südpol aufbrachen, an einem Nachmittag im August 1911 auf dem Heimweg von den Schafsmönchen – Adam war voller düsterer Erwartungen, was den Fortgang der biblischen Handlung anging und welche Rätsel ihm die Wörter in der Zukunft noch aufgeben mochten –, brauste Otto Cohn, Eigentümer der Sektkellerei «Schloß Auwinkel» (es gab gar kein Schloss außer dem, das er auf das Etikett der Flaschen hatte prägen lassen), mit dem Motorenwagen an Adam vorbei. Adam hustete, rieb sich die Augen und schaute ebenso erschrocken wie fasziniert dem knatternden Gefährt nach. Wo kam es her, wo fuhr es hin? Er wandte sich um und wollte sich gerade wieder auf den Weg nach Hause machen, als er auf der Straße das Buch liegen sah.
Es war, wie er befürchtet hatte, voll mit Wörtern, die er noch nie gesehen hatte. Es enthielt aber noch etwas anderes: Zeichnungen mit Symbolen, Linien und – was konnte es anderes sein – der Darstellung von Flüssen und Bergen. Diese Zeichnungen erinnerten ihn an die bemalte Tierhaut, die er im Kloster gesehen hatte.
«Daschind Karten», sagte Schorsch, als Adam ihm am nächsten Tag das Buch zeigte. Schorsch aß das letzte seiner zahlreichen Wurstbrote, sprach mit vollem Mund. «Dadrin getsch um Schätze, wenn du misch fragscht.» Er kaute zu Ende und wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab. «Ist ein Schatzführer. Von einem alten Schatzsucher mit Namen Baedeker. ‹Schätze des Rheinlands› steht hier! Und hier, das ist eine große Karte, mein Vater hat so was in der Wirtschaft hängen, das ist die Welt von oben, als ob man ein Vogel wäre und fliegen könnte, dann würde man das so sehen. Und da, schau! Auf der Karte, wo da unten der Rhein ist, sind da oben wir!»
Adam war beeindruckt. Schorsch kannte wesentlich mehr Wörter als er selbst. Das Faszinierendste aber war die Karte, die er nun herausgeklappt hatte. Er fand darauf Neuorth, einen winzigen schwarzen Punkt über dem mit einem Kreuz markierten Aubacher Kloster, fast am oberen Rand des Blatts. Da war auch der Fuhrweg vom Kloster zum Dorf als dünne, gestrichelte Linie eingezeichnet, auch der kleine Bach entlang des Weges. Über Neuorth waren Büsche aufgereiht, die, wie Adam und Schorsch sofort erkannten, nur die Hohe Hecke bezeichnen konnten.
«Und dahinter?», wollte Adam wissen. «Was ist hinter der Hecke?»
Schorsch drehte das Blatt um. «Gar nichts. Das weiß noch nicht einmal der Schatzsuchermeister Baedeker selbst, was da ist.»
Jedes Kind kannte die Hohe Hecke, das undurchdringliche Dickicht jenseits der Felder, der Rübenäcker, der Apfelbäume, tief im Wald. Es war die Grenze ihrer Welt – errichtet von den alten Herren von Auberg, deren einstmals schimmernde Rüstungen im bereits verpfändeten Herrenhaus der Grafen nun auf den Abtransport nach Pennsylvanien warteten, während ihre Gebeine in vergessenen Gräbern längst zu Staub zerfallen waren, errichtet gegen die Chatten, die Marser, Cherusken und kinderfressenden Vandalen. Die Äste niedriger Buchen waren dort immer wieder zu Boden gebogen und ineinandergezwungen worden, und man hatte Dornengestrüpp dazwischengesetzt und mit den Buchenzweigen verflochten. So war mit der Zeit ein Dickicht gewachsen, das sich von Ross und Reiter nicht durchdringen ließ. Manchmal, wenn sie im Wald spielten, wagten sich die Jungen an den Rand der Hecke, die ihnen düster und nicht geheuer schien, und hörten Geraschel und Jammern, als ob darin immer noch die verlorenen Vandalenheere einen Ausweg suchten. Aber was war dahinter? Diese Frage ließ Adam nicht mehr los.
Der Herbst kam und dann der Winter, und Adam lernte ein paar Wörter dazu und konnte irgendwann seinen Namen und einfache Sätze schreiben, und er konnte auch zwei und zwei zusammenzählen und drei und vier, und immer wieder schaute er sich den Reiseführer an, den er unter seinem Bett versteckt hatte. Dann wurde es wieder Frühjahr, und einmal, als es schrecklich hagelte, ging er mit Schorsch nach der Schule mit, und in einem Hinterzimmer des «Weißen Ochsen» zeigte ihm der Freund ein Buch, das seine Mutter gegen den Willen des Vaters dem Kolporteur abgekauft hatte, der einmal im Jahr nach Neuorth kam und von den meisten im Ort der «dreckische Jud’» genannt wurde, weil er nicht nur als schmutzig galt, sondern angeblich auch «schmutzige Bildchen» verkaufte. Aber das Buch war nicht schmutzig. Es hieß «Das Neue Universum», und Schorsch las ihm heimlich daraus vor. Er las von wundersamen Erfindungen wie dem Aeroplan und dem Unterseeboot und von Entdeckungsreisen durch den Dschungel Afrikas und dem tragischen Marsch von Sir Scott zurück vom Pol durch die Eiswüste der Antarktis, und diese Dinge vermischten sich mit Adams Vorstellung von der Hecke. Er glaubte nicht, dass jenseits des Dornengestrüpps einfach gar nichts war. Dieses Buch bewies es: Überall war etwas. Jedes Mal, wenn er fortan an der alten Karte im Kloster vorbeiging, wurde die Frage, was hinter der Hecke sein mochte, drängender.
«Ich würde gerne ein Entdecker werden», sagte Adam eines Tages beim Mittagessen.
Sein Bruder Helmuth hob kaum den Kopf, sondern schlürfte weiter lautstark die Suppe, seine Schwestern schienen vor sich hin zu träumen, seine Mutter schwieg.
Sein Bruder Ullrich lachte auf. «Was willst du denn schon entdecken? Ist doch schon alles entdeckt! Kannst den Misthaufen hinterm Haus entdecken!»
Sein Vater sagte: «Nach der Schule machst eine Lehre beim Wagner in Auwinkel.»
«Ich gehe noch in den Wald», sagte Adam.
«Jetzt?», fragte die Mutter.
«Holz schlagen.»
Der Vater guckte erstaunt, aber sagte nichts mehr. Worte waren kostbar, denn wer konnte schon wissen, wie viel man noch zu sagen hatte?
Nach dem Essen packte Adam Beil und Säge ein und machte sich auf den Weg zur Hohen Hecke. Die ersten jungen Äste hatte er mit dem Beil schnell niedergemacht, aber allmählich wurde das Gehölz fester, sodass er die Baumsäge nehmen musste und nur mühsam vorankam. Zurückschnellende Zweige schlugen ihm ins Gesicht, Dornenranken schnitten ihm in die Unterarme. Je tiefer er in das Gestrüpp vordrang, desto dunkler wurde es. Obwohl es draußen noch hell sein musste, herrschte in der Hecke bereits modriger Dämmer. Vögel stoben in den Wipfeln über ihm auf (er konnte sie hören, aber nicht sehen), gestört durch das Krachen morscher Äste. Bald kroch er auf Knien, sägte oder hieb die Äste hockend entzwei. Einen Tunnel grub er sich durchs Gestrüpp, einen Gang, der immer enger und düsterer wurde.
Als der Abend anbrach, wusste Adam nicht, wie viel des Weges er noch vor sich hatte. Er hatte den Eindruck, dass sich hinter ihm die Äste wieder schlossen, die gestutzten Zweige nachwuchsen. Und was war das? Nicht weit von ihm entfernt brachen Äste, er glaubte, das Schnaufen eines Pferdes zu hören, und bekam es mit der Angst. Indem er sich mit dem einen Arm vor den Dornen schützte und mit der Hand des anderen auf das Dickicht vor sich einschlug, stolperte er voran. Mehr denn je schien ihm die Hohe Hecke selbst lebendig – wie etwas, das ihn mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung lenkte, das ihn nie wieder loslassen würde.
Als er an eine lichtere Stelle kam, sank er erschöpft an einem Buchenstamm nieder. Er holte sein Messer hervor und ritzte in den Baum die Worte:
ICH WAR HIER – A.R.
Der Mond schien, und sein bläuliches Licht rieselte die Zweige hinab auf die verrosteten Schwerter der Cherusker, ihre von Asseln bewohnten, löchrigen Helme, die im weichen Boden verfaulenden hölzernen Schilde. Kurz bevor Adam einschlief, sah er schemenhaft ein riesiges Skelett, das Gerippe des Urs, jenes Tieres, auf dessen Haut die Mönche den Eingang zum Paradies gemalt hatten.
1969
«Ich dachte schon, du kommst nicht», sagte der Schleicher, «bleibst an dem dummen Mond kleben wie ’ne Fliege am Honig.» Er steckte sich eine Zigarette an, legte den Kopf in den Nacken, wie er es in Filmen gesehen hatte, und betrachtete den Himmel.
Sie hockten im Straßengraben, hinter sich die Mauern des Klosters. Hardy wäre am liebsten gleich weitergerannt, auch wenn er keine Ahnung hatte, wohin, aber der Schleicher hatte auf einer «kleinen Rauchpause» bestanden, als wäre das verhasste Heim nicht hundert Meter, sondern hundert Kilometer von ihnen entfernt.
Nachdem sie lautlos durch die Tür geschlüpft waren, hatte alles ganz einfach ausgesehen. Der Zugang zu den Feldern und dem Gemüsegarten der alten Klosteranlage bis hin zu den Weinbergen war durch einen hohen, stacheldrahtbewehrten Zaun versperrt, aber am Haupttor an der Straße, durch das auch die Besucher gehen mussten, stand nur die alte, brüchige Mauer, die zu überwinden noch nicht einmal Hardy Mühe gehabt hatte. Vielleicht hatte man nicht damit gerechnet, dass hier jemand ausbrechen würde, oder man wollte nicht, dass das Heim von der Straßenseite aus aussah wie das Gefangenenlager, das es war. Hardy drehte sich um. Es dämmerte bereits, aber die Gebäude, in denen sie so viele Jahre zugebracht hatten, standen noch in der Dunkelheit, als hätten nicht nur sie beide, sondern auch alle anderen sie verlassen.
«Ob da noch jemand ist?», flüsterte der Schleicher. Er hatte sich auf die Böschung gelegt und blies Rauchringe in Richtung der blasser werdenden Sterne. «Da oben, meine ich.»
Hardy überlegte. «Ja», antwortete er dann, «ich glaube schon, dass da noch welche sind.»
«Schätze mal», sagte der Schleicher leise, «dass der sich nicht sonderlich für mich interessiert. Ich mich aber auch nicht für ihn.» Er schnippte seinen Zigarettenstummel weg. «Auf geht’s!»
Ruckartig erhob er sich. Hardy folgte ihm.
«Okay, Nummer 13, das ist der Plan: Ich gehe die Straße nach links, und du gehst die Straße nach rechts, und wenn Gott einen guten Tag hat, werden sich unsere beiden Wege nie wieder kreuzen.»
Hardy starrte den Schleicher mit offenem Mund an.
«Ich weiß», flüsterte der, «das hast du dir anders vorgestellt, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Du bist Ballast, verstehst du? Ein Klotz am Bein. Hast du nicht was von ’nem Onkel erzählt?»
«Hab ich erfunden.»
«Dein Pech. Da kann ich dir auch nicht helfen. Hier endet unsere gemeinsame Geschichte. Ab hier hat jeder seine eigene. Du die Straße rauf, ich die Straße runter.» Er wandte sich zum Gehen, drehte sich aber noch einmal um. «Ich denke mal, dass die dich in ein paar Stunden wieder einfangen, aber vergiss nicht: Wenn du was ausplauderst und die kriegen mich auch, dann hocke ich bald wieder mit dir in dem verdammten Loch, und glaube mir, niemand kann mich davon abhalten, dir die Gurgel durchzuschneiden.» Mit diesen Worten und einer letzten, eindeutigen Geste ging der Schleicher die Straße hinunter, und bald schon war er hinter der nächsten Kurve im Morgendunst verschwunden.
Plötzlich fühlte sich Hardy allein. Wie alle Waisen hatte er sich immer schon verlassen gefühlt, aber gleichzeitig war immer jemand um ihn herum gewesen, die anderen Kinder, aber auch die Aufpasser, die Schwestern, die Erzieher. Er hatte ständig, auch wenn sie ihm verhasst gewesen waren, unter ihrer Aufsicht gestanden, und nun überwältigte ihn das Gefühl, auf sich gestellt zu sein. Es drängte ihn, aus dem Graben zu steigen und, so schnell er nur konnte, die Auffahrt zurück zum Heim zu laufen, über die Mauer zu klettern und reumütig an der Tür zu klopfen.
Er zitterte und fing leise an zu weinen, und obwohl der Schleicher schon weit weg sein musste, glaubte er, aus dem Wald heraus höhnisches Gelächter zu hören. Er schluchzte, und dann war er eine Weile lang ganz still, aber irgendwann erhob er sich und ging die Straße hinauf, wie der Schleicher es ihm gesagt hatte.
Nach einer halben Stunde kam er an eine Kreuzung: Eine Straße führte nach rechts, einen Hang hinauf, die andere ging geradeaus, ebenfalls bergauf, aber nicht so steil wie die erste. Der rechte Weg endete auf dem Auberg, «Staatliche Nervenheilanstalt Auberg» stand auf dem Wegweiser, aber das wusste Hardy sowieso. Denn der Auberg war der Ort, wo jene hausten, die noch unter ihnen, den Heimkindern, standen, und wer es im Heim allzu dolle trieb, wer nun wirklich überhaupt nicht gebessert werden konnte, den schickte Herr Martin ins Irrenhaus, der kam auf den Auberg, und vom Auberg kam niemand mehr zurück.
«Glaubt mir, selbst die Hölle ist schöner», hatte der Schleicher einmal zu ihm und dem kleinen Schröder gesagt, und dann hatte er die Zähne gefletscht und einen Veitstanz aufgeführt und ihnen erzählt, dass auf dem Auberg nicht nur die harmlosen «Spastis und Mongos und Schizos» hausten, sondern in einer speziellen Abteilung auch die ganz grausigen Mörder, denen man vorwarf, ihre Frauen gevierteilt und die eigenen Kinder gekocht und gefressen zu haben, die man aber nicht habe aufhängen können, weil sie bei ihrer Verhaftung einen genauso irren Tanz wie er jetzt getanzt und sich selbst für nicht zurechnungsfähig erklärt hätten.
So gesehen hatte Hardy also gar keine andere Wahl, als dem linken Weg zu folgen, der, wie es auf dem Schild stand, nach Neuorth führte, ein Dorf, von dem er schon einmal gehört hatte, mit dem er aber nichts Bestimmtes verband.
Grau schlängelte sich die Straße durch den Wald, der langsam erwachte, während Hardy weiterging und es vermied, darüber nachzudenken, wo sie und damit das ganze Unternehmen enden würden, denn hätte er darüber nachgedacht, so hätte er sich unweigerlich eingestehen müssen, dass er es nicht wusste. Ich kann nirgendwohin, durchfuhr es ihn. Wohin sollte ein fünfjähriger Junge schon gehen, was konnte er machen?
Vor seiner Flucht hatte er sich allerlei Tagträumen hingegeben – dass er und der Schleicher sich auf einem Lastkahn verdingen und den Rhein flussabwärts fahren würden und dass sie dabei Freunde werden könnten wie Huckleberry Finn und Jim, aber davon hatte er dem Schleicher nichts erzählt (unter anderem weil Jim ja ein «Neger» war und der Schleicher seit der Sache mit den Amis, die ihn ins Heim zurückgebracht hatten, keine «Neger» mehr mochte). Bis ans Meer würden sie fahren, und dort wollte er sich als blinder Passagier auf einem Passagierdampfer in einem Rettungsboot verstecken und den Ozean überqueren. In Amerika würde er eine Goldader oder einen alten Indianerschatz finden und steinreich werden, sodass er einer der Ersten wäre, die es sich leisten könnten, zu den neuen Mond- und Marskolonien zu fliegen, die es, wenn er erst einmal erwachsen wäre, sicher geben würde. Und er hatte sich vorgestellt, dass er eines Tages von Mond und Mars und Amerika ins Heim zurückkehren und alle Erzieher entlassen, alle Kinder befreien, den Herrn Martin ins Gefängnis bringen und danach das Kloster niederbrennen würde.
Nur hatte der Schleicher von Anfang an andere Pläne gehabt. Der Schleicher, der beinahe schon erwachsen war, würde bestimmt irgendwo auf einem Hof eine Arbeit finden, oder er könnte mit seinem Messer am Straßenrand lauern und Leute überfallen. Aber er, Nummer 13? Wenn er noch länger darüber nachgedacht hätte, hätte er sich eingestehen müssen, dass Schleichers Vorhersage sich bewahrheiten musste und sie ihn in ein paar Stunden, spätestens in einem Tag wieder einfangen würden, und dann würde er zusammen mit dem kleinen Schröder, der seinetwegen ins Bett gemacht hatte, im Keller ins Fass gesperrt, und das alles für nichts.
Aber er hatte beschlossen, nicht darüber nachzudenken. Hatte Ernest Shackleton nicht mit einem kleinen, offenen Boot das südliche Eismeer bezwungen, war es Marco Polo nicht gelungen, die grausige Wüste Lop Nor zu durchqueren, waren Neil Armstrong und Buzz Aldrin jetzt nicht gerade, in diesem Moment, auf dem Mond, wo es keine Luft gab, kein Wasser, nichts außer der Leere des Alls und lebensfeindlicher kosmischer Strahlung? Das hier, sagte er sich, war nur ein Wald, kein tropischer Dschungel, kein tödlicher Sumpf, kein Staubmeer auf dem Mond, einfach nur ein Wald. Vielleicht konnte er ja in dem Dorf, zu dem die Straße führte, Unterschlupf finden, sich tagsüber in einer Scheune oder einem Stall verstecken und dann in der Nacht weiterwandern zum Fluss, zum Meer, sich in Hamburg auf einen Ozeanriesen schleichen und in einem Rettungsboot, als blinder Passagier, nach New York gelangen.
Vögel sangen, trillerten, schnarrten, krächzten und schrien in den Wipfeln der Bäume, und ab und zu hörte er ein Knacken, ein Ächzen im Unterholz. Ein Schatten huschte auf die Straße und blieb in der Mitte stehen, zwei Augen schauten ihn an. Er erschrak, und so verharrten beide – der Schatten, der, wenn man länger hinschaute, einem Waschbären nicht unähnlich war, und Hardy – für einen Moment reglos in der Zeit, bevor das Tier unbekümmert weitertrottete.
Hinter den Bäumen war die Sonne bereits aufgegangen, als er die Ausläufer des Dorfes, einen dunklen Hof am Ortseingang, erreichte. Kaum näherte er sich, bellte ein Hund und stürmte gegen den Holzzaun, der den Hof umgab. Hardy sah ein riesiges Maul und gefletschte Zähne, und als Zaunlatten schwankten, lief er, so schnell es ging, wieder zurück zur Hauptstraße.
In der Heimbibliothek hatte er den «Atlas der Entdeckungen» mehr oder weniger auswendig gelernt, er hatte einen großformatigen alten Weltatlas studiert, der Jahre zuvor seinen Weg aus der britischen Besatzungszone in das Kloster gefunden hatte, er hatte Expeditionsberichte gelesen, die ihn durch die Wüste Gobi und durch Tibet geführt hatten, und zwar so oft, dass er die Wüste Gobi und Tibet mittlerweile im Schlaf durchqueren konnte, und er hatte Reiseführer studiert, die ihm die Sehenswürdigkeiten von Spanien, Paris und Amerika beschrieben hatten, aber er besaß keine Vorstellung von dem Stückchen Erde um das Heim herum. Als Neil Armstrong nach seinem ersten und einzigen Spaziergang auf dem Mond zurück in die Landefähre stieg und hinter sich die Luke zuzog, entschloss er sich, aus Angst vor einem Hund, statt in das Dorf hinein darum herum zu gehen, was ihn auf jenen Weg brachte, der sein Leben bestimmen sollte.
1914
Der Krieg kam langsam und ohne große Eile nach Neuorth, und bevor er sich endgültig im alten Kloster einrichtete, bezog er, unentschlossen, ob er bald weiterziehen oder auf Dauer bleiben sollte, im Gasthof zum «Weißen Ochsen» eine Weile lang Logis. Dort hatte Schorschs Vater eine Tageszeitung auf dem Tresen ausliegen, und jeder, der wollte, konnte aus ihr die neuesten Nachrichten von der Front erfahren.
Der Schuster war noch beim letzten Krieg gegen die Franzosen dabei gewesen und hatte an der Eroberung von Metz teilgenommen. An diese Zeit hatte er trübe Erinnerungen. Er behauptete, die damals neuen Krupp-Geschütze seien daran schuld, dass er nun auf einem Ohr taub sei, und wenn ihn jemand auf die Überlegenheit der deutschen Kanonen hinwies, erzählte er von den französischen Schnellfeuerbatterien, jenen Höllenmaschinen, die seine anstürmenden Kameraden umgemäht hätten wie die Schnitter das Korn in der Erntezeit, und vor einem Glas saurem Apfelwein sitzend, machte er das Geräusch der «Mitrailleuse» nach, eine Art klapperndes Zischen, das er irgendwie mit seinen verbliebenen Zähnen und der Zunge hinbekam.
Trotzdem meldete sich der jüngere Sohn des Metzgers freiwillig. Helmuth und Ullrich, Adams ältere Brüder, wollten auch, doch ihr Vater verbot es ihnen. Wer sollte sonst im Herbst die Ernte einbringen?
So fand der Krieg zunächst nur im «Weißen Ochsen» statt, wenn Schorsch aus der Zeitung vorlas, was er mit monotoner und gerade dadurch beängstigend wirkender Stimme tat, sodass einige schon in den ersten Tagen murrend forderten, er solle mal aufhören mit dem Kriegsgeleier, das halte man ja auf die Dauer nicht aus. Woraufhin Schorsch entgegnete: «Ich kenne keine Parteien mehr – ich kenne nur noch Deutsche.»
Die Deutschen gewannen eine Schlacht nach der anderen. «Regierung der Franzosen flüchtet Hals über Kopf nach Bordeaux», verlas Schorsch, und Helmuth und Ullrich starrten in ihre geriffelten, halb leeren Apfelweingläser. «Generaloberst von Hindenburg, der Held von Tannenberg», verlas Schorsch wenig später, «ersäuft russische Njemen-Armee in den masurischen Sümpfen.» Da war sie nun ersoffen, die Njemen-Armee, und Helmuth und Ullrich schüttelten betrübt die Köpfe, denn wenn die riesige Njemen-Armee in den Sümpfen ersoffen war, dann würde das Abenteuer vorbei sein, noch bevor das letzte Feld abgeerntet, der letzte Apfel gepflückt wäre. «Französische Gegenoffensive gestoppt», verlas Schorsch eines Tages, und die Hoffnung, die in Helmuth und Ullrich aufgekeimt war, weil die Franzosen überhaupt mal irgendeine Offensive begonnen hatten, verdorrte sogleich wieder, was auch daran lag, dass die beiden von Kriegsführung keine Ahnung hatten, sonst hätten sie, ebenso wie Schorsch, dem nächsten Satz mehr Aufmerksamkeit geschenkt: «Frontverkürzung erfolgreich abgeschlossen.» Das war nämlich nur ein anderes Wort für Rückzug.
Als Adam Anfang September, wie sein Vater es gewollt hatte, zum Wagner nach Auwinkel ging, packte der gerade seinen Tornister und sagte lachend: «Jetzt hat der Lehrjunge wohl erst mal keinen Meister.» Dann wedelte er mit einem Stück Papier und rief: «Marschbefehl! Marschbefehl!» Zum Abschied strich er Adam über den Kopf und sagte: «Gehst halt weiter zur Schule, bis ich zurück bin.»
Einige Wochen später öffnete sich die Tür des Unterrichtssaals in der Klosterschule, und zwei Uniformierte kamen herein. Sie stellten sich neben Bruder Roland, beachteten ihn allerdings nicht, sondern begutachteten die Decke, die Fenster und – mit einem Aufstampfen ihrer Stiefel – den Boden. Sie nickten und murmelten etwas, lachten und gingen durch die Bankreihen hindurch, und weil sie Uniformen und Orden trugen, sagte niemand ein Wort. Schließlich wandte sich einer der beiden den Schülern zu. Er betrachtete sie einige Sekunden lang, bevor er sagte: «Na ja …», und dann noch einmal: «Na ja», bis der andere brüllte: «Weitermachen!», und sie durch die Tür verschwanden.
Bald darauf mussten alle Schüler in den kalten, dunklen Keller der Brüder umziehen, wo die Mönche ihre Wein- und Bierfässer gelagert hatten, von denen einige immer noch leer herumstanden. Sie standen da seit den fernen Zeiten, als die Erde noch eine Scheibe gewesen war, jeder seinen Platz auf ihr gekannt und es noch ein Paradies gegeben hatte. Die aus dem Paradies Vertriebenen hatten dort unten das eine oder andere Saufgelage veranstaltet, aber inzwischen war aus dem Kloster ein Gefängnis, eine Kaserne, eine Irrenanstalt und eine Schule geworden, und nun war es ein Lazarett.
Von den ersten Verwundeten des Krieges, die man im großen Mönchsdormitorium unterbrachte, wurden Fotos gemacht, die später, auf Sammlermessen, hohe Preise erzielen sollten. Es waren Leichtverletzte, die, in ihren Krankenbetten sitzend, mit gewichsten Schnurrbärten und ungebrochener Zuversicht in die Kamera blickten, und neben ihnen standen Krankenschwestern mit gestärkten weißen Schürzen und gestärkten weißen Häubchen. Ein Fotograf aus Auwinkel schoss die Fotos, vervielfältigte sie und zog sie auf postkartengroßen Karton auf, sodass die Soldaten sie mit einem Gruß nach Hause schicken konnten.